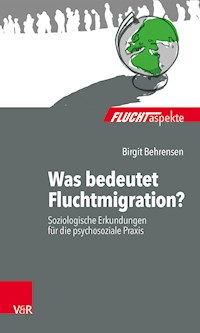
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fluchtaspekte.
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Nach einem kurzen Sommer der Willkommenskultur 2015 haben sich die Bedingungen für Flüchtlinge – und damit auch für das psychosoziale Unterstützungssystem – erheblich verschlechtert. Immer mehr Errungenschaften im Hinblick etwa auf sichere Bleibeperspektiven, Familiennachzug, Gesundheitsversorgung, Arbeitsmarkt- und Ausbildungszugang stehen für immer größere Gruppen von geflüchteten Menschen zur Disposition. Hinzu kommen Erfahrungen gesellschaftlicher Ablehnung bis hin zu rassistischen übergriffen. Birgit Behrensen ergründet aus soziologischer Sicht die gesellschaftlichen und individuellen Reflexe im Umgang mit einer Fluchtmigration, die die bisherige Ordnung der Welt auch in Deutschland nachhaltig erschüttert hat. Nach einem Einstieg in die politischen Ausgangspunkte der Fluchtmigration zeichnet der Band die gesellschaftlichen Prozesse nach. Deutlich wird, wie eng die Flüchtlingszuwanderung in Deutschland mit globalen Veränderungen zu tun hat. Einerseits verweisen staatlich organisierte Exklusionen und individuelle Abwertungen auf Versuche, vergangene nationalstaatliche Ordnungen und Privilegien wiederherzustellen. Andererseits liefert die Integration von Flüchtlingen eine Chance für neue Demokratisierungsprozesse. Vor diesem Hintergrund steht die psychosoziale Praxis vor der Aufgabe, geflüchtete Menschen als Subjekte zu stärken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten
Herausgegeben von
Maximiliane Brandmaier Barbara Bräutigam Silke Birgitta Gahleitner
Birgit Behrensen
Was bedeutet Fluchtmigration?
Soziologische Erkundungen für die psychosoziale Praxis
Mit einer Abbildung und einer Tabelle
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99874-9
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: Nadine Scherer
© 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Reihenredaktion: Silke Strupat Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
1 Vorwort
2 Flüchtlinge oder Geflüchtete? Eine einleitende soziologische Interpretation
3 Der empirische Ausgangspunkt: Fluchtmigration in Zahlen
4 Fluchtursachen und globale Verflechtungen
4.1 Fallstricke bei der Identifizierung von Fluchtursachen
4.2 Krieg und Terror
4.3 Klimakatastrophen und Hunger
4.4 Diskriminierungen und soziale Benachteiligungen
5 Die Flüchtlingsschutzkrise
5.1 Nationalstaatliche Paradoxien im Zeitalter der Globalisierung
5.2 Verschiebungen der Paradoxien an die europäischen Außengrenzen
5.3 Fluchtmigration als soziale Frage
6 Flüchtlingsintegration in Deutschland: Aktuelle Dilemmata
6.1 Soziale Ungleichheit und Globalisierungsangst
6.2 Die Konstruktion von Flüchtlingen als Opfer
6.3 Systembedingte Entmündigungen
7 Implikationen für die Praxis
7.1 Wege in die Zukunft: Bildung und Ausbildung
7.2 Respekt und Empowerment in einer Welt voller Widersprüche
7.3 Kontextkompetenz
7.4 Die wichtigsten Adressen
8 Ausblick
9 Literatur
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
Der Band »Was bedeutet Fluchtmigration? Soziologische Erkundungen für die psychosoziale Praxis« eröffnet die Buchreihe »Fluchtaspekte. Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen«. Die Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin Birgit Behrensen stellt darin die gesellschaftlichen Zusammenhänge und die gesellschaftliche Verantwortung für das Phänomen der Flucht in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Sie bedient damit eines der wesentlichen Anliegen dieser Reihe, das darin besteht, soziale Bedingungen individuellen Leids genauer in den Blick zu nehmen. Ziel der Reihe ist es, psychosoziale Fachkräfte, Sprachmittler und ehrenamtlich Engagierte in ihrer Begegnung und Arbeit mit geflüchteten Menschen mit theoretischem Hintergrund- und nützlichem Praxiswissen zu unterstützen.
Birgit Behrensen beginnt mit einem fundierten und faktenreichen Überblick zu den komplexen Fluchtursachen und neuen Dimensionen der Globalisierung; dazu zählen neben Kriegen und Terror ebenso die fatalen Auswirkungen des Klimawandels und verschiedene Formen von Diskriminierung. Sie behandelt weiterhin die international bestehende Krise im Flüchtlingsschutz und thematisiert die Notwendigkeit, eine neue Praxis zu etablieren, um geflüchteten Menschen den Zugang zu ihren Menschenrechten zu gewähren. Darüber hinaus beschreibt sie die Dilemmata der Integrationsbemühungen von geflüchteten Menschen in Deutschland, die beispielsweise darin bestehen, dass diese quasi Opfer bleiben müssen, um ihren Status nicht zu verlieren, und so zu wenig als Akteurinnen und Akteure angesprochen werden, die an der Mitgestaltung demokratischer Prozesse teilhaben und so auch Verantwortung übernehmen können. Der Band endet mit sehr konkreten Überlegungen für mögliche Konsequenzen in der psychosozialen Praxis und löst so auch den in dieser Reihe zentralen Anspruch ein, theoretische Überlegungen mit praxisbezogenen Ideen zu verknüpfen.
Wir freuen uns sehr, dass wir Birgit Behrensen als aktives Mitglied im Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e. V. und als Professorin für Soziologie der Sozialen Arbeit an der BTU Cottbus für diesen Eröffnungsband gewinnen konnten, und hoffen, dass die Leserinnen und Leser sich durch die Lektüre angeregt und bereichert fühlen.
Barbara Bräutigam Maximiliane Brandmaier Silke Birgitta Gahleitner
1 Vorwort
Als sich 2015 mehr Menschen als jemals zuvor aus Afrika, dem Nahen Osten, Südasien und anderen Regionen der Welt auf verschiedenen Wegen nach Europa aufmachten, erlebte Deutschland eine neue Dimension der Globalisierung.
Die transkontinentale Suche vieler hunderttausender Menschen nach gesicherteren Lebensmöglichkeiten verweist darauf, dass die Menschheit zu einer globalen Weltgemeinschaft wird – auch wenn politische Antworten zur Steuerung der damit einhergehenden gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen noch nicht gefunden sind und der Gedanke der Weltgemeinschaft viele erschreckt. Dieser Band der Reihe »Fluchtaspekte« beschreibt aus soziologischer Sicht einige der gegenwärtigen Veränderungen und mit diesen zusammenhängenden Herausforderungen.
Die Veränderungen und Herausforderungen wirken auf vielfache Weise in das Feld »Arbeit mit Flüchtlingen« hinein, führen zu Widersprüchen und offenen Fragen. Die soziologischen Beschreibungen sollen helfen, den Blick auf das Feld zu erweitern, auch dort, wo es keine schnellen Antworten gibt.
Eine Orientierung für die Beschreibungen dieses Buches liefert der US-amerikanische Soziologe Charles Wright Mills (1963). Er wies in den 1960er Jahren darauf hin, dass die Soziologie einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Demokratie leisten könne, wenn sie individuelle Probleme kontextualisiere. Dies gelingt, wenn sie ihr Kerngeschäft ernst nimmt, nämlich gesellschaftlich wirkmächtige Muster und Zusammenhänge herauszuarbeiten, die hinter individuellen Problemen stehen. Auf diese Weise ordnet die Soziologie individuelle Schwierigkeiten in größere gesellschaftliche Kontexte ein. Dahinter stehende Probleme werden so zu öffentlichen Problemen und damit zu Fragen öffentlicher Verantwortung.
In diesem Buch wird das Vorhaben einer Beschreibung aktueller Probleme, die sich aus der Fluchtmigration ergeben, in der Form betrieben, dass immer von einer untrennbaren Einheit von Individuum und Gesellschaft ausgegangen wird. Mit dem deutsch-britischen Soziologen Norbert Elias (1984) wird die Verbundenheit aller Menschen miteinander als Grundkonstante verstanden. Schließlich ist jede und jeder in der eigenen Entwicklung aufs Engste mit der umgebenden Gesellschaft verbunden und wirkt zugleich in sie hinein. Diesen Gedanken im Sinne der Entwicklung der Menschheit zu einer Weltgemeinschaft ernst zu nehmen, ist eines der Anliegen der im Folgenden zu findenden Beschreibungen und Überlegungen.
Das Verstehen der Fluchtmigration als Dimension der Globalisierung ist dabei mehr als eine akademische Übung im soziologischen Elfenbeinturm. Das Buch will zum Nachdenken über die Mehrdimensionalität von Verflechtungen, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten über nationalstaatliche Grenzen hinaus anregen, um auf dieser Basis psychosoziale Ansätze weiterzuentwickeln. Das ist im Kontext einer sich durch Globalisierung verändernden Gesellschaft dringend geboten.
2 Flüchtlinge oder Geflüchtete? Eine einleitende soziologische Interpretation
Während es vor 2015 üblich war, Geflüchtete als »Flüchtlinge« zu bezeichnen, ändert sich der öffentliche Sprachgebrauch im Zuge der Fluchtzuwanderungen seit Sommer 2015. Der Begriff »Geflüchtete« löst seitdem den Begriff des »Flüchtlings« immer häufiger ab.
Die sprachliche Sensibilität, mit der um die Begrifflichkeiten gerungen wird, erinnert an Debatten in Westdeutschland in den 1980er Jahren. Ähnlich wie heute wurden damals emotional aufgeladene Diskussionen unter den Angehörigen der – ehedem westdeutschen – Gesellschaft geführt. In großen Teilen der Bevölkerung gingen die Diskussionen darum, wem legitime und wem illegitime Gründe der Fluchtzuwanderung unterstellt werden könnten. Im Kern ging es um die Frage, wer Zugang zu Teilhabe und Bleibeperspektiven haben dürfe. Das Wochenmagazin »Der Spiegel« fragte im Sommer 1980: »Wird Westdeutschland überflutet von einer Fremdenwelle, müssen Massenlager her für die Asylanten oder gar Grenzrichter, die kurzen Prozeß machen?«
Anlass für die Debatten war damals – ähnlich wie heute – der relativ plötzliche Anstieg der Zahlen von Asylanträgen, verbunden mit einer wirtschaftlich schwierigen Arbeitsmarktsituation. Der Migrationsforscher Klaus J. Bade (2015) sieht in dem Aufheizen der Debatten rückblickend vor allem eine politische Instrumentalisierung: »Dabei entstand das ›Asylantenproblem‹ nicht etwa allein als Folge der zunächst nur zeitweise und erst später anhaltend starken Zunahme von Asylanträgen. Es wurde bei der Politisierung der ›Ausländerfrage‹ auch bewusst geschaffen […] Die populistischen Argumente in der politischen Diskussion um Asylrecht und Asylrechtspraxis, die in den Medien skandalisierend fortgeschrieben wurden, hatten dabei mit der Realität oft wenig zu tun. Das zeigte sich z. B. darin, dass sogar noch Anfang der 1980er Jahre, bei kurzzeitig wieder sinkenden Asylbewerberzahlen, in den Reihen von CDU und CSU weiter die Rede ging vom ›Asylmissbrauch‹ im Schatten einer angeblich ›anhaltenden Flut von Scheinasylanten und Wirtschaftsflüchtlingen‹ (S. 5).«
In dem Artikel des Spiegels im Sommer 1980 heißt es weiter: »Der Mißbrauch der Asylbestimmungen heizt die Überfremdungsdebatte an und bedroht eine Verfassungsgarantie, die zum Besten der bundesdeutschen Rechtsordnung gehört.«
Die Gewährung politischen Asyls ist ein wichtiges Element der demokratischen Verfasstheit des westdeutschen Staates. Beides zusammen, Demokratie und die Verpflichtung zur Asylgewährung, manifestieren einen deutlichen Bruch mit der nationalsozialistischen Gesellschaft Deutschlands. Was bedeutet es für das nationale Selbstverständnis, wenn diese Verfassungsgarantie nicht mehr uneingeschränkt gewährt würde? Die Verweigerung widerspräche dem nationalen Selbstbild einer Gesellschaft, die auf Humanität, Weltoffenheit und Egalität basiert. Psychisch lieferte die Begründung, die Schutzsuchenden seien nur Scheinasylanten, daher eine Entlastung. Damit wären die Asylanten selbst schuld, wenn ihnen kein Schutz gewährt würde. Die Schuld läge nicht in der westdeutschen Gesellschaft. Mit der Schuldverschiebung war es Angehörigen der westdeutschen Gesellschaft möglich, Fluchtzuwanderung abzulehnen und trotzdem das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten, Angehörige einer humanistischen, weltoffenen und egalitären Nation zu sein (Behrensen, 2006).
Die in den Jahren zuvor neutral verwendeten Begriffe des »Asylanten« und der »Asylantin« erhielten im Zuge dieser Umdeutungsprozesse immer stärker eine negative Konnotation. Die Bezeichnungen »Asylant« und »Asylantin« gingen immer deutlicher mit der Kreation von Sprachbildern einher, dass es sich bei Asylanten um Personen handelte, die aus eher zweifelhaften Gründen Asyl suchten. So schrieb »Der Spiegel« weiter: »Dieses Gemenge fremder Kulturkreise, auf engem Raum und unter gespannten sozialen Bedingungen, das erscheint nun vielen doch zu viel […] Und bei manch einem klingt das Wort Asylant so wie Simulant oder Bummelant.«
Der zunächst nur in politischen Unterstützungskreisen alternativ etablierte Begriff des »Flüchtlings« als neuer neutraler Begriff setzte sich allmählich im öffentlichen Sprachgebrauch durch. Immer häufiger wurde dieser Begriff dort verwendet, wo es darum ging, die Menschen, die Schutz und Sicherheit in Deutschland suchten, als Gruppe zu beschreiben. Der Grund ihres Kommens, die Flucht, ist begrifflich – und damit auch moralisch – präsent. Die Formulierung »Asylant« fand und findet sich fast nur noch dort, wo bewusst negative Unterstellungen im zuvor beschriebenen Sinne transportiert werden sollen.
Der Wandel der Begrifflichkeit im Jahr 2015 hat eine andere Ursache. Erneut hängt die Suche nach einem neuen, geeigneteren Begriff für die Gesamtgruppe der schutzsuchenden Menschen aber mit der Frage des Miteinanders von Aufnahmegesellschaft und Zuwandernden zusammen. Dabei besteht ein Unterschied zwischen den 1980er Jahren und heute darin, dass Selbstorganisationen Geflüchteter und anderer Migranten und Migrantinnen eine aktive Rolle in politischen Diskussionen einnehmen. So haben Geflüchtete mittlerweile nicht nur auf regionaler Ebene, sondern auch auf bundesdeutscher Ebene funktionierende Netzwerkstrukturen entwickelt.
Anders als in den 1980er Jahren entstand die Notwendigkeit eines neuen Begriffs nicht, weil der Begriff des »Flüchtlings« einen negativen Bedeutungswandel erfahren hätte. Vielmehr wird mit der Suche nach einem neuen Begriff der Beiklang von Abhängigkeit, Objektivierung und Passivität im Begriff des »Flüchtlings« zur Disposition gestellt.
Der neue Begriff, der sich gegenwärtig durchsetzt, ist mit dem Adjektiv bzw. dem als Adjektiv verwendbaren, auf die Vergangenheit bezogenem Partizip Perfekt »geflüchtet« verbunden. Mit diesem neuen Begriff wird sprachlich versucht zu fassen, dass es sich um Menschen handelt, die nicht auf den Fakt des Flüchtens reduziert werden können. Es handelt sich um geflüchtete Frauen, Männer und Kinder, um geflüchtete Familien, aber auch um geflüchtete Schüler und Schülerinnen, geflüchtete Akademiker und Akademikerinnen, geflüchtete politische Aktivisten und Aktivistinnen und vieles mehr. Flucht wird zu einem Merkmal unter vielen anderen.
Die Beschreibung eines Merkmals mit einem substantivierten Adjektiv bzw. Partizip passt gut in eine Gesellschaft, die sich auf dem Weg zur Inklusion befindet. Inklusion als Ideal verlangt, dass Geflüchtete perspektivisch in Institutionen wie Kindergarten, Schule, Hochschule und auch auf dem Arbeitsmarkt integriert werden, ohne dass sie auf ihre Flüchtlingseigenschaft reduziert werden.
Sprachlich überwunden werden soll mit dem neuen Begriff das Bild von dem passiven Flüchtling, der verwaltet und über den entschieden wird. Geflüchtete sind Menschen, die sich auf den Weg in eine bessere Zukunft gemacht haben und die ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben. Im Zentrum des neuen Begriffs steht die Idee, dass Geflüchtete keine Objekte einer für sie gestalteten Umgebung sind, sondern dass sie selbst mitgestalten. Das Ideal dahinter ist, dass Angehörige der Aufnahmegesellschaft und Geflüchtete stärker als zuvor zu einer Fluchtmigrationsbewegung (Pries, 2016) zusammenwachsen.
In diesem Buch werden die Begriffe »Flüchtlinge« und »Geflüchtete« synonym verwendet, weil die Quellen, auf die sich bezogen wird, beide Begriffe verwenden. Wichtiger als die Frage der Begrifflichkeit stellt sich aus soziologischer Sicht die Frage, welchen gesellschaftlichen Status Geflüchtete in der Wahrnehmung von Verwaltung, Politik und deutscher Aufnahmegesellschaft haben. Wie wird ihnen begegnet? Wie wird über sie und mit ihnen gesprochen und verhandelt? Wer ist an diesen Diskussionen und Verhandlungen in welcher Position beteiligt?





























