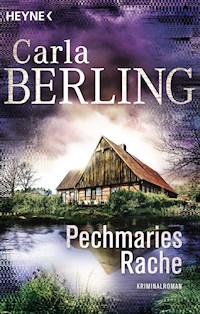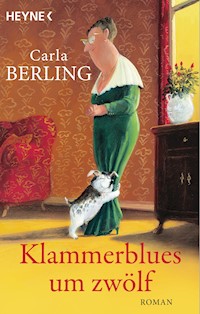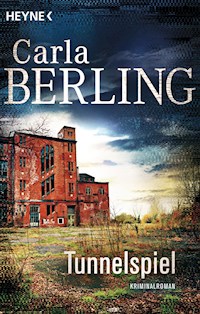9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Billie ist eine Frau mit Prinzipien. Rituale regeln den Alltag, Freundschaften findet sie überflüssig, Besuche oder sonstige Störungen ihres Lebens mit Ehemann Thilo lehnt sie ab. Als ihr Sohn Jonas sie bittet, für ein paar Monate nach Köln zu kommen und ihren Enkel August zu hüten, schlägt ihr mütterliches Herz höher, und sie springt über ihren Schatten. In Köln trifft sie auf ein kunterbuntes Haus, ein vorwitziges Kind und unkonventionelle Menschen, die anders leben, frei denken und Billies Weltbild aus den Angeln heben. Aber dann fängt es an, Spaß zu machen. Bis an einem Weihnachtsabend alte Geschichten auf den Tisch kommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Ähnliche
Das Buch
Billie ist eine Frau mit Prinzipien. Rituale regeln den Alltag, Freundschaften findet sie überflüssig, Besuche oder sonstige Störungen ihres Lebens mit Ehemann Thilo lehnt sie ab. Als ihr Sohn Jonas sie bittet, für ein paar Monate nach Köln zu kommen und ihren Enkel August zu hüten, schlägt ihr mütterliches Herz höher, und sie springt über ihren Schatten. In Köln trifft sie auf ein kunterbuntes Haus, ein vorwitziges Kind und unkonventionelle Menschen, die anders leben, frei denken und Billies Weltbild aus den Angeln heben. Aber dann fängt es an, Spaß zu machen. Bis an einem Weihnachtsabend alte Geschichten auf den Tisch kommen ...
Die Autorin
Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt außerdem regelmäßig mit ihren Romanen durch große und kleine Städte. Zuletzt erschien ihr Roman »Klammerblues um zwölf«.
Carla Berling
Was nicht glücklich macht, kann weg
Roman
Wilhelm Heyne Verlag München
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 09/2021
Copyright © 2021 by Carla Berling
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda, Büro für Kinder- und Erwachsenenliteratur, Hamburg
Umschlaggestaltung: Bürosüd unter Verwendung von Abbildungen von © Gerhard Glück
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-26411-6V001
www.heyne.de
1
Als der Anruf kam, hockte ich in den Johannisbeeren. Mein Handy lag auf der Terrasse, und so musste ich mit knackenden Knien unter dem Netz hervorkriechen, das ich über die Buschreihe gespannt hatte, um die Vögel fernzuhalten. Nicht dass ich was gegen Vögel hatte, im Gegenteil, neben dem Blumengarten waren sie mein liebstes Hobby. Ich erkannte fast alle heimischen Singvogelarten am Zwitschern. Das hieß aber nicht, dass ich meine Johannisbeeren mit ihnen teilen wollte.
Als ich endlich beim Handy ankam, hatte der Anrufer aufgelegt. Gott sei Dank hatte ich kürzlich die Schriftgröße auf dem Display umgestellt (das ist der Beginn des körperlichen Niedergangs!) und konnte ohne Lesebrille erkennen, dass es Jonas gewesen war. Schon wieder?
Unser Sohn rief niemals an, wenn er keinen triftigen Grund hatte. Das letzte längere Telefonat war vor einem Jahr und drei Monaten gewesen. Immerhin hatte er uns damals mitgeteilt, wann Caro bestattet wurde. Wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn er uns zur Beerdigung seiner Frau nur eine Karte geschickt hätte.
Wir waren nach Köln gefahren, hatten während der Trauerfeier abseits gestanden und mit niemandem groß geredet. Natürlich kondolierten wir Caros Eltern, und natürlich versuchte ich, unseren Sohn zu trösten. Was mir nicht gelingen konnte, denn ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt seit drei Jahren nicht gesehen.
Den vierjährigen August hätte ich niemals wiedererkannt; er hatte mit dem pummeligen Kleinkind aus meiner Erinnerung keinerlei Ähnlichkeit. Er stand mit gesenktem Kopf neben Jonas und hielt seine Hand. Nach dem Beerdigungs-Kaffeetrinken hatte ich kurz Gelegenheit, mit dem Kleinen zu reden. »Du bist Papas Mama«, sagte August, und bevor ich überhaupt antworten konnte, »Meine Mama ist mein Schutzengel.« Er blickte zum wolkenlosen Himmel und zuckte mit den Schultern. »Schade, jetzt sind da keine Wolken. Mama wohnt im Himmel auf einer Wolke und passt auf mich auf.«
Ich fand ihn entzückend, er war gut erzogen und ausgesprochen hübsch, die blonden Locken waren für einen Jungen viel zu lang, aber es stand ihm.
Nach der Beerdigung seiner Mutter hielt ich es für unangemessen, ihm zu nahezukommen, schließlich war ich für ihn eine fremde Person und wollte mich nicht aufdrängen. Aber ehrlich gesagt, war ich total unsicher und wusste auch gar nicht, wie ich mit ihm hätte umgehen sollen. Zwar war er mein einziges Enkelkind, aber durch die besonderen Umstände, die den Umgangston in unserer Familie bestimmten, musste ich verhindern, mich gefühlsmäßig an den Kleinen zu binden. Damit war ich immer gut gefahren, denn wenn man den eigenen Enkel nicht kennt, weil man ihn nur zweimal in vier Jahren gesehen hat, ist eine emotionale Bindung eher ungünstig. Was mir beim letzten Treffen sehr schwerfiel, zugegeben, denn er war ein toller kleiner Kerl.
Und nun das.
Ich rief Jonas sofort zurück. »Hier ist Mama, entschuldige, ich war nicht schnell genug, das Handy lag auf der Terrasse, und ich war in den Johannisbeeren, sie sind wieder ganz pünktlich, als wüssten die Pflanzen, dass sie um den Johannistag herum reif zu sein haben … Wusstest du, dass sie daher ihren Namen haben? Es hängen so viele an den Sträuchern, die müssen bald runter, sonst werden sie faul. Ich werde sie einfrieren, Marmelade kochen lohnt sich für uns beide nicht, Papa isst ja keine Marmelade …«
Wie immer, wenn ich eins der äußerst seltenen Gespräche mit meinem Sohn führte, sabbelte ich mich um Kopf und Kragen. Vielleicht hatte ich Angst, dass er wieder zu früh auflegte oder wir sekundenlang in die Hörer schweigen würden, weil wir uns eigentlich nichts zu sagen hatten.
Aber dieses Mal war es anders. Jonas begann sofort zu reden, als ich schwieg, um Luft zu holen.
»Mama, ich habe eine große Bitte.«
Oha.
Das hatte er noch nie gesagt.
Als er hinzufügte: »Ich brauche eure Hilfe, und es ist leider keine Kleinigkeit!«, begann mein Herz laut zu wummern. Auch das hatte er noch nie gesagt.
Er braucht uns, jubilierte ich innerlich. Tausend Gedanken dachte ich in einer Sekunde, überlegte blitzschnell, ob es vielleicht um Geld ging und wenn, um wie viel und wofür, oder ob er, um Gottes willen, krank war. Oder ob er sogar nach Hause zurückkommen wollte, jetzt, wo Caro nicht mehr da und das Trauerjahr längst um war, und ob er August mitbringen würde.
»Meine Direktion schickt mich nach London, als Risikomanager. Für sechs Monate. Ich muss das machen, es ist wichtig für meine Karriere.«
Ach so. Na ja.
Ob mein Sohn in Köln wohnte und wir uns nie sahen, oder ob er in London wohnte und wir uns nie sahen, machte für mich keinen Unterschied.
Lahm sagte ich: »Schön. Gratuliere. Ein toller Erfolg für dich, Jonas, ich bin stolz auf dich. Es wird auch für August ein großer Schritt sein, zweisprachig aufzuwachsen ist heutzutage wichtiger denn je.«
Ich hörte Jonas schlucken. »Um August geht es.«
Er machte eine Pause, die ich aushielt, weil ich einatmete, aber nicht ausatmete.
»August kann leider nicht mit, ich bin doch den ganzen Tag in der Bank, wie soll ich das machen. Es gibt natürlich in London Ganztagsbetreuung für Sechsjährige, aber nach allem, was der Kleine schon mitgemacht hat, will ich ihn nicht aus seinem Zuhause und seinem Umfeld reißen. Er hat sich gerade ein wenig von allem erholt …«
Ich fiel ihm ins Wort. »Wie hast du das denn bis jetzt geregelt? Ist er nicht im Kindergarten?«
»Doch, wir haben ein Au-pair-Mädchen, das ihn morgens hinbringt und nachmittags abholt, aber sie geht zurück nach Amerika. Caros Mutter war nach der Beerdigung ein paar Wochen hier. Aber das war keine Dauerlösung, sie musste wieder in ihre Pension am Tegernsee. Augusts Großeltern sind ja erst Mitte fünfzig und stehen noch mitten im Berufsleben.«
Eifersucht bohrte sich wie eine heiße Nadel in mein Gehirn. Erstens, weil wir ja wohl auch Augusts Großeltern und sogar noch ein bisschen jünger waren. Und zweitens, weil Caros Eltern immer Kontakt zu ihrer Tochter und somit auch zu meinem Sohn und meinem Enkel gehabt hatten. Sie waren mehrmals im Jahr in Köln gewesen, sie hatten August aufwachsen sehen und sie wussten, wie mein Sohn lebte. Sie wussten mehr über mein eigenes Kind als ich. Dieser Gedanke war immer der, bei dem mir sofort die Tränen kamen.
Aber dann sagte Jonas: »Mama, jetzt, wo die Firma verkauft ist … Papa und du, ihr habt doch Zeit … ich meine … ihr seid doch eh zu Hause … ihr müsst nicht mehr arbeiten …«
Er begann tatsächlich zu stammeln, und ich genoss diesen langen Moment, in dem ausnahmsweise mal ich Oberwasser hatte und nicht um seine Aufmerksamkeit und seine Zeit buhlen musste.
»Ja, und?«, fragte ich freundlich.
»Ich wollte fragen, ich meine, ich wollte euch bitten … also, ist es vielleicht möglich, dass ihr … also könnt ihr … geht es, dass ihr für eine Weile in mein Haus zieht und euch um August kümmert? Er kommt nach den Ferien in die Schule, dann ist er den halben Tag aus dem Haus …«
Ja!, wollte ich jubeln, Ja, mein Sohn, danke, danke, danke! Endlich, du brauchst deine Eltern wieder, du brauchst deine Mama. Ich bin für dich da, mein Junge, egal, was zwischen uns war, ich komme, wir kommen, Papa und ich, wir lassen dich nicht im Stich! Vielleicht wird jetzt endlich alles wieder gut …
Aber ich hatte mit den Jahren gelernt, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Also sagte ich mit ruhiger Stimme: »Selbstverständlich, Jonas. Du kannst dich natürlich auf uns verlassen. Ich bespreche alles mit Papa. Wir müssen hier ein paar Dinge regeln, und dann wird das schon. Wann brauchst du uns?«
»Nächste Woche.«
Nächste Woche?! Na, der hatte Nerven.
Nachdem wir aufgelegt hatten, hielt ich das Handy noch eine ganze Weile in der Hand und starrte es an, als könne es mir anzeigen, warum ich eben so und nicht anders reagiert hatte.
Thilo wuselte in seiner Werkstatt herum. Obwohl wir über fünfundzwanzig Jahre lang mit einer Bautischlerei selbstständig gewesen waren, hatte Thilo auch in seiner Freizeit immer irgendwas »zu frickeln«. Seit wir privatisierten (ich wehrte mich gegen das Wort »Frührente«, denn mit Mitte fünfzig fühlte ich mich weiß Gott nicht als Rentnerin), verbrachte Thilo ungezählte Stunden in der Werkstatt. In letzter Zeit tischlerte er Vogelhäuschen und Nistkästen, die reißenden Absatz fanden. Das Modell »Kölner Dom« war das beliebteste. Ich unterstützte ihn – zumindest mental – bei seiner Arbeit. Immerhin hatte er mit seinen Vogelbauten verschiedene Meisenarten, Spatzen, Schwalben, Stare und Trauerschnäpper in unseren Garten gelockt.
Der Garten … er war der Ersatz für meine Arbeit, die ich vermisste. Heimlich hatte ich sogar neulich Stellenangebote studiert, aber nirgends wurde eine erfahrene Buchhalterin gesucht.
Als ich in der Tür zur Werkstatt stand, ließ Thilo sofort seine Zigarette unter dem Turnschuh verschwinden und trat sie auffällig unauffällig aus – offenbar hatte er mich dieses Mal nicht kommen sehen. Er hatte nicht mal gehört, dass ich an den Rahmen der offenen Tür geklopft hatte.
Kein Wunder, es lief Musik, Queen, Don’t stop me now, so laut, dass ich zuerst zu dem alten Ghettoblaster lief, um den Ton abzudrehen. »Das ist zu laut!«, schimpfte ich. Er lachte mich aus. »Ist es zu laut, bist du zu alt!«, sagte er und duckte sich, weil ich eine drohende Handbewegung machte.
Thilo hörte bei der Arbeit immer Queen, Phil Collins oder Joe Cocker. Wenn er ein paar Bier getrunken hatte, lief Helene Fischer. Was Musik anging, so hatten wir einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Er stand auf Pop, Rock und ab einem Promille auf Frau Fischer, ich sang seit einem Jahr bei den Krudhofer Singdrosseln. Seit meiner Jugend war ich ein großer Fan von Nena, und ich liebte Madonna und Lady Gaga. 2014 war ich sogar auf ihrem Konzert in Hamburg gewesen, was mir eine Menge Spott und Häme unserer Nachbarinnen eingebracht hatte. Uschi Doberenz-Tiekenheinrich – sie wohnt rechts neben uns, von der Straße aus gesehen – hatte sich über die Hainbuchenhecke hinweg empört: »Ausverkauft? Und du hast direkt vor der Bühne gestanden? In deinem Alter? Billie, das ist nicht in Ordnung. Da hast du einem jungen Menschen den Platz weggenommen. Für uns sind die Sitzreihen auf der Tribüne gedacht.«
Und Rita-Marianne Schnathorst-Bretthauer aus dem Winkelbungalow links von uns meinte, als wir uns am Glascontainer trafen: »Ich finde, man sollte mit Würde alt werden, meine Liebe! Und dazu gehören gewiss nicht Besuche solch schamloser Darbietungen wie die dieser Verrückten.«
Sagte eine, die mindestens fünfzehn Jahre älter als ich war, als pensionierte Erdkundelehrerin ohne Büstenhalter unterm Schlabberlook vor die Tür ging, und die nicht mal versuchte, die Weinflaschen zu kaschieren, die sie in absolut handelsunüblichen Mengen in den Container warf. Die ganze Nachbarschaft nannte sie nur Schlabber-Else, weil sie sich erstens ausschließlich in schlabberige, leberwurstfarbene Leinengewänder hüllte (sie nannte die Farbe »taupe«), und weil sie zweitens täglich ordentlich Wein wegschlabberte. Wo war ich stehen geblieben?
Ach so, bei Thilo in der Werkstatt.
Er trug seine geliebten, verbeulten Jeans und eins seiner unvermeidlichen karierten Hemden. Und seinen stattlichen Bauch trug er seit Langem über der Hose.
Auf seiner Glatze saß eine Baseballkappe, deren Schirm er nach hinten gedreht hatte, seinen Bart hatte er mit einem Haushaltsgummi zu einem Zopf zusammengebunden. Das sah zwar beknackt aus, war aber bei Feinarbeiten wie Schleifen, Feilen, Lackieren und Löten ganz praktisch.
»Billie, du hast mich hier ja lange nicht besucht!«
»Wir müssen packen«, sagte ich.
Er grinste. Ich freute mich spontan darüber, dass wir bei unserem Zahnersatz nicht gespart hatten: Thilos Lächeln mit den neuen Zähnen war wirklich charmant. Wenn man das bei unserer Vorgeschichte und nach all den Jahren vom Ehemann denkt, ist alles gut gelaufen, fand ich. Okay, fast alles. Das große Drama konnte ich meistens gut verdrängen.
»Verstehe. Packen«, sagte Thilo. »Verpacken, anpacken, einpacken, auspacken?«
Mir war nicht nach seinen Scherzen zumute. »Nein, Koffer packen. Wir müssen nach Köln. Zu Jonas. Wir müssen ein paar Monate auf August aufpassen.«
Thilos Grinsen erstarb und verwandelte sich in eine Art grenzdebile Grimasse. »Wir. Nach Köln. Monate.«
Ich erklärte es ihm. Thilo brauchte eine ganze Weile, um es zu verstehen. Er nahm die Kappe ab, fuhr sich mit der Hand von hinten nach vorn über die Glatze, griff nach seinem krausen, weißen Bartzopf und zupfte ihn nachdenklich. Diese Gesten rührten mich irgendwie, sie waren mir unendlich vertraut. Schon damals, als er noch ein paar Haare gehabt hatte, hatte er sich immer auf diese Art über den Kopf gestrichen und mir damit gezeigt, dass er ratlos war.
»Papa rauft sich die Glatze«, hatte Jonas mal gesagt, und Thilo hatte würdevoll gekontert: »Wo der Verstand wächst, müssen Haare weichen.«
»Bahnhof«, sagte er jetzt, »Sybille, ich verstehe nur Bahnhof.«
Wenn er mich nicht Billie, sondern Sybille nannte, war er wirklich durch den Wind. Ich erklärte es geduldig nochmal. »Jonas braucht uns. Er muss nach London und wird nur am Wochenende zu Hause sein, deswegen müssen wir uns um August kümmern.«
»Aber … wie sollen wir … er kennt uns doch gar nicht … Billie, ich bin zweiundsechzig, wir sind viel zu alt, um ein Kind zu betreuen …«
Ich unterbrach ihn: »Wenn du dich zu alt fühlst, okay, aber ich traue es mir sehr wohl zu!«
Er ging nicht darauf ein und fuhr fort: »Wie hat Jonas das in den letzten Monaten organisiert?«
»Erst mit Caros Mutter, dann mit einem Au-pair-Mädchen. Das geht aber zurück nach Amerika.«
»Und jetzt fragt er uns? Ausgerechnet uns?«
»Thilo, wen denn sonst? Wir sind immer noch seine Eltern. Wenn er uns braucht, sind wir da. Trotz allem. Nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für August.«
Beim Abendessen besprachen Thilo und ich die Details. Im Prinzip hatten wir im Rest des Jahres nichts weiter vor. Auf das Feuerwehrfest in zwei Wochen konnte ich gerne verzichten, und der Tag der offenen Tür im Heimatmuseum war mir auch nicht wichtig. Im November stand allerdings die Eiserne Hochzeit meiner Schwiegereltern an. Aber bis dahin floss noch viel Wasser die Weser hinunter. Wer wusste schon, ob sie dann überhaupt noch lebten. Gut, der Chor würde mir fehlen. Besonders, weil wir kürzlich einige Musicalstücke ins Repertoire aufgenommen hatten, auf die ich mich gefreut hatte.
Mein größtes Problem aber war der Garten. Wer sollte sich um ihn kümmern? Ausgerechnet in der schönsten Zeit würde ich ihn nicht genießen können, sondern abgeben müssen. Ich schaute aus dem Küchenfenster hinaus in den Staudengarten, der mein ganzer Stolz war: Prachtspieren in satten Rottönen, die jetzt herrlich blühten, daneben standen üppige Sterndolden in Rot und Pink, und diese Farbenpracht hatte ich mit lila Eisenhut kombiniert. Die Rot- und Lilatöne gingen erst in eine breite Partie Schleierkraut und dann zu den weißen und gelben Blumen über. Der Garten war ein Blütenmeer. Ich hatte ihn nach ausgetüftelten Plänen angelegt, damit ich zu jeder Jahreszeit Freude daran hatte. Und nun musste ich ihn allein lassen.
Weder Uschi noch Rita-Marianne alias Schlabber-Else konnte ich ihn anvertrauen, und auch der alte Dieckmann von gegenüber war als Gartensitter nicht geeignet. Ich meine, jemandem, der sich den kompletten Vorgarten einbetonieren und den antiken Jägerzaun abbauen lässt, damit das Auto zwanzig Zentimeter von der Haustür entfernt stehen kann, kann man keine lebenden Pflanzen überlassen. Außerdem hatten wir mal einen Disput wegen einer Feuerwanzenplage. Beziehungsweise er hatte die Feuerwanzen im Vorgarten gehabt, und ich beobachtete zufällig eines Tages, dass er sie mit Handfeger und Kehrschaufel zusammenfegte, sich verstohlen umschaute und sie dann in unserem Vorgarten über das Mäuerchen kippte.
Wir hatten damals immer Unmengen Hasenköddel auf der hinteren Wiese, die sammelte ich daraufhin auf, nahm sie mit in die Küche, überzog sie mit flüssiger Schokolade und verpackte sie anschließend hübsch. Ich stellte sie dem Alten nachts auf die Fußmatte vor der Haustür.
Am nächsten Morgen waren sie weg.
Ich machte mich daraufhin den ganzen Morgen im Vorgarten zu schaffen. Dem Geräusch aus seinem auf Kippe stehenden Klofenster neben der Haustür entnahm ich, dass er die Hasenköddel gegessen hatte. Das war eine ganz besondere Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Und so gaben wir nach einigen Überlegungen meinen geliebten Garten in die Hände des Friedhofsgärtners, der auch unser Familiengrab pflegte, ließen die Jalousien runter, verriegelten unser Haus, schalteten die Bewegungsmelder ein und reisten für unbestimmte Zeit nach Köln.
2
Wir waren früh um fünf in Krudhof losgefahren, um dem Berufsverkehr auf den Autobahnen auszuweichen, und kamen fünfeinhalb Stunden später an.
Jonas wohnte am Ende einer Sackgasse im Kölner Stadtteil Weiß. Genau genommen sah es dort nicht wie im Viertel einer Großstadt aus, sondern so ähnlich wie in den meisten Dörfern in unserer Heimat. Zumindest was die Wohnsituation anging, hatte Jonas sich wohl kaum verbessert, das alles hatte er in Krudhof auch gehabt. Frei stehende Einfamilienhäuser, Wiesen, grasende Kühe auf großen Weiden, Felder, Pferdekoppeln, Wälder.
Wir parkten am Straßenrand, stiegen aus, sahen uns um. Hier wohnte also unser Sohn. Hübsch. Idyllisch, ruhig. Aber sein Haus war rosa.
Man konnte es von der Straße aus kaum sehen, so verwildert war der Garten, der es umgab. Alter Baumbestand, Birken, Rotahorn, Blutbuche, Flieder, Rosen. Wir ließen das Gepäck im Auto, öffneten eine hölzerne Gartenpforte, an der die grüne Farbe abblätterte, und folgten einem geschwungenen Weg, der mit kleinen Findlingen abgegrenzt war. Rechts und links steckten bunte Plastikwindmühlen in der Erde. Vor dem Haus blieben wir stehen. Es war eine Art Schwedenhaus mit umlaufender Veranda, weißen Fensterrahmen und dieser unglaublichen rosa Holzverkleidung.
Ich zog die Augenbrauen hoch. »Fehlt nur noch das Pferd auf der Terrasse, und Pippi Langstrumpf mit dem Affen auf der Schulter, dann ist das Bild komplett.« Thilo lachte. »Und Jonas ist der dicke König von Taka-Tuka-Land?«
Jonas war alles andere als dick, im Gegenteil, bezüglich der körperlichen Merkmale hatte er wohl meine Gene und nicht die seines Vaters mitgekriegt.
Kurz bevor wir auf die Klingel drücken konnten, wurde die Tür aufgerissen. August trug einen Pyjama, das wuschelige Blondhaar war ungekämmt, und er hatte einen Nutella-Schnurrbart.
»Hallo August.« Mehr fiel mir nicht ein. Thilo kraulte sich den Bart, den er heute offen trug, und grinste bloß. August musterte uns von oben bis unten, drehte sich um und rannte ins Haus. »Sie sind da!«, rief er.
Wir blieben unschlüssig stehen.
Jonas tauchte in der Diele auf, und mein Puls beschleunigte sich. Mit einem Blick scannte ich seine Statur, die schmalen Lippen, das markante Kinn, die grauen Augen. Mein Gott, wie ich diesen Burschen liebte! Und wie sehr ich ihn vermisst hatte. Jeden gottverdammten Tag, nachdem er uns verlassen hatte, hatte ich ihn vermisst. Ich hätte ihn so gern umarmt, aber das wagte ich nicht. Wir gaben uns die Hand, als seien wir gute Bekannte. »Hallo, danke, dass ihr da seid!«
Förmlicher ging es kaum. Die dunklen Bartschatten verstärkten die ungesunde Blässe seiner Haut. Er hatte abgenommen, war viel zu dünn für seine Größe, und ich bemerkte, dass er Geheimratsecken bekam. Der arme Kerl hatte offenbar Thilos Haarpracht geerbt und war schon auf dem Weg zum Kahlkopf.
Jonas machte einen Schritt zur Seite, wir traten ein.
Und blieben sprachlos in der Diele stehen. Das Haus war alt. Jonas bemerkte meinen entsetzten Blick und erklärte, dass er und Caro das meiste selbst renoviert hatten. »Wir haben außen die Holzverkleidung angebracht, neue Fenster einsetzen lassen und selbst gestrichen.«
Ja. Rosa. Ich konnte es nicht fassen und stellte mir vor, was die Leute zu Hause in unserer Straße über jemanden sagen würden, der sein Haus rosa anstrich. Und den herrlichen Garten dermaßen verwildern ließ. Schlabber-Else würde wahrscheinlich wütende Leserbriefe an die Tageszeitung schreiben oder sich beim Arzt ein Attest über Augenschmerzen aufgrund zu hoher Rosa-Belastung holen. Rita-Marianne würde Unterschriften sammeln und eine Petition für einheitliche Fassadenfarben starten. Und Dieckmann traute ich zu, dass er sich ein Bataillon Dickmaulrüssler besorgen und heimlich in einem solchen Garten aussetzen würde, damit da mal richtig Grund reinkam.
Im Erdgeschoss waren einige Wände herausgerissen und eine schicke offene Küche eingebaut worden. Es schien allerdings, als wären die Renovierungsarbeiten ganz plötzlich abgebrochen worden. Styroporfliesen mit braunem Holzdekor klebten im Flur unter der Decke, die hölzernen Treppenstufen waren zwar abgeschliffen, aber nie neu lackiert worden, es gab einen roten Handlauf und ein gedrechseltes Geländer. Das Badezimmer war scheußlich hellblau gekachelt und hatte uralte Sanitäranlagen, in der Küche gab es keinen Fußbodenbelag, sondern provisorische Filzmatten auf blankem Estrich.
Thilo sagte es zuerst. »Oha. Hier muss aber noch ordentlich was gemacht werden!«
Jonas nickte müde. »Ich weiß. Aber in den letzten Monaten gab es Wichtigeres. Jetzt muss die Renovierung warten, bis ich aus London zurück bin.«
Es lag mir auf der Zunge, meinen Sohn darauf hinzuweisen, dass er jederzeit die tatkräftige Hilfe seines Vaters hätte in Anspruch nehmen können. Thilo war schließlich Tischlermeister und hatte bis zum Verkauf unserer Firma überwiegend im Innenausbau gearbeitet. Aber ich sagte nichts.
Thilo und Jonas trugen unsere Koffer über die knarrende Treppe ins Dachgeschoss.
»Das war früher eine abgeschlossene Wohnung, wir haben Wände entfernt und einen großen Raum daraus gemacht.«
Ich sah mich um, nickte anerkennend. »Schön. Grau, Weiß und Gelb, das mag ich.«
»Unser Au-pair hat hier gewohnt, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ist nicht so groß wie bei euch …«
Schon wieder bekam ich einen Stich in der Magengegend. Beieuch … das war mal sein Zuhause gewesen, und wenn alles normal gelaufen wäre, hätte er jetzt bei uns gesagt. Er zeigte uns das Bad, soweit ich es auf die Schnelle erkennen konnte, war alles sauber. Die moderne Kochnische hinter einer Schiebetür sah aus, als sei sie noch nie benutzt worden.
Wir sahen uns noch das Kinderzimmer und die Kellerräume an, und Jonas zeigte mir den Raum mit Waschmaschine, Trockner und Bügelbrett.
»Putzen musst du nicht, zweimal die Woche kommt unsere Anna und macht alles sauber.« Er bemerkte meinen Blick und erklärte eine Spur zu aggressiv: »Ich bin seit fünfzehn Monaten Witwer mit einem kleinen Kind und arbeite fünfzig Stunden in der Woche. Das Au-pair-Mädchen hat sich fabelhaft um August gekümmert, aber fürs Putzen war sie nun wirklich nicht zuständig, dafür haben wir Anna eingestellt!«
Ich spürte irgendwie, dass wir uns auf dünnem Eis bewegten, und beschwichtigte ihn. »Mir macht es nichts aus, wenn ich mich nicht um den Haushalt kümmern muss, ich freue mich auf August.«
Und über August redeten wir schließlich bei Schnittchen und Kaffee.
Jonas hatte – ganz der Sohn einer Buchhalterin – eine ordentliche mehrseitige Liste angelegt und sie für Thilo und mich kopiert. Punkt für Punkt gingen wir sie gemeinsam durch. Telefonnummern und Adressen des Kinderarztes, der Giftnotrufzentrale, des nächsten Krankenhauses, des Kindergartens und der Grundschule, die er ab Sommer besuchen würde, standen ganz oben.
»Sie sind im Telefon gespeichert, wir sollten aber alle Nummern auch in eure Handys übertragen«, sagte er.
Natürlich.
Auf der nächsten Seite hatte er Daten über August notiert: Geburtsdatum (13.01.), Größe (1,21 Meter, also recht groß für sein Alter), Gewicht (20,5 Kilo, das war wohl der Größe entsprechend), Blutgruppe, (A+), Datum der letzten Untersuchung beim Kinderarzt und beim Zahnarzt. August hatte keine Allergien und keine Lebensmittelunverträglichkeiten, was mich sehr beruhigte. Man hört ja von modernen Kindern, dass sie oft keine Milch, keine Kekse, keine Gummibärchen und was weiß ich noch alles nicht vertrugen, und ich hätte mich in kindgerechte Diäten wirklich erst mal einarbeiten müssen.
Auf der nächsten Seite der Gebrauchsanweisung für unseren Enkel fanden wir die Kontaktdaten von Familien und deren Kindern, zu denen er zum Spielen gehen durfte. Dann stand da die Telefonnummer einer Elfie Konstantino, zu der Jonas uns später mehr sagen wollte, und eine Aufzählung von Augusts Lieblingsessen, -spielen und -liedern (»Die Affen rasen durch den Wald« kannte ich noch aus Jonas’ Kinderzeit. Ich freute mich darauf, es mit August zu singen, und hatte sofort einen Ohrwurm).
Nach dem Studium dieses Dossiers wussten wir mehr über unseren Enkel, als wir in den vergangenen Jahren über ihn erfahren hatten.
Zuletzt legte Jonas eine Liste mit den Adressen der wichtigsten Geschäfte in der Umgebung in die Mitte des Tisches. »Ich schlage vor, dass wir nachher alle Strecken gemeinsam fahren, damit ihr einen Eindruck von unserem Veedel bekommt.«
Er sagte tatsächlich »Veedel« und nicht Viertel. So weit war es also schon gekommen.
Wir nahmen seinen Wagen. Zuerst fuhren wir Richtung Südstadt, denn dort war das nächste Krankenhaus. »Nur zur Sicherheit, Papa, du hast einen guten Orientierungssinn. Wenn was sein sollte, kennst du die Strecke.«
Ich konnte es mir nicht nehmen lassen zu betonen, dass ich mich in meinem Leben noch nie verlaufen hatte.
Thilo lachte. »Du warst ja noch nie irgendwo ohne mich!«
Das kommentierte ich in Gegenwart unseres Sohnes besser nicht.
Mit Jonas und August im Auto zu sitzen, war für mich so ungewohnt, dass ich vor Aufregung nicht reden konnte. Was bei mir relativ selten ist, Thilo kann es bezeugen. Ich saß hinten neben August, der sich lässig in seinem Kindersitz zurücklehnte und mich höflich anlächelte. Vielleicht war er auch freundlich und nicht bloß höflich, ich kannte ihn nicht näher und konnte sein Verhalten nicht einordnen.
Thilo fragte Jonas über das Auto aus, wollte wissen, wie schnell es fahren konnte, wie viel PS und welche Sicherheitsassistenten es hatte und weiß der Kuckuck was noch. Er interessierte sich absolut nicht für Autos, also wusste ich, dass er genauso nervös war wie ich. Nun ja. Kein Wunder.
August tippte mit dem Finger auf meinen Arm. »Guck mal Oma, da drüben, das ist der Rhein!«
Ich erstarrte. Nicht wegen des Rheins, sondern weil er Oma zu mir gesagt hatte. Noch nie in meinen fünfundfünfzig Lebensjahren hatte mich jemand als Oma bezeichnet. Oma! Das klang grauhaarig, klein, gebückt, korpulent und senil. Ich war nichts davon: Meine schulterlangen Haare waren in natürlichem Brünett gefärbt, ich war eins zweiundsiebzig groß und stolz auf meine Kleidergröße vierzig, die ich seit meiner Pubertät gehalten hatte. Ich ging so gerade, dass Thilo mich manchmal fragte, ob ich mal wieder einen Stock verschluckt hätte, und senil war ich ganz und gar nicht. Okay, wenn ich wollte, konnte ich Namen oder Termine durchaus vergessen, aber das war Berechnung und keine Altersschwäche.
Oma. Das klang wie ein Schimpfwort.
Nein, als August es gesagt hatte, das war ganz süß gewesen. Aber trotzdem … Mir war klar: Auch daran würde ich mich gewöhnen müssen.
Ich muss zugeben, dass ich die Infrastruktur am Kölner Stadtrand unterschätzt hatte. Hier merkte man durchaus, dass der kleine Ortsteil Weiß zu einer Metropole gehört. Aldi, Lidl, Penny, Rewe, Netto, Edeka – keins der Geschäfte war weiter als ein paar Autominuten entfernt. Außerdem gab es überall genug Parkplätze.
Nachdem wir alles vom Auto aus angeschaut hatten, rauchte mir der Kopf. Eine Million neuer Eindrücke und Informationen rauschten durch mein Gehirn, und ich wollte nur noch schlafen.
3
Weiß gehört zum Stadtbezirk Rodenkirchen, und dessen Hauptstadt Rodenkirchen hat einen richtigen Ortskern. Der Maternusplatz, um den sich etliche Läden gruppieren, ist ziemlich groß, größer als zu Hause unsere komplette Fußgängerzone. Zweimal in der Woche gibt es hier einen gut sortierten, ländlichen Wochenmarkt, den ich bei uns in der Provinz noch nie in solcher Größe gesehen hatte.
Jonas hatte uns diesen Markt ans Herz gelegt, also sahen wir ihn uns gemeinsam am Samstag an.
Früher hatte es in Krudhof einen Wochenmarkt am Wilhelmsplatz gegeben, aber da standen mittlerweile nur noch fünf oder sechs Stände. Die Fahrt dorthin lohnte sich nicht, weil man für Waschmittel, Zeitungen und Bier doch wieder zum Supermarkt fahren musste. Da konnte man auch gleich alles in einem Geschäft kaufen, fand ich. Außerdem war es bei uns auf dem Markt sauteuer. Und ob die Lebensmittel dort frisch waren, konnte kein Mensch kontrollieren, weil es keine Tüten und somit keinen Stempel mit dem Haltbarkeitsdatum gab.
Warum gefühlt alle Rodenkirchener auf dem Markt am Maternusplatz einkauften, obwohl sie so viele Supermärkte vor der Tür hatten, begriff ich schnell: Weil das eine Art Wochenendaufwärmparty war. Man traf sich, man kannte sich, man trank in den Cafés am helllichten Tag Sekt – vielleicht war es sogar Champagner –, grell orangefarbene Drinks mit einer Apfelsinenscheibe drin oder Kölsch. Menschen, die bei uns daheim längst in Altenheimen wohnen und Mau-Mau spielen würden, saßen hier lachend, schwatzend und in großen Runden zusammen. Sie benahmen und kleideten sich, als seien sie jung, und als wäre das Leben unendlich. Ich versuchte mir vorzustellen, wie sich unsere Nachbarinnen oder meine Schwiegermutter, schick aufgebrezelt und fröhlich, in einer solchen Clique tummelten. Undenkbar.
Wir bummelten zwischen den Reihen umher, und ich beobachtete das Treiben. Meine Güte, so wie die Leute hier zum Markt gingen, zog ich mich zu standesamtlichen Trauungen oder ähnlichen Festivitäten an!
Zum ersten Mal sah ich Frauen mit aufgespritzten Lippen, straffen Stirnen, gepolsterten Wangen und operierten Augenlidern in natura. Während sie mit gepflegten Händen und langen, lackierten Fingernägeln jede einzelne Möhre oder Tomate vor dem Kauf prüften, hatte ich genügend Zeit, sie genau zu betrachten. Schön fand ich diese getunten Gesichter bei den meisten nicht. Jünger sahen sie dadurch auch nicht aus. Manche der Damen hatten Brüste, die so stramm und so hochgestemmt waren, dass man das Kinn darauf hätte legen können (wenn die Hälse nach den Straffungen überhaupt noch beweglich genug dafür waren).
Nachdem ich mir die gepfefferten Preise für Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch angeschaut hatte, kaufte ich nur ein Pfund Kirschen. Alles andere würden wir im Supermarkt besorgen.
Wir setzten uns auf eine Bank unter Bäumen, aßen ein Eis und beobachteten ziemlich fasziniert dieses affektierte Schaulaufen und die übertriebenen Bussi-Orgien.
»Nie im Leben werde ich fremden Leuten um den Hals fallen, Sätze wie ›Großartig siehst du aus, Liebelein‹ oder ähnlichen Schwachsinn flöten und rechts und links in die Luft küssen. Jetzt mal ehrlich: Würde ich mich zu Hause so verhalten, würden sie mich direkt einweisen lassen«, sagte ich.
»Das machen die bloß, weil sie sich freuen, wenn sie sich treffen«, erklärte August. »Ist doch nicht schlimm, wenn sie sich schön finden.«
Ich widersprach ihm nicht, obwohl ich anderer Meinung war.
Kopfschüttelnd widmete ich mich wieder meinem Basilikum-Zitronen-Eis. Was, zugegeben, lecker schmeckte. Basilikum gehörte eigentlich auf Tomaten und nicht ins Eis, aber man musste offen für Neues sein.
Abends kochte ich für alle; Jonas hatte sich »Linseneintopf à la Mama« gewünscht, und natürlich bekam er den. Es war das erste Mal seit seinem Auszug, dass ich für ihn kochen durfte. In seiner Küche fand ich mich schnell zurecht, Geräte und Geschirr waren sinnvoll und logisch platziert.
Während ich Suppengemüse putzte, Kartoffeln schälte und alles in kleine Würfel schnitt, saß August auf der Arbeitsplatte und schaute mir aufmerksam zu.
»Kann ich eine Möhre?«, sagt er. Ich erwiderte sofort: »Haben? Essen? Schneiden?«
Er sah mich mit großen Augen an, und ich ärgerte mich über meine kleinkarierte Reaktion. Aber August begann zu lachen und sagte: »Oma, du bist immer so komisch!«
Bei dem Wort Oma zuckte ich wieder zusammen.
»Wieso komisch? Wenn du eine Möhre haben möchtest, musst du sagen: ›Kann ich bitte eine Möhre haben.‹ Wenn du sie anschauen willst, musst du das auch sagen. Aber kann ich eine Möhre, tut mir leid, das verstehe ich nicht.«
Ich reichte ihm eine Karotte, er biss hinein und beobachtete mich die ganze Zeit. »Ich habe noch eine Oma, die ist ganz anders als du.«
»Tatsächlich? Nun, Menschen sind verschieden.«
Er antwortete nicht. Ich bohrte nach. »Wie ist denn die andere Oma so?«
August zuckte mit den Schultern. »Ach, die ist lieb, aber sie weint immer. Wir haben schöne Blumen zu meiner Mama gebracht, zum Friedhof. Mama wohnt im Himmel, aber wenn man zum Menschengrab geht und Blumen hinbringt, sieht sie das und freut sich.« Ich wunderte mich über den Ausdruck »Menschengrab«, aber dann kamen Jonas und Thilo aus dem Garten ins Haus, und unser Gespräch war beendet.
Ich ärgerte mich über meine Eifersucht. Natürlich hing August an der anderen Oma, und dass sie viel weinte, weil ihre Tochter gestorben war, verstand ich natürlich. Ich war mir nicht sicher, ob ich mit dem Kind und der Situation klargekommen wäre, wenn seit Caros Tod nicht schon eine Weile vergangen wäre.
Am Sonntag übte ich mit August »Oma und Enkel«. Es war der letzte Tag mit Jonas, sein Flieger nach London ging am nächsten Morgen um fünf vom Köln-Bonner Flughafen. Dann begann der Ernst des Alltags im rosa Haus.
Ich weckte meinen Enkel, stellte ihn unter die Dusche und seifte ihm die Haare ein, bürstete später seine Locken und achtete darauf, dass er die Zähne ordentlich putzte. Der Junge war wirklich brav, und ich hatte das Gefühl, dass Jonas ihn gut auf die nächste Zeit vorbereitet hatte. Hoffentlich blieb das so, wenn wir mit allein zurechtkommen mussten.
Am Frühstückstisch strich Jonas ihm liebevoll über den Kopf. »Morgen fliege ich mit dem Flugzeug nach London.«
August riss plötzlich die Augen auf. »Fliegst du durch den Himmel?«
Mir stockte der Herzschlag, denn ich wusste genau, was er jetzt dachte. Jonas wusste es auch und reagierte ehrlich. »Du fragst, weil Mama im Himmel ist? Ich glaube nicht, dass ich sie vom Flugzeug aus sehen kann. Aber du weißt, dass sie immer bei dir ist, und sie passt auch auf, dass Oma und Opa hier alles richtig machen!« Dann sagte er mit spitzbübischem Blick auf Thilo und mich: »Und wenn die beiden Blödsinn machen, erzählst du mir das jeden Abend, wenn wir facetimen, okay?«
Plötzlich begann ein Hund hysterisch zu bellen. Ich wurde stocksteif, denn ich habe Angst vor Hunden. August rannte wie gestochen zur Haustür und riss sie auf. Das Bellen verstummte.
Es dauerte einen Moment, bis ich begriffen hatte, dass es die Klingel war, die gekläfft hatte.
Ich atmete tief durch. »So was habe ich schon mal im Fernsehen gesehen«, rang ich mir ab. »Das soll Einbrecher abschrecken, oder?«
Jonas grinste. »Genau. Aber nur die, die vorher klingeln.«
August kam mit einer großen, korpulenten Frau herein, die ein auberginefarbenes Zeltkleid trug. Ihre grauen Haare waren zu einem kinnlangen Bob geschnitten, in den vorn rechts und links pinkfarbene Zöpfchen eingearbeitet waren.
Jonas stellte uns vor: »Mama, Papa, das ist Elfie, unsere Nachbarin. Elfie, meine Eltern Billie und Thilo Berthold aus Krudhof.«
Die Frau strahlte mich an und schüttelte erst meine Hand und dann Thilos. »Hächzlisch willkommen in Kölle, isch bin janz sischer, dattse sisch hier rischtisch wohlfühlen! Schön, dattse sisch um Aujust kümmern wollen, dat is en janz toller Junge, und so tapfer, de janze Zick, wo de Mama krank jewesen war, war der oft bei mir aufm Friedhof. Is ja jut für de Pänz, wennse mit de Tiere wat zu tun kriejen, auch wennse tot sin.«
Ich verstand kein einziges Wort.
Thilo übersetzte: »Pänz sind Kinder, und Zick heißt Zeit.« Weiß der Geier, woher er diese Vokabeln kannte.
»August war bei Ihnen die ganze Zeit auf dem Friedhof?«, fragte ich zur Sicherheit nach. Bestimmt hatte ich da was falsch verstanden.
Elfie fasste mich an die Schulter. »Solle mer du saren? Mir sin ja im Rheinland, hier isset immer jesellisch, sojar bei mir aufm Jelände!« Sie lachte dröhnend.
Dann ging sie zum Schrank, nahm sich eine Tasse, marschierte zur Kaffeemaschine, machte sich einen Cappuccino und setzte sich zu uns.
Jonas erklärte: »Hinter unserem Grundstück betreibt Elfie einen Tierfriedhof.« Während ich diese Information sacken ließ, sagte Elfie: »Un isch bin jekommen, um mit Aujust ne Prozession zu bespreschen, bei der er Flöte spillt.«
»Flöte spielt … «, wiederholte ich dümmlich.
»Für Pitty?«, fragte August, der offenbar genau Bescheid wusste.
»Jenau, die Jrube ist schon ausjehoben, dat Kreuz ist fertisch und Pitty is schon im Sarsch. Un am nächsten Tach is die Urnenbestattung von Charlys Vojel, mit Jesang vorwesch, da kannste direkt wieder flöten.«
Jonas aß ungerührt sein Brötchen weiter. Die Merkwürdigkeiten, die diese Frau von sich gab, schienen ihn nicht im Mindesten zu irritieren.
Elfie plapperte die ganze Zeit in einer Sprache, die ich kaum verstand und der mein Göttergatte selig lauschte. »Jötterjatte«, hätte Elfie gesagt, denn soviel hatte ich verstanden, im Kölschen kannten die kein »g«.
Um zu verstehen, was Thilo an diesem Dialekt so faszinierte, musste man wissen, dass er ein völlig beklopptes Hobby hatte: Karneval. Das ist für einen gebürtigen Krudhofer aus meiner Sicht so etwas wie eine genetische Störung, denn der Krudhofer an sich ist für »Gelage im Kostüm« nicht geschaffen.
Natürlich gibt es Ausnahmen. In manchen Gegenden haben sich auch bei uns Gleichgesinnte zusammengeschlossen, in Holtenburg zum Beispiel. Da stürmen an Weiberfastnacht komplett durchgedrehte Frauen die Rathäuser und hissen Fahnen. Außerdem schneiden sie den Männern unterwegs ihre Krawatten ab, keiner ist vor denen sicher, ohne Ansehen der Person.
Für mich hat das Symbolcharakter. Das sind wahrscheinlich Frauen, die mit ihrer stumpfen Schere eigentlich gern weiter unten am Mann agieren würden. Dann betrinken sie sich gemeinsam mit den Kerlen und singen fragwürdige Lieder, geben sich nicht mal die Zeit, ihre Räusche auszuschlafen, sondern toben fast übergangslos auf sogenannten Sitzungen weiter.
Thilo und seine Kumpels feierten den Weiberdonnerstag mit frenetischer Begeisterung, und am darauffolgenden Wochenende saßen sie auf der Prunksitzung, was bedeutet, dass die vorgeschriebenen Kostüme und der Eintritt noch teurer waren als sowieso schon.