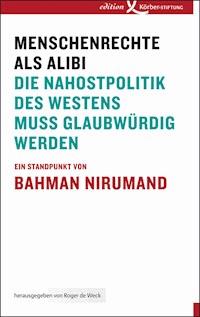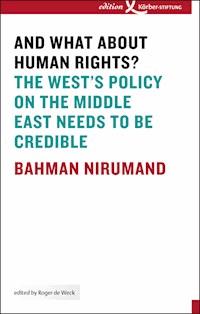9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der junge Bahman Nirumand ist 15, als er aus dem pulsierenden Teheran auf ein Internat im eher tristen Nachkriegs-Deutschland geschickt wird. Die deutsche Sprache erwirbt er sich mit Goethe: Er lernt den kompletten «Faust I» auswendig. Sein erstes eigenes Buch macht ihn mit einem Schlag berühmt: Im Frühjahr 1967 erscheint bei Rowohlt «Persien, Modell eines Entwicklungslandes». Diese Anklage gegen die Diktatur in seiner Heimat wird zum Fanal der Anti-Schah-Proteste. Nirumand gehört fortan zur ersten Reihe der Studentenbewegung; Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Peter Schneider und Ulrike Meinhof zählen zu seinen engen Freunden. Aber er ist mehr als eine Galionsfigur der 68er, auch sein Leben davor und danach steckt voller aufregender und abenteuerlicher Geschichten – viele davon bislang unbekannt und unerzählt. Dazu gehört die wichtige Rolle, die Nirumand für die Gründung der iranischen Auslandsopposition und im verlorenen Kampf gegen den politischen Triumph Chomeinis spielte. Politisches und Privates, Anekdotisches und Analytisches werden in diesem Buch zu einem Lebensroman verwoben, der zugleich vom Elan des Aktivisten und dem Heimweh des Exilanten getragen wird. Es ist das Buch eines Wanderers zwischen den Welten, der viel bewegt hat und an herben Niederlagen wachsen musste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Ähnliche
Bahman Nirumand
Weit entfernt von dem Ort, an dem ich sein müsste
Autobiographie
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für meine Frau Sonia Seddighi,
in Dankbarkeit für alles, was sie mir gegeben hat
Mehrabad: Ein Abschied vom «Ort der Liebe»
Weichenstellung im Arbeitszimmer – Die Schulkrise – Eine väterliche Entscheidung – Schmied oder Deutschland – Kindheit ist Heimat – Das zurückgelassene Fahrrad – Die Tränen der Mutter – Aufbruch ins Unbekannte
Das Arbeitszimmer meines Vaters war für uns Kinder eine Verbotszone, in die uns der Zutritt versagt war. Wenn eines meiner Geschwister oder ich dann doch einmal dorthin bestellt wurden, verhieß das zumeist nichts Gutes. Nur selten sprach unser Vater ein Lob aus. Wer ins Arbeitszimmer gerufen wurde, musste mit einer Standpauke rechnen – und mit Strafmaßnahmen für Verstöße gegen die strengen Regeln, die er oft wider jegliche Vernunft angeordnet hatte.
Eines Tages wurde ich in das Zimmer gerufen. Schon die Aufforderung erfüllte mich mit Schrecken. Dennoch beeilte ich mich, ihr nachzukommen, und rannte schnell die Stufen hoch, in den dritten Stock unseres Hauses. Mein Vater saß an seinem Schreibtisch. Seine strengen Gesichtszüge ließen das Schlimmste befürchten.
«Nimm Platz», sagte er und zeigte auf den Stuhl, der ihm gegenüber auf der anderen Seite des Tisches stand. «Du bist kein Kind mehr», setzte er an, «und ich mache mir große Sorgen um deine Zukunft. Darüber möchte ich mit dir ein ernstes Wort reden.»
Mein Vater hatte recht, das war mir durchaus bewusst. Meine Leistungen in der Schule waren alles in allem miserabel. Am Ende eines jeden Schuljahres brachte ich ein schlechtes Zeugnis nach Hause und wurde dafür mit verächtlichen Kommentaren, Beschimpfungen und nicht selten auch saftigen Ohrfeigen bestraft. Da es aber nicht sein durfte, dass ein Sprössling aus dieser angesehenen Familie das Klassenziel verfehlte, hatte mein Vater ein ums andere Mal seine Beziehungen spielen lassen – und damit tatsächlich erreicht, dass ich trotz meiner schlechten Leistungen stets versetzt wurde.
In Iran lief fast alles über Beziehungen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn man ins Ausland reisen, ein Telefon installieren, ein Auto zulassen oder heiraten will, sogar wenn man ein Paket ins Ausland schicken möchte, ist man auf Beziehungen angewiesen – oder der Willkür der Behörden ausgeliefert. Die einzige Möglichkeit, ohne Beziehungen ans Ziel zu gelangen, sind Schmiergelder. In jeder Behörde sitzen die Beamten und Angestellten hinter ihren Schreibtischen mit einer demonstrativ geöffneten Schublade und verlangen für ihre Dienstleistungen unausgesprochen den gebührenden Preis. Weigert man sich zu zahlen, ist man geliefert. «Wir sind total überlastet», heißt es dann. «Kommen Sie in vier Wochen wieder», obwohl die erwünschte Dienstleistung nicht mehr als fünf Minuten Zeit in Anspruch nehmen würde. Und jeder Protest hätte nur weitere Verzögerungen zur Folge. Also zahlt man lieber. Dann läuft alles wie geschmiert.
Mein Vater hatte Einfluss. Da er seit vielen Jahren am Hof des Königs arbeitete, war er ein wichtiger Mann. Der Schuldirektor tat also gut daran, sich den Wünschen meines Vaters zu fügen. Aber einmal wollte er mich doch nicht ganz ungeschoren davonkommen lassen. Er verlangte, dass ich nach den Sommerferien, vor dem Beginn des neuen Schuljahrs, in den Hauptfächern eine Prüfung ablege. Das war eine harte Strafe, denn damit war die schöne freie Zeit, auf die wir Schulkinder uns das ganze Jahr über freuten, für mich verloren. Während meine Freunde draußen spielten, musste ich in meinem Zimmer büffeln. Immerhin absolvierte ich die Prüfung anschließend mit Erfolg. Doch als ich mein Zeugnis abholen wollte, fauchte mich der Direktor an: «Das ist eine Unverschämtheit! Was glaubst du, was du dir an dieser Schule alles erlauben kannst? Du hättest in allen Fächern eine Prüfung ablegen müssen.» Ich denke, der Direktor hatte wohl endgültig die Nase voll von mir, sodass er auch vor einer offenkundigen Lüge nicht zurückschreckte.
Ich schlich wie ein geprügelter Hund nach Hause. Mein Vater wusste, dass ich gut gelernt hatte, und er kannte die Vereinbarung mit dem Direktor. Als ich ihm erzählte, was mir widerfahren war, war er so erbost, dass er mir untersagte, je wieder einen Fuß in diese Schule zu setzen. Das empfand ich natürlich zunächst wie einen Segen. Aber es war mir klar, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein konnte.
«Wenn du so weitermachst», sagte mein Vater, «wird aus dir nichts werden. Willst du in Zukunft als Straßenkehrer, Gepäckträger oder Bauarbeiter dein Brot verdienen, während deine Brüder studieren und wichtige Posten bekleiden? Zurück in die Schule kannst du nicht. Du müsstest die Klasse wiederholen, was nicht nur für dich schwer zu ertragen wäre, sondern auch dem Ansehen unserer Familie schaden würde. Außerdem zweifele ich daran, ob eine Wiederholung der Klasse dazu führt, dass du den Ernst deiner Lage begreifst und dir genügend Mühe gibst, um den Rückstand aufzuholen. Was meinst du dazu, hast du selber schon einmal darüber nachgedacht?»
«Ja», sagte ich leise. Ich merkte, dass es ernst war, aber mein Vater war nicht wütend. Das wollte ich unter keinen Umständen ändern. Natürlich hatte ich über meine Lage nachgedacht, und obwohl ich das Fernbleiben von der Schule durchaus genoss, konnte ich nicht leugnen, dass mich ein unangenehmes Gefühl plagte. Aber wie sollte ich dieses Gefühl in Worte fassen? Da ich keinen Ausweg wusste, nahm ich einen kleinen Umweg. «Ja», wiederholte ich, «ich habe mir Gedanken gemacht. Und deshalb habe ich mir im letzten Jahr auch sehr viel Mühe gegeben. Doch ich denke, dass sowohl der Direktor als auch die Lehrer mich mit Absicht nicht weiterkommen lassen wollen. Ich vermute, dass sie sich für meine Artikel in der Schülerzeitung rächen wollen. Sie wissen sehr wohl, dass ich der Initiator dieser Zeitung bin und das meiste, was darin steht, von mir stammt. Sie wollen mich einschüchtern und mir meine Kritik heimzahlen. Wie oft haben mich der Direktor und die Lehrer gewarnt, ich solle mich statt um die Zeitung um meine Schulaufgaben kümmern. Ja, sie haben mir sogar offen gedroht, dass ich mich nicht wundern solle, wenn ich am Ende des Schuljahres wieder ein schlechtes Zeugnis bekomme.»
Ich wusste, dass mein Vater auf meine Initiative stolz war. Er hatte mich gelegentlich sogar dafür gelobt. Daher schien es mir angebracht, die Schülerzeitung jetzt zu meinen Gunsten ins Spiel zu bringen.
Doch mein Vater blieb unbeeindruckt. «Es ist immer am einfachsten, die Schuld auf andere zu schieben», erwiderte er. «Wenn deine Leistungen ausgereicht hätten, wärst du nicht sitzengeblieben. Ich weiß, dass du für die Zeitung gute Arbeit geleistet hast, und es ist auch anerkennenswert, dass die Einschüchterungsversuche der Lehrer dich nicht zum Aufgeben zwingen konnten. Dennoch musst du wissen, dass sich nur gute Schüler kritische Äußerungen erlauben können. So ist es nicht nur in der Schule, sondern überall. Wenn du gute Arbeit leistest, kannst du dir einiges erlauben, wenn aber deine Leistungen schwach sind, wirst du dich vor Anfeindungen nicht schützen können.»
«Wie auch immer, die Frage ist nun, wie es weitergehen soll», fuhr er fort. «Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen und mache dir nun zwei Vorschläge. Entweder du verzichtest auf die weitere Schulausbildung und damit auf ein Studium. In diesem Fall könntest du ein Handwerk erlernen, zum Beispiel bei dem Schmied in unserer Nachbarschaft. Oder ich biete dir eine letzte Chance, und zwar eine, die selten einem Jungen in deinem Alter geboten wird: Ich schlage dir vor, in Europa, genauer in Deutschland, zur Schule zu gehen und später dort zu studieren.»
Ich war wie erstarrt. Es wäre mir niemals in den Sinn gekommen, dass mein Vater mir ein solches Angebot machen würde. Seine Worte lösten die widersprüchlichsten und verwirrendsten Gefühle in mir aus. Einerseits war die Aussicht, nach Deutschland geschickt zu werden, höchst verlockend, denn meine aus Filmen und Reiseberichten gespeiste Vorstellung von Europa entsprach weitgehend meinen Wünschen und Sehnsüchten. Ich hatte gehört, dass dort Jugendliche in meinem Alter unvergleichlich freier waren als in Iran. Ich wusste auch, dass ein Studium in Europa die Brücke, ja, nahezu eine Garantie für eine spätere Karriere darstellte. Wer das Privileg besaß, in Europa zu studieren oder auch sich nur für längere Zeit dort aufzuhalten, konnte die Gewissheit haben, dass er nach der Rückkehr in den Iran zu den Auserwählten gehören würde. Andererseits schien mir die Aussicht, ein Leben fern von meinen Eltern, Geschwistern und Freunden zu führen, kaum vorstellbar. Schon der Gedanke daran rief ungekannte Ängste in mir hervor.
Mein Vater redete immer weiter, beschrieb ausführlich die Nachteile, die ein Lehrling in der Schmiedewerkstatt hinzunehmen hätte, und die Vorteile, die ein Schulbesuch und ein Studium in Europa mit sich bringen würden. Sicherlich verlange dieser Vorschlag große Opfer von den Eltern, nicht nur finanziell. Die Trennung von mir würden sie nur schwer verschmerzen können. Doch das Wohl der Kinder überwiege jedes Opfer.
Ich hörte ihm nicht mehr zu. Ich war völlig verwirrt, fühlte mich hin und her gerissen zwischen einer vertrauten und einer fremden Welt und wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Denn natürlich hatte mein Vater längst entschieden. Die Gewichtung, die in seinen Worten mitschwang, seine strengen Gesichtszüge, sein abschätziger Blick bei der Schilderung der Arbeit in einer Schmiedewerkstatt auf der einen und ein selten gesehenes Lächeln auf seinen Lippen, während er von Europa sprach, auf der anderen Seite ließen daran keinen Zweifel.
Es ist deshalb müßig, der Frage nachzugehen, was aus mir geworden wäre, wenn ich das Angebot meines Vaters ausgeschlagen hätte. Mir blieb gar keine Wahl, als zuzustimmen. Und so musste ich mit fünfzehn Jahren meine Heimat, meine Mutter, meine Geschwister, meine Freunde verlassen – die Mauern um unser Haus, auf die ich so oft geklettert war, die große Platane im Garten, den Teich mit den Goldfischen, den Granatapfelbaum, dessen rote Blüten schon im Frühsommer die Früchte ankündigen, von denen jede Hunderte von kleinen roten Perlen in sich verbirgt, den Berg Damawand, den höchsten Gipfel im Norden Teherans, der trichterförmig zum Himmel ragt und das ganze Jahr über, selbst bei glühender sommerlicher Hitze, mit Schnee bedeckt ist, die schwatzenden Frauen, die auf den Stühlen vor ihren Haustüren sitzen und den Kindern gelegentlich etwas zum Naschen geben, sowie all die ungezählten Dinge, mit denen ich aufgewachsen war.
Fast am meisten belastete mich, dass ich mein Fahrrad, das ich nach langem Betteln wenige Monate vor meiner Abreise bekommen hatte, nicht würde mitnehmen können. Dieses Fahrrad, ein Produkt der holländischen Firma Philips, liebte ich mehr als alles andere, was ich besaß. Ich pflegte es tagtäglich, nahm es abends mit in mein Zimmer, stellte es neben mein Bett. Morgens verabschiedete ich mich von ihm, denn zur Schule durfte ich damit nicht fahren. Ein anständiger Junge aus gutem Hause dürfe nicht auf den Straßen Fahrrad fahren, meinten meine Eltern. So blieb mir keine andere Wahl, als damit in unserem Garten ständig im Kreis herumzufahren.
Meine Eltern hätten mir deshalb auch niemals ein Fahrrad geschenkt. Und ich hatte mich damit abgefunden und die Hoffnung längst aufgegeben. Doch eines Tages klopfte es an unserer Haustür, und als ein Dienstbote sie öffnete, hörte ich das Klingeln einer Fahrradglocke. Neugierig schaute ich aus dem Fenster und sah einen Onkel, der ein nagelneues Fahrrad neben sich herschob und meinen Namen rief. Ich wollte es nicht glauben, das Fahrrad war für mich. Vor Freude kamen mir die Tränen, und meine Eltern konnten das Geschenk nicht ablehnen.
Als mein Vater mir nun eröffnete, mich nach Deutschland zu schicken, galt mein erster Gedanke dem Fahrrad. Dass ich mich davon trennen sollte, fiel mir unsagbar schwer. Doch meine Mutter tröstete mich und sagte, in Deutschland dürfe ich mir ein neues Fahrrad kaufen und damit nach Belieben herumfahren. Es gebe dort sogar besondere Wald- und Feldwege für Fußgänger und Fahrräder. Tatsächlich kaufte ich mir in Deutschland bald nach meiner Ankunft ein Fahrrad, aber so ein wunderschönes Exemplar wie das von meinem Onkel habe ich nie mehr besessen.
Je näher der Tag der Abreise heranrückte, desto stärker spürte ich ein Beben in meiner Brust. Zwar war, was mich erwartete, so unbekannt, dass ich mir nicht im Entferntesten ein klares Bild davon machen konnte. Dennoch beschlichen mich immer stärkere Angstgefühle, sodass ich nicht selten kurz davor war, gegen die Entscheidung meines Vaters aufzubegehren. Andererseits jedoch musste mein jugendlicher Stolz diese Angst bekämpfen. Ich wollte doch nicht als Versager dastehen.
Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass viele Gegenstände in meiner Umgebung, denen ich bis dahin keinerlei Beachtung geschenkt hatte, plötzlich an Bedeutung gewannen: sogar die Stühle um den Esstisch, die wir, weil sie aus Polen kamen, polnische Stühle nannten, oder der Wasserkrug mit dem langen schmalen Hals und dem Mund, der wie die herausgestreckte Unterlippe eines Schimpansen aussah, oder das Hochzeitsbild meiner Eltern, das in einem vergoldeten Rahmen auf dem Geschirrbuffet stand. Wie jung und schön meine Mutter auf diesem Foto aussah!
Im Wohnzimmer hingen zwei große Originalgemälde. Eines davon zeigte ein Gastmahl. Eine erlauchte Gesellschaft in kurdischer Tracht sitzt im Grünen um ein großes, auf der Wiese ausgebreitetes Tischtuch. Darauf stehen Obstschalen mit Pfirsichen, Äpfeln, Aprikosen, Pflaumen. Dienstboten tragen gerade das Mahl auf. Eine Momentaufnahme der iranischen Feudalaristokratie. Die Bilder waren wohl Erbstücke der Familie meines Vaters, die aus dem kurdischen Teil Irans stammte und irgendwann in die Hauptstadt gezogen war, wo mein Großvater dem Kadscharen-König Ahmad Schah als Berater gedient hatte.
Mein Zimmer, unter dem Dach des dreistöckigen Hauses gelegen, war klein und einfach eingerichtet: ein Bett, ein Schreibtisch mit einem Stuhl, ein kleines Bücherregal mit ein paar Kinder- und Jugendbüchern darin. Dennoch verwandelte sich dieses Zimmer in den letzten Tagen vor meiner Abreise in einen Sehnsuchtsort. Spielzeug hatte ich kaum, und das wenige war zudem selbst gebastelt. Weder ich noch meine vier Geschwister hatten je irgendein Spielzeug geschenkt bekommen. Wir mussten uns alles selbst basteln, wobei Basteln vielleicht ein irreführender Begriff ist. Wir hatten weder Werkzeuge, noch durften wir uns Holz oder anderes Baumaterial kaufen. Uns stand nur das zur Verfügung, was wir zu Hause vorfanden und gerade nicht gebraucht wurde. Wir nahmen zum Beispiel eine leere Schuhwichsdose, Schnur aus dem Nähkasten der Mutter und einen geraden Baumzweig und machten daraus eine Waage. Oder wir fanden eine leere Puderdose aus Pappe, befestigten die beiden Hälften an den Enden eines langen Fadens und benutzten sie als Telefon.
Nachts träumte ich von Deutschland, von den wunderbaren, reich geschmückten Schaufenstern, den breiten Straßen und Alleen, von den Parks und den Waldwegen, auf denen ich mit einem Fahrrad dahinglitt. Das Merkwürdige war nur, dass ich in diesen Träumen keine Menschen sah, so als wäre ich ganz allein dort. Ich erwachte dann stets mit einem beängstigenden Gefühl der Einsamkeit.
Am Tag meiner Abreise begleiteten mich die ganze Familie und ein Teil der Verwandtschaft zum etwa zehn Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Flugplatz mit dem schönen Namen Mehrabad (Ort der Liebe). Heute hat die wuchernde Stadt Teheran diesen Flughafen längst vereinnahmt. Er liegt inmitten eines großen Stadtteils und wird nur noch eingeschränkt für Inlandsflüge genutzt, während das Gros des Flugverkehrs über einen neuen, großen Flughafen vierzig Kilometer entfernt abgewickelt wird, der den Namen des Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Chomeini, trägt. Aber diese neue Welt lag damals noch in weiter Ferne.
Viel Gepäck hatte ich nicht, ich sollte mir alles in Deutschland kaufen. Die Stimmung am Flughafen war gedämpft. Alle schienen ziemlich traurig zu sein, versuchten aber, es vor mir zu verbergen. Meine Mutter, mit sorgenvoller Miene und Tränen in den Augen, gab mir immer neue Ratschläge: «Pass gut auf dich auf! Zieh dich immer warm an, denn in Deutschland ist es sehr kalt.» Wenn ich krank würde, solle ich sofort einen Arzt aufsuchen, und wenn ich mich in Deutschland nicht wohlfühlen würde, solle ich sofort zurückkommen. Mein Vater hingegen bewahrte wie immer Haltung, klopfte mir beim Abschied auf die Schulter und sagte: «Nun liegt dein Leben in deiner Hand, versuche das Beste daraus zu machen. Ich bin stolz auf dich.»
Dieses seltene Lob aus seinem Munde überhörte ich fast. Ich war einfach nur aufgeregt, nicht nur, weil ich ins Unbekannte aufbrach, sondern vielleicht mehr noch, weil ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Flugzeug fliegen würde. In diesem Moment des Abschieds vergaß ich deshalb beinahe, dass ich dabei war, all das Gewohnte, alles, was mir lieb und teuer war, für lange Zeit, womöglich für immer zu verlassen.
Kinderzeiten – und der Mahlstrom der Politik
Die persische Despotie – Eine Quasi-Kolonie – Der Diktator zu Hause – Ein Nichts, das man wegpusten kann – Todesurteil für den Vater – Die junge Mutter: Verheiratet mit 13 – Unbeschwerte Kindheit – Mohammad Mossadegh: Irans vergebliche Hoffnung – Eine erste politische Aktion
Als ich das Land verließ, befand sich Iran in einer der turbulentesten Phasen seiner Geschichte. Eine Bewegung unter der Führung von Mohammad Mossadegh hatte sich die Nationalisierung der Ölindustrie zum Ziel gesetzt, doch im Grunde ging es um weit mehr als dies. Es ging um die Befreiung von der britischen Vorherrschaft und den Aufbau einer unabhängigen demokratischen Gesellschaft. Denn der Iran meiner Kindheit war eine Despotie und der so mächtige Schah ein König von Großbritanniens Gnaden.
Was Mossadegh und seine Anhänger anstrebten, hatte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der konstitutionellen Revolution seinen Anfang genommen. Jener erste Versuch, mit der asiatischen Despotie und ihren feudalistischen Machtstrukturen zu brechen und den Sprung vom Dunkel des Mittelalters in die aufgeklärte, moderne, industrialisierte Welt zu vollziehen, war jedoch gescheitert. Denn der gesellschaftliche Träger der Volkserhebung, die iranische Mittelschicht, war noch zu schwach und deren Gegner, die konservative Geistlichkeit und der Hof mitsamt der ihm hörigen Grundbesitzer, zu stark gewesen. Hinzu kam die Abhängigkeit vom Ausland, namentlich von Großbritannien und Russland. Beide Mächte wetteiferten schon seit der Jahrhundertwende um Einfluss, indem sie die schwachen und infantilen iranischen Monarchen jener Zeit mit Staatsanleihen und Krediten versorgten, damit diese in ihren Palästen hinter hohen Mauern ein reiches, sorgenloses Leben führen konnten. So waren das Land und seine nationalen Rechte Stück für Stück verschachert worden. Bereits im 19. Jahrhundert hatte Iran auf seine kaukasischen Provinzen (Georgien, Armenien und andere) zugunsten Russlands verzichtet, ebenso wie auf seine Rechte auf das Kaspische Meer. (Der Kommentar des Königs zu diesem Vertrag: «Wir sind ja keine Enten, dass wir das Wasser des Kaspischen Meeres nötig hätten!»)
Als nicht minder folgenreich erwiesen sich die Konzessionen, die den Briten gemacht worden waren. 1903 hatte der englische Unternehmer William Knox D’Arcy mit dem damaligen Schah einen Vertrag geschlossen und sich für 60 Jahre das ausschließliche Recht gesichert, auf dem gesamten iranischen Territorium, mit Ausnahme der unter russischem Einfluss stehenden fünf nördlichen Provinzen, nach Erdöl zu suchen, Fundstellen auszubauen und das Öl zu exportieren. Dafür sollte Iran 16 Prozent der jährlichen Profite erhalten. Zusätzlich hatte der Schah einen einmaligen Barbetrag von 20 000 Pfund auf die Hand bekommen. Damit war der Grundstein zur Wandlung Irans in eine Quasi-Kolonie gelegt. Die beiden Mächte, Russland und Großbritannien, hatten das Land schließlich 1907, im Vertrag von Petersburg, sogar förmlich unter sich aufgeteilt und damit ihrer Rivalität vorläufig ein Ende gesetzt. Von da an gab es ein russisches Interessengebiet im Norden, ein britisches im Süden und dazwischen eine Art neutrale Pufferzone, in der sich die Könige als Herrscher gerieren durften.
Doch das Volk, das sich in seiner zweieinhalbtausendjährigen Geschichte immer wieder gegen Fremdherrschaft zur Wehr gesetzt hatte, leistete auch jetzt Widerstand. In allen Teilen des Landes kam es zu Unruhen. Vor allem jene Kräfte, die schon bei der Revolution von 1906 aktiv gewesen waren und die Idee von Freiheit und Demokratie nicht aufgeben wollten, begannen sich neu zu organisieren. Das Land drohte ins Chaos zu sinken. Die Außenmächte sahen ihre Interessen gefährdet. Da aber in Russland inzwischen die Revolution ausgebrochen war, hatten die Russen Wichtigeres zu tun, als sich um Iran zu kümmern. So schlug die Stunde der Briten. Sie befestigten ihre Position und bereiteten, um die Lage zu stabilisieren, einem Diktator den Weg an die Macht.
Das Los fiel auf Reza Khan Savad Kouhi. Reza Khan, dessen Vater kurz nach seiner Geburt gestorben war, war schon mit vierzehn Jahren in eine unter russischem Kommando stehende iranische Kosakenbrigade eingetreten. Dort hatte er aufgrund seines niedrigen Alters zunächst als Aushilfe in der Kantine arbeiten müssen, doch sein Ehrgeiz und sein organisatorisches Talent ließen ihn rasch Karriere machen. Binnen weniger Jahre erklomm er die Stufen der militärischen Hierarchie, bis er als Oberkommandierender der Brigaden die Spitze erreichte. Und woanders ging es noch höher hinaus: 1921 wurde er Kriegsminister, zwei Jahre später Premierminister, und 1925 schließlich, nachdem er den Sturz des letzten Königs der Kadscharen erfolgreich betrieben hatte, setzte er sich selbst die Krone aufs Haupt.
Zu dieser Zeit befand sich Iran im Übergang von einem absolutistischen Feudalsystem zu einem modernen Nationalstaat. Es gab kein allgemeines Rechtswesen, kein Gesundheitswesen, kein Finanzwesen, keine Hochschulen. Die Infrastruktur war miserabel, Straßen hatten offiziell keine Namen, die Häuser keine Nummern, die Menschen waren nicht gemeldet. Das Land wurde von lokalen Herrschern regiert, die in loser Verbindung zum Hof standen.
Ähnlich wie Mustafa Kemal Atatürk, der zwei Jahre zuvor in der Türkei die Macht übernommen hatte, leitete Reza Khan, der inzwischen den Nachnamen Pahlawi trug, die Modernisierung des Landes ein. Das Wort «Palawi» bezeichnet die mittelpersische Sprache und sollte ihm die Aura altpersischer Dynastien verleihen. Mit Hilfe eines zügig aufgebauten Polizeistaates gelang es ihm, die gesamte Macht in seiner Hand zu konzentrieren. Ein Nationalismus, verbunden mit einem verbissenen Streben nach Fortschritt um jeden Preis, verleiteten den innerhalb weniger Jahre vom einfachen Rekruten zum König aufgestiegenen Analphabeten zum Aufbau einer gut organisierten Gewaltherrschaft, wie sie bis dahin in der iranischen Geschichte unbekannt gewesen war.
Gewalt und Fortschritt gingen Hand in Hand. Reza Schah ließ Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen bauen, und es gelang ihm tatsächlich, dem allgemeinen Chaos und der Unsicherheit ein Ende zu setzen. Er ordnete das Führen eines Nachnamens an und machte den Personalausweis zur Pflicht, er ließ ein neues Gesetzbuch nach französischem Vorbild schreiben, führte die allgemeine Schulpflicht ein, gründete die erste Universität des Landes und organisierte den Verwaltungsapparat neu, vor allem die Armee, die Polizei und den Geheimdienst. Jeder, der sich seinem Diktat widersetzte, wurde ins Gefängnis geworfen oder gleich getötet.
Die Modernisierung schloss für den Schah, ähnlich wie für Atatürk in der Türkei, auch einen Feldzug gegen die Religion, gegen die islamischen Riten und Bräuche ein. So verbot er den Frauen, Schleier zu tragen, und nahm den Männern ihre Nationaltracht. Auch die Geistlichen mussten sich fürchten, mit Turban und Umhang in der Öffentlichkeit aufzutreten. Er reduzierte die religiösen Feiertage und übertrug viele juristische und administrative Aufgaben, die bis dahin von Klerikern wahrgenommen worden waren, auf den Staat.
Der damalige Justizminister Sadrolaschraf, der selbst ein Geistlicher war und die Kleidung der Mullahs trug, beschrieb in seinen Memoiren, wie Reza Schah die europäische Kleiderordnung durchsetzte. «Nach der Rückkehr von einer Reise in die Türkei äußerte sich der Schah sehr lobend über die Fortschritte, die dieses Land bei der Abschaffung islamischer Kleidung erzielt hatte. Eines Tages im Monat Mai 1935 berief er das Kabinett ein und sagte bei der Sitzung: ‹Wir müssen sowohl in unserem Aussehen als auch in unseren Sitten und Gebräuchen westlich werden. Der erste Schritt dazu ist die Abschaffung der Nationaltracht und das Tragen von europäischen Hüten. Bei der morgigen Sitzung des Parlaments werden Sie alle europäische Anzüge und Hüte tragen. Wenn Sie den Raum betreten, müssen Sie, wie die Europäer es zu tun pflegen, Ihre Hüte abnehmen. Wir müssen natürlich auch bald damit beginnen, den Frauen den Schleier zu verbieten. Das wird für die Bevölkerung schwer sein. Daher müssen wir selbst den Anfang machen. Zu diesem Zweck werden wir einmal in der Woche ein Fest veranstalten, bei dem Sie und Ihre Staatssekretäre gemeinsam mit Ihren Frauen in europäischer Kleidung erscheinen werden.› Dem Kultusminister erteilte er den Befehl, an sämtlichen Mädchenschulen allen Lehrerinnen und Schülerinnen, die Schleier tragen, den Eintritt zu verwehren. Wer sich dem widersetze, solle sofort entlassen werden. An allen Ministerien und staatlichen Ämtern sollen nur Frauen angestellt werden, die bereit seien, europäische Kleidung zu tragen.»
Es dauerte nicht lange, da riss man den Frauen auf den Straßen die Schleier vom Kopf. Viele Frauen fühlten sich ohne Schleier wie nackt und zogen es daher vor, ihre Wohnung nicht mehr zu verlassen. In der späteren Verordnung, die das Tragen europäischer Kleidung für jeden Mann und jede Frau zur Pflicht machte, wurde nur noch den Großayatollahs ein Zugeständnis gemacht. Sie durften ihr geistliches Gewand auch weiterhin tragen. Doch die Polizisten auf den Straßen richteten sich selten danach. Unter dem Gelächter von Passanten wurde den Mullahs der Turban vom Kopf gerissen und der Bart abrasiert. Diese ungeheure Erniedrigung erzeugte bei der iranischen Geistlichkeit und frommen Gläubigen tiefe Hass- und Rachegefühle – die sich ein halbes Jahrhundert später entladen sollten.
Die Hoffnungen auf Freiheit und Demokratie, die die konstitutionelle Bewegung erweckt hatte, waren dahin. Eine Schreckensherrschaft hatte sich etabliert, Widerstand schien sinnlos. Liberale, Kommunisten, Feudalherren oder lokale Herrscher, die dem Schah ihre Gefolgschaft verweigerten, landeten in den Kerkern oder wurden liquidiert.
All die Widersprüche, Ungerechtigkeiten, Gewalttätigkeiten dieser Zeit drangen erst allmählich in mein kindliches Bewusstsein. Ich gehörte zur privilegierten Schicht und hatte nicht nur nichts Schlimmes zu ertragen, sondern kann auf eine glückliche Kindheit zurückblicken. Das Haus, in dem wir fünf Geschwister mit den Eltern wohnten, hatte mein Vater bauen lassen, um in unmittelbarer Nähe des Königspalastes zu sein. Mein Vater war der erste Adjutant des Schahs, das heißt der Mann, der seine Befehle weitergab oder seine Wünsche erledigte. Eine Zeitlang war er auch Direktor des Hofgefängnisses.
Der Schah, der meinen Vater stets an seiner Seite haben wollte, hatte sonderbare Manieren. Er schlief wenig, und manchmal stand er mitten in der Nacht auf und wollte zum Beispiel kontrollieren, ob eine neu gebaute Straße auch ordentlich asphaltiert war. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern ließ er seinen Fahrer die Straße entlangfahren, und wenn er Unebenheiten entdeckte, musste der Asphalt anderntags aufgerissen und komplett erneuert werden. Die Kosten hierfür hatte der verantwortliche Ingenieur zu tragen, der anschließend natürlich sofort entlassen wurde. Ein anderes Mal inspizierte der Schah den Teheraner Bahnhof und die dort parkenden Züge. Der Marmorfußboden der Eingangshalle musste immer glänzen, die Waggons hatten in einwandfreiem Zustand zu sein. Versäumnisse wurden hart bestraft.
Wenn der Schah meinen Vater rufen ließ, musste er sofort zur Stelle sein, sonst wäre er in Ungnade gefallen. Zwischen unserem Haus und dem Sitz des Schahs stand nur der Palast der Schah-Tochter Schams, sodass mein Vater nur wenige Gehminuten benötigte, um beim Schah zu sein. Doch selbst dies dauerte dem Diktator zu lange. Deshalb stand immer, wenn mein Vater zu Hause war, auch nachts, ein Wagen mit einem Fahrer und laufendem Motor vor dem Haus, um innerhalb einer Minute den Palast zu erreichen. Um keine Zeit zu verlieren, trug mein Vater auch zum Schlafen seine Uniform.
Eines Tages geschah etwas, was nie aus meinem Gedächtnis schwinden wird. Mein Vater war am Mittag nach Hause gekommen, um ein Bad zu nehmen. Als er unter der Dusche stand, entdeckte ich im Schlafzimmer ein paar Gummistrumpfbänder, die mir sehr geeignet schienen für eine Gummischleuder. Also nahm ich ein Band und schnitt es für meine Schleuder zurecht. Als ich vergnügt unten im Hofe mit dem ersten Stein auf einen am Beckenrand stehenden Eimer zielte, klingelte das Telefon. Der Anruf kam aus dem Palast. Wenige Augenblicke später hörte ich meinen Vater vor Wut brüllen: «Wo ist mein Strumpfband?»
Er hatte keine Zeit, musste ohne Strumpfband los. Ich, fünf Jahre alt, merkte erst jetzt, was ich angerichtet hatte.
Was für eine Katastrophe! Ich war sicher, dass ich für meine dreiste Frechheit bestraft werden würde, und betete zum Himmel, dass mein Vater nie mehr nach Hause kommen möge. Gott sei Dank wurden meine Gebete nicht erhört. Aber als er wenige Stunden später zurückkam, ging er mit eiligen Schritten und wütender Miene ins Gästezimmer und ließ sofort alle Bewohner des Hauses antreten, meine Mutter, uns Kinder und die Dienstboten.
Da saß er nun zu Gericht: «Jemand muss, während ich im Bad war, mein Strumpfband genommen haben, denn das Band kann ja nicht weggeflogen sein», sagte er. «Wer war es also?»
Totenstille herrschte im Raum, alle schienen den Atem anzuhalten. Jeder schaute die anderen fragend an. Es waren qualvolle Augenblicke. Ich zögerte ein wenig, doch dann trat ich aus der Reihe hervor und sagte mit leiser, reuiger Stimme: «Ich war es.» Ich wusste, dass ich damit mindestens ein paar saftige Ohrfeigen in Kauf nahm. Doch die Reaktion meines Vaters überraschte nicht nur mich, sondern auch die anderen. Er hielt einen Moment inne, dann stand er auf, kam auf mich zu und umarmte mich. «Für deinen Mut gebührt dir ein Lob», sagte er. «Habe nie Angst, die Wahrheit zu sagen, und stehe zu dem, was du getan hast.»
Mein Vater war sehr streng. Was der Schah draußen im Großen war, war mein Vater in seiner kleinen Welt zu Hause, ein Diktator. Ich hatte nie ein enges Verhältnis zu ihm, nicht als Kind, auch nicht später, als ich erwachsen und er mit zunehmendem Alter weicher geworden war. Es gab immer eine gewisse Distanz zwischen uns, nicht zuletzt wegen unserer gravierenden politischen Meinungsverschiedenheiten.
Trotz seiner Strenge gestattete mein Vater einmal im Jahr seinen Kindern die freie Meinungsäußerung. Am Vorabend des neuen Jahres, das bei uns mit dem Frühling beginnt, durften meine Geschwister und ich unsere Eltern kritisieren, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Davon machten wir auch reichlich Gebrauch. Selbstverständlich richtete sich unsere Kritik in erster Linie gegen den Vater. Ich erinnere mich, dass ich einmal recht theatralisch sein strenges, autoritäres Gehabe nachahmte, sodass auch er sich vor Lachen nicht halten konnte. Die Kritik wirkte allerdings nur einige Wochen.
Mein Vater war ein entschiedener Monarchist, ich wurde Republikaner und Sozialist. Vor allem in meiner linksradikalen Lebensphase, in der ich mir auch größere Kenntnisse über die Despotie Reza Schahs angeeignet hatte, stellten sich mir in Bezug auf die Rolle meines Vaters an der Seite des Diktators und auch im Hinblick auf die Zeit, in der er das Palast-Gefängnis leitete, unzählige Fragen. Ich wusste doch, dass in diesem Gefängnis Menschen getötet worden waren, vor allem Kommunisten. Im Falle des Kommunistenführers Taghi Erani war es so gut wie erwiesen, dass er ermordet worden war. Es war unmöglich, dass mein Vater von alledem keine Ahnung hatte. Ich habe ihn später immer wieder danach gefragt. Er hat mir nie eine befriedigende Antwort gegeben. Ich musste mich mit der Zusicherung begnügen, während seiner Zeit sei niemand umgebracht worden. Konnte ich das glauben?
Einen, den Schriftsteller Bozorg Alavi, der damals meinen Vater als Gefängnisdirektor erlebt hatte, habe ich Jahrzehnte später getroffen. Er gehörte einer Gruppe von 53 Kommunisten an, die gemeinsam im Gefängnis gesessen hatten. Nach seiner Befreiung schrieb er über seine Haftzeit das Buch «Gruppe 53». Nicht nur dieses Buch, sondern die Romane und Erzählungen, die er in den darauf folgenden Jahren schrieb, machten ihn zu einem landesweit bekannten und populären Schriftsteller. Als der Sohn Reza Schahs, Mohammad Reza, nach dem Sturz von Mossadegh seine neue Diktatur errichtete, wurden erneut Kommunisten verfolgt; Alavi flüchtete ins Ausland, in die DDR, und lehrte an der Humboldt-Universität persische Literatur und Sprache. Wir sahen uns gelegentlich und wurden gute Bekannte. Einmal bat ich ihn, ohne Rücksichtnahme auf meine Gefühle, mir ehrlich und offen zu sagen, was er damals im Gefängnis erlebt und beobachtet hatte. Seine Antwort war für mich sehr überraschend. Er sagte, die Gräuelgeschichten seien vor allem Propaganda gewesen, auch er selbst habe in seinem Buch die Vorgänge übertrieben dargestellt. Mein Vater sei zwar streng gewesen, er habe auch Prügel angeordnet, und die Gefangenen seien strengen Verhören unterzogen worden. Aber niemand sei durch Folter gestorben.
Zeugte diese Aussage von orientalischer Höflichkeit, von der Rücksichtnahme gegenüber einem ähnlich gesinnten Bekannten, den er nicht verletzen wollte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls half mir seine Antwort nicht weiter. Im Gegenteil, sie gab mir noch mehr Rätsel auf. Wie konnten, sollte die Antwort der Wahrheit entsprechen, Kommunisten jahrelang solche Behauptungen aufrechterhalten, Behauptungen, die meinen Vater beinahe an den Galgen gebracht hätten?
Denn nach der von den Alliierten erzwungenen Abdankung Reza Schahs und seiner Verbannung ins Ausland kamen seine Gegner, die Liberalen und auch Kommunisten, an die Macht. Kommunisten und Teile der Sozialdemokraten schlossen sich 1941 in der Tudeh-Partei zusammen, eine Partei, die in den folgenden Jahren von Moskau unterstützt wurde und als verlängerter Arm der Sowjetunion eine wichtige Rolle in Iran spielte.
Sowohl die Sowjets als auch die Briten sahen durch die Annäherung Irans an das Deutsche Reich ihre Interessen bedroht. Die Deutschen hatten ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Iran ausgebaut und verfolgten darüber hinaus militärische und strategische Interessen. Als Nachbarland zur Sowjetunion wäre Iran als Nachschubweg für Waffen beim Russlandfeldzug ideal gewesen. Zudem genossen die Deutschen aufgrund ihrer Gegnerschaft zu Großbritannien unter der Bevölkerung große Sympathien. Es gab sogar eine Anzahl von Gruppen, die sich dezidiert auf die Nazis beriefen. Und auch der Schah selbst sah in der Annäherung an das Hitler-Regime eine Möglichkeit, sich aus der Abhängigkeit von den Briten zu lösen. Somit stellte die deutsch-iranische Annäherung eine Bedrohung sowohl für die Sowjets als auch für die Briten dar.
Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion einigten sich die Rivalen von einst auf Kooperation, zumal auch die Alliierten Iran als Nachschubweg für den Transport amerikanischer Waffen nach Russland brauchten. So begann am 25. August 1941 eine Invasion von Norden und Süden, die innerhalb weniger Wochen zur vollständigen Besetzung Irans führte. Die iranischen Streitkräfte gaben schnell ihren Widerstand auf. Verzweifelt wandte sich Reza Schah an den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und berief sich auf die Atlantik-Charta. Er schrieb an Roosevelt: «In Übereinstimmung mit der Deklaration Ihrer Exzellenz hinsichtlich der Notwendigkeit, die Prinzipien des internationalen Rechts und des Rechts der Völker auf Freiheit zu verteidigen, bitte ich Ihre Exzellenz, wirksame und dringend erforderliche humanitäre Schritte zu unternehmen, diesem Akt der Aggression ein Ende zu setzen. Dieser Vorfall zieht ein neutrales und friedliches Land in einen Krieg hinein, das nichts anderes will, als den Frieden zu bewahren und die eingeleiteten Reformen weiter voranzutreiben.»
Roosevelt lehnte ungerührt ab: «Betrachtet man die Problematik in ihrer Gänze, so sind nicht nur Fragen berührt, die von Ihrer königlichen Majestät angesprochen werden, es sind auch Fragen hinsichtlich Hitlers Ambitionen, die Welt zu erobern, zu berücksichtigen.» Deutschland werde seine Feldzüge fortsetzen und über die Grenzen Europas bis nach Asien, Afrika und sogar Amerika ausweiten, sofern es nicht durch den Einsatz militärischer Kräfte daran gehindert werde. Der Präsident versicherte, dass «die Äußerungen der britischen und sowjetischen Regierungen der iranischen Regierung gegenüber nicht gegen die Unabhängigkeit oder territoriale Integrität Irans gerichtet sind.»
Obwohl Reza Schah von der Mehrheit des Volkes nicht geliebt wurde, wurde seine Absetzung als eine nationale Schande empfunden. Wie war es möglich, dass allein der Wille einer ausländischen Macht ausreichte, um den König eines Landes ins Ausland zu verbannen? Reza Schah selbst, erzählte mein Vater später, spottete über sein Schicksal. Am letzten Tag der Abreise lief er in seinem Arbeitszimmer auf und ab und sagte immer wieder: «Ich bin Reza Schah, König der Könige, Alleinherrscher über Iran, ein Nichts, das man wegpusten kann.» Und er lachte schallend.
Eigentlich sollte mein Vater ihn in die Verbannung begleiten. Als er sich von uns verabschiedete, gingen die Erwachsenen davon aus, dass sie ihn nie mehr sehen würden. Unsere Familie hatte gepackt, mehrere Autos sollten uns von Teheran nach Isfahan bringen. Denn in der Hauptstadt schien die Lage immer gefährlicher zu werden. Außerhalb der Stadt waren ein paar Bomben gefallen. Das war für viele, die dazu die Möglichkeit hatten, Anlass genug, um in die Provinz zu fliehen. Als wir in der Nacht mit ausgeschalteten Scheinwerfern auf einer Chaussee, die sich durch die Wüstenlandschaft schlängelte, nach Isfahan fuhren, wurden wir von der Autokolonne mit dem Schah und seiner Eskorte überholt. Ich sehe noch deutlich meinen Vater, wie er uns im Vorbeifahren zuwinkt. Wenige Tage später war er dann doch wieder bei uns. Der Schah hatte sich anders entschieden. Kehre in die Hauptstadt zurück, dort wirst du mehr gebraucht als hier, hatte der Diktator befohlen.
Nach der Besetzung Irans wurden durch den «Persischen Korridor» über fünf Millionen Tonnen militärisches Gerät aus den USA an die Sowjetunion geliefert. Der Nachfolger Reza Schahs, sein Sohn Mohammad Reza, war zu jedem Zugeständnis an die Besatzer bereit. Im Januar 1942 sicherte er in dem sogenannten Dreimächteabkommen den Alliierten jede erdenkliche nichtmilitärische Unterstützung zu. 1943 erklärte Iran Deutschland den Krieg und konnte damit in die neu entstehende Organisation der Vereinten Nationen aufgenommen werden. In der Konferenz von Teheran im November 1943 bestätigten Franklin Roosevelt, Winston Churchill und Josef Stalin noch einmal die Unabhängigkeit und territoriale Integrität Irans und vereinbarten, spätestens sechs Monate nach dem Krieg ihre Truppen abzuziehen. Während die Briten diesem Abkommen dann auch tatsächlich Folge leisteten, weigerten sich die Sowjets, die vor allem im Nordwesten Irans stationiert waren. Ihr Ziel war, ihren Einfluss im Nachbarland durch die weitere Unterstützung der neu entstandenen separatistischen Regime in der Volksrepublik Aserbaidschan und der kurdischen Republik Mahabad dauerhaft zu sichern. Erst im Mai 1946 zwang ein Ultimatum der USA die Sowjets, ihre Truppen zurückzuziehen, was gleichzeitig das Ende für die beiden Volksrepubliken bedeutete und den Beginn des Kalten Krieges markierte.
Nachdem der alte Schah außer Landes war, kam zunächst die Zeit für die Rache all jener, die von der Diktatur unterdrückt worden waren. Selbstverständlich geriet auch mein Vater ins Visier. Er wurde festgenommen und in der ersten Instanz zum Tode verurteilt. Ich erinnere mich nur dunkel an die Schlagzeilen der Zeitungen, die das Urteil bekanntgaben. Es war ein großes Unglück für unsere Familie. Meine Mutter fiel in den ersten Tagen nach der Urteilsverkündung alle Stunden einmal in Ohnmacht. Doch bald schon schöpften wir wieder Hoffnung. Wichtige Akteure auf der politischen Bühne, die es wissen mussten, beruhigten meine Mutter. Das Urteil sei als Abschreckung und Machtdemonstration gedacht, meinem Vater habe man keine Verbrechen nachweisen können, die Berufungsinstanz werde alles zurechtrücken.
Tatsächlich wurde mein Vater in der letzten Instanz freigesprochen. Aber die ganze Prozedur zog sich über vier Jahre hin, eine unerträglich lange Zeit für einen Mann, der zur Machtelite des Landes gehörte und sich in eine Einzelzelle verbannt sah. Er wurde zwar bevorzugt behandelt, seine Zelle durfte er wie ein eigenes Zimmer einrichten, und täglich wurde ihm von zu Hause das Essen gebracht. Er konnte jederzeit Besuche empfangen, auch mich nahm meine Mutter gelegentlich mit. Aber der Machtverlust, das Gefühl, seinen Gegnern und Feinden ausgeliefert zu sein, all dies hinterließ tiefe Spuren. Als der neue Schah ihm nach seiner Freilassung anbot, wieder am Hof zu arbeiten, lehnte er ab. Er wollte kein staatliches Amt mehr übernehmen; auch hielt er den jungen Schah für völlig unfähig, die Geschicke des Landes zu lenken.
Meine Mutter war im Gegensatz zu meinem Vater sanft und liebevoll. Sie war mit dreizehn Jahren verheiratet worden und hatte mit vierzehn ihren ersten Sohn bekommen. Damals war es üblich, dass die Frauen schon in ihrer Jugend, einer Zeit, in der sie von irrigen Gedanken zu Fehltritten verleitet werden und ihre Unschuld verlieren könnten, wie es hieß, unter die Obhut ihres künftigen Gemahls gebracht wurden. Meine Tante, die ältere Schwester meiner Mutter, wurde bereits mit zehn Jahren in die Ehe geführt. Die Moral der Geschichte, die selbstverständlich von Männern geschrieben wurde, hieß, so werde der Mann die Möglichkeit haben, die Frau seinen Vorstellungen gemäß zu erziehen, und damit eine harmonische und gut funktionierende Familie gründen.
Zur Hochzeit hatte mein Vater, zehn Jahre älter als sie, meiner Mutter eine Puppe geschenkt. Oft erzählte mir meine Mutter, der ich sehr nahestand, die Geschichte von den ersten Jahren ihres Ehelebens. Sie lebten damals bei den Eltern meines Vaters, einer konservativen Familie, die mit ihren Kindern wie auch mit ihren Schwiegertöchtern oder Schwiegersöhnen sehr streng umgingen. Es zieme sich nicht für eine ehrbare Frau, vor allem wenn sie frisch verheiratet und so jung sei, zu oft mit dem Mann zusammen zu sein, sagte die Schwiegermutter zu der jungen Braut. Sie müsse sich zurückhalten und Zweisamkeit möglichst vermeiden.
Mein Vater tröstete meine Mutter, die sich nun eingesperrt und unter rigider Aufsicht fühlte, mit dem Versprechen, er werde, sobald sie achtzehn Jahre alt sei, abends mit ihr ausgehen und dann auch versuchen, eine eigene Wohnung zu beziehen. Er selbst ging jeden Abend allein aus und kam in der Nacht nach Hause, wenn meine Mutter längst schlief. Er war in der Offiziersausbildung, ein hochgewachsener, gutaussehender Mann, der von den Frauen begehrt wurde. Wer weiß, wo er sich damals herumgetrieben hat?
Eines Abends kam er dann wirklich in ihr Zimmer und brachte ihr ein herrliches Kleid. Sie möge das anziehen und sich schminken. «Ich sah wunderschön aus, wie eine Prinzessin», erzählte meine Mutter. «Er sagte mir, ich soll mir einen Schleier umlegen. Dann nahm er mich an der Hand, und wir verließen auf Zehenspitzen unbemerkt von den Großeltern das Haus. Draußen vor der Tür stand eine Droschke, und als wir einstiegen, zog er meinen Schleier weg, gab mir einen Kuss und sagte: ‹Von nun an bist du eine erwachsene Frau.› Wir fuhren zu einem Tanzlokal. So etwas hatte ich noch nie erlebt, und er gab mir Wein zu trinken. Es war eine der schönsten Abende und Nächte meines Lebens.»
Als ich als fünftes und letztes Kind der Familie geboren wurde, hatten meine Eltern längst ein eigenes Haus, und mein Vater befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wenige Tage nach meiner Geburt bekam meine Mutter Malaria, ich musste daher von einer Amme gestillt werden. Wenn meine Geschwister mich ärgern wollten, erzählten sie mir, mein Vater habe mich auf einer seiner Reisen als Baby in einem Kuhstall im Norden gefunden und mit der Amme gemeinsam nach Teheran gebracht. Sie merkten nicht, wie ernst ich das nahm und wie oft ich mich im Stillen fragte, ob sie nicht recht hätten und ich wohl nicht der Sohn der Familie sei.
Das Haus, in dem wir anfangs wohnten, war zweistöckig und hatte einen kleinen Garten, in dessen Mitte sich ein Wasserbecken befand. Ich habe schöne Erinnerungen an diese Zeit. Eigentlich war das Gebäude für unsere siebenköpfige Familie mitsamt den Dienstboten zu klein. Die Eltern und zwei der älteren Kinder hatten ihre Zimmer im ersten Stock, und wir jüngeren Geschwister waren im Erdgeschoss untergebracht. Am Ende des Gartens gab es zwei weitere Zimmer für die Dienstboten. Das Haus hatte zwei Eingänge, sodass man sowohl durch den Garten als auch von der gegenüberliegenden Seite hereinkonnte. Wir kannten sämtliche Nachbarn und spielten den ganzen Tag mit deren Kindern. Alle Häuser standen offen, sodass man überall hineingehen konnte. Was die Erwachsenen, auch unsere Eltern, dachten und taten, scherte uns nicht.
Wir Kinder wuchsen im Grunde unter der Obhut der Dienstboten auf und erzogen uns gegenseitig. Die Eltern kümmerten sich wenig um uns. Mein Vater war ohnehin selten zu Hause, und meine Mutter ging ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nach. Wir hatten fast täglich mehrere Gäste, die zumeist unangemeldet zu uns kamen. Sie brachten auch ihre Kinder mit. Mit unserem Umzug in das neue Haus erweiterte sich der Kreis unserer Familie erheblich. Denn auch meine Großeltern mütterlicherseits, vier Onkel und eine Tante wurden zu unseren unmittelbaren Nachbarn. Fast jeden Abend versammelte sich die gesamte Verwandtschaft mit Kind und Kegel und mitsamt Gästen im Hause meiner Großeltern. Mein Großvater war ein sehr aufgeschlossener, modern eingestellter und geselliger Mensch. Berühmte zeitgenössische Dichter, Schriftsteller und Musiker genossen gern seine Gastfreundschaft. So trugen einmal in der Woche die Poeten und Autoren ihre Werke vor, begleitet von Gitarre, Sentur und Geige. Es wurde getrunken, zumeist der vorzügliche persische Wodka, und anregend diskutiert.
Für uns Kinder und Jugendliche waren diese Abende höchst vergnüglich. Die Erwachsenen waren mit sich selbst beschäftigt und achteten nicht auf uns. Wir kletterten über die Mauern und auf die Bäume und konnten uns austoben, wie wir wollten. Wie wertvoll diese Familiengemeinschaft war, merkten wir besonders, als mein Vater, vom Tode bedroht, vier Jahre im Gefängnis verbrachte. Meine Mutter hätte diese Zeit ohne die Familie niemals schadlos überstanden. Es war so, als ob das Leid, aber auch die Freude und das Glück eines jeden von der Gemeinschaft mitgetragen wurden.
Dass diese Großfamilie so eng zusammenhielt, war nicht zuletzt der Persönlichkeit meines Großvaters zu verdanken. Er besaß eine Großhandelsfirma und handelte mit Glas, das damals aus Russland und Osteuropa importiert wurde. Seine Kunden waren Zwischenhändler, die das Glas – für Fenster, Schaufenster und ähnliche Zwecke – an einzelne Geschäfte verkauften. Reich war er nicht, aber wohlhabend genug, um mit seiner Familie ein gutbürgerliches Leben zu führen. Er hatte drei seiner Söhne zum Studium nach Deutschland geschickt und war selbst zweimal mit meiner Großmutter zu Besuchen nach Berlin gereist. Es ist für mich ein Rätsel, wie die beiden, ohne Kenntnis einer Fremdsprache, diese Reisen hatten wagen können. Verkehrsflugzeuge gab es damals nicht. Sie mussten zunächst mit der Eisenbahn oder dem Bus ans Kaspische Meer fahren, dann mit dem Schiff von Bandar Palawi nach Baku in Aserbaidschan und von dort aus mit dem Zug über Georgien, die Ukraine und Polen nach Deutschland. Sie waren wochenlang unterwegs.
Nach dem Abzug der Besatzer begann eine neue Ära in der iranischen Geschichte. Die Zentralmacht unter dem jungen Schah, der nur eine Marionette in der Hand der Briten war, erwies sich als viel zu schwach, um die Diktatur Reza Schahs fortzusetzen. Das Volk atmete endlich auf, politische Strömungen sammelten sich in Parteien und Organisationen, die Presse erlebte eine neue Blüte, Künstler und Schriftsteller konnten ohne Zensur ihre Werke veröffentlichen. Das Parlament behauptete wieder seine Position als Volksvertretung. Während der Hof als Handlanger der Briten agierte, wurden Unabhängigkeit und Freiheit zum Hauptanliegen der neu formierten Kräfte. Und hier ragte eine wichtige Figur, die Geschichte machen sollte, hervor: Mohammad Mossadegh.
Mossadegh war ohne Zweifel über mehr als ein Jahrzehnt der schillerndste Politiker und die herausragendste Persönlichkeit in der neuen Geschichte Irans. Er stammte aus einer der Großfamilien in der Kadscharen-Dynastie, die von Reza Schah abgelöst worden war. Nach seiner Schulausbildung durch Hauslehrer begab er sich 1909 zum Studium der Finanzwissenschaft nach Paris. Anschließend ging er in die Schweiz und promovierte als erster Iraner an der Universität von Lausanne im Fachgebiet Rechtswissenschaft. Nach der Rückkehr in die Heimat übernahm er verschiedene Staatsämter und arbeitete unter anderem als Gouverneur der Provinz Fars und als Finanzminister im selben Kabinett, in dem Reza Khan als Kriegsminister tätig war. Als Reza Khan Premierminister wurde, verließ Mossadegh die Regierung und wurde zum Abgeordneten ins Parlament gewählt. Hier gehörte er zu den wenigen, die gegen die Ernennung Reza Khans zum Schah stimmten. Danach zog er sich bis zu dessen Abdankung ins Privatleben zurück.
Sein Hauptanliegen nach dem Abzug der Alliierten war die Nationalisierung der Ölindustrie, die sich vollständig in der Hand der Briten befand. Gleichzeitig war er ein Demokrat, der den Kampf für die Rechte der Individuen als oberstes Ziel seiner Politik betrachtete. Er war ein außerordentlich belesener Intellektueller, ein ausgezeichneter Rhetoriker und Taktiker. Es war höchst vergnüglich, seinen Reden, vor allem in den Debatten des Parlaments, zuzuhören. Einem Schauspieler gleich, konnte er je nach Bedarf tränenreich weinen, schallend lachen oder sogar in Ohnmacht fallen. Sein längliches Gesicht, seine traurigen, klugen Augen, seine herausragend große, gebogene Nase, die Karikaturisten und seine Gegner zum Vergleich mit einem Geierschnabel veranlassten, sein Gang mit gebeugtem Rücken, gestützt auf einen Stock, verliehen ihm eine auffallende und einprägsame Erscheinung. Mossadegh war in seinem Gehabe, seinen Umgangsformen auf diplomatischem Parkett ein Aristokrat, aber politisch einer der schärfsten Gegner der korrupten Feudalherren und Kollaborateure am Hof des Königs. Es bleibt ein Rätsel, wie er trotz seiner aristokratischen Herkunft und der hohen Ämter, die er bekleidet hatte, zu einem Politiker werden konnte, der sich mit aller Kraft in den Dienst des Volkes stellte. Sein Patriotismus war unbeugsam, kein noch so verführerisches Angebot konnte ihn von seinem Widerstand gegen die Fremdherrschaft ablenken, und diesen Widerstand leistete er nicht nur im politischen und ökonomischen, sondern mehr noch im kulturellen Bereich. Jede koloniale Arroganz, die er bei Begegnungen mit ausländischen Diplomaten spürte, konnte ihn rasend machen. Das ist auch der Grund dafür, dass er noch heute, nach sechzig Jahren, in ganz Iran als Held verehrt wird und dass sein Sturz durch einen CIA-Putsch für das iranische Volk zu einem Trauma wurde, welches bis in die Gegenwart nachwirkt.
Mossadegh wohnte in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, sein Haus stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich sah als Kind und Jugendlicher gelegentlich von unserem Balkon aus, wie er aus seinem türkisfarbenen Pontiac stieg und, gestützt auf seinem Stock, den Kopf nach vorn gebeugt, ins Haus ging. Persönlich habe ich ihn nur ein einziges Mal erlebt. Er hatte an einem Treffen im Hause eines meiner Onkel teilgenommen. Dieser, der vor dem Krieg das iranische Konsulat in Berlin geleitet hatte, war mit Mossadegh gut bekannt und zugleich mit dessen engstem Berater, Said Ali Schajegan, eng befreundet. Mossadegh, Schajegan und mein Onkel, Reza Kaviani, organisierten 1949 gemeinsam mit siebzehn anderen Gleichgesinnten eine Protestdemonstration gegen die manipulierten Parlamentswahlen. Von mehreren tausend Menschen begleitet, marschierten sie zum Marmorpalast, dem Sitz des Königs. Angeführt von Mossadegh, wurden die zwanzig vom Hofminister empfangen, und als sie sich nicht einigen konnten, ließ sich die Gruppe dort zu einem Hungerstreik nieder, der fünf Tage lang dauerte.
Als Mossadegh 1951 Premierminister wurde, gehörte mein Onkel als stellvertretender Kulturminister seinem Kabinett an. Als das Treffen im Hause meines Onkels stattfand, stieg ich auf die Mauer und konnte von dort aus durch die Fensterscheiben sehen, wie Mossadegh beim Reden gestikulierte. Damals war ich zwölf oder dreizehn Jahre alt. Dennoch machte Mossadegh auf mich einen unvergesslichen Eindruck.
Auch meine erste politische Aktivität hatte mit Mossadegh zu tun. Als er und auch Schajegan für einen Sitz im Parlament kandidierten, verteilte ich gemeinsam mit einigen Gleichaltrigen Werbezettel für die beiden. Was auf diesen Zetteln stand, weiß ich nicht mehr, das Einzige, was in meiner Erinnerung haftengeblieben ist, ist der Satz: «Schajegan kennt den ganzen Koran auswendig.»
Natürlich war ich in meinem Alter weit davon entfernt, die Tragweite und Bedeutung der von Mossadegh geführten Bewegung zu begreifen. Ich war mehr emotional engagiert, nicht zuletzt aufgrund der Erklärungen, mit denen unser Grundschullehrer versuchte, uns die Vorgänge im Land verständlich zu machen. Was er sagte, war so plausibel, dass keiner der Schüler davon unberührt bleiben konnte. Die Mehrheit unseres Volkes lebe in Armut, obwohl unser Land sehr fruchtbar und reich an Bodenschätzen sei, sagte der Lehrer. Unser Reichtum aber wandere ins Ausland. Die Briten raubten unser Öl und überließen uns nur einen kleinen Bruchteil der Gewinne. Sie behandelten iranische Arbeiter wie Sklaven. Sämtliche Fachleute in der Ölindustrie seien Briten, Iraner ließen sie nicht hochkommen, damit das Land nie die Fähigkeit erlange, das Öl in eigener Regie zu fördern. Sie lebten in Saus und Braus, während Iraner, die in der Ölgesellschaft arbeiten, ein kärgliches Dasein fristen müssten. Das sei nur möglich, weil jene, die in unserem Land herrschen, mit den Briten unter einer Decke steckten, anstatt sich um das eigene Volk zu kümmern. Dieser Zustand müsse aufhören, sagte der Lehrer. Eine Regierung sei nötig, die der Fremdherrschaft ein Ende setze. Das sei jedoch nur möglich, wenn jeder um dieses Ziel kämpfe.
Ich überlegte gemeinsam mit einem Freund, was wir in dieser Lage tun könnten. Die Idee war schnell geboren. In der Nähe unserer Schule gab es eine Straße, in der einige Briten wohnten. Wir kannten die schicken Autos, die vor ihren Häusern parkten. Also besorgten wir uns Nägel, steckten sie heimlich in die Reifen, versteckten uns hinter einer Mauer. Sobald eines der Autos losfuhr, platzten sämtliche Reifen, und wir hatten unseren Spaß, waren auch stolz, den Engländern ordentlich geschadet zu haben.
Die Aktion – heute würde man sie wohl als terroristisch einstufen – musste selbstverständlich höchst geheim bleiben. Dennoch erzählte ich meiner zwei Jahre älteren Schwester davon. Sie bekam Panik und verpetzte mich bei meinem Vater, was mir ordentlich Prügel eintrug und die Aktion beendete. Es war eine Dummheit gewesen, ihr davon zu erzählen. Sie war ängstlich und rannte bei der kleinsten Gefahr zu den Eltern, weswegen ich oft mit ihr Krach hatte. Zu meinen beiden ältesten Geschwistern hatte ich dagegen ein gutes Verhältnis. Der Altersunterschied von zwölf und neun Jahren schloss Konkurrenz und Neid aus, sie lebten in ihrer eigenen Welt. Etwas schwieriger gestaltete sich mein Verhältnis zu meinem nächstälteren Bruder. Er war – sechs Jahre lagen zwischen uns – ziemlich streng mit mir, und wenn er von meinen Eltern oder den Geschwistern schlecht behandelt wurde, ließ er seine Wut an mir aus. «Aus dir wird nie was», sagte er oft zu mir. Nicht selten ließ er auch die Hand ausrutschen. Später wurden wir dicke Freunde.
Mit dem Einzug Mossadeghs und der von ihm gegründeten nationalen Front ins Parlament wurde die Frage der Nationalisierung der Ölindustrie zum Thema Nummer eins. Dabei ging es nicht nur darum, dem regelrechten Raub des iranischen Öls durch die Briten ein Ende zu setzen. Die Nationalisierung wurde vielmehr zu einem existenziellen Anliegen der ganzen Nation, nicht nur ökonomisch, auch politisch und kulturell. Ein Volk schien entschlossen, sich vom Joch der Fremdherrschaft zu befreien. Diesem Ziel stand die britische Weltmacht entgegen, die mit allen militärischen, diplomatischen und juristischen Mitteln, natürlich auch durch Intrigen und Bestechungen, versuchte, die Bewegung aufzuhalten. Als das iranische Parlament, nicht zuletzt durch den unermüdlichen Einsatz Mossadeghs, im März 1951 dann tatsächlich das Gesetz zur Nationalisierung der Ölindustrie verabschiedete, organisierte die britische Regierung die größte Konzentration ihrer Marinestreitkräfte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor der Küste der Stadt Abadan am Persischen Golf. Darüber hinaus erwirkte London eine einstweilige Verfügung beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wonach die beiden Regierungen sich verpflichten sollten, keine Maßnahmen zu treffen, die die Tätigkeit der Anglo-Iranian Oil Company beeinträchtigen könnten. Iran lehnte die Verfügung als Einmischung in innere Angelegenheiten ab. Im Mai 1951 wurde Mossadegh mit 99 gegen drei Stimmen zum Premierminister gewählt. Einige Monate später verließ ich Iran.
Weltenwechsel 1: Ankunft mit Hindernissen
Der erste Flug – Verzweiflung in Frankfurt – Die Polizei, dein Freund und Helfer – Eine Eckbank in Stuttgart – Die Einsamkeit des Fremden – Novemberstimmung – Flucht aus der Sprachlosigkeit
Die viermotorige Propellermaschine, die mich nach Europa brachte, war nahezu voll besetzt. Mit an Bord war ein mit uns entfernt verwandtes junges Ehepaar, das wir zufällig auf dem Flughafen in Teheran getroffen hatten. Meine Eltern waren erleichtert, dass ich die Reise nicht ganz allein würde antreten müssen und hatten das Ehepaar gebeten, mir, wenn nötig, behilflich zu sein. Auch ich war beruhigt und erlebte mit großer Neugierde und Bewunderung, wie die Maschine startete und langsam aufstieg. Schon bald eilten meine Gedanken dem Flug voraus. Ich hatte nur Gutes gehört: In Europa gäbe es keine Armut, keine Aggressionen. Die Menschen gingen höflich und freundlich miteinander um. In der Schweiz, hörte ich, seien die Justizbehörden seit Jahren ohne Arbeit, denn es gäbe keine Verbrechen, keine Diebstähle, keine Betrüger. Man könne sich nachts ohne Befürchtung, überfallen zu werden, in den Städten bewegen. Na, dann konnte mir ja nichts passieren. In Teheran hatte ich ohne Begleitung nicht einmal zur Schule gehen, geschweige denn allein in der Stadt etwas unternehmen dürfen.
Als wir Stunden später in Genf landeten, endete der Flug für die meisten Passagiere. Auch das Ehepaar verabschiedete sich von mir. Zum Weiterflug nach Frankfurt blieb außer mir nur noch ein einziger Passagier, ein Araber, an Bord. Es war Nacht, wir flogen durch die Wolken. Die Dunkelheit draußen und die Einsamkeit in der Maschine ließen in mir ein bisher ungekanntes Gefühl aufkommen, ich bekam Heimweh. Was für eine Dummheit habe ich begangen, sagte ich mir. Aber nun gab es kein Zurück.
Um sieben Uhr früh landeten wir in Frankfurt. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und war hungrig. Zwar war mir im Flugzeug etwas zu essen angeboten worden, aber als wohlerzogener Junge hatte ich selbstverständlich abgelehnt. Das hatten mir meine Eltern beigebracht. Wenn jemand etwas anbietet, lehrten sie mich, lehnt man zunächst dankend ab. Erst beim dritten Mal dürfe man es annehmen. Leider wurde mir das Essen im Flugzeug aber nur einmal angeboten.
Laut Flugplan sollte eine Stunde nach meiner Ankunft in Frankfurt die Maschine nach Stuttgart starten. Eine Stewardess führte mich zum Flughafenrestaurant. Ein Kellner bot mir Frühstück an, ich winkte ab und hoffte inständig, dass er mich ein zweites und drittes Mal fragen würde. Doch er kümmerte sich nicht weiter um mich. Schmachtend sah ich, wie die Leute an den Nachbartischen herzhaft in die mit Wurst und Käse belegten Brötchen bissen und dazu Kaffee oder Tee tranken. Aber ich konnte doch unmöglich den Kellner auffordern, mir das Frühstück noch zweimal anzubieten. Und selbst wenn ich es hätte tun wollen, es wäre mir unmöglich gewesen. Ich konnte kein Wort Deutsch.
Ich musste also weiter hungern und warten, bis man mich zum Anschlussflug abholte. Aber niemand kam. Ich wurde nervös, hatte Angst, die Maschine zu verpassen. Die Stunde, die das Warten dauern sollte, war längst verstrichen. Ich wollte meinen Platz nicht verlassen, sonst würde man mich ja nicht finden. Auch nach zwei Stunden geschah nichts. Der Kellner lächelte mich ab und zu im Vorbeigehen an, machte aber keine Anstalten, mir noch einmal Frühstück anzubieten.
Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und ging in die Halle zum Schalter der Scandinavian Airlines. Eine Angestellte schaute mich freundlich an. Ich sagte: «Stuttgart» und machte eine Handbewegung nach oben. Sie nickte und sagte ein paar Sätze. Ich verstand kein Wort. Aber in ihrem Gesichtsausdruck deutete nichts darauf hin, dass ich die Maschine verpasst hatte. Im Gegenteil, sie schien mich beruhigen zu wollen. So war ich erst einmal zufrieden, blieb aber in ihrer Sichtweite. Der Zeiger der großen Uhr drehte sich immer von neuem um das Ziffernblatt, es vergingen Stunden, ohne dass ich zum Weiterflug aufgefordert wurde. Hunger und Müdigkeit zehrten meine Kraft auf. Es war Ende November. Bald wurde es draußen dunkel. Zudem sah der Flughafen ziemlich ärmlich aus. Kein Vergleich mit Teheran. Alles schien mir so trüb, so traurig. Ich ging noch einmal zu der Angestellten: «Stuttgart», sagte ich und erhielt wieder eine freundliche Antwort. Etwa um sechs Uhr nachmittags verlor ich vollends Geduld und Kraft, setzte mich gegenüber dem SAS-Schalter auf den Boden und begann laut zu heulen. Die Angestellte eilte herbei, nahm mich in den Arm, brachte mich zum Schalter, gab mir ein Glas Wasser und schenkte mir ein großes Bild von einem Flugzeug.
Die Maschine, die ich schließlich um zehn Uhr abends bestieg, war zweimotorig, klein, innen schwach beleuchtet und voll besetzt. Es waren nahezu ausschließlich ältere Leute, zumeist weißhaarige Frauen. Nun war ich bald am Ziel, ich sollte von einer deutschen Familie, der Familie Kopp, abgeholt werden, die mit einem Onkel von mir befreundet war und mich aufnehmen wollte. Aber als wir in Stuttgart landeten, wartete niemand auf mich. Ich schaute mich um, es war um Mitternacht, der Flughafen leerte sich, die Schalter wurden geschlossen. Am Ende war ich ganz allein und wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich kam ein Polizist auf mich zu. Zum Glück hatte ich die Adresse der Familie dabei. Ich überreichte sie dem Polizisten. Er merkte, dass ich kein Deutsch verstand, und winkte mir, ihm zu folgen. Wir gingen in die Polizeiwache. Er telefonierte, brachte mich dann zu einem Polizeiwagen und fuhr mich zum Hauptbahnhof.
Zum ersten Mal in meinem Leben befand ich mich in einer Stadt des so begehrten und bewunderten Europas. Was für eine Enttäuschung! Der erste Eindruck auf der Fahrt im Polizeiauto zum Hauptbahnhof war so schockierend, so traurig, dass ich nur mit Mühe meine Tränen zurückhalten konnte. Es nieselte, dunkle Wolken hingen so tief, als lägen sie unmittelbar auf den zumeist zerbombten und zerstörten Häusern, die im schwachen Licht der Straßenlaternen nur schemenhaft erkennbar waren. Die Straßen waren leer, nur wenige Schaufenster waren beleuchtet. Ein richtiger deutscher Novemberabend in einer noch deutlich von den Folgen des Krieges gezeichneten Stadt.