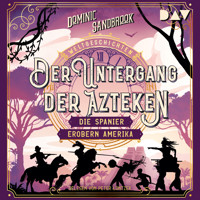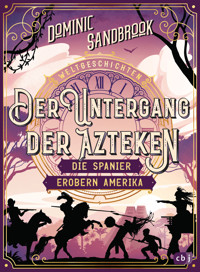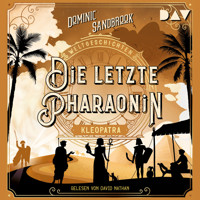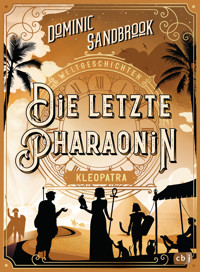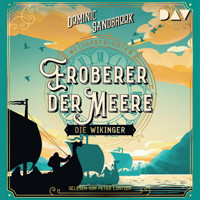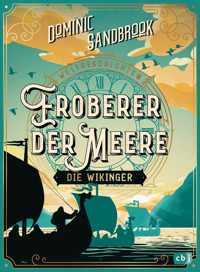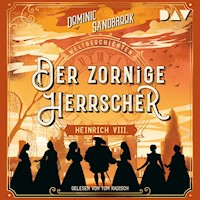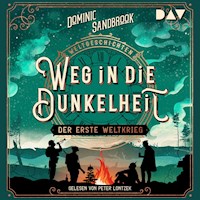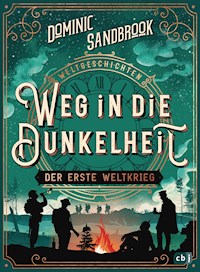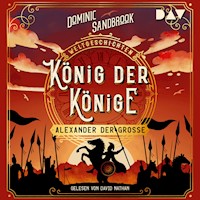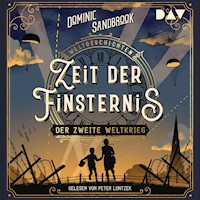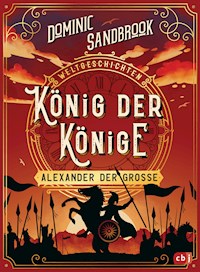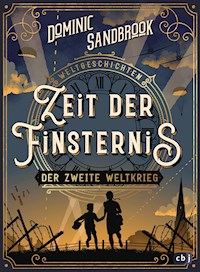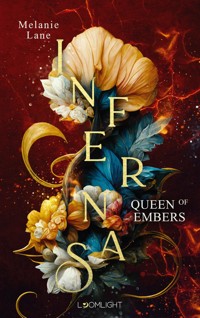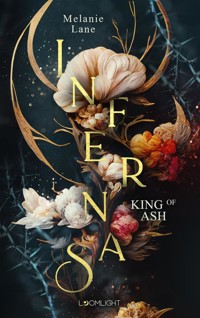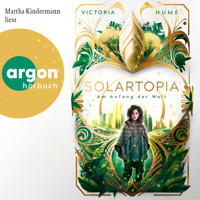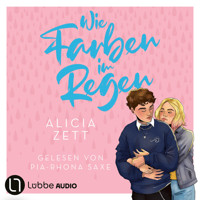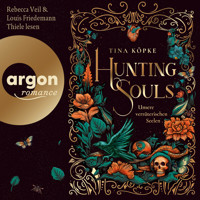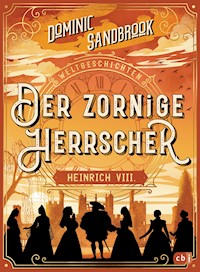
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Weltgeschichten-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Weltgeschichte hautnah: Heinrich VIII. und die Tudorzeit
An einem Frühlingstag vor über 500 Jahren besteigt der 17-jährige Heinrich Tudor den Thron und verändert als König von England die Geschichte Europas für immer.
Heinrich VIII. wandelt sich in einer Welt aus prunkvollen Festen, Intrigen und Kämpfen von einem beliebten, hübschen und hochgebildeten König zu einem grotesken, misstrauischen und tyrannischen Herrscher. Auf der Jagd nach einem Thronfolger heiratet er sechs Mal und beschert seinen Ehefrauen ein Schicksal voller dramatischer Wendungen. Er bricht mit der katholischen Kirche und gründet schließlich die Kirche Englands, die ein neues Zeitalter einläutet und unsere Geschichte bis heute beeinflusst.
Historiker Dominic Sandbrook katapultiert uns mitten hinein in die historischen Ereignisse, Schauplätze und Einzelschicksale. Das Ergebnis: Geschichtswissen in einer fundierten, mitreißenden und dramatischen Erzählung für Leser*innen ab 10 Jahren.
Alle Bände der Weltgeschichten-Reihe:
König der Könige: Alexander der Große (Band 1)
Zeit der Finsternis: Der Zweite Weltkrieg (Band 2)
Weg in die Dunkelheit: Der Erste Weltkrieg (Band 3)
Der zornige Herrscher: Heinrich VIII. (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Ähnliche
Dominic Sandbrook
Aus dem Englischen
von Knut Krüger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Für Tamsin und Juliana Jenkinson
Copyright Text © 2021, Dominic Sandbrook, All rights reserved
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Adventures in Time: The Six Wives of Henry VIII« bei Particular Books, einem Imprint von Penguin Press, London
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe bei cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Knut Krüger
Lektorat: Roman Stadler
Umschlaggestaltung und -illustration: Nele Schütz Design/Sonja Gebhardt
mk • Herstellung: AJ
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-27412-2V001
www.cbj-verlag.de
Inhalt
Prolog: Die Schlacht
TEIL 1
KATHARINAVONARAGON
1Das Mädchen aus Kastilien
2Das Königreich der Schatten
3Die einsame Katharina
4Felder aus Blut und Gold
5Die Flammen des Glaubens
6Die Lady aus dem Grünen Schloss
7Der Prozess
8Die Scheiterhaufen brennen
TEIL 2
ANNEBOLEYN
9Königin Anne
10Seht das Haupt des Verräters!
11Madam, Ihr müsst sterben
12Oh Tod, wieg mich in den Schlaf
TEIL 3
JANESEYMOUR
13Jane, die Gerechte
14Der Große Hauptmann
TEIL 4
ANNAVONKLEVE
15Die Prinzessin aus Kleve
TEIL 5
CATHERINEHOWARD
16Zum Tower!
17Das entlarvte Komplott
TEIL 6
CATHERINEPARR
18Die grausame See
19Der König ist tot
Epilog: Das Grabmal
Nachwort
Prolog
Die Schlacht
Über dem Herzen Englands dämmerte ein früher Morgen. Auf dem Hügelkamm brannten im grauen Zwielicht die Lagerfeuer.
Die Offiziere von König Richard rissen die Soldaten aus dem Schlaf und trieben sie an, ihre Rüstungen anzulegen. Die Morgenluft war erfüllt vom Scheppern der Harnische, dem Surren der Bogensehnen und dem Klirren der Hämmer.
Über dem Zelt des Königs wehten die englische Flagge sowie das Sankt-Georgs-Kreuz neben seiner persönlichen Fahne, die einen weißen Eber mit furchterregenden Hauern zeigte. Richard stand wie eingerahmt im Eingang seines Zelts, seine Hauptmänner sammelten sich um ihn, um letzte Anweisungen entgegenzunehmen. Ein Diener hielt seinen Helm mit der funkelnden goldenen Krone.
Richard III. war seit kaum zwei Jahren König. Er war ein skrupelloser Mann. Fast sein ganzes Leben lang hatte sich England im Krieg befunden, zerrissen vom erbitterten Kampf der Dynastien des Landes um die Krone.
Es hieß, Richard habe seine beiden Neffen ermorden lassen, um sich selbst die Krone zu sichern. Die beiden Jungen waren im Tower von London verschwunden und nie wieder gesehen worden.
Doch Richard war davon überzeugt, dass im Herzen eines Königs kein Platz für Mitleid war. Der Sieg würde demjenigen zufallen, der etwas riskierte, der als Erster handelte und sich nicht scheute, Blut zu vergießen.
Nach langen Jahren des Krieges waren fast all seine Rivalen tot. Nur einer von ihnen war noch am Leben, ein junger walisischer Abenteurer mit einem bunt zusammengewürfelten Söldnerheer.
In den letzten Tagen hatte Richard seinen Widersacher durch ganz England verfolgt. Und am Morgen des 22. August 1485 hatte er ihn nahe des Dorfes Bosworth in Leicestershire aufgespürt.
Richard warf einen ruhigen und kalten Blick hinunter auf die Rebellen.
In wenigen Stunden, versprach er seinen Hauptmännern, würden sie den entscheidenden Sieg erringen. Ihr Feind sei ein »walisischer Milchbart«, der eine Horde von »Verrätern, Dieben, Banditen und Geächteten« anführe.
Richard hob seine Stimme. »Heute werde ich entweder einen triumphalen Sieg feiern«, rief er, »oder durch meinen Tod ewigen Ruhm erlangen!«
Die königliche Armee brach in Jubel aus. Schwerter glitzerten in der Morgensonne. Jetzt stand sie bevor: die letzte Schlacht.
Auf der Ebene unter ihnen waren die Rebellen nun ebenfalls in Bewegung. Nur wenige von ihnen hatten viel geschlafen.
Unter dem Banner des roten Drachens stand ein feingliedriger junger Mann mit scharfem Blick und spähte zur königlichen Armee hinauf. In Wales geboren, hatte Heinrich Tudor den Großteil seines Lebens auf der Flucht verbracht.
Sein Vater war getötet worden, ehe er geboren wurde. Unter der Obhut seines Onkels hatte er sich jahrelang in Frankreich und der Bretagne versteckt gehalten.
Zwei Wochen zuvor war Heinrich mit einer Gruppe von Gefolgsleuten in Wales an Land gegangen und hatte darauf gehofft, weitere Anhänger zu finden, doch nur wenige Männer schlossen sich ihm an. Als sie Bosworth erreichten, war seine Truppenstärke auf nur fünftausend Mann angestiegen, kaum die Hälfte dessen, was König Richard aufbieten konnte.
Heinrich war stets ein zurückhaltender und vorsichtiger Mann gewesen. Doch als er jetzt seine Rüstung anlegte, wusste er, dass seine Zukunft am seidenen Faden hing.
In den letzten Tagen hatte er der mächtigsten Adelsfamilie Englands, den Stanleys, wiederholt Nachrichten gesandt und sie um Unterstützung angefleht. In der Ferne konnte er im trüben Morgenlicht ihre roten Waffenröcke ausmachen.
Bisher hatten die Stanleys jedoch keinerlei Anstalten gemacht, den Rebellen zu Hilfe zu eilen. Heinrich wusste nur zu gut, dass sie in Ruhe abwarteten, welche Kriegspartei sich als die stärkere erweisen würde.
Als sich seine Hauptmänner um ihn scharten, suchte er nach den richtigen Worten:
»Nicht die Überzahl von Männern führt zum Sieg«, rief er, »sondern der Mut der Herzen und die Kühnheit eurer Seelen! Lasst uns daher wie unbesiegbare Riesen in die Schlacht ziehen und, gleich einem Rudel anstürmender Löwen, alle Furcht vergessen. Jetzt gilt es – wahre Männer gegen Verräter, rechtmäßige Erben gegen Thronräuber, die Geißel Gottes gegen den Tyrannen!«
Ein Jubelschrei lief durch die Reihen der Rebellen. Doch als Heinrich sein Visier herunterklappte, spürte er, wie Furcht von ihm Besitz ergriff.
Sein ganzes Leben lang war er ein Spielball des Schicksals gewesen. Doch jetzt, da es um alles ging, schien ihn sein Glück zu verlassen.
Kanonendonner dröhnte über das Schlachtfeld von Bosworth. Die Fußsoldaten von König Richard strömten den Hügel hinab. Gellende Schlachtrufe durchschnitten die Luft.
Auf halber Höhe trafen die vorderen Reihen mit klirrenden Schwertern aufeinander. Männer sanken zu Boden, schrien, starben.
Die Soldaten von Heinrich Tudor kämpften tapfer, waren aber hoffnungslos in der Unterzahl. Noch hielten sie dem Feind stand, aber wie lange noch?
Mit wachsender Verzweiflung blickte Heinrich zur anderen Seite des Schlachtfelds hinüber, wo die in Rot gehüllten Soldaten der Stanleys immer noch abwarteten.
Dann nahm er auf der Kuppe des Abhangs eine Bewegung wahr, silberne Lichtreflexe in der Morgensonne. Richards Ritter gingen zum Angriff über, ihre roten Fahnen flatterten im Wind, die Luft war von ihren siegesgewissen Kampfgesängen erfüllt.
Starr vor Schreck beobachtete Heinrich, wie sie elegant dem engsten Getümmel auf dem Schlachtfeld auswichen und auf ihn zuhielten. Jetzt kamen sie ihm im gestreckten Galopp entgegen.
Mit einem ekelerregenden Krachen sprengten die Reiter mitten in Heinrichs kleine Schar hinein. Allen voran eine Gestalt in schimmernder Rüstung, ein goldenes Glitzern um den Helm, mit blutverschmierter Streitaxt, die wie mechanisch auf- und niederfuhr.
Es war Richard. Unaufhaltsam. Unbesiegbar. Seine Augen strahlten in wilder Freude über das Gemetzel.
In Heinrichs Kopf drehte sich alles, sein Pferd scheute und bäumte sich auf. Das Banner mit dem roten Drachen lag auf dem Boden, zertrampelt unter den Hufen der Pferde. Richard war kaum noch eine Speerlänge von ihm entfernt.
Und plötzlich, in der Ferne, wie aus einer anderen Welt, drangen wütende und überraschte Rufe zu ihm herüber. Heinrich drehte den Kopf und sah ein Heer von feuerroten Männern heranstürmen, die Richards Ritter wie eine Flutwelle unter sich begruben und in den Tod rissen.
Heinrich wurde von einer unaussprechlichen Freude und Erleichterung ergriffen. Er wusste, dass er gerettet war. Die Stanleys waren ihm im letzten Moment zu Hilfe geeilt.
Auch Richard starrte die heranstürmenden Männer sprachlos an. In einem wütenden Versuch, sich gegen das Schicksal zu stemmen, hieb er mit seiner Streitaxt in alle Richtungen und schrie mit heiserer Stimme: »Verrat! Verrat!«
Doch es waren bereits zu viele Widersacher, die ihn zurückdrängten und umzingelten. Sein Pferd geriet ins Straucheln. Die Angriffe kamen von allen Seiten.
Im nächsten Moment stürzte der letzte Plantagenet zu Boden und versuchte panisch, auf die Beine zu kommen. Sein Helm hatte sich gelöst. Schwerter und Hellebarden hieben – wie aus dem Himmel kommend – auf ihn ein.
In Richards Kopf dröhnte ein mächtiger Donnerschlag, dann wurde alles dunkel.1
Wenige Minuten später sank auch Heinrich auf die Knie, sein Gesicht schweißnass und dreckverschmiert, seine Augen im Gebet geschlossen. Der Lärm der Schlacht nahm allmählich ab. Es war vorbei.
Er hob den Kopf und blickte auf. Lord Stanley kam ihm entgegen und hielt etwas in der Hand.
Einer seiner Männer habe sie unter einem Weißdornbusch gefunden, sagte er. Sie müsse dem Tyrannen vom Kopf gerutscht sein, als sich dessen Helm gelöst habe.
Im Schein der Mittagssonne sah die mattgolden glänzende Krone dünn und zerbrechlich aus. Ihretwegen war all dies geschehen.
Ehrerbietig und behutsam setzte er dem neuen König die Krone auf den Kopf. Und als Heinrich VII., der erste englische König aus dem Hause Tudor, sich erhob, schallten Jubelschreie über die weite Ebene.
In den letzten Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts kannten jede Frau und jeder Mann im Land die Vorstellung vom Rad des Schicksals. In einem Moment war man obenauf, genoss Wohlstand, Ruhm und Glück. Doch ehe man sich’s versah, drehte sich das Schicksalsrad weiter, und man stürzte kopfüber in Elend und Verzweiflung.
»So dreht sich das Rad des Schicksals verräterisch weiter«, schrieb der Dichter Geoffrey Chaucer in seinem Buch Die Canterbury-Erzählungen, »und bringt einen Mann vom Glück ins Verderben.«
Doch nur selten drehte sich das Rad des Schicksals so rasant weiter wie in Bosworth. Wenige Stunden auf einem Schlachtfeld in Leicestershire sollten genügen, um der englischen Geschichte eine dramatische Wendung zu geben.
Mit Heinrichs Sieg waren die langen Jahre des Bürgerkriegs – der sogenannten Rosenkriege – vorbei. Ein neues Zeitalter, die Zeit der Tudors, begann.
Doch auch wenn die Krone nun auf dem Haupt von Heinrich VII. glänzte, drehte sich das Rad des Schicksals unaufhörlich weiter. Und dieses Buch handelt davon, was als Nächstes geschah.
Es ist die Geschichte von Heinrichs Sohn: dem zweiten Tudor-König, Heinrich VIII., und den sechs Frauen, die ihn geheiratet haben.
Dieser jüngere Heinrich war eine der faszinierendsten Persönlichkeiten in der englischen Geschichte. Groß gewachsen, gut aussehend, einnehmend und intelligent, ein begabter Musiker und ausgezeichneter Sportler, aber auch habgierig, aufbrausend, misstrauisch und brutal.
Zu Beginn seiner Regentschaft entsprach er dem Idealbild galanter Ritterlichkeit und endete als aufgedunsenes, übel riechendes Monstrum, das im ganzen Land gefürchtet und gehasst wurde.
Doch mit seiner Entschlossenheit, seinem siegreichen Vater gerecht zu werden und die Tudor-Dynastie zu bewahren, prägte Heinrich VIII. das englische Königreich auf eine Weise, die noch heute zu spüren ist.
Er scharte eine Reihe illustrer Gestalten um sich, wie beispielsweise Kardinal Wolsey, den machtbesessenen, ehrgeizigen und außerordentlich intelligenten Sohn eines Schlachters, der zum Machtstrategen in roter Robe wurde.
Oder Thomas More, den aschfahlen Fanatiker, der seine Widersacher auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ – aber trotzdem in ganz Europa verehrt wurde, weil er lieber den Tod in Kauf nahm, als seine Prinzipien zu verraten.
Und dann war da noch Thomas Cromwell, der Großmeister der Lüge und Intrige, der entschlossen war, England für immer zu verändern, indem er es aus den Fängen der römisch-katholischen Kirche befreite.
Einer wie der andere dieser Männer brachte es zu einem unvorstellbaren Maß an Reichtum und Macht. Doch das Rad des Schicksals drehte sich auch für sie weiter und das Schwert der Nemesis fuhr auf sie herab.
Was folgt, wird jedoch vor allem die Geschichte der sechs Ehefrauen von Heinrich VIII. sein:
Katharina von Aragon – die spanische Königstocher, die in der Fremde betrogen und verstoßen wurde, doch den Mut aufbrachte, bis zum Ende weiterzukämpfen.
Anne Boleyn – die geistreiche, exzentrische, kluge und skrupellose Tochter eines Diplomaten, die das Herz des Königs gewann, doch am Ende einer blutrünstigen Intrige zum Opfer fiel.
Jane Seymour – die sanftmütige, bescheidene, freundliche und gehorsame junge Frau, die Heinrich den ersehnten Sohn schenkte, deren Geschichte jedoch in einer furchtbaren Tragödie endete.
Anna von Kleve – das wohlbehütet in einer deutschen Burg aufgewachsene junge Mädchen, das gedemütigt und verstoßen wurde und dem es dennoch gelang, sich am Hof des Tudors zu behaupten.
Catherine Howard – das hübsche, übermütige Mädchen, das Musik und Tanz, Jungs und Partys liebte und schließlich der eigenen Naivität zum Opfer fiel.
Catherine Parr – die umsichtige, kühne und scharfsinnige Witwe eines Adeligen, die eine Intrige gegen sich aufdeckte und ihren Mann, den König, überlebte.
Dies waren die Frauen von Heinrich VIII., deren Lebensgeschichten England für immer verändert haben.
Auf ihre Weise waren sie alle außergewöhnliche Persönlichkeiten. Alle sechs haben bis heute ihre Bewunderer, die nach wie vor über ihre Verdienste diskutieren.
Aber genug der Vorrede. Lassen wir die Geschichte beginnen.
Der Schauplatz ist ein anderer, das Sonnenlicht verblasst. Vier Monate sind vergangen und das Schlachtfeld von Bosworth gehört der Vergangenheit an.
Der Winter ist angebrochen und in einem fernen Land erwartet eine kampferprobte Königin ein Kind.
So beginnt die Geschichte von Katharina von Aragon, dem Mädchen aus Kastilien.
1Nach mehreren Hundert Jahren wurde Richards Skelett im Jahr 2012 unter einem Parkplatz in Leicester gefunden. Womöglich nicht das Schicksal, das er sich erträumt hatte.
TEIL 1 – KATHARINA VON ARAGON
1
Das Mädchen aus Kastilien
Auf einer kargen Ebene des Königreichs Kastilien, im Herzen des heutigen Spanien, befindet sich die Stadt Alcalá de Henares.
Es ist eine Stadt mit schmalen, gepflasterten Gassen und schattigen grünen Plätzen, mit prächtigen Palästen und hoch aufragenden Kirchtürmen. Im Sommer, wenn die glühende Sonne die hellen Fassaden aufheizt, sind die Plätze der Stadt voller Menschen, die im Schatten der Cafés lachen und plaudern.
Doch diese Geschichte beginnt im Winter, vier Monate nach der Schlacht von Bosworth.
Es war ein grauer und kühler Tag. Eine bleiche Sonne kämpfte sich mühsam durch die Wolkendecke. Wochenlang war der Regen auf die Stadt geprasselt und hatte die Wege in Schlamm verwandelt. Von der weiten Ebene herein peitschte der Wind gegen die Stadt, und die Bewohner hasteten durch die gewundenen Gassen – sie froren viel zu sehr, um lange irgendwo zu verweilen.
Doch im prächtigsten Gebäude der Stadt, dem Palast des Erzbischofs, herrschte große Aufregung. Königin Isabella erwartete ein Kind. Und am 16. Dezember 1485 hörten die Angehörigen des Hofes, die vor den königlichen Gemächern warteten, das helle und durchdringende Schreien eines Neugeborenen.
Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Gott hatte Isabella ein kleines Mädchen geschenkt. Es war nicht leicht gewesen, doch dank der Gnade des Herrn waren Mutter und Kind wohlauf.
In den Straßen von Alcalá wurde ausgelassen gefeiert. Neun Tage vor Weihnachten strebte die festliche Stimmung ohnehin ihrem Höhepunkt entgegen – und jetzt hatte die Adelsgesellschaft von Kastilien erst recht einen Grund, zu singen und zu tanzen.
Das neugeborene Mädchen war kerngesund, hatte eine perfekte weiße Haut und ein paar zarte blonde Haare mit rötlichem Schimmer. Ihre Mutter nannte sie Catalina, nach ihrer eigenen Großmutter. Doch die Geschichte sollte sie als Katharina von Aragon in Erinnerung behalten.
Von ihrer Geburt an erwartete sie ein außerordentliches Schicksal, denn sie war kein gewöhnliches Mädchen. Sie war die Tochter von Ferdinand, dem König von Aragon, und Isabella, der Königin von Kastilien, dem berühmtesten Herrscherpaar in Europa.
Katharinas Eltern hatten schon in jugendlichem Alter geheiratet und lange davon geträumt, ihre beiden Königreiche zu einem mächtigen spanischen Reich zu vereinen. Jahr um Jahr hatten sie die Sommer auf dem Rücken ihrer Pferde verbracht und ihre Armeen über die weiten Ebenen des Südens geführt – ihre glitzernden Schwerter in die gleißende Sonne gereckt.
Ferdinand galt als listig und schlau, doch vor allem Isabella war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. In einer Zeit, in der nur wenigen Frauen Macht zugestanden wurde, war sie entschlossen, Kastilien zu regieren und ihre Truppen gegen die Mauren, ihren Erzfeind im Süden, ins Feld zu führen.
Da sich ihre Mutter wegen der vielen Feldzüge nie lange am selben Ort aufhielt, war auch die kleine Katharina an dieses unstete Leben gewöhnt. Alle paar Tage zogen sie in ein anderes Schloss um. Ständig gab es neue Klöster zu besuchen und neue Schlachten zu schlagen. In ihren ersten sechzehn Jahren feierten Katharina und ihre Mutter in dreizehn verschiedenen Städten das Weihnachtsfest.
Überall lauerten Gefahren. Einmal brach im Feldlager ihrer Mutter ein Feuer aus, ein anderes Mal entgingen sie nur um Haaresbreite der maurischen Gefangenschaft.
Doch trotz ihres blauen Bluts und ihrer abenteuerlichen Kindheit war Katharina ein ganz normales Mädchen. Als kleines Kind hatte sie eine Art Wägelchen, das sie vor sich herschob, um sich beim Gehenüben daran festzuhalten. Sie naschte gerne Geleefrüchte, und besonders liebte sie ein gezuckertes Getränk, das als »Rosenhonig« bekannt war.
Als Prinzessin mangelte es ihr nie an Geschenken. Im Alter von fünf Jahren bekam sie alles, um ihre eigenen Puppenkleider anfertigen zu können. Mit sechs Jahren erhielt sie ihre ersten Schmuckstücke, ein goldenes Stirnband und mehrere Armreife. Und im Alter von neun Jahren bekam sie ihr erstes Schachbrett und ihre ersten Chopines, Schuhe mit hohen Absätzen, damit ihre Füße nicht mit dem allgegenwärtigen Schmutz in Berührung kamen.
Mädchen gingen damals noch nicht zur Schule. Doch Königin Isabella stellte Hauslehrer aus Italien ein, die die königliche Familie auf ihren Reisen begleiteten. Unter ihrer Anleitung lernte Katharina lesen und schreiben, nicht nur Spanisch, sondern auch Latein – die alte Sprache der Römer, die in Herrschaftshäusern und gebildeten Kreisen immer noch vorherrschend war.
Außerdem erhielt sie Gesangs- und Zeichenunterricht, lernte Hemden zu nähen und auf Pferden zu reiten. Sie befasste sich mit Wappenkunde, um zu lernen, was die Symbole und Abzeichen der Adelsfamilien bedeuteten. Ferner wurde sie in Gesetzeskunde unterwiesen, weil sie als Prinzessin wissen musste, welche Gesetze und Regeln in den jeweiligen Ländern galten.
Jeden Tag las Katharina in der Bibel. Ihre Mutter war tiefgläubig und wollte ihre Tochter mit der Lehre Jesu vertraut machen, dem Leben der Heiligen und der Geschichte der frühen Christen.
Doch gab es auch Zeit, um sich abzulenken und Spaß zu haben. Mit ihrer älteren Schwester Maria spielte Katharina gern Schach und Karten, Brett- und Wortspiele. Ihre Tanzstunden wurden von Lehrern aus dem benachbarten Portugal geleitet.
Mehr als alles andere liebten sie aber die Abenteuergeschichten von edlen Rittern und vornehmen Prinzessinnen. Andächtig lauschten sie den Erzählungen über den berühmtesten aller kastilischen Ritter, El Cid, der sowohl für die Mauren als auch für die Christen gekämpft hatte und später zum spanischen Nationalhelden werden sollte.
Von allen Büchern in der Bibliothek ihrer Mutter nahm eines jedoch einen herausragenden Platz ein: die Legende von Artus, dem Jungen, der ein Schwert aus einem Stein herausgezogen hatte und so König von Britannien geworden war.
Für Kinder wie Katharina war dies die faszinierendste Geschichte von allen. Überall in Europa sangen Balladensänger von den Rittern der Tafelrunde, vom geheimnisvollen Druiden Merlin, dem verräterischen Mordred, dem schönen Lancelot und der tragischen Guinevere – Gestalten, die noch heute Menschen in ihren Bann ziehen.
In der Geschichte von Artus und seinem dem Untergang geweihten Hof gab es vieles, das junge Leute in seinen Bann ziehen konnte: Geburt und Tod, Blut und Schönheit, Mut und Grausamkeit, Treue und Verrat. Und die Liebe zog sich durch alles wie ein roter Faden – eine Leidenschaft, die zu Liedern und Schlachten inspirierte, zu grenzenloser Hingabe und unsterblichem Hass.
Katharina wäre ein seltsames Mädchen gewesen, hätte sie sich nicht selbst als eine der jungen Damen am Hof von Artus gesehen, die sich vor Liebeskummer verzehrten. Doch nicht in ihren wildesten Träumen hätte sie sich vorstellen können, was für eine Liebesgeschichte sie selbst erwartete.
Neun Tage vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1498 wurde Katharina dreizehn Jahre alt. Bald würde sie kein Kind mehr sein.
Wenn sie in den Spiegel blickte, sah sie ein ovales Gesicht von vornehmer Blässe. Ihre Augen waren klar und blau, ihre vollen, langen Haare glänzten rötlich golden in der spanischen Sonne.
Sie war klein gewachsen und untersetzt und ist nie als große Schönheit beschrieben worden. Es umgab sie jedoch eine Art angenehme Ruhe, sie strahlte Anmut und eine gewisse Ernsthaftigkeit aus.
Ihre Wanderungen neigten sich jetzt dem Ende zu. Wenige Monate später – die Hitze des Sommers kündigte sich bereits an – sattelte Katharina ihr Pferd und machte sich auf Richtung Süden, über die weiten Ebenen Kastiliens, den fernen Bergen entgegen.
Ihr Ziel war der prächtigste aller spanischen Paläste: das funkelnde Juwel der Alhambra in der Stadt Granada.
An die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada geschmiegt, war Granada ein Schmelztiegel von Moscheen, Kirchen und Synagogen, wo Muslime, Christen und Juden Seite an Seite ihren jeweiligen Glauben praktizierten.
Seit Jahrhunderten war Granada die Hauptstadt der maurischen Emire gewesen, das letzte muslimische Staatswesen im heißen Süden der Iberischen Halbinsel. Doch die christlichen Könige hatten sich immer weiter in Richtung Berge vorgekämpft und ihre Feinde zurückgedrängt.
Das Ende des Emirats Granada kam zu Beginn des Jahres 1492, als Katharina sechs Jahre alt war. Nach einer zermürbenden Belagerung übergab der letzte Emir von Granada die Schlüssel an Ferdinand und Isabella und ritt niedergeschlagen aus der Stadt.
Der Legende zufolge blickte der Emir von einem Hügelkamm aus auf seine geliebte Stadt zurück und vergoss bittere Tränen. »Du weinst wie eine Frau«, sagte seine betagte Mutter verächtlich. »Hättest du lieber wie ein Mann gekämpft.«
Am zweiten Tag des Monats Juli im Jahr 1499, in der trockenen Hitze des Hochsommers, ritt Katharina in die Stadt ein. Von den Minaretten der Moscheen wurden die Muslime zum Gebet gerufen. Doch Katharinas Ziel war die ummauerte Festung oberhalb der Stadt – die Alhambra.
Erst hundert Jahre zuvor erbaut, rankten sich um die Alhambra bereits zahlreiche Legenden. Auf dem Felsplateau eines Berges hatten die Mauren hinter honigfarbenen Mauern ein Paradies aus Marmorhöfen und bemalten Decken, aus kristallklaren Wasserbecken und sprudelnden Springbrunnen, aus üppigen Zitronenbäumen und duftenden Orangenblüten geschaffen.
Hier fanden Katharina und ihre Eltern endlich ein Zuhause. Der Dreizehnjährigen, die durch die Gärten streifte, während die Gebetsrufe aus der Stadt zu ihr empordrangen, musste die Alhambra geradezu märchenhaft erscheinen.
Doch Katharina wusste, dass dies nur ein kurzzeitiger Traum von berückender Schönheit war, aus dem sie schon bald wieder erwachen würde.
Als Prinzessin war ihr Schicksal von Beginn an vorgezeichnet. Sie war dazu verpflichtet, eine Ehe einzugehen, die den Ruhm Spaniens mehren würde, und es spielte keine Rolle, wohin sie dieser Weg führen würde.
Ferdinand und Isabella hatten Katharinas Zukunft bereits vorgeplant, als diese gerade erst gehen lernte. Und als sie die Europakarte betrachteten, fanden sie sofort einen geeigneten Heiratskandidaten.
Eintausendsechshundert Kilometer weiter im Norden gelegen, war das Königreich von Heinrich Tudor ein natürlicher Verbündeter für das vereinigte spanische Königreich. Die beiden Länder hatten vieles gemeinsam, vor allem ein tiefes Unbehagen gegenüber dem Land, das zwischen ihnen lag – das reiche und großspurige Frankreich.
Heinrichs ältester Sohn war nur ein Jahr jünger als Katharina, was ihn zum idealen Kandidaten machte. Noch dazu trug er den Namen des legendären Königs, dessen Abenteuer Balladensänger in ganz Europa inspiriert hatten.
Er hieß Arthur.
Katharina hatte immer gewusst, dass ihr Lebensweg sie einst nach England führen würde. Als sie gerade drei Jahre alt gewesen war, hatten sich ihre Eltern bereits vertraglich zusichern lassen, dass sie später Arthur Tudors Frau werden würde.
In adeligen Kreisen war Liebe nicht die entscheidende Voraussetzung für eine Eheschließung. Ganz im Gegenteil: Ehen wurden häufig arrangiert, um den Reichtum, die Macht oder den Einfluss einer Familie zu mehren.
Und Prinzen und Prinzessinnen wurden sich oft schon als Kinder versprochen. Falls sie sich später auch noch ineinander verliebten, umso besser. Falls nicht, war das kein Hindernis.
Katharina war noch nie in England gewesen. Doch sie wusste, dass es dort kalt und feucht war, dass die Engländer seltsame Menschen mit seltsamen Gepflogenheiten und noch seltsameren Essgewohnheiten waren. Sie wusste auch, dass das Englische eine eigentümliche Sprache war, die mit den eleganten europäischen Sprachen wie dem Spanischen nichts gemein hatte.
Als Katharina zwölf Jahre alt war, ließ ihr Arthurs Mutter, Elisabeth von York, ein paar nützliche Tipps zukommen. Sie erklärte ihr, dass niemand in England auch nur ein einziges Wort Spanisch spreche. Katharina solle ein wenig Französisch lernen, um von den Leuten verstanden zu werden. Aus unerfindlichen Gründen kam niemand auf den Gedanken, ihr gleich Englisch beizubringen.
Außerdem riet ihr Elisabeth, sich ans Weintrinken zu gewöhnen. »Das Wasser in England«, fügte sie betrübt hinzu, »ist ungenießbar.«
Was bislang die Vorstellung einer fernen Zukunft gewesen war, wurde nun zusehends konkreter. Das künftige Ehepaar hatte sogar begonnen, sich Liebesbriefe auf Latein zu schreiben.
Im Oktober 1499 schrieb der dreizehnjährige Arthur seiner Verlobten, ihre Briefe machten ihn so glücklich, und er stelle sich bereits vor, seine »liebste Ehefrau« zu küssen. Er könne es nicht erwarten, sie zu sehen, und denke »Tag und Nacht« an sie.
Zu diesem Zeitpunkt waren sich Katharina und Arthur noch kein einziges Mal begegnet. Es war eine Art Spiel, ein höfisches Liebesritual, was ihnen beiden bewusst war.
König Heinrich konnte es inzwischen kaum mehr erwarten, endlich die spanische Braut seines Sohnes zu sehen. Ferdinand und Isabella ließen sich jedoch Zeit und führten immer neue Gründe an, warum Katharina die Reise noch nicht antreten könne.
Ihre übrigen Kinder lebten alle nicht mehr zu Hause, und sie hassten die Vorstellung, nun auch noch ihre Jüngste zu verlieren. »Von allen meinen Töchtern«, hatte Ferdinand ihr einmal gesagt, »liebe ich dich am meisten.«
Doch als der Frühling des Jahres 1501 anbrach, fielen ihnen keine Ausreden mehr ein. Katharina war fünfzehn Jahre alt und an einem strahlenden Morgen im Mai war es schließlich so weit.
Die Sonne stand hoch über den Straßen von Granada. Die Mauern der Alhambra schienen zu glühen und auf den Berggipfeln der Sierra Nevada leuchtete der Schnee.
Ihre Reisegesellschaft stand bereit. Der Erzbischof, ein Bischof, ein hoher Adeliger und sechs junge Frauen sollten sie bis nach England begleiten.
Während ihre Begleiter auf ihren Pferden auf sie warteten, warf Katharina der Stadt, die sie so sehr liebte, einen letzten Blick zu: den plätschernden Springbrunnen und schattigen Plätzen, den Kirchen und Moscheen, den duftenden Orangenbäumen.
Schließlich wendete sie ihr Pferd und ritt aus der Stadt, ihrem neuen Leben entgegen. Sie sollte die Alhambra, Granada und ihre Eltern niemals wiedersehen.
Selbst für eine Prinzessin stellte so eine Auslandsreise ein anstrengendes und gefährliches Unterfangen dar. Und obwohl sich Katharina im Frühling auf den Weg machte, um die gute Witterung zu nutzen, dauerte ihre Reise nach England genau ein halbes Jahr.
Drei Monate brauchten sie, um die weiten staubigen Ebenen zu durchqueren und den Hafen von La Coruña im entlegenen Nordwesten Spaniens zu erreichen. Jede Stadt, die sie passierten, richtete zu Ehren der scheidenden Prinzessin Festgelage und Stierkämpfe aus. In Spanien herrschte jetzt glühende Sommerhitze und sie kamen nur noch im Schneckentempo voran.
Da Katharina noch nie eine Schiffsreise unternommen hatte, war sie verständlicherweise nervös. So nahm sie zuvor einen Umweg in Kauf, um der Kathedrale in Santiago de Compostela einen Besuch abzustatten, wo angeblich die sterblichen Überreste des heiligen Jakobus aufbewahrt wurden.
Wie so viele spanische Ritter kniete auch sie vor dem Reliquienschrein und bat den Heiligen im Gebet um eine sichere Überfahrt. Doch leider sollte sich herausstellen, dass der heilige Jakobus gerade mit anderen Dingen beschäftigt war.
Das Schiff der Prinzessin legte am 25. August mit etwa sechzig Passagieren in La Coruña ab. Ein letztes Mal winkte sie ihrem Heimatland zu – so dachte sie zumindest.
Doch sie waren erst eine Woche auf See, als in der Bucht von Biskaya ein heftiger Sturm losbrach. Sie kamen vom Kurs ab und waren schließlich gezwungen, weiter östlich in Laredo anzulegen.
Später sagten die Leute, dies sei bereits ein schlechtes Omen gewesen. Einige meinten sogar, sie hätten gehört, wie Katharina sich selbst laut gefragt hatte, ob der Sturm sie nicht vor einem Unglück in der Zukunft warnen wollte.
Doch Stürme in der Bucht von Biscaya waren keine Seltenheit, selbst im Sommer. Und nicht einmal Prinzessinnen waren vor den Winden und Wellen sicher, die so viele Seeleute in den Tod gerissen hatten.
Einen Monat später, am Abend des 27. September, hatten sich die Stürme gelegt, und Katharinas Kapitän konnte einen neuen Versuch wagen. Diesmal verlief die Reise weitaus ruhiger, zumindest am Anfang. Doch als sie an der Westküste der Bretagne vorbei in den Ärmelkanal hineinsteuerten, wandte sich das Wetter erneut gegen sie.
Was als sanfte Brise begonnen hatte, wurde ein böiger Wind und schließlich ein tosender Sturm. Das Schiff wurde in der aufgepeitschten See hin und her geworfen. Krachende Donnerschläge ließen den Himmel erbeben, turmhohe Wellen überspülten das Deck.
Katharina hatte sich in ihrer Kabine zusammengekauert und litt unter schrecklicher Seekrankheit. Ihren Reisegefährten erging es nicht anders – sie sanken auf die Knie und schickten verzweifelte Gebete gen Himmel.
Glücklicherweise beherrschte der Kapitän sein Handwerk. Zunächst hatte er Southampton anlaufen wollen, den nach Meinung vieler sichersten Hafen in England, doch dann kam ihm eine bessere Idee.
Am 2. Oktober um drei Uhr nachmittags lief Katharinas Schiff in den Hafen von Plymouth ein. Sie befanden sich zwar hundertfünfzig Kilometer weiter westlich als geplant, doch die Einheimischen waren hocherfreut, sie zu sehen.
Eine kleine Menschenmenge hatte sich am Hafen versammelt, um einen ersten Blick auf die spanische Prinzessin zu erhaschen. Und als Katharina ihren Fuß an Land setzte, brach die Menge in Jubel aus.
»Sie hätte nicht enthusiastischer begrüßt werden können«, schrieb ihr Arzt wenige Tage später an Isabella, »und wenn sie der Heiland selbst gewesen wäre.«
Das war sie also, ihre neue englische Heimat. Katharina war entschlossen, von Beginn an so würdevoll aufzutreten, wie sie es von ihren Eltern gelernt hatte.
Als Allererstes galt es jedoch, eine ganz andere Pflicht zu erfüllen. Sie ignorierte ihre Erschöpfung von der monatelangen Reise und die Spuren von Salzwasser und Erbrochenem auf ihrer Kleidung und steuerte auf die nächstgelegene Kirche zu.
Erst nachdem sie dort ein Dankgebet für ihre glückliche Ankunft gesprochen hatte, begann das Mädchen aus Kastilien, ihre seltsame neue Heimat zu erkunden.
2
Das Königreich der Schatten
Eine Woche nach ihrer Ankunft ritt Katharina über sanft geschwungene Hügel und einen Flickenteppich aus Wiesen und Kornfeldern nach Osten.
Das Herbstlicht verlieh den Bäumen einen rötlich braunen Schimmer. Von den kleinen Siedlungen stieg der Geruch von verbranntem Holz auf. Hämmer klirrten auf Ambossen und Sensen wurden an Wetzsteinen geschliffen.
Katharina schien dieses England ein bemerkenswert feuchtes und grünes Land zu sein – voll dichter Wälder und langer Heckenreihen, einzeln stehender Eichen und Buchen, verstreuter Herrenhäuser und kleiner Dörfer.
Wenn sie mitsamt ihren Begleitern an Bauern vorbeiritt, starrten diese sie mit offener Neugier an. Von dem, was sie ihnen zuriefen, verstand Katharina allerdings kein einziges Wort.
Sie wusste, dass die Engländer eine hohe Meinung von sich selbst hatten. Wie ein italienischer Reisender berichtete, waren sie »ein stolzer Menschenschlag ohne jeden Respekt, der sich allen anderen Nationen überlegen fühlte«.
Doch auf ein Mädchen, das die Pracht Granadas gewohnt war, machte England keinen großen Eindruck. Mit nur zwei Millionen Einwohnern war dieses Königreich auch bedeutend kleiner als Großmächte wie Frankreich oder Spanien.
In der englischen Hauptstadt London wohnten damals nur etwa fünfzigtausend Menschen, was heute etwa einer mittelgroßen Stadt entspricht. Und da neun von zehn Leuten auf dem Land lebten, kam Katharina fast ausschließlich an winzigen Ortschaften vorbei. Nur wenige Holzhäuser besaßen mehr als zwei Zimmer.
Einem Besucher zufolge waren die englischen Häuser ekelerregend schmutzig und es gärte in ihnen nahezu vor »Speichel und Erbrochenem, dem Urin von Hunden und Menschen, Bier und halb vergammeltem Fisch sowie anderen unaussprechlichen Dingen«.
Es gab kein fließendes Wasser und die Toiletten waren furchtbar: ein Eimer, ein Loch in einem Holzbalken oder auch nur ein Loch in der Erde sowie ein Haufen Blätter, um sich sauber zu machen.
Die Bevölkerung war im Vergleich zu heute sehr jung. Die meisten Menschen wurden im Durchschnitt gut vierzig Jahre alt, nur sehr wenige lebten deutlich länger.
Ein Viertel waren Kinder unter zehn Jahren und jedes fünfte Kind starb noch vor dem ersten Geburtstag an irgendeiner Krankheit.
Natürlich kannten die Menschen auch die Freuden des Alltags. Kinder spielten mit Puppen, Reifen und Murmeln. Es wurde Fußball gespielt und alle liebten Musik und Tanz.
Doch war das Leben von frühster Kindheit an auch strengen Regeln unterworfen. Schläge waren an der Tagesordnung und an den Schulen herrschte strikte Disziplin.
Der Schultag begann bei Anbruch des Tages und endete, wenn es dunkel wurde. Nur am Sonntag war schulfrei.
Die Kinder saßen auf Holzbänken und lernten unter anderem Latein und Griechisch. Wer aus der Reihe tanzte, wurde vom Lehrer mit einem Stock geschlagen – reiche Eltern konnten allerdings einen sogenannten »Prügelknaben« dafür bezahlen, dass er anstelle ihres Sohnes geschlagen wurde.
Die meisten Kinder gingen jedoch nicht zur Schule. Von ihrem achten Lebensjahr an halfen die Mädchen ihren Müttern im Haushalt, lernten zu kochen und das Herdfeuer anzufachen, während die Jungen sich um die Schweine, Kühe und Schafe kümmerten.
Katharinas Leben verlief natürlich vollkommen anders. Während die Bauern sich mühten, über die Runden zu kommen, trugen Adelige und Bischöfe wertvolle Kleider mit goldenen Fäden und funkelnden Edelsteinen.
Sie bauten sich riesige Herrenhäuser, deren Wände und Fußböden mit wertvollen Teppichen und Gemälden geschmückt wurden. Und während sich die einfachen Leute von trockenem Brot, Kohl und Suppe ernährten, stopften sie ungeheure Mengen an Fleisch und Fisch in sich hinein.
Während eines Festmahls ließen die reichen Leute Kalb, Rind, Lamm und Wild auftischen, Lerchen und Storche, Rebhühner und Fasane, gefolgt von Dorschen, Heringen, Lachsen und Aalen. Da es keine Kühlschränke gab, war das Fleisch oft verdorben und wurde von den Köchen außerordentlich stark gewürzt, um den fauligen Geschmack zu überdecken.
Auch gab es bei Arm und Reich ganz verschiedene Vorstellungen, wie man sich vergnügen konnte. Als Prinzessin konnte sich Katharina auf abgerichtete Falken, Jagdausflüge und Tennis freuen. Die meisten normalen Leute mussten sich hingegen mit Alkohol, Hahnenkämpfen und ab und an einem Wettbewerb im Bogenschießen begnügen.
Kalt, dunkel und schmutzig war die Welt damals für alle. Die Wege waren schlammig, in den Dörfern türmte sich der Abfall, und die Leute dachten sich nichts dabei, wenn sie ihre Nachttöpfe einfach auf der Straße ausleerten.
Verbrechen waren allgegenwärtig und die Strafen unbarmherzig. Diebe wurden gehängt, Giftmischer bei lebendigem Leibe gesotten und Bettler mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt.
Und wer König Heinrich herausforderte, der konnte sich seiner grausamen Rache sicher sein.
Zwei Jahre zuvor legte ein junger Mann – Edward, Graf von Warwick – im Tower von London seinen Kopf auf den Richtblock. Kurz darauf wurde sein abgetrenntes Haupt der Menge präsentiert.
Edwards Verbrechen hatte darin bestanden, ein geborener Plantagenet zu sein, ein Neffe Richards III., was ihn zu einem Anwärter auf Heinrichs Thron machte. Katharina wusste, dass der König seinen Tod befohlen hatte, um ihren Eltern zu gefallen und ihnen zu demonstrieren, dass er gewillt war, seine Stellung zu verteidigen.
Auch sollte dies eine Warnung sein, dass – so hoch man auch stieg – das Henkersbeil stets lauerte. Und Katharina fragte sich Jahre später, ob ihr eigenes Unheil nicht Gottes Strafe für das Schicksal dieses jungen Mannes war.
Nach einem dreiwöchigen Ritt – fast sechs Monate nachdem sie Granada verlassen hatte – erreichte Katharina mit ihrem Gefolge das Herrenhaus in Dogmersfield, Hampshire. Hier sollte sie sich für ein paar Tage erholen, ehe sie die letzte Etappe nach London in Angriff nehmen würde.
Doch schon nach wenigen Stunden erhielt sie eine überraschende Nachricht. Ein Bote teilte ihr mit, dass König Heinrich keine Geduld mehr habe, auf sie zu warten, und sich bereits auf dem Weg zu ihr befinde.
Zunächst war Katharina geschockt. Ein Treffen vor der Hochzeit widersprach allen Regeln des spanischen Hofs. Doch vielleicht war ihr auch – ganz tief drinnen – mulmig bei dem Gedanken, einer so mächtigen Persönlichkeit allein, ohne ihre Eltern, gegenüberzutreten.
Sie wusste bereits, dass Heinrich Tudor ein Ehrfurcht gebietender Mann war. Nachdem er in Bosworth zum König geworden war, hatte er Jahrzehnte des Streits beendet und in England für Ordnung gesorgt. Den mächtigen Adel hatte er mit horrenden Steuern belegt, die ihn selbst immer reicher machten.
Seine Regentschaft stützte sich auf »neue Männer« – Bischöfe, Spione, Rechtsgelehrte und Wissenschaftler –, die ihm treu ergeben waren. Doch wurde er lieber gefürchtet als geliebt.
Heinrich war ein misstrauischer und vorsichtiger Mann. Er wusste, dass seine Feinde es selbst auf die Krone abgesehen hatten und nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, um zuzuschlagen.
Drei große Rebellionen hatte er schon niedergeschlagen und sich gezwungen gesehen, auch einige Verwandte hinrichten zu lassen. Er war ständig auf der Hut, ruhig schlafen konnte er fast nie.
Heinrich war fest entschlossen, die Tudor-Dynastie zu bewahren. Er wusste, dass ein falscher Schritt ausreichte, um England ins Chaos zu stürzen und den Namen seiner Familie aus den Geschichtsbüchern zu tilgen.
Deshalb spielte Katharina in seinen Plänen eine so außerordentlich große Rolle. Sie war nicht nur die Braut seines Sohnes, sondern die zukünftige Mutter weiterer Tudor-Könige.
Kein Wunder, dass Heinrich es nicht erwarten konnte, sie zu sehen. Als er ankam, trug er immer noch seine Reitausrüstung. Seine Stiefel waren mit Dreck bespritzt. Doch er eilte sofort zu ihrem Zimmer und winkte den Protest ihrer Diener beiseite.
Für den Bruchteil einer Sekunde starrten sie sich an, der englische König und die spanische Prinzessin. Viele Mädchen hätten seinem durchdringenden Blick nicht standgehalten – Katharina von Aragon jedoch schon.
Sie sah einen mageren, wettergegerbten Mann mit dem wachsamen Blick eines Fuchses. Er sah ein aufgewecktes, klein gewachsenes sechzehnjähriges Mädchen mit dichten, rotblonden Haaren und ernsten blauen Augen.
Dann nickte er lächelnd. Sie war perfekt, ganz wie ihre Eltern versprochen hatten.
Am späten Nachmittag kam ein zweiter Besucher in Dogmersfield an. Zum ersten Mal erblickte Katharina den Mann, dem sie schon so lange versprochen war – den fünfzehnjährigen Arthur, Fürst von Wales.
Arthur war so schmal gebaut wie sein Vater, hatte ebenso schmale Lippen und den gleichen wachsamen Blick. Er war ernsthaft und belesen, ein guter Bogenschütze und exzellenter Tänzer. Alles in allem hätte es Katharina weitaus schlechter treffen können.
Es gab jedoch ein Hindernis. Als das schüchterne junge Paar unter sich war, versuchten sie es mit lateinischer Konversation. Doch sprachen sie die Wörter vollkommen unterschiedlich aus, und Katharina hatte größte Mühe, zu verstehen, was Arthur ihr sagte.
Dennoch war dies kein Grund zur Besorgnis. Schließlich blieben ihnen noch viele Jahre, um sich besser kennenzulernen.
Als Katharina von Aragon am Donnerstag, dem 11. November, erwachte, regnete es. Auf dieser seltsamen kalten Insel regnete es ständig, dachte sie. Würde sie sich jemals daran gewöhnen?
Heute hatte eigentlich ihr großes Entree in der Hauptstadt London stattfinden sollen, doch selbst die Engländer mussten sich diesen Regenmassen geschlagen geben. So mussten sie bis zum nächsten Tag warten und auf besseres Wetter hoffen.
Erst am Freitagmorgen also machte man sich auf Richtung Osten – vorbei an den Obstgärten entlang der Themse – und sah während des ganzen Weges immer wieder skeptisch zur dunklen Wolkendecke hinauf.