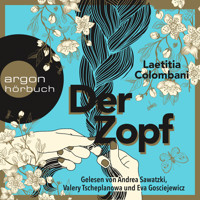3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Londoner Lehrerin Margaret Holloway ist auf dem Weg von der Schule nach Hause, als ihr Wagen in einen Unfall gerät. Sie ist gefangen in dem Fahrzeug, das kurz davor ist, in Flammen aufzugehen. Ein Fremder befreit sie und verschwindet sofort wieder. Anfangs kann sich Margaret kaum an etwas erinnern – wie so oft in ihrem Leben. Nur die Narben im Gesicht des Mannes sind ihr deutlich vor Augen. Doch nach und nach kehren die Erinnerungen zurück: nicht nur an den Unfall, sondern auch an Erlebnisse in ihrer Kindheit in Schottland, die sie allzu lange verdrängt hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Ähnliche
Zum Buch
Die Londoner Lehrerin Margaret Holloway ist auf dem Weg von der Schule nach Hause, als ihr Wagen in einen Unfall gerät. Sie ist gefangen in dem Fahrzeug, das kurz davor ist, in Flammen aufzugehen. Ein Fremder befreit sie und verschwindet sofort wieder. Anfangs kann sich Margaret kaum an etwas erinnern – wie so oft in ihrem Leben. Nur die Narben im Gesicht des Mannes sind ihr deutlich vor Augen. Doch nach und nach kehren die Erinnerungen zurück: nicht nur an den Unfall, sondern auch an Erlebnisse in ihrer Kindheit in Schottland, die sie allzu lange verdrängt hat …
Zur Autorin
LISA BALLANTYNE wurde 1975 in Armsdale, Schottland geboren, wo sie Englische Literatur studierte. Sie hat einige Jahre in China gelebt, wo sie in den Bereichen Internationale Entwicklung und Bildung tätig war. 2002 kehrte sie in ihre Heimat zurück und arbeitet seitdem im International Office der Universität Glasgow. Nach ihrem internationalen Debüterfolg »Der Schuldige« ist »Wenn du vergisst« ihr zweiter Roman.
LISA BALLANTYNE BEI BTB
Der Schuldige
Lisa Ballantyne
Wenn du vergisst
Roman
Deutsch von Marie Rahn
Mein Dank gilt Creative Scotland und dem Scottish Book Trust für die Unterstützung und Inspiration, die ich mit Hilfe des Robert-Louis-Stevenson-Stipendiums bekam.
1
Margaret Holloway
Donnerstag, 5. Dezember 2013
Margaret Holloway schlang sich den Schal um, bevor sie hinaus zum Parkplatz der Schule ging. Es war kurz nach vier, doch der Winter hatte sein Laken über London gebreitet, sodass es bereits dämmerte und die Straßenlaternen vorzeitig ihr mattes Licht auf die vereisten Bürgersteige warfen. Schneeflocken trudelten herab, und Margaret blinzelte, als eine auf ihren Wimpern landete. Wie immer dämpfte der erste Schnee alle Geräusche und hüllte die Welt in Stille. Dankbar, allein zu sein, ging Margaret durch die Dunkelheit und hinterließ eine einsame Fußspur auf dem Weg. Sie begrüßte die kalte Luft, denn drinnen war ihr zu warm gewesen.
Der Wagen stand am hinteren Ende des Parkplatzes. Sie hatte nicht die richtigen Schuhe für das Wetter angezogen, wohl aber ihren langen braunen Daunenmantel. Im Radio war der strengste Winter seit fünfzig Jahren vorhergesagt worden.
In ein paar Wochen würde sie sechsunddreißig, und wie immer lag ihr Geburtstag in den Ferien, doch bis dahin hatte sie noch viel zu tun. Sie trug eine große, schwere Tasche voller Akten, die sie für die morgige Konferenz lesen musste. Sie war einer der beiden stellvertretenden Rektoren der Byron Academy und die einzige Frau im Führungsgremium, allerdings war auch einer der vier Fachbereichsleiter, die ihr unterstellt waren, eine Frau. Vom Arbeitstag fühlte sie sich immer überreizt. Angesichts all dessen, was sie noch zu tun hatte, hüpften ihre Gedanken zischend wie frisches Popcorn in siedendem Öl durcheinander.
Außerdem war sie wütend, daher schritt sie schneller als sonst durch die winterliche Kälte und Dunkelheit.
»Mach das nicht«, hatte sie eben noch Malcolm Harris, den Direktor, angefleht.
»Es ist ein gravierender Verstoß«, hatte Malcolm entgegnet, sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt, die Hände gehoben, als wollte er sich ergeben, und dabei die Schweißflecken unter seinen Armen enthüllt. »Ich weiß, wie du über ihn denkst, er ist eines deiner ›Projekte‹ …«
»Nein, das stimmt doch nicht. Aber ein endgültiger Ausschluss könnte Stephens Ende bedeuten. Dabei ist er schon so weit gekommen.«
»Auch du wirst noch erfahren, dass er von allen nur ›The Trap‹ genannt wird.«
»Außerdem betrachte ich ihn nicht als Projekt«, hatte Margaret gesagt, ohne auf Malcolms Bemerkung einzugehen. Sie wusste ganz genau, dass Stephen Verbindungen zu Jugendgangs hatte, kaum ein Lehrer kannte ihn so gut wie sie. Direkt nach dem College hatte sie als Englischlehrerin an der Schule angefangen, war jedoch schon kurz darauf in den Förderbereich gewechselt. Dort arbeitete man oft auch mit verhaltensauffälligen Kindern, die aus den normalen Klassen entfernt werden mussten. Es schockierte sie, wie viele Kinder Analphabeten waren. Stephen hatte sie seit seinem ersten Jahr an der Schule unterrichtet. Nachdem sie entdeckt hatte, dass er mit dreizehn noch nicht mal seine eigene Adresse schreiben konnte, hatte sie ihn zwei Jahre lang besonders gefördert, bis er wieder in eine normale Klasse gehen konnte. Als er seinen Realschulabschluss schaffte, war sie sehr stolz auf ihn gewesen.
»Er hatte ein Messer dabei, auf dem Schulgelände, aus meiner Sicht also ein klarer Fall. Er ist fast siebzehn und …«
»Ein Schulverweis würde ihn vernichten. Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt dafür: Er hat gerade angefangen, aufs Abitur hinzuarbeiten, und macht gute Fortschritte. Es würde sein ganzes Selbstvertrauen zerstören.«
»Wir können keine Messer auf dem Schulgelände dulden.«
»Er hat es ja nicht mal herausgeholt, es wurde rein zufällig in der Sporthalle entdeckt. Du weißt genau, dass er es nur zum Schutz bei sich hat.«
»Nein, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht der Punkt. Außerdem ist das Ganze nicht so dramatisch, wie du es darstellst. Es passiert ständig, dass Kinder in dem Alter die Schule verlassen …«
»Aber er verlässt sie nicht, sondern du schmeißt ihn raus, und das nach all dem, was er erreicht hat. Er hat seinen Realschulabschluss mit guten Noten geschafft, und seine Lehrer meinen, bislang sähen sie keinerlei Probleme, dass er das Abitur machen kann. Es ist doch nur ein harmloser Zwischenfall.«
Malcolm lachte kurz auf. »So würde ich das nicht gerade nennen.«
Margaret schluckte ihren Zorn hinunter, holte tief Luft und sagte bemüht leise: »Diese Entscheidung wird ungeheure Konsequenzen für sein Leben haben. Gerade jetzt, da er eine Chance hat, willst du sie ihm wegnehmen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich bitte dich, etwas Abstand zu gewinnen und noch mal eingehend darüber nachzudenken.«
»Ja, Abstand gewinnen muss allerdings einer von uns …«
»Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Jetzt bitte ich dich nur, eine Nacht darüber zu schlafen.«
Malcom ließ die Hände in den Schoß sinken. Er verschränkte sie, stellte die Daumen auf und hob gleichzeitig seine Augenbrauen. Margaret wertete das als Zustimmung.
»Danke«, brachte sie hervor und schlüpfte in ihren Mantel.
»Fahr vorsichtig. Draußen friert es.«
Margaret lächelte ihn mit zusammengepressten Lippen an. Malcolm war für seinen Posten noch jung, Anfang vierzig, ein ehrgeiziger Bergsteiger. Er war nur sieben Jahre älter als Margaret. Eigentlich kamen sie gut miteinander aus und hatten selten Differenzen. Er hatte ihren Aufstieg in die Schulleitung unterstützt.
»Ja, du auch«, hatte sie gesagt.
Auf dem Weg zum Wagen ließ Margaret sich das Gespräch immer wieder durch den Kopf gehen. Sie dachte an Stephen, an seinen gewalttätigen älteren Bruder und seine Sammlung von Schwimmpokalen aus der Grundschulzeit. Dann dachte sie an Malcolm und seine Unterstellung, sie ließe sich von persönlichen, emotionalen Motiven leiten.
Der Schnee trieb ihr jetzt viel heftiger entgegen, hatte sich zu einem richtigen Sturm entwickelt. Sie war durstig und müde und spürte, wie ihre Haare nass wurden. Als sie ihren Wagen sah, holte sie den Schlüssel heraus und betätigte den automatischen Türöffner.
Gerade als die Scheinwerfer blitzten, rutschte sie aus. Sie trug einfach zu viel, konnte nicht mehr das Gleichgewicht halten und schlug hart auf dem Boden auf.
Sie rappelte sich hoch und merkte, dass sie sich die Knie aufgeschürft hatte. Der Inhalt ihrer Tasche hatte sich auf den frischen Schnee ergossen, und die Unterlagen für morgen wurden nass.
»Mann, Mann, Mann«, flüsterte sie, als sie auf der Suche nach ihrem iPhone mit den Fingerknöcheln über den Asphalt schrammte.
Im Wagen musterte sie ihr Gesicht im Rückspiegel und fuhr sich mit den Fingern durch ihre dunklen Haare, die sie kurz trug, seit sie Anfang zwanzig war. Es betonte ihre großen Augen und ihr herzförmiges Gesicht. Durch den Schnee waren ihre Wimpern nass und ihr perfekter Lidstrich ruiniert worden. Sie wischte sich mit dem Daumen über die Lider. Im Licht, das von der Schule zu ihr herüberdrang, wirkte sie blasser, jünger, fast kindlich, und verloren.
Dann drehte sie den Schlüssel in der Zündung. Der Motor wimmerte auf, stotterte und sprang an.
»Danke«, flüsterte Margaret, trat wiederholt aufs Gas und schaltete Licht und Radio ein.
Sie schnallte sich an, drehte die Heizung auf, atmete langsam aus und warf einen kurzen Blick auf ihr iPhone, wo Ben ihr gesimst hatte Brauchen Milch aber nur wenn es passt xxx. Dann fädelte sie sich in den Verkehr ein.
Mittlerweile arbeiteten die Scheibenwischer auf höchster Stufe und türmten den Schnee an den Rändern der Windschutzscheibe auf.
Sie bog rechts auf die Willis Street und nahm dann am Autobahnkreuz Green Man die erste Ausfahrt, die mit Cambridge und Stansted Airport ausgeschildert war. Unter günstigen Bedingungen dauerte die Fahrt von der Schule nach Loughton nur eine gute halbe Stunde, doch wegen des Schnees und des dichten Verkehrs rechnete Margaret damit, vierzig Minuten bis nach Hause zu brauchen.
Unter der blickdichten Strumpfhose brannten ihr die Knie. Das Gefühl erinnerte sie an ihre Kindheit. Sachte wippte sie mit dem Hinterkopf gegen die Kopfstütze, wie um sich die Sorgen aus dem Hirn zu schlagen.
Ben würde sich ums Abendessen kümmern, aber direkt danach musste sie Paula zu ihrem Theaterclub im Gemeindezentrum bringen, wo sie selbst sich mit einem dünnen Automatenkaffee auf die morgen anstehende Konferenz vorbereiten würde. Falls sie es früh genug nach Hause schafften, konnte sie noch den Streit beenden, den Ben und ihr siebenjähriger Sohn Eliot offenbar immer bekamen, wenn Eliot sein iPad weglegen und ins Bett gehen sollte.
Sie war jung Mutter geworden, zumindest nach heutigen Maßstäben: Mit fünfundzwanzig hatte sie Ben geheiratet, mit sechsundzwanzig Paula bekommen und nur zwei Jahre später Eliot. Da Ben als freiberuflicher Journalist von zu Hause aus arbeitete, war Margaret manchmal eifersüchtig auf ihn, weil er die Kinder häufiger um sich hatte. Oft empfing Ben sie nach der Schule, und unter der Woche kochte er meist das Abendessen und half ihnen bei den Hausaufgaben.
Während der Heimfahrt konnte sie es jedes Mal kaum erwarten, sie alle wiederzusehen.
Auf dem Kaminsims zu Hause stand ein Schwarz-Weiß-Foto von Margaret, die den Kindern vorlas, als sie noch klein waren. Ihr Lieblingsfamilienbild. Ben hatte es geschossen, ohne dass sie es merkten. Darauf hatte sie Eliot in dem einen Arm und Paula im anderen, während sie alle drei wie gebannt, die Köpfe ganz nah beieinander, auf das Buch vor ihnen starrten, das nur verschwommen zu sehen war. Margaret versuchte immer noch, ihnen möglichst oft vorzulesen, aber heute Abend blieb keine Zeit dazu.
Sie blinkte und fuhr dann knapp vor einem Lkw auf die M11 auf. Der Jeep vor ihr spritzte ihr reichlich Matsch gegen die Windschutzscheibe. Der Verkehr bewegte sich mit sechzig Meilen die Stunde vorwärts, und die Fahrbahn war nass vom schmutzigen Schnee.
Margaret drosselte ihr Tempo, weil die Sicht miserabel war. Die Schneeflocken wirbelten in konzentrischen Kreisen vor ihren Scheinwerfern. Wenn sie an den linken oder rechten Rand der Windschutzscheibe blickte, schienen die Flocken direkt auf sie zuzuschießen. Der an den Scheibenrändern zusammengeschobene Schnee engte wie Scheuklappen ihre Sicht ein. Zwar konnte sie die Rücklichter des vor ihr fahrenden Wagens sehen, aber darüber hinaus bloß die leuchtenden, herumwirbelnden Schneeflocken.
Sie wusste nicht, was sie erwischte, sondern spürte nur einen harten Schlag von hinten, und dann explodierte der Airbag vor ihr. Sie bremste scharf, aber der Wagen krachte so laut auf den Jeep, dass ihr der Atem stockte. Ihre Motorhaube schob sich vor ihren Augen hoch, und alles wurde dunkel. In Erwartung großer Schmerzen ballte sie die Fäuste und hielt die Luft an.
Aber die Schmerzen blieben aus. Als sie die Augen wieder öffnete, hörte sie Autosirenen, gedämpfte Schreie und, in der Nähe, ein Tröpfeln und Rieseln. Sie tastete Gesicht und Körper ab, spürte jedoch keine Verletzungen, wohl aber ein dumpfes Ziehen im Brustkorb vom Aufprall des Airbags. Sie versuchte, die Fahrertür zu öffnen, doch die ging nicht auf, nicht mal, als sie mit der Schulter dagegen rammte. Sie griff nach ihrer Tasche, aber deren Inhalt hatte sich schon wieder auf den Boden ergossen. Da ihr Wagen zusammengequetscht und dunkel war, konnte sie nicht sehen, wohin ihr Handy gefallen war. Sie beugte sich vor und versuchte, die Beifahrertür zu öffnen, doch durch den Aufprall hatte auch die sich verzogen.
Hinter der Motorhaube sah sie rötliches Licht, als wäre etwas im Motor in Brand geraten.
Immer noch fiel Schnee und türmte sich in der Lücke zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe, sodass sie das Gefühl bekam, begraben zu werden. Um sie herum wurden die Lichter schwächer. Margaret wischte über das beschlagene Seitenfenster und drückte ihr Gesicht ans Glas. Trotz der Dunkelheit konnte sie Formen ausmachen, die sich bewegten und in den im Scheinwerferlicht aufblitzenden Öllachen oszillierten. Sie befand, dass die Formen Menschen waren. Außerdem sah sie ein flackerndes Gelb, das fast aussah wie Flammen.
»Ist schon gut«, sagte sie laut zu sich selbst. Hilfe war unterwegs. Sie brauchte nur abzuwarten. Dann beugte sie sich auf dem Sitz vor und tastete den Boden mit der ganzen Handfläche nach ihrem Handy ab. Fast alles andere fand sie: Lipgloss, ein Päckchen Tampons, abgerissene Eintrittskarten für ein Konzert der Band Arcade Fire und zwei Haarbürsten.
Als sie so vornübergebeugt, mit dem Kopf nach unten, suchte, stieg ihr der scharfe Geruch von Benzin in die Nase. Unwillkürlich musste sie daran denken, wie sie als Kind an Tankstellen immer ihren Kopf aus dem Fenster gehalten hatte. Angestrengt spähte sie durch den kleinen nicht beschlagenen Fleck des Seitenfensters. Der Rasenstreifen an der Leitplanke brannte.
Plötzlich wurde Margarets Atem flach, dörrte ihr rasselnd die Kehle aus.
Wenn ihre Ahnung sie nicht trog und ihr Benzintank durch den Aufprall einen Riss bekommen hatte und wenn irgendwas im Motorraum brannte, dann bestand durchaus die Möglichkeit, dass der Wagen explodierte.
Eben noch hatte sie Ben anrufen wollen, jetzt aber war sie froh, dass sie ihr Handy nicht fand. Sie hätte ihre Angst vor ihm nicht verbergen können.
Ben. Allein der Gedanke an ihn trieb ihr die Tränen in die Augen. Ihr fiel ein, wie eine bestimmte Stelle zwischen seinen Schulterblättern nachts roch und wie er sie fragend ansah, wenn sie etwas sagte, mit dem er nicht einverstanden war; wie er sich in seinem Arbeitszimmer über seine Tastatur beugte, wenn er an einem Artikel schrieb. Dann dachte sie an Paula, die vor lauter Eifer, zum Theaterclub zu gehen, schon aufgegessen hatte und nun dachte, ihre Mum käme wieder zu spät. Und Eliot, der in ein Spiel auf seinem iPad vertieft war und nicht wusste, in welcher Gefahr seine Mutter schwebte und dass sie ihm für immer genommen werden konnte.
Margaret sah sich nach etwas um, mit dem sich die Scheibe zertrümmern ließ, und entdeckte auf der Innenseite der Fahrertür einen schweren Eiskratzer aus Kunststoff. Mit aller Kraft schlug sie zu, und tatsächlich bekam die Scheibe einen Riss.
Sie roch nur Benzin und ihren eigenen Schweiß – ihre eigene Angst. Die Alarmsirenen waren verstummt, stattdessen ertönte jetzt mehrstimmiges, ununterbrochenes Hupen. Ihr wurde klar, dass noch viel mehr Wagen in den Unfall verwickelt sein mussten. Das lang anhaltende Hupen stammte sicher von Fahrern, die bewusstlos auf den Lenkrädern lagen. Durch das kleine nicht beschlagene Dreieck sah sie tanzende Flammen.
»Nein!«, schrie sie und traktierte die Scheibe mit Fäusten, Schultern und sogar ihrem Kopf. »NEIN!« Sie wusste, dass wegen des Schnees niemand sie hören konnte. Sie wand sich auf ihrem Sitz, hob die Beine an und trat mit den Füßen gegen die Scheibe, rammte die Sohlen ihrer nicht besonders robusten Schuhe dagegen. Es tat weh, hatte aber keinerlei Effekt.
Sie wollte jetzt nicht sterben. Es war noch so vieles unvollendet. Es gab noch so vieles, das sie wissen, verstehen, tun musste.
Plötzlich erschien ein Mann an der Tür, vermutlich von der Feuerwehr. Sie konnte seine dunkle Silhouette sehen. Mit seinem ganzen Gewicht stemmte er sich gegen die Tür und ruckte am Griff.
»Danke«, sagte sie durch das Glas, während ihr heiße Tränen über die Wangen strömten. »Danke.«
Die Tür wollte sich nicht bewegen. Der Mann hob etwas von der Straße auf – ein Stück Metall – und fing an, damit gegen die Scheibe zu schlagen.
»Schützen Sie Ihr Gesicht«, hörte sie ihn rufen.
Margaret gehorchte, hielt sich ihre Tasche vors Gesicht, beobachtete ihn aber weiter, um die Chance herauszukommen nicht zu verpassen.
Der Mann versuchte, mit dem Metallstück die Türverriegelung auszuhebeln. Als das nicht gelang, wandte er sich wieder zum gesprungenen Fenster am Fahrersitz.
»Ich krieg sie nicht auf«, rief er.
Sie hob den Kopf, um ihn durch einen der größeren Risse besser sehen zu können. Er trug einen dunklen Pullover, war also kein Feuerwehrmann.
»Tut mir leid«, hörte sie ihn mit erstickter Stimme sagen. »Ich schaff’s nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit.«
Sie biss sich auf die Lippen und legte erneut ihre Hand auf die gesprungene Scheibe. »Ist schon gut«, sagte sie laut genug. »Danke, dass Sie es versucht haben. Gehen Sie. Ist schon gut.«
Als der Mann ebenfalls seine Hand auf die Scheibe legte, war Margaret überzeugt, ihre Wärme zu spüren. Als er sie wieder wegnahm, senkte sie den Kopf und brach in Tränen aus, weil sie sich schwach und hilflos fühlte wie ein Kind, ganz auf sich selbst reduziert, außer ihr nichts.
Licht drang durch die Risse in der Scheibe, nachdem er die Hand entfernt hatte. Sie bekam einen Kloß im Hals, als sie sich fragte, wie lang es wohl dauern würde und ob sie würde leiden müssen. Sie hoffte auf eine Explosion, denn die Vorstellung, bei lebendigem Leib zu verbrennen, jagte ihr solche Angst ein, dass sie wieder nach dem Eiskratzer griff und ihn heftig gegen die Scheibe schlug.
»Zurück!«
Das war der Mann – er presste sein bleiches Gesicht gegen die Scheibe.
»Ich versuche, es einzuschlagen, also halten Sie Abstand.«
Sie rutschte zum Beifahrersitz und hielt sich die Hände vors Gesicht.
Ein dumpfer Schlag ertönte, und als Margaret den Kopf hob, ragte die blutige Faust des Mannes in den Wagen. Er hatte die Scheibe durchgestoßen und sich dabei die Haut vom Fleisch gerissen.
Kalte Luft drang herein, und der Benzingeruch wurde stärker. Der Mann rupfte mit bloßen Händen die Scherben aus dem Fensterrahmen.
»Ich ziehe Sie durch«, hörte sie ihn sagen.
»Das passt nicht.«
»Geben Sie mir Ihre Hände!« Als er das mit verzweifelt drängender, autoritärer Stimme sagte, rutschte ihm sein Schal vom Gesicht.
Sie holte scharf Luft, als sie es erblickte, wich aber nicht zurück. Es sah aus, als hätte sich eine Krake auf sein Gesicht gestürzt: Tentakel breiteten sich über seine Wangen, seine Stirn, seinen Schädel und seinen Hals aus. Um Platz für einen Tentakel zu machen, war eines seiner Augen aus der Höhle verrutscht. Seine Haut glänzte im ölig-hellen Licht blass und porenlos.
Margaret legte ihre Hand in seine. Er zog sie schnell durchs Fenster, sie blieb kurz mit den Hüften hängen, landete dann aber auf ihm.
Schwer atmend lag sie auf seiner Brust und spürte voller Dankbarkeit den kalten Schnee auf ihren Wangen. Sie hob den Kopf und sah die vernarbte Haut an seinem Hals.
Mühsam stand er auf, eindeutig hatte er Schmerzen. Er half ihr auf die Beine.
»Beeilung, wir müssen …«
Sie hatten fast den Seitenstreifen erreicht, da explodierte der Wagen. Die Druckwelle durchströmte Margaret und presste ihr die Luft aus den Lungen. In ihrem Kopf war nur noch gleißendes Entsetzen, doch der Mann riss sie an sich, flog mit ihr hin und rollte mit ihr über den Boden, während Trümmer sie trafen. Margaret spürte seinen schweren Körper auf ihrem und plötzlich nichts mehr, dann wieder sein Gewicht, das sie niederdrückte und mit Zentrifugalkraft vorwärtsschleuderte. Sie fühlte sich sicher in dieser Kraft, und Dankbarkeit erfüllte sie.
Jetzt wurde eine Gesichtshälfte von ihr in den Schnee gedrückt. Der Fremde fegte sich den Matsch vom Körper. Seine Stirn blutete heftig. Kniend starrte er auf die lodernden Flammen und hielt seine blutige Hand mit der anderen fest. Margaret rollte sich auf den Bauch und erhob sich. Sie hatte keine Schuhe mehr an, und ihre Fußsohlen waren nass vom eiskalten Schnee. Sie sah Sanitäter auf sie zustürzen. Hören konnte sie nichts, außer ihrem eigenen Herzschlag und dem Brausen des Feuers.
Ihr Wagen wurde von Flammen verschlungen, und jetzt erkannte sie, dass die Fahrbahnen ein Trümmerfeld ineinandergeschobener Autos waren. Die M11 sah aus wie ein Schrottplatz: unzählige umgekippte Wagen und darüber der Gestank nach verbranntem Gummi. Blaulicht blinkte nur in der Ferne, denn nicht mal die Rettungswagen kamen durch das Chaos.
Erleichterung überströmte sie wie der Strahl einer warmen Dusche. Margaret blickte auf ihren Retter hinunter.
»Waren Sie auch in dem Unfall?«, fragte sie. »Sie sind verletzt. Ihre Hand ist bestimmt gebrochen, und ihr Kopf …«
»Okay«, sagte er nur, wandte den Blick von ihr ab und versuchte, mit seiner blutigen Hand den Schal über sein Gesicht zu ziehen.
»Ist schon gut«, sagte Margaret und legte ihm ihre Hand auf den Hals. »Danke. Ohne Sie wäre ich gestorben. Jetzt müssen wir Hilfe für Sie holen.«
»Ich bin okay«, wiederholte er, erhob sich unsicher und taumelte von ihr fort, hinein in den Rauch, das Feuer und den Schnee.
»Warten Sie«, rief Margaret ihm nach. »Bitte.«
Sanitäter übernahmen das Kommando. Sie wurde in eine Isolierdecke gewickelt, ihr Puls wurde gemessen, und dann bekam sie ein Schild und die Anordnung zu warten; sie war außer Gefahr. Nach Angabe ihrer Personalien teilte man ihr mit, dass Ben informiert würde.
Zitternd stand Margaret am Seitenstreifen, umklammerte die Aludecke und sah sich nach dem Mann mit den Brandnarben um, der sie gerettet hatte. Sie fragte den Sanitäter, doch der schüttelte den Kopf. »Hab ich mir nicht gemerkt. Gibt einfach zu viele Verletzte hier. Sie müssen sich jetzt ausruhen.«
Ihr fiel wieder ein, wie sich die Wärme von der Hand des Fremden auf ihre übertragen hatte, und wie groß er gewesen war, als er vor ihr im Schnee gekniet und seine blutende Hand an seine Brust gedrückt hatte. Er hatte sich verletzt, das wusste sie genau; sie wollte ihn finden, um dafür zu sorgen, dass er Hilfe bekam.
2
Big George
Freitag, 27. September 1985
Big George stieg mit dem Bier in der Hand auf den Tisch und stimmte »Sweet Caroline« an. Er war eins siebenundachtzig groß, hatte schwarze Haare und strahlend blaue Augen mit längeren Wimpern als seine einzige Schwester Patricia. Von den McLaughlins sah er am besten aus und war deswegen jahrelang mit allem durchgekommen. Er war der Liebling seiner Mutter gewesen und konnte genauso gut singen wie sie, nur dass sie jahrelang keinen Anlass mehr zu singen gehabt hatte.
George war schon beim vierten Bier, und seine Augen blitzten mutwillig. Alle in der Bar drehten sich ihm zu und klatschten im Takt. Die McLaughlins zogen immer Aufmerksamkeit auf sich, doch normalerweise, weil der Ruf der Gewalttätigkeit sie umgab. Georgie-Boy war anders. Die meisten Leute im East End von Glasgow kannten ihn und behandelten ihn wegen seiner Familie mit Vorsicht, aber wer ihn näher kannte, behauptete, George sei ein sanfter Riese. Georges Vater Brendan hielt ihn für einen Weichling, aber andererseits war Brendan McLaughlin ohnehin der Härteste.
George stützte sich auf Tam Driscolls Schulter, als er nach seinem spontanen Auftritt vom Tisch kletterte. Ein älterer Mann, der das Portland Arms verließ, klopfte ihm auf den Rücken. »Alle Achtung, Neil Diamond.«
»Hau ab!«, erwiderte George über die Schulter hinweg, doch seine Augen strahlten wegen des Kompliments.
»Noch einen, Großer?«, fragte Tam.
George nickte, wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn und stellte sein leeres Glas auf der Theke ab. Als Tam das bestellte Bier bekam, war ein Tisch in der Nähe der Bar frei geworden, und da George nach seinem Auftritt erschöpft war, setzte er sich dorthin und fuhr sich mit den Händen durchs Haar.
Tam arbeitete seit Neuestem bei George in der Werkstatt der McLaughlins an der Shettleston Road. Der Betrieb stand mehr oder weniger auf legalen Beinen, aber das galt nicht unbedingt für alles, was dort gemacht wurde. Die Werkstatt war so weit ins Familienunternehmen eingebunden, wie George es gerade noch tolerierte. Tam war Mechaniker, und zwar ein guter, doch hatte er den Job nur angenommen, weil er fast ein Jahr arbeitslos gewesen war.
»Ich will in nichts verwickelt werden«, flüsterte er George zu, Gesicht und Hände ölverschmiert, wann immer Georges älterer Bruder Peter auftauchte und, nervös die behandschuhten Hände verschränkend und lösend, ihre Arbeit begutachtete. Peter hatte das Geschäft übernommen, als ihr Vater vor Jahren, vermutlich für immer, verschwunden war.
»Ich doch auch nicht«, versicherte George ihm dann.
In den wenigen Wochen, die sie sich kannten, hatte George ihm als Zeichen seines Wohlwollens und Vertrauens einige persönliche Dinge erzählt, von ihm jedoch bisher nur hier und da einen Abend in der Kneipe und ein paar Bier zurückbekommen.
George verstand Tams Angst und hatte beschlossen, sich in Geduld zu üben. Sein Vater hatte sich einen Namen als Eintreiber für einen der führenden Glasgower Geldverleiher gemacht. Selbst jetzt saßen mindestens zwei, drei Männer in der Bar, die von den McLaughlins verletzt worden waren. Einer der Männer, die George applaudiert hatten, war Giovanni DeLuca, dem die Frittenbude an der Ecke gehörte. Allein sein Anblick im Publikum hatte George so aus dem Takt gebracht, dass er eine Liedzeile vergaß, obwohl alle das dem Bier zuschrieben. Er hatte gesehen, wie Giovanni mit seiner bleichen, mageren Hand gegen die andere, dunkelbraune schlug. Als Vierzehnjähriger hatte George miterlebt, wie sein Vater Giovannis Hand tief in sprudelndes Frittierfett getaucht hatte.
Langsam und darauf bedacht, das Bier nicht zu verschütten, kam Tam zum Tisch. Er war einen ganzen Kopf kleiner als George, aber fünfzehn Jahre älter, dünn und drahtig, mit kurzen grauen Haaren. Er hatte George beigebracht, wie man einen Motor entlüftete und einen Auspuff wechselte. George, der nie ein guter Schüler gewesen war, hatte entdeckt, dass er über Autos gerne alles lernte, und konnte schnell umsetzen, was Tam ihm beibrachte. Für ihn war Tam ein Ersatzvater: wohlwollend, wo Brendan, Gott mochte seiner Seele gnädig sein, gemein gewesen war.
»Du kannst einfach nicht anders, wie, Großer?«
»Geht doch nichts über ein Liedchen, um die Stimmung zu heben.«
»Wenn du es sagst.«
George trank noch einen Schluck von seinem Bier. »Nein, nein, diesmal nicht«, sagte er mit schwerer Zunge und tätschelte Tam am Brustkorb. »Nicht: wenn ich es sage. Ich will …«, George unterdrückte ein Aufstoßen, »… einmal hören, was du zu sagen hast. Du bist der Mann, der Macher. Du bist mein Lehrer, mein Meister.«
»Ach was! Was redest du da!«
»Nein, ich mein’s ernst. Ich hab ernsthaft Respekt vor dir. Ernsthaften Respekt. Aber du redest nie über dich selbst. Erzähl mir was von dir – von DIR – was ist bei dir so los?«
»Da gibt’s nicht viel zu erzählen«, entgegnete Tam.
Trotz seiner Angetrunkenheit merkte George doch, dass sein Freund beunruhigt war. George hatte die Statur von seinem Vater geerbt, aber das Herz von seiner Mutter. Seine Brüder, und seine Schwester noch mehr, hatten sich gegen die Gewalt verhärtet. George und seine Mutter jedoch hatten Mitgefühl, eine Perle im Schmutz und Schlamm ihres Lebens, die sie sich gegenseitig poliert hatten. Seine Mutter war erst letztes Jahr gestorben, und zwar grausamer- und ungerechterweise an einer simplen Infektion, nachdem sie Jahrzehnte der Gewalt überlebt hatte.
»Du hast eine Familie«, beharrte George. »Du erzählst aber nie über sie.«
»Da gibt’s nicht viel zu erzählen.«
Tams Miene war starr, nur seine Augen zuckten.
»Du hast eine Tochter. Wie alt ist sie?«
»Fünfzehn«, sagte Tam mit schwacher Stimme, als gestehe er etwas.
»Ich frag doch bloß«, sagte George und drückte dem Älteren den Arm. »Ich will dich nur besser kennenlernen, Herrgott noch mal. Wenn dir das zu persönlich ist, kannst du mir einfach sagen, ich soll mich verpissen. Schließlich bin ich nicht dein Beichtvater.«
Tam nickte. Wieder meinte George, etwas in seinem Blick zu sehen.
»Du bist gar nicht katholisch, oder?«
»Meine Mutter war katholisch. Ich hab nichts gegen …«
»Es kümmert mich einen Scheiß, woran du glaubst. Herrgott, es ist schwer genug, überhaupt an was zu glauben, oder? Du bist mein Kumpel, und wenn du ein Protestantischer bist, ist mir das egal.«
Tam sagte nichts, sondern nickte nur. Ihm stand der Schweiß auf der Stirn. George trank noch einen Schluck Bier und beschloss, sich an seine bisherige Taktik zu halten und von sich zu erzählen. Blieb zu hoffen, dass Tam irgendwann sein Vertrauen erwiderte.
»Du hast Glück«, bemerkte George, verschränkte die Arme und lehnte sich zurück. Sie saßen nebeneinander auf der mit rotem Kunstleder bezogenen Bank. Weil er wollte, dass sein Kumpel sich entspannte, blickte er bewusst zur ovalen Bar. »Ich beneide dich um deine Tochter. Es verändert einen Mann, wenn er eine Tochter hat. Das heißt, meinen Vater natürlich nicht, aber der war auch speziell. Mich jedenfalls hat es verändert.«
George holte tief Luft. Allein das Wort Tochter brachte ihn schon aus der Fassung. Es war wie ein Riss in seiner Trunkenheit, ein Portal in einen anderen Bewusstseinszustand.
»Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast«, sagte Tam leise.
Da wandte sich George wieder zu ihm und grinste breit. »Hier, guck dir das mal an«, sagte er, knöpfte sein Hemd auf und zog es zurück, um Tam seine Brust zu zeigen. Dort prangte direkt über seinem Herzen in roter Tinte der Name Moll.
»Moll war deine Tochter?«, fragte Tam und trank einen Schluck.
»Nein, sie ist meine Tochter. Sie ist nicht tot. Sie lebt.«
Tam leckte sich über die Lippen. George sah ihm an, dass er mehr wissen wollte, sich aber nicht zu fragen traute. Er trank selbst einen Schluck Bier, und dann erzählte er Tam die ganze Geschichte.
»Kathleen Jamieson wirst du nicht kennen. Ich kam direkt nach der Schule mit ihr zusammen, und wie ich schon mal sagte, wurde ich mit knapp vierzehn rausgeschmissen, also fing ich früh an. Sie war meine erste große Liebe … und wohl auch meine einzige. Wir waren fünf, sechs Jahre zusammen, den größten Teil davon heimlich, weil ihre Familie was gegen mich hatte. Sie war ein nettes Mädchen, weißt du? Na ja, wir passten nicht auf, und sie wurde schwanger. Ich freute mich darüber, denn im Gegensatz zu anderen Typen wollte ich immer heiraten und Kinder haben. Schon als ich sechs, sieben Jahre alt war, träumte ich davon, irgendwann eine eigene Familie zu gründen …« George unterbrach sich und lachte. »Wahrscheinlich, weil meine ein einziger beschissener Albtraum war, oder?«
Tam erlaubte sich ein Lächeln. Dazu verzog er nur einen Mundwinkel, doch seine andere Gesichtshälfte blieb wachsam, fast traurig.
»Ihre Familie war echt fromm – du kennst doch die Sorte: für jeden Furz ein Ave Maria. Also war es schon schlimm genug, dass sie unverheiratet schwanger wurde, aber dann auch noch von so einem? Tja, natürlich beschlossen sie, dass sie das Baby kriegen musste. Ich kam sofort mit Verlobungsring und allem an, aber davon wollten sie nichts wissen. Sie sagten, sie hätte eine Fehlgeburt gehabt und würde sich jetzt bei einer Tante erholen. Ich war sicher, dass sie sie wie in den Sechzigern in ein Kloster gesteckt hatten. Das meinte jedenfalls meine Mutter. Sie war die Einzige aus meiner Familie, der ich es erzählt hab … das mit dem Baby.«
George steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und klopfte seine Taschen ab, bis Tam ihm Feuer bot. Dann nahm er einen langen Zug von der Zigarette und zuckte beim Inhalieren zusammen.
»Was ist passiert?«, fragte Tam.
Das war für George Ermutigung genug.
»Tja, kurz nach Weihnachten dachte ich immer noch an Kathleen, deswegen tauchte ich morgens nach der Messe bei den Jamiesons auf, um mich nach ihr zu erkundigen. Ich dachte, sie würden mich abwimmeln, aber als ich dort ankam, war Kathleen da und lag in den Wehen. Ihr Vater fehlte, wollte wohl seine Hände in Unschuld waschen, also war am Ende ich es, der sie, ihre Mutter und ihre Schwester ins Krankenhaus fuhr. Dort mussten wir eine Ewigkeit warten. Irgendwann hatte ich nichts mehr zu rauchen. Erst mitten in der Nacht wurde meine Tochter geboren, und ich weiß noch, dass ich und ein anderer werdender Vater uns das Warten mit einer Flasche Whisky versüßten. Nur … war es bei ihm schon das Dritte, und er wusste, dass er es mit nach Hause nehmen konnte.« In Erinnerung versunken hielt George seinen Blick auf einen Punkt in der Ferne gerichtet. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie es war, als ich sie zum ersten Mal sah.«
»Die Kleine?«
»Sie war so wunderschön. Hattest du auch dieses Gefühl …«
Tam zog eine Augenbraue in die Höhe.
»Molly. Ich nannte sie Molly. Sie hat meine Augen. Kathleen erlaubte mir, sie zu halten, obwohl ihre Mutter und ihre Schwester schimpften, ich würde nach Whisky stinken, und mich ständig anblökten, ich sollte sie ja nicht fallen lassen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber nichts macht einen Mann so demütig. Wenn mein Vater das hören könnte, würde er sich im Grabe umdrehen, aber ich wollte schon immer ein kleines Mädchen.«
»Es heißt, Mädchen machen ’ne Menge Ärger«, bemerkte Tam nur.
»Ich jedenfalls war bis über beide Ohren in sie verliebt. Ich hätte alles für sie getan. Als Kathleen aus dem Krankenhaus kam, gingen wir gemeinsam ihre Geburt anmelden und machten einen Spaziergang. Und da bat ich sie noch mal, mich zu heiraten, auf den Knien … auf meinen gottverdammten Knien im Glasgow Green, aber … sie meinte, sie wäre schon mit einem anderen zusammen.«
»Was?«
»Dafür hat ganz sicher ihre Familie gesorgt. So sicher wie das Amen in der Kirche. Die haben irgendeinen alten Bastard aufgetrieben, der bereit war, ein gefallenes Mädchen und ihr Balg zu nehmen. Diesen Leuten war einfach nicht klar, dass wir schon das Ende der Siebziger hatten. Genauer gesagt, neunzehnhundertsiebenundsiebzig, verdammt noch mal!«
»Sie haben sie verkuppelt?«
»Kathleen war völlig aufgelöst und weinte. Sie erklärte mir, das wäre der einzige Ausweg … Ihre Familie war wütend auf sie, aber zuzulassen, dass sie mich heiratete? Niemals, nur über ihre Leiche. Kathleen hatte sich verändert. War mir gegenüber kalt geworden. Du weißt ja, wie Frauen sind. Schlag sie dir aus dem Kopf, Georgie, sagte sie zu mir.«
»Das tut mir leid«, bemerkte Tam und trank einen großen Schluck. Die letzte Runde wurde ausgerufen.
George nickte, immer noch den Blick in die Ferne gerichtet. »Willst du noch eins?«, fragte er.
»Nein, ich bin bedient«, sagte Tam und wies mit dem Kopf auf die Bierpfütze in seinem Glas.
»Ach, komm schon, ist doch Zahltag«, beharrte George und knallte seine Brieftasche auf den Tisch.
Tam nickte zustimmend. George schwankte unsicher, nachdem er aufgestanden war, doch nach ein, zwei Sekunden fand er sein Gleichgewicht wieder.
»Danke, Großer«, bemerkte Tam, als George zurückkehrte und die leicht überschwappenden Gläser auf den Tisch stellte.
Eine Weile saßen sie nur schweigend da und beobachteten die anderen Gäste in der Bar. Es waren größtenteils Männer. Durch den Rauch war der Schankraum in bläuliches Licht getaucht, und George spürte, wie sein Kopf vor lauter Bier und Erinnerungen schwer wurde.
»Hast du je daran gedacht, von hier zu verschwinden?«, fragte er leise.
»Ab und zu schon«, bemerkte Tam zurückhaltend wie immer. »Warum?«
»Kann ich mich auf dich verlassen?«, fragte George und blickte Tam jetzt direkt an. Einen Moment wich Tam nicht mehr seinem Blick aus, sondern riss die Augen auf.
Er schluckte und leckte sich über die Lippen, als rechnete er mit etwas Furchterregendem.
»Du musst es für dich behalten.«
Tam nickte.
»Ich bin auf ein bisschen Geld gestoßen. Wie genau, solltest du nicht wissen, also werde ich’s auch nicht sagen, aber es ist genug – mehr als genug, um zu verschwinden – und genau das hab ich vor. Zu verschwinden. Jetzt bin ich noch da …«, fügte er hinzu und stieß Tam an, um ihm ein Lächeln zu entlocken, »und gleich nicht mehr.«
»Wohin willst du denn?«, fragte Tam, der plötzlich grau und verhärmt wirkte.
»Zuerst nach Norden, dann nach Süden. Aber ich gehe nicht allein.«
»Ich … Georgie, ich hab Familie. Ich bin ein verschwiegener Mensch …«
Wieder brach George in Gelächter aus, obwohl er unter der gehobenen Stimmung seiner Trunkenheit und Mitteilsamkeit todernst war.
»Ich meine doch nicht dich, Tam, ganz ruhig! Ich selbst mache mir ja schon ständig Sorgen, aber gegen dich bin ich gar nichts. Ich meine, ich kann dich gut leiden, aber deshalb will ich noch lange nicht mit dir durchbrennen.«
Tams Gesicht nahm wieder Farbe an. Er war zu dünnhäutig und mager, um knallrot zu werden, doch ihm stieg eindeutig Farbe in die Wangen.
George knöpfte nochmals sein Hemd auf und legte sich die rechte Hand aufs Herz, als wollte er einen Schwur ablegen.
»Ich hab sie nämlich gefunden, weißt du«, sagte er und hielt die Augen starr auf die hintere Wand des Portland Arms gerichtet.
»Wen, Kathleen?«
»Ich hab meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Kathleen ging mit so ’nem alten Knacker in den Norden, und ich war am Boden zerstört, aber … tja, ich versuchte, über sie hinwegzukommen. Du hast keine Ahnung, wie ich früher war: jeden Abend stockbesoffen und mit jeder mit, die mich haben wollte. Trotzdem wollten sie und die Kleine mir einfach nicht aus dem Kopf. Dieses Gefühl, meine eigene Tochter in den Armen zu halten, ihr Gesicht zu sehen und meins in ihrem. Das verändert einen. Hat es dich nicht auch verändert?«
Wieder sah George Tam um Bestätigung bittend an.
Tam sagte nur: »Sie sind schon niedlich, wenn sie klein sind.«
»Wie auch immer, ein paar Jahre war mir alles egal, wenigstens redete ich mir das ein. Ich wusste ja eh nicht, wo sie steckten. Kathleen war verschwunden – weg aus Glasgow –, und sie hatte praktisch gesagt, dass sie und die Kleine unerreichbar für mich wären. Aber dann lief mir Wee Malkie über den Weg, der überall im Norden auf Bohrinseln gearbeitet hat. Und der hatte Kathleen und die Kleine gesehen und erzählte, die Kleine wäre mir wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Wann war das?«
»Vor zwei Jahren. Ich hab rausgekriegt, wo sie wohnen.«
»In zwei Jahren kann man auch wieder umziehen.«
»Stimmt, aber nicht, wenn man ein großes Haus in Thurso hat. Ich weiß, wo sie sind.«
George leerte sein Glas und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
Tam lächelte wieder – es war das seltsame Lächeln, das er immer aufsetzte, wenn Peter in der Werkstatt war. Dabei hatte er die Augen zusammengekniffen, sodass es echt wirkte, aber irgendwie passte das trotzdem nicht zu seinen hochgezogenen Mundwinkeln. Sein Mund wollte lieber nicht zu viel preisgeben. Wenn Tam so lächelte, sah es eher so aus, als hätte er Schmerzen.
George wandte sich ernst und aufrichtig zu ihm und wünschte sich etwas, was sich auch Brendan McLaughlin hätte wünschen können: dass Tam mehr Manns wäre. Aber George war nicht sein Vater und daher fest entschlossen, dem kleinen, dünnen, ängstlichen Tam zu vertrauen, der sich mit Motoren so gut auskannte wie ein Chirurg mit menschlichen Körpern.
»Ich habe die Mittel«, sagte George langsam und beugte sich so nahe zu Tam, dass er die Wäschestärke seines Ausgehhemds riechen konnte. »Aller guten Dinge sind drei. Ich gehe erst in den Norden, um Kathleen zu fragen, ob sie mit mir kommt, und dann können wir drei zusammen fortgehen: ich, Kathleen und mein kleines Mädchen.«
»Wo willst du denn überhaupt hin?«
George neigte sich noch näher zu Tam und flüsterte: »Kann ich dir vertrauen?« Er drückte Tams Oberarm.
»Klar.«
»Hast du schon mal was von einem kleinen Ort namens Penzance in Cornwall gehört?«
»Cornwall? Ja.«
»Tja, da will ich leben, in Ruhe und Frieden, direkt am Meer. Dort werden wir sein: ich und meine eigene kleine Familie.«
»Wieso ausgerechnet da? Wen kennst du denn da?«
»Keinen. Aber die Familie meiner Mutter stammt von dort. Meine Mum ist dort aufgewachsen und hat mir früher davon erzählt: von dem offenen Land, dem Meer und den winzigen Häusern. Sie hatte ein Grundstück mit einem Cottage, am South West Coast Path, zwischen Sennen und Porthcurno. Ich schätze, das Cottage ist mittlerweile nur noch eine Ruine. Ich war nie da, aber sie hat mir Fotos gezeigt. Und sie hat es mir hinterlassen. Das war ein Geheimnis, niemand außer uns beiden wusste davon, auch nicht meine Geschwister. Hätte meine Mutter dorthin zurückgehen können, hätte sie das sicher getan. Sie hat mir alles darüber erzählt, und da will ich hin. Ich werde es instand setzen – neu aufbauen, wenn’s sein muss – und dann mit meiner Familie dort wohnen. Mit meiner eigenen Familie.«
»Du spinnst doch, Mann. Wenn Kathleen verheiratet ist, wieso sollte sie wieder was mit dir anfangen?«
»Würdest du dir mal dieses Gesicht ansehen, Tam? Wirf nur mal einen Blick darauf«, sagte George und reckte mit blitzenden Augen sein Kinn.
»Ich weiß, aber …«
»Was, aber? Sie liebt mich. Sie hat mich immer geliebt. Außerdem bin ich der Vater der Kleinen, und ich finde, sie verdient es, mich kennenzulernen.«
»Was willst du denn mit einem Baby?«
»Sie ist doch gar kein Baby mehr.«
»Wie alt ist sie jetzt?«
»Sieben.«
3
Angus Campbell
Freitag, 27. September 1985
»Ich komme, wenn ich fertig bin«, sagte Angus, ohne sich auch nur umzudrehen und sie anzusehen.
»Ich wollte jetzt auftragen.« Seine Frau stand mit gefalteten Händen an der Tür.
»Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden«, erwiderte er, über die Schreibmaschine gebeugt, und wedelte mit der Hand, als wollte er eine Schmeißfliege verscheuchen.
Drei Tage ging er schon nicht in sein Büro beim John O’Groat Journal, sondern saß an der Schreibmaschine, die einst Hazels Vater gehört hatte. Denn Maisie konnte jeden Moment kalben. Der Tierarzt hatte gesagt, in dieser Woche wäre sie fällig, und Angus behielt sie ständig im Auge. Er hoffte, sie würde so schnell wie möglich kalben, und lief abends, anstatt zu lesen, unruhig im Wohnzimmer hin und her, voller Sorge, Maisies Wehen würden am Sabbath einsetzen. Der Tierarzt hatte behauptet, Maisie käme allein klar, aber das konnte sich jederzeit ändern. Wenn es so weit war, würde sie ganz bestimmt seine Hilfe brauchen.
»Gott wird sicher dafür sorgen, dass das Kalb sich dreht und dass Maisie vor oder nach dem Sabbath kalbt, und wir werden ihr helfen«, hatte Hazel gesagt, als er ihr von seinen Sorgen erzählte.
»Bist du närrisch, Frau? Gott ist doch nicht der Vollstrecker unserer Wünsche!«
Sie wollte ihn ständig mit abgedroschenen Phrasen trösten, die so schal waren wie die Stücke Fladenbrot, die sie zur Kommunion aßen. Jedes Mal, wenn er sie auch nur ansah, füllte sich sein Herz mit Vitriol. Diese Frau war selbst für einen Heiligen eine schwere Prüfung.
Er arbeitete an einem Artikel mit der Schlagzeile VERWAISTEROTTERAUFDEMWEGEDERBESSERUNG. Er liebte Tiere – mehr als Menschen, wie er manchmal zugab –, doch dieser Artikel war wirklich unter seiner Würde. Sein ausgeprägtes journalistisches Talent war noch nicht entdeckt worden, und jetzt, kurz nach seinem dreiundvierzigsten Geburtstag, fragte er sich, ob sich das Zeitfenster für seine Entdeckung nicht langsam schließen und sich stattdessen die Tür zum Vergessen öffnen würde. Wegen Hazels Störung hatte er sich vertippt. Sie behinderte ihn ständig. Sobald der Artikel fertig war, musste er zur Redaktion des Groat in Wick fahren, um ihn abzuliefern.
Angus beendete den Artikel, klopfte die Seiten neben der Schreibmaschine ordentlich auf Kante und legte sie dann in einen Hefter. Es war demütigend, was für Artikel er schreiben musste: über Otter, Fehlverhalten von Stadträten und Gewinner von Wettbewerben, die niemanden interessierten. Der Herr hatte Größeres mit ihm vor.
Im März hatte der Streik der Bergarbeiter nach einem ganzen Jahr endlich sein Ende gefunden, doch im Groat war der Artikel erst auf Seite drei gebracht worden. Obwohl Angus gegen den Streik gewesen war, hätte er trotzdem gerne darüber geschrieben. Aber das hatte der Herausgeber selbst getan: zweihundert Wörter.
Angus betrachtete sich als Reporter, allerdings nicht für das John O’Groat Journal, sondern für die Times. Er träumte davon, von einer Story Wind zu bekommen, die weltweit veröffentlicht würde. Die Story war irgendwo da draußen, aber Angus wusste, dass er sie in sich finden konnte, genauso wie er Gott gefunden hatte.
Vor etwa einem halben Jahr hatte in der Redaktion eine Mitarbeiterin von Scottish Television angerufen, die auf der Suche nach Storys war. Im Gegensatz zu sonst war nicht seine Kollegin Amanda ans Telefon gegangen, sondern er. Die Frau von STV war nur eine Praktikantin, doch hatte sie gesagt, ihr Boss wäre an jedem Knüller interessiert, den sie hätten.
Dieser Knüller war es, abgesehen von der kalbenden Maisie, der all seine Gedanken beherrschte. Ein Knüller war seine Chance, berühmt zu werden.
Schließlich ging Angus nach unten zum Abendessen. Alle setzten sich, nachdem Angus Platz genommen hatte, und falteten die Hände, als er sein Gebet sprach.
Er schloss die Augen, und weil er Hunger hatte, sagte er schnell: »Wir danken dem Herrn für dieses Essen. Jesus ist unser bester Freund. Er ist unser König. Er allein kann unsere Herzen bewegen, Ihn noch mehr zu lieben. Wir brauchen Ihn jeden Tag. Unsere Kirche bleibt leer, wenn wir nicht mit aller Hingabe an Ihn glauben. Er allein kann die verschlossenen Herzen unserer ungläubigen Freunde öffnen. Er will unsere Gebete hören. Er entscheidet, welche Taten er darauf folgen lässt. Dies ist unser Privileg, und dies ist unsere Verantwortung für Sein Königreich, für unsere Kirche, für uns … Danke, Gott.«
Wie es ihnen beigebracht worden war, warteten die Kinder – die vierzehnjährige Rachael und der zwölfjährige Caleb –, bis er Messer und Gabel hob, dann erst griffen sie zu ihrem Besteck. Rachael entwickelte sich zu einem linkischen Teenager und hatte Pickel am Kinn. Caleb war klein und verstohlen, hatte einen verschlagenen Blick. Als sie noch klein waren, hatte er große Hoffnungen auf sie gesetzt – vor allem auf Caleb –, doch beide brauchten viel Führung.
Es gab Lammkoteletts, überbackenen Blumenkohl und Kartoffeln, und alles war kalt. Angus löffelte etwas Blumenkohl auf seinen Teller und testete die Temperatur.
Dann ließ er sein Besteck fallen, umklammerte mit beiden Händen die Tischkante und starrte Hazel an.
»Was bedeutet das, Frau? Sind wir Tiere, dass wir kalte Pampe essen sollen?«
»Ich … es … war warm. I-ich …«
Wenn sie stotterte, hasste er sie am meisten. Als würde all ihre Schwäche aus ihrem Mund herausquellen, sodass kein Platz mehr für Worte war.
Er hatte sich selbst eine Regel auferlegt: niemals die Frau vor den Kindern schlagen. Daher fegte er nur den Teller vom Tisch und stand auf, um in den Stall zu gehen.
»In einer Stunde bin ich wieder da, und du weißt, dass ich Besseres erwarte«, bemerkte er nur und zog sich Gummistiefel und Anorak an.
Als er ging, sahen ihm die drei nach, ihre Gesichter so bleich und geistlos wie ungebackene Brötchen.
Der Weg zu Maisies Pferch dauerte fünf Minuten, wenn man schnell ausschritt. Allein die Vorfreude, sie zu sehen, wärmte Angus die Hände, seinen ganzen Körper. Er hatte sie aufgezogen, seit sie sechs Monate war. Er liebte das samtige Rosa ihrer Nase, die starken Sehnen ihrer Beine, den Schwung ihrer Flanken, den wissenden, verehrenden Blick, mit dem sie ihn bedachte: passiv, anbetend, rein. Er sah ganz deutlich, dass Maisie ihn liebte, er war ihr Herr. Sie vertraute ihm vollkommen und war ihm zutiefst ergeben.
Angus war in Northbay auf der Isle of Barra als jüngster von drei Söhnen in einer Fischerfamilie aufgewachsen. Sein Vater hatte ein kleines Boot besessen, doch hatten die Campbells in ihrer Kate auch Tiere gehalten: Hühner, ein paar Schafe und Kühe und zwei Ponys. Als Kind war es Angus’ Aufgabe gewesen, für die Tiere zu sorgen.
Zwar blieb das Fischen der Haupterwerb der Familie, und der Gestank von Fischgedärmen durchdrang das Haus fast so stark wie die Frömmigkeit seiner Mutter, aber in den Ställen hatte er sich so sicher und geborgen gefühlt wie nirgend sonst. Der Geruch der Ställe hatte etwas Intimes an sich, etwas Warmes, Lebendiges. Wenn Angus die Kühe mit den Händen molk, waren wilde Kätzchen durchs Stroh gehuscht.
Seine Mutter hatte ihn Gottesfurcht gelehrt – und die Furcht vor ihrem Kochlöffel. Sein nach Salz riechender Vater mit den schwieligen Händen und dem vom Meereswind geröteten Gesicht hatte nichts getan, außer ihn jeden Tag im Stich zu lassen, wenn er die älteren Brüder zum Fischen mitnahm, während Angus zu Hause bei seiner Mutter bleiben musste.
Der Teufel findet schon Arbeit für müßige Hände, sagte sie immer zu Angus und wackelte mit ihrem Zeigefinger, an dem Fischschuppen klebten.
Die Tiere hatten ihm gezeigt, was recht war, und zwar mehr als seine Eltern. Oder er hatte die Lektionen, die die Tiere ihm gaben, einfach mehr beachtet: Primrose, die sich seinen kalten Fingern an ihrem Euter widersetzte, Bolt, der ihn abwarf, als er mit ihm über den Bach springen wollte. Durch seine Liebe zu den Tieren hatte er zu lieben gelernt. Sie hatten ihm zwar Grenzen aufgezeigt, doch hatten sie sich auch seinem Willen gebeugt. Am Ende hatte er Heiligkeit erfahren. Liebe konnte ihm nicht ins Gesicht zurückgeschleudert werden wie Sand.
Maisie fraß gerade, als er ihren Pferch betrat. Trotz ihres zum Platzen angeschwollenen Bauches kaute sie eifrig. Angus ging zu ihr und fuhr ihr mit der Hand über die Flanke.
»So ist es gut, mein Mädchen. Bald ist es so weit, dann helfe ich dir, es schnell wie der Blitz herauszubekommen. Wie der Blitz, versprochen. Alles wird einfach nur schön sein. Du weißt ja, dass ich für dich da sein werde. Du weißt, dass ich sehe, wie du wirklich bist, mein Prachtmädel. Übrigens siehst du heute Abend wieder wunderbar aus. Du bist wahrlich eine Schönheit.«
Gehorsam wandte sich die Kuh mit ihrer rosa Nase zu ihm und kaute methodisch. Angus umfasste ihren mahlenden Kiefer mit beiden Händen. Ihr Gesicht war das freundlichste, sanfteste, das er je gesehen hatte. Er fühlte sich gesegnet.
4
Margaret Holloway
Montag, 9. Dezember 2013
Obwohl der Unfall erst drei Tage her war, ging Margaret schon wieder arbeiten. Sie hatte nur einen einzigen Tag gefehlt, den Freitag danach, doch an diesem Tag war Stephen Hardy der Schule verwiesen worden. Sie fühlte sich hintergangen, wollte darüber aber unbedingt noch mit Malcolm sprechen.
Es hatte alle überrascht, dass Margaret so schnell zur Arbeit zurückgekehrt war. Ben hatte sie angefleht, noch die ganze Woche freizunehmen, aber sie wollte nicht. Sie hatte ein paar Schürfwunden im Gesicht und an den Armen, und ihre Rippen taten weh, wenn sie lachte oder sich drehte, das war schon alles.
»Wieso soll ich mich eine Woche krankmelden, wenn doch alles in Ordnung ist?«, hatte sie Ben gefragt und ihn mit großen Augen angesehen. »Außerdem sind bald Weihnachtsferien.«
»Hör auf den Arzt.«
Der Arzt hatte ihr erklärt, sie stehe noch unter Schock. Doch Margaret hatte Ben gesagt, es gehe ihr gut, und schließlich hatte er nachgegeben.
Ben war ein Bär von einem Mann mit dicken schwarzen Haaren und einem schiefen Lächeln. Margaret war mit ihren eins siebzig auch nicht gerade klein, aber neben ihm wirkte sie wie eine Liliputanerin. Ihre Liebe zueinander war urplötzlich gekommen, aus dem Boden geschossen, doch sie war zärtlich und fühlte sich richtig an. Sie waren seit der Uni in Bristol zusammen, als er in einem Englischseminar neben ihr saß – die Knie wie ein Frosch abgespreizt, weil er sie nicht unter die Schreibplatte zwängen konnte – und sie fragte, ob sie ihm einen Stift leihen würde, den er sich prompt hinters Ohr steckte, ohne sich während des gesamten Seminars auch nur eine einzige Notiz zu machen. Er stammte aus Liverpool, hatte einen melodischen Akzent und ein nettes Lächeln, und sie hatte ihn auf Anhieb gemocht.
Jetzt in ihrem Büro im dritten Stock musste Margaret wieder an sein Gesicht denken, als sie morgens zur Arbeit aufgebrochen war. Er war müde gewesen, verschlafen, und auf seinen Wangen mit dem Bartschatten zeigten sich die Abdrücke vom Kissen.
»Ich finde das unvernünftig«, hatte er noch mal gesagt, die Hände in die Taschen geschoben und die Achseln gezuckt. Sie hatte sich auf die Zehenspitzen gestellt, um ihm einen Kuss zu geben, und noch mal gesagt, es gehe ihr gut.
Am Nachmittag stand ihr eine Konferenz der stellvertretenden Rektoren bevor, auf der sie einen Vortrag über pädagogische Maßnahmen bei Verhaltensauffälligkeiten halten musste, daher arbeitete sie die Mittagspause durch. Neben ihrer Tastatur lag ein Eiersandwich, das sie nicht anrührte.
An dem Unfall auf der M11 waren über dreißig Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die meisten Verletzten waren im Traumazentrum im Royal London Hospital behandelt worden. Margaret wusste, dass sie Glück hatte, noch am Leben zu sein.
Sie war nervös und konnte sich schlechter konzentrieren als sonst. Jetzt suchte sie im Internet nach Meldungen über den Unfall. Es gab mehrere Berichte, sogar in der überregionalen Presse, denn es hatte ungewöhnlich viele Todesopfer und Verletzte gegeben, und der Sachschaden war riesig. Die Mail hatte den Unfall Londons schlimmste Massenkarambolage aller Zeiten genannt.
Obwohl sie sich alle Mühe gab, sich zu konzentrieren, wanderten ihre Gedanken immer wieder zum Unfall zurück. Die schlimmste Erinnerung daran war der Moment, als ihr Wagen sich um sie herum zusammenschob, der Airbag vor ihrem Brustkorb explodierte und der Benzintank barst. Jedes Mal, wenn sie daran dachte, fielen ihr weitere Details ein: das Geräusch von übereinanderschabendem Metall, ihre verschwitzten Handflächen am Lenkrad, das Muster der Schneeflocken, die die Windschutzscheibe verdunkelten.
Um ein Haar wäre sie bei lebendigem Leib in ihrem Wagen verbrannt, und die Vorstellung lähmte sie, ließ sie innerlich erstarren. Sie wusste nicht warum, musste aber wie unter Zwang immer wieder daran denken. Als sie das kurz gegenüber dem Arzt erwähnte, meinte der, dies sei ein Symptom für posttraumatischen Stress.
Sie war Atheistin und hatte nie zu Aberglauben geneigt, doch der Verbrannte war ihr wie ein Schutzengel erschienen, der sie im letzten Augenblick vor dem drohenden qualvollen Tod rettete. Sie hatte kaum mit ihm gesprochen, und er war einfach im Schneegestöber verschwunden, obwohl er offensichtlich selbst verletzt war. Im überfüllten Wartebereich des Krankenhauses hatte Margaret nach seinem Gesicht in der Menge gesucht, es aber nicht entdeckt.
Es klopfte an Margarets Bürotür, und dann kam Malcolm herein. Sie schob sich die Ärmel hoch.
»Ich habe gehört, du bist zurück. Wie geht es dir?«
Am Wochenende hatte er bei ihnen angerufen, doch Ben war ans Telefon gegangen.
»Ganz gut, danke. Ich bin froh, wieder hier zu sein.«
»Du hast Riesenglück gehabt. Was für ein Horror …«
»Ich weiß.«
»Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du mehr Zeit brauchst …«
»Danke. Ich wollte einfach arbeiten. Du weißt doch, wie das ist.«
Malcolm nickte, runzelte aber die Stirn.
»Ich hab das von Stephen erfahren«, sagte Margaret, stand auf, lehnte sich gegen ihren Schreibtisch und sah ihn direkt an.
»Ja, tut mir leid. Ich weiß, was du darüber denkst«, erwiderte er. »Ich hab mit Jonathan geredet …«
Jonathan war der Lehrplanbeauftragte.
»Wieso hast du darüber mit ihm geredet? Ich bin die Vertrauenslehrerin. Was hat Jonathan damit zu tun?«
Malcolm lächelte und wurde rot. »Hör zu, deine Meinung war natürlich die wichtigste, und ich habe sie zur Kenntnis genommen, aber letztlich lag die Entscheidung bei mir.«
»Ich habe dich gebeten, an Stephen zu denken, an sein Leben …«
»Margaret, die Entscheidung ist gefällt.«
»Du hattest kein Recht dazu.«
»Doch, genau das hatte –«
»Du wusstest, was ich davon halte!«
Malcolm schloss die Tür, und erst da wurde Margaret klar, dass sie geschrieen hatte. Ihr Herz raste, schlug deutlich spürbar gegen ihre Rippen. Es klopfte so heftig wie in dem Augenblick, als sie dachte, sie würde sterben.
»Es wurde vom Vorstand abgesegnet. Ich erteile nicht leichthin Schulverweise, bin aber sicher, dass es in diesem Fall das Richtige war. Schließlich habe ich die Polizei außen vor gelassen.«
»Dadurch wird es auch nicht besser.«
»Deine Argumente waren gewichtig, haben mich am Ende aber nicht überzeugt. Ich bin sicher, ein anderes Mal wird sich deine Ansicht durchsetzen.«
»Hier geht’s doch nicht um mich«, sagte Margaret und spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. »Es geht um ihn, ist dir denn nicht klar, was du getan hast?«
Dann begann sie zu weinen.
Malcolm fiel die Kinnlade nach unten, so geschockt war er.
Peinlich berührt und verwirrt versuchte Margaret sofort, ihre Fassung wieder zu gewinnen.
Um drei Uhr nachmittags stand sie vor einer Gruppe stellvertretender Rektoren verschiedener Londoner Schulen und hielt einen Vortrag über die Strategien, die die Byron Academy bei Verhaltensauffälligkeiten einsetzte. Die Konferenz fand in einer High School in Camden statt, einem Gebäude aus den Sechzigern mit niedrigen Decken und Neonbeleuchtung. Die Heizung lief jetzt im Winter auf vollen Touren. Margaret spürte, wie sich an ihrem Haaransatz Schweißperlen bildeten.
Sie hatte schon oft vor dieser Gruppe gesprochen, aber an diesem Tag fühlte sie sich jung und verletzlich. Da ihr Sandwich immer noch unangerührt in ihrer Tasche lag, knurrte ihr der Magen. Sie drückte eine Hand darauf, um ihn zum Schweigen zu bringen.
Sie prüfte ihre Notizen und beugte sich über den Laptop, wählte Schaubilder aus. Ihre Finger zitterten.
Sie war Expertin auf diesem Gebiet. Nicht nur weil sie seit sechs Jahren im Führungsgremium war, sondern weil sie sich hochgearbeitet und auf dem Weg mehrere Posten übernommen hatte: erst als Fachbereichsleiterin, dann als Leiterin des gesamten Förderbereichs. Sie war eine der jüngsten Rektorinnen in diesem Raum, doch auch eine der erfahrensten, das wusste sie.
»Danke für Ihr Kommen und Dank an John für den Kuchen«, setzte Margaret mit unsicherer Stimme an. Sie räusperte sich, griff nach dem Glas Wasser und bemerkte wieder, dass ihre Hand zitterte. Sie hörte leises Reden und Lachen.
Margaret strahlte die vor ihr sitzende Gruppe an und verschränkte die Hände. »Heute möchte ich nicht nur über Maßregelungen reden …«, sie spürte, wie ihr das Herz klopfte, »sondern über unsere Richtlinien in Bezug auf Drogen und Sexualerziehung und über vertrauensbildende Maßnahmen bei … bei …«
Die Notizen in ihrer Hand zitterten, sie verlor den Faden.
»Sie können es hier sehen«, setzte sie neu an und wandte sich zu dem Schaubild, das auf das Whiteboard projiziert worden war. Es zeigte einen Schüler, der mit gesenktem Kopf an seinem Platz saß. Die Worte, die sie über mangelnde Lernmotivation und Isolierung aus der Lerngruppe sagen wollte, wirbelten ihr wild im Kopf umher. Sie hatte diesen Vortrag schon so oft gehalten, aber jetzt hatte sie Mühe, die Worte hervorzubringen, die den Zusammenhang zwischen Verhalten und Leistung erklärten. Sie kannte das alles in- und auswendig, doch die Luft in ihren Lungen reichte einfach nicht, um den Satz zu beenden. Ein Schweißtropfen rann ihr zwischen den Schulterblättern den Rücken hinunter. Sie versuchte zu schlucken, aber ihr Mund war zu trocken.
Ihr zitternder Zeigefinger drückte zu fest auf die Taste für das nächste Schaubild, sodass sie versehentlich etwas übersprang und einen Moment mit der Maus hantierte – zitternder Cursor auf dem Bildschirm –, bis sie wieder zur richtigen Stelle zurückfand. Reiß dich zusammen, dachte sie.
In diesem sicheren, warmen Konferenzraum fühlte sie sich auf einmal gefangen, genau wie in ihrem brennenden Auto.
Als sie tief Luft holen wollte, schienen ihre Lungen zu blockieren. In der Hoffnung, sich zu fassen, wandte sie sich zum Schaubild, brachte jedoch kein Wort mehr hervor. Gleich würde sie in Ohnmacht fallen. Jedes Mal, wenn sie zu sprechen ansetzte, klang sie, als würde sie eine Treppe hinaufrennen.
»Verzeihung«, sagte sie schließlich, fasste sich an die Stirn und entdeckte, dass sie schweißnass war. Sie legte ihren Zeigestock nieder, nahm ihren Mantel und verließ den Raum.
Die Luft draußen war die reinste Erlösung. Margaret trug ein Kostüm und eine ausgeschnittene Bluse, und die Kälte brauchte sie jetzt. Sie wusste nicht, was mit ihr los war. Als ihr Herzschlag sich beruhigte, überkam sie Scham. Sie hatte doch tatsächlich vor Malcolm geweint, und jetzt hatte sie sich vor all ihren Kollegen im Umkreis noch mehr erniedrigt. Das sah ihr gar nicht ähnlich. Sie war eine zwar passionierte, aber durch und durch professionelle Lehrerin. Noch nie hatte sie einen Kollegen angeschrieen, war in Tränen ausgebrochen oder mitten in einem Vortrag zusammengeklappt.