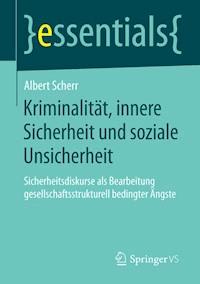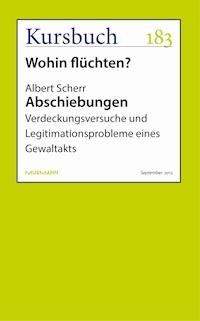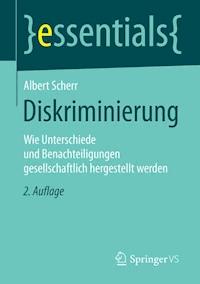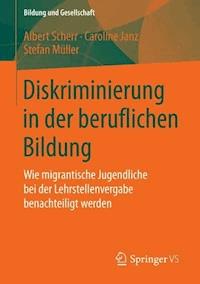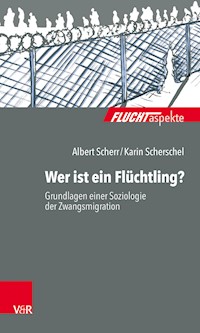
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fluchtaspekte.
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Flucht ist ein gesellschaftliches Konfliktfeld in einer global ungleichen Welt. Die Berufung auf menschenrechtliche (universelle) Werte tritt zugunsten nationalstaatlicher (partikularer) Interessen zunehmend in den Hintergrund. Globale Ungleichheiten führen dazu, dass Migration für viele die einzige Chance ist, unerträglichen Lebensbedingungen in ihren Herkunftsländern zu entkommen. Die Zielländer reagieren mit Abwehrmaßnahmen: Humanitäre Überlegungen verlieren zugunsten nationalstaatlichen politischen Interessen an Bedeutung. Karin Scherschel und Albert Scherr analysieren Flucht im Kontext von Globalisierungsprozessen sowie als gesellschaftliches Konfliktfeld. Sie fragen nach den Ursachen von Migration und nehmen die Gründe und die Folgen der restriktiven Fassung des Flüchtlingskonzepts in den Blick, mit denen Flüchtlingen Aufnahme und Schutz gewährt oder verweigert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geflüchtete Menschen psychosozialunterstützen und begleiten
Herausgegeben von
Maximiliane Brandmaier
Barbara Bräutigam
Silke Birgitta Gahleitner
Dorothea Zimmermann
Albert Scherr/Karin Scherschel
Wer ist ein Flüchtling?
Grundlagen einer Soziologieder Zwangsmigration
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 GöttingenAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Nadine Scherer
Satz und Layout: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6436ISBN 978-3-647-99910-4
Inhalt
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
1Vorbemerkungen
2Soziologie der Zwangsmigration und Flucht: Konturen eines Forschungsfeldes
2.1Institutionelle Konturen des Forschungsfeldes
2.2Konzeptionelle Ausgangspunkte der Soziologie von Flucht und Zwangsmigration
2.3Soziale Zwänge und Migrationssysteme
2.4Zwangsmigration: ein umstrittenes, aber unverzichtbares Konzept
3Globalisierung und Zwangsmigration
3.1Fluchtmigrationen im Spannungsfeld globaler Dynamiken und nationaler Partikularinteressen
3.2Citizenship und gewöhnlicher Nationalismus
3.3Ökonomie der Migration und Grenzregime
4Wer gilt als Flüchtling?
4.1Gegenwärtige Fluchtdynamiken
4.2Der Flüchtlingsbegriff: eine politische Kategorie
4.3Die Selektivität des Flüchtlingsbegriffs
4.4Selektivität im Asylverfahren
5Zwangsmigration und Flucht als Konfliktfeld: Abwehr, Solidarität und Proteste von Migrant*innen
5.1Menschenrechtliche Moral und gewöhnlicher Nationalismus
5.2Bevölkerungseinstellungen und zivilgesellschaftliche Solidarisierung
5.3Acts of Citizenship – Kämpfe um Rechte
5.4Solidarität und Aktivismus: Urban Citizenship und Sanctuary Cities
5.5Eine abschließende Bemerkung
Literatur
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
»Denn alles hängt davon ab, wer überhaupt als Mitmensch gilt …« – die Soziolog*innen Albert Scherr und Karin Scherschel zitieren in ihren grundlegenden Ausführungen zu einer Soziologie der Zwangsmigration den amerikanischen Philosophen Richard Rorty und lassen keinen Zweifel daran, dass sich bei aller Differenzierung und Abwägung unterschiedlicher Positionen das Spannungsverhältnis zwischen einer auf universalen Menschenrechten basierenden Haltung und nationalstaatlichen Interessen wohl momentan nicht auflösen lassen wird. Das Buch beginnt nach einführenden Vorbemerkungen und einem Gesamtüberblick mit einer Konturierung des Forschungsfeldes, in der die Autor*innen, die beide Mitglieder sowohl des DFG-Netzwerks »Grundlagen der Flüchtlingsforschung« waren, als auch des multi-disziplinären Netzwerks Fluchtforschung sind, eindrücklich darlegen, dass die soziologische Forschung nach wie vor überwiegend Nationalstaaten oder Nationalgesellschaften als ihre grundlegenden Analyseeinheiten betrachtet. Der Terminus der Zwangsmigration wird als umstrittenes Konstrukt beschrieben, das dennoch unverzichtbar ist, wenn grundlegende Menschenrechte im Heimatland nicht gewährleistet sind. Im dritten Kapitel werden Fluchtmigrationen im Spannungsfeld globaler Dynamiken und nationaler Partikularinteressen sowie der Begriff der »Citizenship« erläutert; dabei wird insbesondere die enge Verquickung zwischen Migrationsprozessen und der Entwicklung eines modernen, globalisierten Kapitalismus herausgearbeitet. Schließlich widmen sich Albert Scherr und Karin Scherschel ihrer Kernfrage: Wer ist ein Flüchtling? Bei der Beantwortung dieser Frage wird deutlich, dass zum einen nach der Genfer Flüchtlingskonvention und anderen völkerrechtlichen Konventionen an einem sehr begrenzten Flüchtlingsbegriff festgehalten wird, der einen großen Teil globaler Zwangsmigrant*innen ausschließt, und zum anderen die Anerkennung des Flüchtlingsstatus nicht nach einheitlichen, transparenten juristischen, sondern nach politisch motivierten Kriterien vonstattengeht. Abschließend umreißen die Autor*innen »Zwangsmigration und Flucht als ein gesellschaftspolitisches Konfliktfeld, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Frage, wer ein Recht auf Aufnahme und Schutz haben soll, Gegenstand gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen ist« (S. 79). Albert Scherr und Karin Scherschel haben mit dem vorliegenden Band eine klare und sehr eindringliche Analyse erstellt, wie wir uns individuell und als Gesellschaft mit den beschriebenen Spannungsfeldern auseinandersetzen und dass wir uns in ihnen positionieren müssen. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei dieser aufschlussreichen Lektüre!
Barbara Bräutigam
Maximiliane Brandmaier
Dorothea Zimmermann
Silke Birgitta Gahleitner
1Vorbemerkungen
Die Aufnahme und Integration, aber zunehmend auch die Abschreckung und Abwehr von Flüchtlingen sind seit einigen Jahren zentrale Themen der internationalen, europäischen und auch der deutschen Politik. Zunehmend dominant ist dabei in den Ländern des globalen Nordens eine Sichtweise, die unkontrollierte Einwanderung als Bedrohung, nicht zuletzt als Gefährdung von Wohlstand und Sicherheit in den Blick rückt. In der Folge werden die Erfordernisse und Möglichkeiten der Steuerung und Begrenzung durch Grenzsicherung, rechtliche Verschärfungen und die Steigerung der Zahl der erzwungenen Ausreisen akzentuiert. Gleichzeitig wird jedoch ökonomisch auf die Notwendigkeit von weiterer Arbeitskräftemigration hingewiesen, die durch politische Maßnahmen angeregt und reguliert werden soll.
Eine Politik, die im Kern auf die bedarfsorientierte Anwerbung von Arbeitsmigrant*innen bei gleichzeitiger Verhinderung unerwünschter Migration zielt, provoziert Kritik. Dabei wird normativ, vor allem in einer menschenrechtlichen Perspektive, argumentiert, dass es unzulässig sei, Menschen an Aus- und Einwanderung zu hindern, die sich aus unterschiedlichen Gründen – wie Bedrohung durch Kriege und Bürgerkriege, politische Verfolgung, aber auch Armut und Perspektivlosigkeit – gezwungen sehen, ihr Herkunftsland zu verlassen. Die Frage nach dem angemessenen und zulässigen Umgang mit Zwangsmigrant*innen und Flüchtlingen ist dabei eingebettet in eine generelle gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Vor- und Nachteile von Globalisierungsdynamiken sowie die Bedeutung von Menschenrechten für das Selbstverständnis nationalstaatlich verfasster Gesellschaften. Debatten über Migration sind dabei vielfach durch Vereinfachungen, Stereotype und Emotionalisierung geprägt. Sie sind ein diskursiver Schauplatz, an dem Ängste vor den vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahren einer zentral durch ökonomische Motive angetriebenen Globalisierungsdynamik projektiv artikuliert werden. Darauf hat insbesondere Zygmunt Bauman (1998, 2005, 2008) wiederkehrend hingewiesen:
»Flüchtlinge und Einwanderer, die von ›weit her‹ kommen, sich jedoch in der Nachbarschaft niederlassen wollen, eignen sich vorzüglich für die Rolle der Strohpuppe, die als Symbol für das Schreckensgespenst der ›globalen Marktkräfte‹ verbrannt wird […]« (Bauman, 2005, S. 94).
In diesem Buch soll es dezidiert nicht darum gehen, unsere politischen und normativen Positionen in diesem Konfliktfeld darzulegen und zu begründen. Vielmehr ist die Zielsetzung dieser Veröffentlichung, Grundlagen einer soziologischen Betrachtung von Zwangsmigration und Flucht darzustellen. D. h.: Es geht hier darum, gesellschaftliche Bedingungen in den Blick zu nehmen, die zu Flucht und Zwangsmigration führen, sowie die gesellschaftlichen Verhältnisse zu analysieren, in denen sich diese vollziehen und die den Rahmen bilden, in dem die darauf bezogenen politischen Auseinandersetzungen situiert sind. Normative Bewertungen und Forderungen, die diesbezüglich von unterschiedlichen Akteur*innen vorgenommen werden, sind in dieser Perspektive ein Gegenstand unserer soziologischen Analyse.
Im Sinne einer ersten Annäherung an die Thematik lässt sich feststellen: Migration war und ist immer schon ein Bestandteil der historischen und gegenwärtigen Dynamiken, die unter dem Begriff Globalisierung zusammengefasst werden. Dies betrifft unterschiedliche Formen wie u. a. die Migration im Kontext der Kolonialisierung außereuropäischer Länder, die Vertreibung von Minderheiten, die Flucht vor Kriegen und Bürgerkriegen sowie vor politischer Verfolgung, den Menschenhandel mit männlichen und weiblichen Arbeitssklaven sowie Zwangsprostituierten und nicht zuletzt auch aus ökonomischen Gründen herbeigeführte Arbeitskräftemigration. Potenzielle Zielländer unterscheiden dabei zwischen mehr oder weniger erwünschten oder unerwünschten Formen der Zuwanderung, insbesondere aus wirtschaftlichen und politischen Gründen. Mit dieser Differenzierung korrespondieren politische Versuche der Migrationssteuerung durch Anreize oder Restriktionen.
Fragt man nach den Ursachen und Gründen von Migration, dann wird in einem durchaus instruktiven und einflussreichen – aber allzu vereinfachenden – Denkmodell zwischen unterschiedlichen Push- und Pull-Faktoren (Druck- und Sog-Faktoren) und im Zusammenhang damit zwischen einer mehr oder weniger freiwilligen oder erzwungenen Migration unterschieden. Dies geht mit der Annahme einher, dass durch starke Push-Faktoren bedingte Zwangsmigration weiter zunehmen wird, da es global sehr viele Menschen gibt, die aufgrund der gravierenden Unterschiede der Lebensbedingungen zwischen den Staaten und Regionen der Weltgesellschaft veranlasst sind, ihre Lebensbedingungen durch Migration zu verbessern. In den einschlägigen öffentlichen Debatten, die in dramatisierender Weise kommende »Zuwanderungswellen« als eine Bedrohung darstellen, wird jedoch immer wieder übersehen, dass die Möglichkeit der Migration keineswegs für alle erreichbar ist, die gute Gründe hätten, ihr Herkunftsland zu verlassen: Migration, und dies gilt in besonderer Weise für interkontinentale Migration, ist voraussetzungsvoll; sie erfordert nicht zuletzt ökonomische Ressourcen, Ablösungsprozesse aus den bisherigen Lebenszusammenhängen und eine erhebliche Handlungsfähigkeit der Migrant*innen in Bezug auf den Migrationsprozess und die Neuorientierung im Zielland. Soziologisch ist also nicht nur zu klären, was mögliche Ursachen und Gründe von Zwangsmigration und Flucht sind, sondern auch, unter welchen Bedingungen Menschen in der Lage und daran interessiert sind, diese Option zu realisieren.
Noch vor jeder genaueren Betrachtung ist deshalb festzustellen, dass neben den Ungleichheiten der Lebensbedingungen (insbesondere Unterschiede der ökonomischen und ökologischen Situation, der politischen Ordnung und der Rechtsordnung) auch die Mobilitätschancen (u. a. Vorhandensein und Kosten von Transportmitteln) die Entstehung und den Verlauf von Migrationsbewegungen beeinflussen. So sind beispielsweise durch die Ausweitung des Flugverkehrs erhebliche Mobilitätserleichterungen geschaffen worden; genau aus diesem Grund sind aber die Flughäfen auch Orte einer rigiden Kontrolle, durch die als illegal etikettierte Migration verhindert werden soll. Dass etwa in einem Land wie Kanada nur so wenige Zwangsmigrant*innen ankommen, ist auch dadurch bedingt, dass die Seewege dorthin erheblich schwerer zu bewältigen sind als das Mittelmeer und zugleich der Landweg voraussetzt, die USA zu durchqueren, ohne dabei von den Migrationsbehörden aufgegriffen zu werden.
Im vorliegenden Zusammenhang sind auch die normativen und rechtlichen Dimensionen von Migration von entscheidender Bedeutung: Seit der Ernennung eines Hohen Kommissars für Flüchtlinge durch den Völkerbund 1921, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 1948 und der Verabschiedung der Konvention über den internationalen Status der Flüchtlinge 1993 hat die Überzeugung international an Einfluss gewonnen, dass Staaten nicht berechtigt sind, allein auf der Grundlage eigener ökonomischer und politischer Interessen über die Aufnahme oder Ablehnung von Migrant*innen zu entscheiden. Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte deklariert das Recht, »in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen« (AEMR Art. 14, Abs. 1), was jedoch keine einklagbaren individuellen Rechtsansprüche begründet. Mit der Genfer Flüchtlingskonvention wurde völkerrechtlich ein darüber hinausgehender Anspruch auf Aufnahme und Schutz für diejenigen verankert, die als Flüchtlinge gelten. Auf die einschlägigen rechtlichen Regelungen und darauf, was als Verfolgung oder verfolgungsgleicher Tatbestand gilt, werden wir in Kapitel 4 eingehen. Entscheidend ist hier zunächst nur, dass damit eine normative Begrenzung staatlicher Souveränität eingefordert und zum Teil auch in rechtlich einklagbarer Weise verankert wird. Dies ist folgenreich: Wie zwischen Asylsuchenden und Flüchtlingen einerseits, sonstigen Migrant*innen andererseits unterschieden wird, ist deshalb von erheblicher gesellschaftspolitischer Bedeutung. Denn diejenigen, die als Asylsuchende oder Flüchtlinge betrachtet werden, können ein Recht beanspruchen, nicht nur ihr Herkunftsland zu verlassen, sondern auch in anderen Staaten Aufnahme und Schutz zu beantragen.
Für die Soziologie der Flucht- und Zwangsmigration ist es von entscheidender Wichtigkeit, analytische Distanz zu solchen gesellschaftlichen Festlegungen einzunehmen. Soziologie kann die geltenden politischen und rechtlichen Klassifikationen der eigenen Forschung nicht als unhinterfragbare Ausgangspunkte zugrunde legen, sondern muss diese als voraussetzungsvolle und folgenreiche gesellschaftliche Festlegungen in den Blick nehmen. Definitionen der Asylpolitik und des Flüchtlingsbegriffs sind wirkungsmächtige soziale Tatsachen, deren Entstehung, Funktionen und deren soziale, politische sowie ökonomische Konsequenzen soziologisch zu analysieren sind. Deshalb genügt es nicht, allein die gesellschaftlichen Ursachen, Regulierungen und Folgen von Migrationsbewegungen zu betrachten. Vielmehr ist es klärungsbedürftig, warum und wie zwischen sogenannter freiwilliger Migration sowie Flucht und Zwangsmigration unterschieden wird und welche Auswirkungen diese migrationspolitischen Selektionen haben. Wir nehmen in diesem Buch deshalb die Perspektive einer reflexiven Soziologie ein, die gesellschaftlich wirkungsmächtige Klassifikationen nicht als gegebene Tatsachen voraussetzt, sondern als ein soziologisch erklärungsbedürftiges Phänomen versteht.
Zum Aufbau des Buches: Wir betrachten zunächst im zweiten Kapitel die Entwicklung des Forschungsfeldes Flucht- und Zwangsmigration und ordnen dieses in den Kontext der Migrationsforschung ein. Daran anschließend skizzieren wir im dritten Kapitel zentrale Aspekte einer gesellschaftstheoretischen Betrachtung, die Zwangsmigration im Kontext globaler Ungleichheiten diskutiert. Vor diesem Hintergrund wird im vierten Kapitel näher darauf eingegangen, was die Flüchtlingskategorie als politisch und rechtlich folgenreiche Festlegung kennzeichnet. Auf dieser Grundlage nehmen wir dann im fünften Kapitel Flucht als gesellschaftspolitisches Konfliktfeld in den Blick und befassen uns mit den Abwehrhaltungen und Solidaritätsbewegungen im Kontext von Flucht und Zwangsmigration.
Zur Terminologie: Wir verwenden den Begriff Zwangsmigration im Folgenden als eine übergreifende Kategorie, die Fluchtmigration als einen spezifischen Fall einschließt. Unter welchen Bedingungen Zwangsmigrant*innen veranlasst sind, sich selbst als Flüchtlinge zu bezeichnen, und unter welchen Voraussetzungen sie eine Chance haben, politisch und rechtlich als Flüchtlinge anerkannt zu werden, wird im vierten Kapitel dargestellt.
Diese Veröffentlichung ist als ein Grundlagentext konzipiert, dessen Lektüre keine fundierten Vorkenntnisse der Migrationssoziologie und der Flüchtlingsforschung voraussetzt. Wir stellen ausgewählte theoretische Modelle, analytische Konzepte und Ergebnisse der empirischen Forschung in der Absicht dar, damit zur Versachlichung einer Debatte beizutragen, in der Ängste und Bedrohungsszenarien allzu einflussreich sind und politische Ideologien sowie moralische Positionierungen wiederkehrend an die Stelle einer informierten und differenzierten Betrachtung der Wirklichkeit globaler Migrationsdynamiken treten.
2Soziologie der Zwangsmigration und Flucht: Konturen eines Forschungsfeldes
Bereits bei den Klassikern der Soziologie wird Arbeitskräftemigration als ein Bestandteil der Etablierung des industriellen Kapitalismus thematisiert, und erste Projekte der soziologischen Migrationsforschung wurden früh in der Chicago School der 1920er Jahre realisiert (s. Aigner, 2017; Treibel, 2011). Die Migrationssoziologie hat sich seit den 1970er Jahren als anerkannter Teilbereich soziologischer Forschung etabliert. Eine eigenständige sozialwissenschaftliche Forschung über Flucht und Zwangsmigration hat sich dagegen erst ab den 1980er Jahren entwickelt. Der sozialwissenschaftliche Blick auf Migration in der Entstehungsphase der Soziologie umfasst zwar durchaus auch ein Wissen über die Bedeutung des Sklav*innenhandels, also einer extremen Form von Zwangsmigration. So wird z. B. bei Marx (1890/1970, S. 777 ff.) auf die große Bedeutung des Handelns mit Sklav*innen für die Entstehung des industriellen Kapitalismus und »die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd« auf Sklav*innen hingewiesen. Die Bedeutung unterschiedlicher durch ökonomische Not, Kriege und politische Zwangsmaßnahmen ausgelöster Formen der Migration für die Entstehung und Entwicklung moderner Gesellschaften wurde in der Soziologie des 20. Jahrhunderts jedoch weitgehend vernachlässigt.1
Dies ist zweifellos eine Folge davon, dass die Soziologie ihr Interesse vor allem auf Entwicklungen innerhalb der Nationalgesellschaften des globalen Nordens gerichtet hat sowie überwiegend von der fortschrittsoptimistischen Vorstellung beeinflusst war, dass Zwangs- und Gewaltverhältnisse wie Menschenhandel und Vertreibung im Prozess der Modernisierung an Bedeutung verlieren würden, es sich also eher um historische Phänomene als um Kennzeichen der Gegenwartsgesellschaft handelte.2 Infolgedessen war und ist das zentrale Interesse der Migrationssoziologie auf die Betrachtung der Folgen von Arbeitsmigration in den jeweiligen Aufnahmegesellschaften gerichtet. Dementsprechend setzen sich die Autoren der klassischen Studien der Chicago School (s. etwa Znaniecki u. Thomas, 1928/1984) insbesondere mit den Schwierigkeiten von Integrationsprozessen der unterschiedlichen Einwanderungsgruppen sowie den Abwehrhaltungen der ansässigen Bevölkerung auseinander. In der deutschen Migrationssoziologie waren seit den 1960er Jahren die Möglichkeiten und Erfordernisse der Integration von Arbeitsmigrant*innen und die Analyse ihrer Benachteiligungen im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt zentrale Themen. Zudem wurden im angelsächsischen und auch im deutschen Kontext gesellschaftliche Folgen von Einwanderung in den Debatten über Multikulturalismus und Ethnizität thematisiert (s. dazu Bommes, 2011; Treibel, 2011; Müller u. Zifonun, 2010).