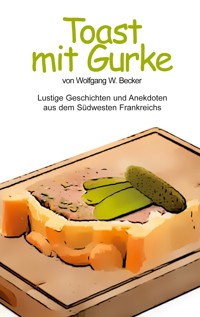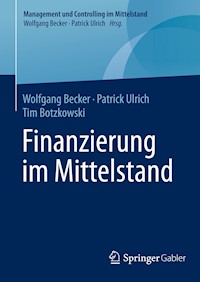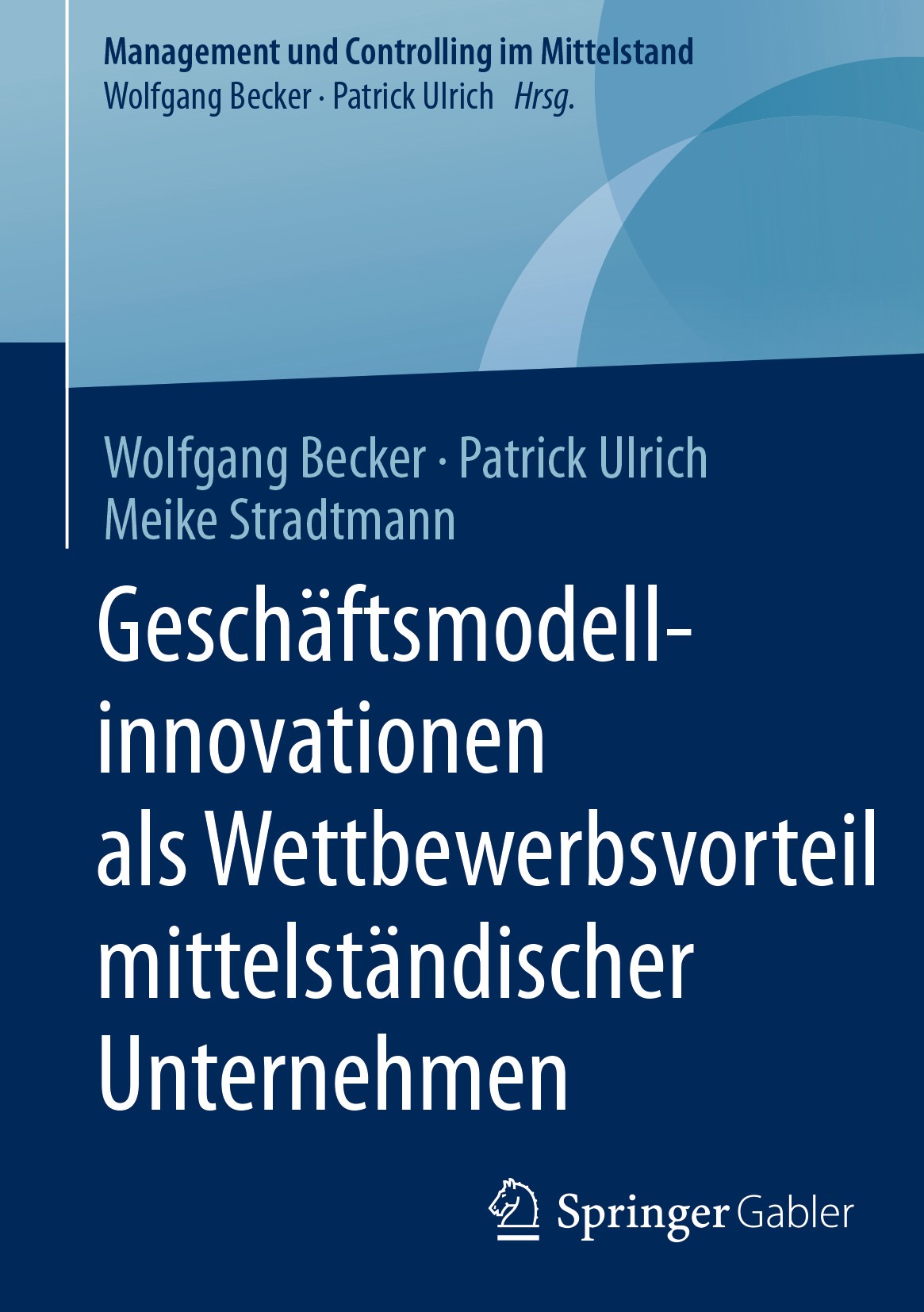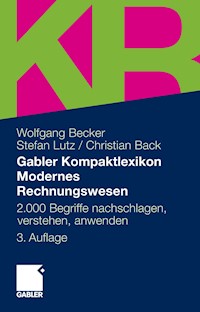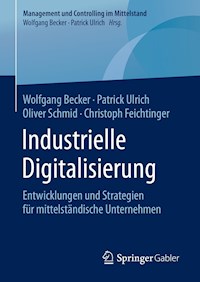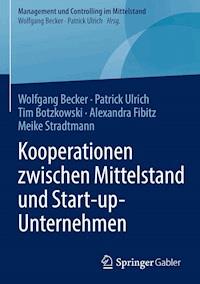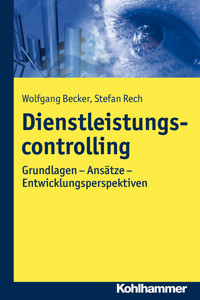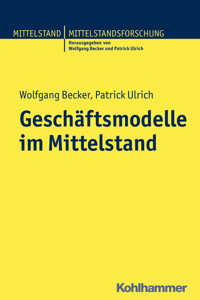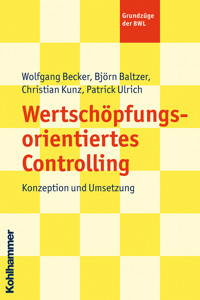
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Controlling ist als moderne Unternehmensfunktion heute unverzichtbar. Mit seinen Instrumenten sichert es nicht nur den nachhaltigen Unternehmensbestand, sondern ermöglicht auch die proaktive und zielgerichtete Lenkung des unternehmerischen Handelns im Sinne des Unternehmenszwecks der Wertschöpfung. Erklärtes Ziel dieses neu konzipierten Buches ist es daher, aus einer spezifisch wertschöpfungsorientierten Perspektive den Wirkungsbereich des Controllings in Theorie und Praxis darzustellen, wobei neben der theoretischen Fundierung auch der praktischen Umsetzbarkeit besondere Bedeutung zukommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Becker, Björn Baltzer, Patrick Ulrich
Wertschöpfungsorientiertes Controlling
Konzeption und Umsetzung
unter Mitarbeit vonTim Botzkowski, Bianca Brandt, Robert Ebner,Harald Eggeling, Christian Hilmer,Robert Holzmann und Maria Vogt
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-021640-2
E-Book-Formate:
epub: ISBN 978-3-17-025694-1
mobi: ISBN 978-3-17-025695-8
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil I: Grundlagen
1 Einführung
1.1 Terminologie
1.2 Historische Entwicklung
1.3 Status quo der Controlling-Wissenschaft im deutschsprachigen Raum
1.4 Status quo der Controlling-Praxis im deutschsprachigen Raum
2 Theoretische Grundlagen des Controllings
2.1 Systemtheorie
2.2 Situativer Ansatz
2.3 Neue Institutionenökonomik
2.4 Verhaltenswissenschaften
2.5 Soziologischer Institutionalismus
3 Wertschöpfungsorientierte Controlling-Konzeption
3.1 Bedeutung und Elemente von Controlling-Konzeptionen
3.2 Begründung der wertschöpfungsorientierten Controlling-Konzeption
3.3 Vergleich und Bewertung des wertschöpfungsorientierten Controllings
Teil II: Elemente des wertschöpfungsorientierten Controllings
4 Philosophie und Ziele des Controllings
5 Funktionen und Aufgaben des Controllings
5.1 Abstimmungsfunktion
5.2 Informationsfunktion
5.3 Aufgabenfelder
6 Aufgabenträger des Controllings
7 Prozessuale Aspekte des Controllings
8 Instrumente des Controllings
8.1 Begriffsabgrenzung
8.2 Bedeutsame Instrumente des Controllings
8.2.1 Bilanzkennzahlen
8.2.2 Kosten-, Erlös- und Ergebnisrechnung
8.2.3 Verrechnungspreise
8.2.4 Budgetierung
8.2.5 Working Capital-Kennzahlen und Liquiditätsplan
8.2.6 Verfahren der Investitionsbeurteilung
8.2.7 Wertorientierte Kennzahlen
8.2.8 Balanced Scorecard
8.2.9 Berichtswesen
8.2.10 Anreizsysteme
8.3 IT-Unterstützung im Controlling
9 Organisation des Controllerbereichs
9.1 Einordnung in das Unternehmen
9.2 Binnenorganisation des Controllerbereichs
9.3 Anforderungen an die Person des Controllers
9.4 Zusammenarbeit des Controllerbereichs mit anderen Bereichen
9.4.1 Controllerbereich und Externes Rechnungswesen
9.4.2 Controllerbereich und Treasury/Finanzen
9.4.3 Controllerbereich und Internes Consulting
10 Erfolgsanalyse des Controllings
Teil III: Anwendungsfelder
11 Controlling in Funktionsbereichen
11.1 Primäre Aktivitäten
11.1.1 Supply-Chain- und Logistik-Controlling
11.1.2 Produktions-Controlling
11.1.3 Marketing-Controlling und Vertriebs-Controlling
11.2 Unterstützende Aktivitäten
11.2.1 Personal-Controlling
11.2.2 Risiko-Controlling
11.2.3 IT-Controlling
11.2.4 F&E-Controlling
12 Situative Anpassung des Controllings
12.1 Controlling in internationalen Konzernen
12.2 Controlling im Mittelstand
12.3 Controlling im öffentlichen Sektor
12.4 Controlling in projektorientierten Unternehmen
12.5 Controlling in Non-Profit-Organisationen
Teil IV: Entwicklungsperspektiven des Controllings
13 Internationale Perspektive des Controllings
13.1 Controlling in den USA
13.2 Controlling in Russland
14 Entwicklungen im Umfeld des Controllings
14.1 Compliance und Controlling
14.2 Ethik und Controlling
14.3 Corporate Governance und Controlling
14.4 Steuern und Controlling
Literaturverzeichnis
Informationen zu den Autoren
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Im Themengebiet ›Controlling‹ hat man als Leser die Auswahl zwischen zahlreichen Lehrbüchern sowie unzähligen Fachbüchern. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, mit diesem in Erstauflage erscheinenden Lehrbuch eine Marktlücke zu schließen. Unser Lehrbuch unterscheidet sich von anderen Werken unter anderem durch seine konzeptionelle Ausrichtung: Es basiert durchgängig auf einem wertschöpfungsorientierten Verständnis von Controlling, welches von Wolfgang Becker Anfang der 1990er Jahre konzipiert und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Der wissenschaftliche Kodex gebietet es jedoch, dass wir den Lesern unser eigenes Controlling-Verständnis nicht unkommentiert und unreflektiert präsentieren, sondern vielmehr auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu konkurrierenden Meinungen aufzeigen und bewerten.
Nach der Lektüre dieses Buches verfügen die Leser über umfassende Kenntnisse zu allen wesentlichen Aspekten des Controllings. Gleichzeitig haben wir ein hinsichtlich Format und Umfang kompaktes Lehrbuch konzipiert. Vor diesem Hintergrund war es unvermeidlich, an einigen Stellen eine Auswahl der Inhalte vorzunehmen, wie bspw. bei den Instrumenten des Controllings. Allerdings bieten wir neben dem üblichen Literaturverzeichnis am Ende jedes Kapitels ein kommentiertes Quellenverzeichnis, welches zu einem themenspezifischen Weiterlesen ermuntern soll.
Den Anforderungen an ein modernes Lehrbuch wollen wir nicht nur durch die sprachliche und optische Aufbereitung, sondern insb. auch durch die Zusammenstellung der Inhalte gerecht werden. So stellen wir theoretisch-konzeptionelle nicht einfach neben anwendungs- und praxisorientierte Ausführungen, sondern verknüpfen beide. Daher richtet sich dieses Buch nicht nur an Bachelor- und Masterstudenten an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sondern ebenso an Studenten in Weiterbildungsstudiengängen sowie an Praktiker, die sich im Selbststudium fortbilden möchten. Wiederholungsfragen am Ende der einzelnen Kapitel ermöglichen jedem Leser eine Kontrolle seines Lernerfolgs.
Der Aufbau dieses Lehrbuchs in vier Teilen ist primär auf eine sequentielle Bearbeitung ausgelegt, allerdings ermöglicht das umfassende Stichwortverzeichnis auch, einen Fokus auf spezifische Themen zu legen. Durch die zahlreichen Querverweise im Buch, welche die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Inhalten aufzeigen, ist darüber hinaus auch ein Querlesen möglich.
Im ersten Teil wird nach einer Klärung der wesentlichen Begrifflichkeiten ein Bogen von den historischen Anfängen hin zum aktuellen Stand des Controllings gespannt. Anschließend wird das theoretische Fundament des wertschöpfungsorientierten Controllings erläutert und unser Verständnis in das Spektrum der Controlling-Konzeptionen eingeordnet.
Im zweiten Teil werden vor dem Hintergrund dieses wertschöpfungsorientierten Verständnisses alle relevanten Teilaspekte des Controllings erläutert:
• Philosophie und Ziele
• Funktionen und Aufgaben
• Aufgabenträger, Prozesse und Organisation
• Instrumente und Werkzeuge
Der zweite Teil schließt mit Überlegungen zum Erfolg des Controllings.
Nach dieser allgemeinen Betrachtung des Controllings werden im dritten Teil spezielle Anwendungsfelder analysiert. Zu diesem Zweck greifen wir zunächst auf das im Vorfeld vorgestellte Modell der Wertkette zurück und untersuchen die Spezifika des Controllings in primären und unterstützenden Funktionsbereichen. Die Ausführungen gehen hierbei von einem national tätigen, produzierenden Unternehmen gehobener Größe aus. Anschließend weichen wir von diesen Annahmen ab und gehen auf Besonderheiten des Controllings in anderen Unternehmenstypen ein.
Der vierte Teil dient schließlich zur Abrundung der vorangegangenen Ausführungen. Nunmehr ausgestattet mit detailliertem Wissen über das Controlling im deutschsprachigen Raum, blicken wir auf das Controlling im internationalen Kontext und betrachten hierbei exemplarisch die USA sowie Russland. Zu guter letzt beschäftigen wir uns mit bedeutsamen aktuellen Entwicklungen innerhalb und rund um das Controlling. Die nachfolgende Abbildung fasst den Aufbau dieses Buchs nochmals in grafischer Form zusammen.
Herzlich bedanken möchten wir uns einerseits bei unseren Interviewpartnern Prof. Dr. Thomas Egner, Prof. Dr. Sergej Falko, Dr. Michael Kieninger und Dr. h.c. Frank-J. Weise sowie andererseits bei den Lehrstuhlmitarbeitern Lena Binninger (v. a. Enddurchsicht), Tim Botzkowski (v. a. Abschnitte 8.2.7, 12.1 und 12.5), Bianca Brandt (v. a. Abschnitte 8.2.10, 9.3, 11.2.1 und 11.2.5), Robert Ebner (v.a. Abschnitte 8.2.4 und 11.1.1), Harald Eggeling (v. a. Abschnitte 8.2.6, 9.2 und 9.4.2), Liudmila Häusser (Abschnitt 13.2), Christian Hilmer (v.a. Abschnitte 8.2.1, 9.4.4, 11.1.2 und 11.1.3), Robert Holzmann (v.a. Abschnitte 8.2.2, 9.3 und 14.1), Dr. Christian Kunz (Abschnitt 12.4), Maria Vogt (v. a. Abschnitte 8.2.8 und 12.2), Lisa Zimmermann (v. a. Abschnitt 14.2), bei Dr. Sofya Malikova (Abschnitt 13.2) sowie bei unseren studentischen Hilfskräften für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Lehrbuchs. Für die sekretariatsseitige Unterstützung bedanken wir uns bei Jutta Eichhorn. Ein besonderer Dank gebührt unserem Verlagsleiter Dr. Uwe Fliegauf vom Kohlhammer Verlag, der unsere Projekte nun schon seit mehreren Jahren mit großem Interesse und stetigem Rückhalt betreut.
Wir wünschen allen unseren Lesern eine angeregte Lektüre. Über jedes Feedback, seien es Lob oder Verbesserungsvorschläge, freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse [email protected].
Bamberg, im Sommer 2013
Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker
Dr. Björn BaltzerDr. Patrick Ulrich
Teil I: Grundlagen
1 Einführung
1.1 Terminologie
Neben ›Controlling‹ trifft man in der Betriebswirtschaftslehre auf eine Reihe verwandter Begriffe. Um »Sprachverwirrungen« (Roso/Vormweg/Wall 2003, S. 61), welche durch eine ungenaue und/oder inkonsequente Verwendung dieser nahestehenden Begriffe entstehen können, von vornherein zu vermeiden, wollen wir wesentliche Termini gleich zu Beginn dieses Buches erläutern und voneinander abgrenzen. Zwar kann dies an dieser Stelle nur in knapper Form erfolgen, allerdings werden uns die nachfolgenden Begriffe an vielen späteren Stellen wieder begegnen und dort konkretisiert.
Ausgangspunkt der terminologischen Untersuchung ist der englische Wortstamm ›control‹ welcher selbst wiederum lateinische Wurzeln aufweist (mehr dazu in Kap. 1.3). Schlägt man dieses Wort in einem allgemeinen zweisprachigen Wörterbuch nach, so findet man ein Verb sowie ein Substantiv mit jeweils einer Vielzahl unterschiedlicher Übersetzungsmöglichkeiten, welche sich auf die Alltagssprache sowie auf unterschiedlichste Wissenschaftsdisziplinen beziehen. Für die Betriebswirtschaftslehre sind hierbei zwei Bedeutungsrichtungen von Control von besonderer Relevanz (vgl. Schwarz 2002, S. 3 ff.): Einerseits Überwachung und Kontrolle sowie andererseits Beherrschung und Steuerung. Diese beiden Bedeutungsrichtungen von Control lassen sich mit dem Managementzyklus in seiner einfachsten Form in Verbindung bringen, nach der er aus den Phasen der Planung, der Steuerung und der Kontrolle besteht (vgl. Hahn/Hungenberg 2001, S. 45 ff.). Wenn Horngren et al. in ihrem im angloamerikanischen Raum weit verbreiteten Lehrbuch den Managementzyklus in die beiden Phasen Planning und Control (vgl. Horngren et al. 2008, S. 9 ff.) unterteilen, so wird deutlich, dass Control Steuerung und Kontrolle umfasst. Das Verbalsubstantiv Controlling meint hierbei die Ausübung von Control, d. h. die Aktivitäten des Steuerns und Kontrollierens des Unternehmensgeschehens. Der Bezug zum Managementzyklus macht hierbei deutlich, dass Controlling nach angloamerikanischem Verständnis Aktivitäten umfasst, die von Managern auf allen Hierarchiestufen wahrgenommen werden.
Als Controller wird im englischsprachigen Raum ein Stelleninhaber bezeichnet, welcher das Management bei Planning und Control unterstützt, d. h. während des gesamten Managementzyklus. Hierzu erledigt er eine Vielzahl von Aufgaben, welche unter dem Begriff Controllership oder Controller Function zusammengefasst werden. Der Controller selbst macht somit kein Controlling, sondern er führt Führungsunterstützungsaufgaben aus. Führungsaufgaben übernehmen Controller nur dann, wenn sie als Abteilungsleiter einem Controllerbereich vorstehen (vgl. Hahn/Hungenberg 2001, S. 265).
Hinsichtlich der soeben dargelegten Bedeutung der Begriffe Control(ling), Controller und Controllership herrscht im englischen Sprachraum weitgehendes Einvernehmen. Sprachliche Schwierigkeiten ergaben sich allerdings bei der Übernahme des Konzepts des Controllers und des mit ihm verbundenen Aufgabenbereichs der Controllership aus den USA in den deutschsprachigen Raum ab den 1950er Jahren (siehe Kap. 1.3). Hierbei wurde zunächst versucht, geeignete deutschsprachige Begriffe zu finden. So wurden für die Position des Controllers bspw. Bezeichnungen wie Führungsrechner oder Wirtschaftlichkeitsprüfer vorgeschlagen. Da sich letztlich jedoch kein geeignetes deutsches Wort finden ließ, wurde stattdessen der Begriff Controller eingedeutscht und wird inzwischen auch im Duden geführt.
Dieselbe Problematik stellte sich beim Wort Controllership: Auch hier wurden zahlreiche deutsche Entsprechungen diskutiert (vgl. Harbert 1982, S. 36), ohne dass man sich jedoch auf einen Begriff einigen konnte. So bürgerte sich letztlich anstelle des ursprünglichen Begriffs Controllership für das Aufgabenspektrum des Controllers im deutschsprachigen Raum das missverständliche Wort Controlling ein. Die im angloamerikanischen Raum übliche Unterscheidung zwischen Controlling als Führungsfunktion und Controllership als Führungsunterstützungsfunktion wurde im deutschsprachigen Raum somit nicht aufrechterhalten, sondern zumindest sprachlich verwischt. Hieraus resultiert folgende Schwierigkeit (vgl. Eschenbach/Niedermayr 1996, S. 50 f.): Wenn in der deutschsprachigen betriebswirtschaftlichen Literatur von Controlling die Rede ist, dann können damit im ursprünglichen englischen Sinne zwei Bedeutungen gemeint sein:
Controlling, also die Wahnehmung von Control
Wir wollen im vorliegenden Buch an der sprachlichen Trennung zwischen Controlling als Führungsfunktion und Controllership als Führungsunterstützungsfunktion festhalten. In diesem Sinne »[. . .] bedeutet Controlling die Steuerung des Unternehmens im Rahmen einer vorgegebenen Zielrichtung und ist eine Aufgabe des Managements.« (Eschenbach/Niedermayr 1996, S. 50 f.). Als ›vorgegebene Zielrichtung‹ dient nach unserer Auffassung der Wertschöpfungszweck von Betrieben. Hierdurch bleibt das Konzept des Controllings nicht allein auf gewinnorientierte Unternehmen beschränkt, sondern ist in jedem Betriebstyp anwendbar, wie z. B. auch im öffentlichen Sektor (siehe ) oder in Non-Profit-Organisationen (siehe ). Bei unserem wertschöpfungsorientierten Controlling-Verständnis ist somit grundsätzlich die Anschlussfähigkeit an die internationale Literatur sichergestellt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!