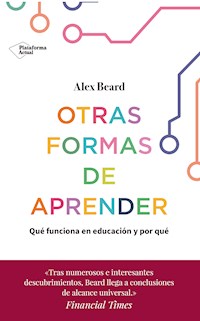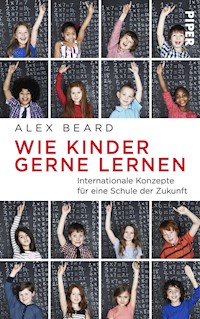
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Auf der Spur der glücklichsten Schüler von Lima bis London Lernen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Egal wo wir geboren werden, egal wie viel wir besitzen – wir sind die Summe unseres Wissens. Unsere Ausbildung bestimmt darüber, wie viel wir verdienen, wie zufrieden wir sein werden und wie lange wir leben. Bildungsexperte Alex Beard beobachtet daher mit Sorge, dass die Bildungslandschaft mit dem Wissensbedürfnis der Menschen nicht mehr mithalten kann. Wir leben in einem Informationszeitalter, doch unsere Schulen sind Relikte einer industriellen Ära. Auf der Suche nach der Schule der Zukunft bereist er die Bildungsfabriken Koreas, erkundet das Inklusions-Geheimnis finnischer Schulen, spricht mit den Erfindern der PISA-Studie und ergründet so die Wurzeln wahrer Kreativität. Wie Bildung im 21. Jahrhundert aussehen sollte Alex Beard ist der international renommierte Bildungsexperte von Teach First
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deÜbersetzung aus dem Englischen von Franka Reinhart und Claudia Van Den Block© 2017 Alex BeardDie Originalausgabe erschien 2018 in Großbritannien unter dem Titel »Natural Born Learners« bei Weidenfeld & Nicolson, Orion Books.© der deutschen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Flashpop / Getty ImagesSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Einführung
Ein Märchen von zwei Akademien
Teil 1
Neu denken
1 Künstliche Intelligenz
Hüte dich vor Computerfreaks, auch wenn sie Geschenke bringen!
2 Geboren, um zu lernen, denn Kinder lernen gern
In Babyschritten
3 Unsere Intelligenz lebt
Mit dem Strom schwimmen
Teil 2
Es besser machen
4 Einfach loslegen
Gute Bildung von Anfang an
5 Schöpferisches Tun
Termin bei deinem Schöpfer
6 Spitzenklasse
Meister des Lerniversums
Teil 3
Sich engagieren
7 Big Data
Das Leben unter der Lupe
8 Echter Mumm
Was die Persönlichkeit bildet
9 Kontrolle der Gedanken
… denn sie wissen, was sie tun
Teil 4
Coda
10 Besser scheitern
Open Source
Nachwort
Eine Lernrevolution
Danksagung
Literaturhinweise
Anmerkungen
Motto
Das Leben muss eine unaufhörliche Erziehung sein;
alles will gelernt sein, vom Sprechen bis zum Sterben.
Gustave Flaubert
Einführung
Ein Märchen von zwei Akademien
Die Zukunft ist hier, sie ist nur ungleich verteilt.
William Gibson
Ins Licht
Der Hippeius Kolonos liegt etwa eine Meile nördlich des antiken Athen. Der dicht mit Wein, Olivenbäumen und Lorbeer bewachsene Hügel, am Gipfel ein Poseidon-Tempel und ein heiliger Hain der Erinnyen oder Furien, war angeblich die letzte Ruhestätte des Ödipus und Geburtsort des großen Dramatikers Sophokles. Wären wir im Jahr 385 vor Christus an einem lauen mediterranen Abend dort hinaufgestiegen, umschmeichelt vom rosa Licht der Ägäis und dem aus der Gluthitze des Bodens aufsteigenden Oregano-Duft, hätten wir vielleicht den Blick nach Westen schweifen lassen und eine der größten Erfindungen der menschlichen Geschichte erblickt – die Schule.
Diese Schule lag in einem Hain mit Namen Akademeia, benannt nach dem griechischen Heros Akademos, der einst Athen vor der Zerstörung gerettet hatte. Die Gegend war damals bekannt als Startpunkt eines stimmungsvollen Rituals, nämlich eines nächtlichen Fackellaufs in die Stadt. Die Teilnehmer liefen über eine Gräberstraße mit den Ruhestätten verstorbener Athener, um als Erste mit ihrer Flamme den Prometheus-Altar zu erreichen. Auch Athene selbst, der Göttin der Weisheit, war der Ort heilig.[1] Damals hatte gerade ein weit gereister Adliger mittleren Alters, ein gewisser Platon, einen großen Teil dieses Geländes erworben, um dort seinen neuen »akademischen« Klub einzurichten, der sich der Suche nach der Erkenntnis verschrieben hatte.
Platons Akademie wurde schnell zum intellektuellen Treibhaus, vergleichbar heute etwa dem MIT oder der University of Cambridge. Zu den vielen illustren Alumni gehört auch Aristoteles, der später sein eigenes Lykeion gründen und zum Lehrer Alexanders des Großen werden sollte. Ihr Gedankengut sollte ganze Zivilisationen prägen. Das Lernen bestand in Gesprächen über bestimmte Texte und Fallstudien, wobei ein Lehrer – häufig Platon selbst – Fragen aufwarf, die die Mitglieder im Gespräch ausleuchten sollten; genau wie heute in der Harvard Business School. Themen waren Mathematik und Philosophie, sie reichten von der naturwissenschaftlichen Analyse der Bewegungen der Himmelskörper bis hin zu Überlegungen zu den besten Regierungsformen. Platon schrieb viele dieser Fallstudien in seiner Politeia nieder, in der sein einstiger Mentor Sokrates als Lehrer auftritt, dazu weitere Mitglieder aus seinem Umfeld als seine Schüler. Eine der berühmtesten Passagen ist das sogenannte Höhlengleichnis.[2]
Stellen wir uns eine ganz spezielle Höhle vor. Darin sind auf einer Seite eine Gruppe von Menschen an den Boden gekettet; ihre Schenkel und Nacken sind so fixiert, dass sie nur auf eine leere Wand starren können. In dieser Position sitzen sie seit frühester Kindheit, sie haben also ihr Leben lang nichts anderes zu Gesicht bekommen als diese Höhlenwand vor ihnen. In ihrem Rücken brennt ein Feuer, und davor steht eine niedrige Mauer, über die verborgene Helfer verschiedene Gegenstände emporhalten und dazu Geräusche von sich geben. Die Gefangenen sehen also lediglich bewegliche Schatten, die auf die Wand vor ihnen geworfen werden, und weisen die Geräusche den gespenstischen Formen zu. Sie interpretieren eine Bedeutung in das Schattenspiel und fangen an, es für die Wirklichkeit zu halten. Mehr kennen sie nicht. Die flackernden Formen und unheimlichen Geräusche sind ihre ganze Welt.
Was, fragt nun Sokrates, würde passieren, wenn einer dieser Gefangenen befreit würde?
Beim Umdrehen würde das helle Feuer ihn zunächst blenden, er könnte noch nicht einmal die Umrisse von Gegenständen erkennen und die neuen Eindrücke, die seine Sinne überfallen, in keiner Weise einordnen. Erschrocken würde er sich wieder zu seiner Wand umwenden. Stellen wir uns nun vor, dass jemand ihn aus der Höhle herausschleppt, am Feuer vorbei in das sonnendurchflutete Land draußen über der Höhle. Der Gefangene wäre wütend, halb blind, er würde sich wehren und fest an seiner alten Vorstellung vom Leben festhalten. Nach der Wand und den Schatten empfände er die farbenfrohe Welt rund um ihn wie eine schockierende Halluzination. Doch ganz allmählich würden seine Augen sich an das Licht gewöhnen, der Schmerz ließe nach, und er würde sich in eine neue, unendlich schönere Wirklichkeit einfinden. Er wäre glücklich über die Veränderung und würde eiligst zu seinen Höhlengefährten zurückkehren, um auch sie zu befreien.
Platons Höhlengleichnis lässt sich als Parabel auf das Lernen lesen. 2500 Jahre später ist uns die Bildsprache von Licht und Dunkelheit als Metapher für Wissen und Unwissenheit noch immer geläufig. Wir verstehen uns als empfindsame, bewusste und rationale Lebewesen, als Menschen, die »das Licht gesehen« haben. Wir sind der Meinung, dass immer mehr Menschen die Höhle hinter sich gelassen haben und in die Oberwelt eingetreten sind. Für Platon hingegen war klar, dass die meisten von uns diese Reise noch vor sich haben. Sein Ziel – und das seiner Schule – lautete, mehr Menschen in das sonnendurchflutete Land der Aufklärung hinaufzuführen. Es war Aufgabe des Philosophen, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu erweitern, die Welt immer vollständiger zu begreifen und herauszufinden, wie Individuen und Gesellschaften darin am besten leben sollten.
Heute stehen wir vor einer noch größeren Herausforderung. Wir glauben, dass jeder eine gute Bildung erfahren sollte, nicht nur reiche Adlige. Unsere Jugend muss in einer Welt zurechtkommen, die sich in scheinbar exponentiellem Tempo verändert und einer ungewissen Zukunft entgegensteuert. Doch ein Blick auf unsere Schulsysteme zeigt uns nicht Platons scharfsichtiges Ziel, die Menschheit zu verbessern, sondern kränkelnde Bürokratien, die sich abmühen, in der allgemeinen Finsternis ein paar hell flackernde Lichtpunkte am Leben zu erhalten. Wie die Sterne in einer diesigen Nacht über dem modernen Athen.
Nie die Flinte ins Korn
Ich hatte meinen Abschluss, also unterrichtete ich. Eines hellen Septembermorgens vor zehn Jahren radelte ich durch die Old Kent Road – bekannt als die billigste Karte im London-Monopoly – auf dem Weg in mein neues Leben als Englischlehrer. Die Schule lag in einem der ärmsten und facettenreichsten Viertel, Elephant and Castle, benannt nach einer Poststation aus dem 18. Jahrhundert. Ich kannte es nur vom Hörensagen. Es gab in der Gegend vor allem zwei Wohnsiedlungen, Aylesbury und Heygate, die wegen ihrer labyrinthischen Fußwege und schmuddeligen Treppenhäuser nach Einbruch der Dunkelheit No-go-Zonen waren.[3] Die Walworth School sah nicht viel besser aus. Bei einem Treffen mit neuen Lehrern im Bezirk erklärte ein älterer Kollege von einer nahe gelegenen Schule: »Wir sagen unseren Kindern immer, dass sie hier enden werden, wenn sie sich nicht zusammenreißen.« Meine erste Lehrerkonferenz sollte mit der nüchternen Meldung beginnen, dass ein vierzehnjähriger Schüler ums Leben gekommen war – bei einer Messerstecherei nach einem Fußballspiel.
Dieser erste Tag war für Walworth freilich ein echter Neubeginn.[4] Die Schule war soeben zur »Academy« geworden; dieses Regierungsprogramm sollte Problemschulen in Großstädten zu mehr Geld und mehr Autonomie verhelfen, wobei sie natürlich weit vom Athener Original einer Akademie entfernt blieben. Durch das Schultor trat ich an diesem Morgen mit dem explosiven Mix aus blank liegenden Nerven, schierer Inkompetenz und platonischen Idealen, die allen Junglehrern gemein sind. Ich hatte Angst, ich war schlecht vorbereitet, aber ich wusste – ich wusste! –, dass ich nach drei Wochen Robin Williams aus dem Klub der toten Dichter sein würde. Schließlich sagte mir alles, was ich in meiner eigenen Schule und an der Universität gelernt hatte, dass Unterrichten ganz einfach war. Man warf die richtigen Probleme auf, zeichnete interessante Gedankenexperimente vor, und dann lehnte man sich zurück, ließ die Schüler selbst denken und diskutierte.
Meine ersten Stunden waren ein totaler Reinfall. Ich war zunächst in den unteren Klassen gelandet, und die jüngeren Kinder fand ich begeistert, aber undurchschaubar. Einmal kam während der Stunde der elfjährige Kai strumpfsockig zu mir und erklärte, seine Schuhe seien (wir waren im 3. Stock) aus dem Fenster gefallen, ob er sie holen gehen dürfe. Eine besonders wilde Pause endete mit einem Krieg zwischen Shaun auf der einen Seite des Klassenzimmers und Marcel auf der anderen Seite; sie verwendeten Stühle als Geschosse und Tische zur Deckung. Jede Stunde begann mit einem deprimierenden Chor von verlorenen Büchern, vergessenen Hausaufgaben und Versuchen, sich in die glorreiche Freiheit der Toilette flüchten zu dürfen. Es sprach sich herum, wie sehr ich zu kämpfen hatte, regelmäßig wurden kompetente Kollegen zur Unterstützung herbeigerufen. Die Haine von Akademeia wirkten wie ein fernes Traumland.
In den höheren Klassen klappte es nicht viel besser. Zwar wusste man, dass es dort zeitweilig Versuche mit Lesen und Schreiben gab, aber die Hauptbeschäftigungen der älteren Schüler bewegten sich meistens zwischen gelangweiltem Aus-dem-Fenster-Starren, Hochleistungsmissverstehen und dem ständigen Übertrumpfen mit immer neuen »Deine Mutter«-Flüchen. Eine 10. Klasse war geradezu eine UN-Vollversammlung, da saßen dreißig Jugendliche britischer, irischer, chinesischer, jamaikanischer, liberianischer, kongolesischer, afghanischer, somalischer, sudanesischer, nigerianischer, türkischer, portugiesischer und vietnamesischer Herkunft mit ebenso vielen Meinungsverschiedenheiten. Viele von ihnen sprachen zu Hause kein Englisch. Mir war freilich immer weniger zum Lachen zumute. Die Schüler mussten auf das GCSE in Englisch vorbereitet werden, die anspruchsvolle Abschlussprüfung für die Sekundarstufe, die über ihre Zukunft entscheiden würde. Der Klassendurchschnitt lag meist bei D, E oder F, also weit unter Ausreichend. Wenige Monate später müssten ihre Noten bei A, B oder C liegen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollten.
Innerhalb des Unterrichts würden wir in den nächsten eineinhalb Jahren gemeinsam zwei Shakespeare-Stücke durchnehmen, über die eine schriftliche Arbeit abgefasst werden sollte. Trotz aller Unkenrufe freute ich mich darauf, meine Denkmuskeln mal wieder ein bisschen anzustrengen. (In meinem Bewerbungsgespräch für die Lehrerstelle hatte ich meine Liebe zur Literatur erwähnt und meine Pläne, einige Lücken durch die Lektüre von Klassikern zu füllen – Milton, Marvell, Woolf und Eliot. Die Leiterin des Vorstellungsgesprächs hatte mich geduldig angesehen und erwidert: »Das klingt toll, aber ich würde vielleicht mit den Geheimnissen von Green Lake anfangen und dem Jungen im gestreiften Pyjama.«) Die Schule hatte als Textgrundlage Romeo und Julia sowie Macbeth ausgesucht, und ich verbrachte mehrere Wochenenden damit, mir eine klare Meinung dazu zu bilden. Die Kids würden tolle Arbeit leisten, so schwer sie sich auch tun würden. Genau dafür war ich schließlich Lehrer geworden.
Doch leider funktionierte es nicht. Mit der Lektüre von Romeo und Julia kamen wir lähmend langsam vorwärts. Eine Woche verbrachten wir mit dem Versuch, den Prolog zu verstehen, und lasen am Ende nur ein paar Szenen aus dem Stück. Die Schüler schafften es, Meinungen dazu zu äußern, wenn ich Lückentexte mit einer Auswahl von drei Adjektiven vorbereitete, aber abgesehen davon fiel ihnen nichts ein. Nachdem wir Baz Luhrmanns Verfilmung angesehen hatten, um wenigstens die inhaltlichen Lücken zu füllen, kamen in jedem Essay über das 16. Jahrhundert personalisierte Revolver, Muscle-Cars und explodierende Tankstellen vor. Trotz meiner großen Hoffnungen, die Klasse würde in der Erkenntnissuche und der Liebe zur Literatur Erfüllung finden, lieferten sie in ihrer ersten schriftlichen Arbeit hartnäckig ungenügende Noten ab.
Ich dachte zurück an meine eigene Schulzeit. Ich hatte das Glück gehabt, eine gute Grundschule in einer Kleinstadt in den Midlands zu besuchen, wo die Lehrerinnen eigentlich eher Ersatzmütter oder -omas waren und meinen Wissensdrang geweckt hatten. Danach war ich meine gesamte Schulzeit über an einer Privatschule gewesen. Sie rühmte sich der größten zusammenhängenden Rasenfläche Großbritanniens und eines Flügelaltars – man benutzte das ehrwürdige Fachwort reredos –, der bekanntermaßen auf sechs Millionen Pfund geschätzt wurde (ein Lieblingsspiel des Religionslehrers bestand darin, die Jungen herauszufordern, sich durch die Laserstrahlen des Sicherheitssystems bis zum Altar zu schlängeln wie kleine Einbrecher-Lehrlinge). Wir nannten unsere Lehrer Dons (Dozenten) und den Direktor Warden. Im Englischunterricht büffelten wir Jane Austen und T. S. Eliot, und dann schrieben wir alle Essays, die mit A oder A* benotet wurden. Das alles geschah mit einer gewissen Selbstverständlichkeit – genauso selbstverständlich wie das unvermeidliche Scheitern der Klasse, in der ich unterrichtete.
Doch eine Erkenntnis trieb mich an. Als ich diese Kids aus dem südlichen London immer besser kennenlernte, indem ich Tag für Tag mit ihnen arbeitete und redete, stellte ich schnell fest, dass zwischen ihnen und meinen alten Schulkameraden kein grundsätzlicher Unterschied bestand. Sie hatten dieselben Träume, dieselbe Kameradschaft, dieselben Fehden und dieselben Teenager-Ängste. Ihre Eltern wollten genau wie meine, dass sie Erfolg hatten und glücklich wurden. Sie hatten keine vornehmen Schulmäntel und keinen Umgang mit Rassehunden, aber das waren nur Äußerlichkeiten. Was ihr Potenzial anging, ihren Ehrgeiz und vor allem ihren Witz, waren sie meinen privilegierten Mitschülern im Internat mehr als ebenbürtig. Doch wo die Gesellschaft uns auf die Sprünge half, ließ sie diese Kinder eben links liegen.
Ich fühlte mich weit, weit weg von Platon. Sogar weit weg von Robin Williams. Die Klasse scheiterte, und ich war völlig ratlos.
Die Patentlösung
Zu diesem Buch haben mich genau die Kinder an dieser Schule im südlichen London inspiriert. Als Lehrer stellte ich verblüfft fest, dass Schule heute im Grunde noch genau dasselbe ist wie zu Platons Zeiten. Ein Kind aus dem antiken Athen, das per Zeitreise zu uns stieße, würde vielleicht staunen über unsere Smartphones, wäre überwältigt von unseren dicht bevölkerten Städten und verängstigt von den Autos auf unseren Straßen. Ein Klassenzimmer mit Lehrer und Schülern wiederzuerkennen wäre dagegen ein Kinderspiel. Bei all unserem Fortschritt in anderen menschlichen Betätigungsfeldern – Medizin oder Neurologie, Psychologie oder Technologie: Brauchen wir nicht längst eine Revolution in der Art und Weise, wie wir lernen?
Die 2400 Jahre, die uns trennen, haben epochale Umbrüche gebracht: ein fast unbegreifliches Bevölkerungswachstum; riesige landwirtschaftliche, industrielle und technologische Revolutionen; unglaubliche Veränderungen in unserer Wissensschöpfung und -verbreitung; neue Formen der sozialen und politischen Organisation; Einsichten in die Geheimnisse unseres Denkens. Unendliche Herausforderungen durch Globalisierung, Automatisierung und Klimawandel sind die Folge. Wollen wir sie meistern, müssen wir unseren Einfallsreichtum weiter steigern, unsere Fähigkeiten voll entwickeln und unsere Kooperation als Spezies radikal verbessern, um unser menschliches Potenzial zu entfalten. Das Lernen muss zu einem Thema werden, für das sich unsere Generation voll und ganz einsetzt.
Wie sollen wir Bildung heute angehen? Auf den folgenden Seiten wollen wir gemeinsam herausfinden, was es bedeutet, in unserer sich schnell verändernden Welt zurechtzukommen, und was wir tun können, damit wirklich all unsere Kinder dabei mithalten. Zu Platons Zeiten ging es vor allem darum, erwachsenen Männern zu ermöglichen, die Grenzen des menschlichen Wissens und Verstehens zu erweitern. Heute steht das zwar immer noch auf der Agenda, doch eine wichtigere Frage lautet, wie wir den Zugang zu den Weiten der menschlichen Entwicklung allen Kindern, und allen Menschen ermöglichen können. Unser Ziel ist nicht mehr die glorreiche Entfaltung einer Handvoll Philosophen-Bürger in einem antiken Stadtstaat, sondern die Entfaltung einer Menschheit von Philosophen, die unsere globalisierte Hightech-Welt erfolgreich steuern kann.
Nach meinen ersten wechselhaften Lehrerfahrungen vor zehn Jahren stellte ich mich meiner Verblüffung über den niedrigen Lernstand meiner Schüler und machte mich auf zu einer lebenslangen Suche nach neuen Ideen und aufregenden Neuerungen, die uns dazu bringen könnten, Schule neu zu erfinden und die veralteten Hierarchien unseres globalen Erziehungssystems neu auszurichten. Auf dieser Reise stellte ich mir immer wieder die Frage, die im Mittelpunkt allen Lernens steht: Warum? Warum ähneln die Schulen von heute den Schulen im antiken Athen? Warum stellen wir schulischen Erfolg über alles? Warum sind die Kinder in ihren Lernerfahrungen so häufig unglücklich? Warum verfolgen wir weiter ein industrielles Modell, das die Wirtschaft längst ausrangiert hat? Und vor allem hatte ich ständig ein einziges Ziel vor Augen: darzustellen, wie das Lernen im 21. Jahrhundert aussehen sollte.
Die Suche, auf die wir uns gleich gemeinsam begeben werden, hat mich in die ganze Welt geführt, von den intelligenten Maschinen im Silicon Valley bis in die koreanischen Examensfabriken; vom besten Lehrer Finnlands bis zum klügsten Schüler in Großbritannien; vom MIT-Professor, der einen Roboter entwickelt, bis zum Hongkonger Schulkind im Kampf gegen eine Supermacht; von Lehrern, die wie Leistungssportler ausgebildet werden, bis zu Schülern, die ohne Lehrer lernen. Ich war in Schulen auf allen Kontinenten, habe mit führenden Neurowissenschaftlern und Experimentalpsychologen gesprochen, die legendärsten Pädagogen getroffen. Ich habe die Beschränkungen meines Denkens und die Grenzen der neuesten Technologien ausgetestet. Sogar in Hollywood war ich. Und das Gute ist: Überall bin ich auf Hinweise gestoßen, dass wir an der Schwelle zu einer Lernrevolution stehen.
Dieses Buch stellt die drei entscheidenden Faktoren heraus, die diese Transformation vorantreiben werden. Der Text ist in drei Teile untergliedert.
Der erste Teil fordert ein neues Denken. Die Wissenschaft weiß heute viel darüber, wie unser Gehirn funktioniert, und zeigt, dass jeder Einzelne von uns über sehr viel mehr Lernkapazität verfügt, als wir meinen. Wir sind geboren, um zu lernen, und tatsächlich lernt jeder von uns gern – aber allzu häufig bremst uns die falsche Annahme aus, dass unsere Intelligenz ein unveränderlicher Wert ist. Das ist sie nicht. Unsere Vorstellung vom Verstand ist gebunden in den Metaphern der Computerwissenschaft, doch er ist nicht einfach eine Maschine, die von den Schulen programmiert wird. Das Gehirn lebt, es ist unbändig, stellt sich einer ständigen Hinterfragung. Die wissenschaftliche Revolution, die im 19. Jahrhundert der Medizin gegolten hat, steht womöglich heute der Bildung bevor. Wenn wir neu über die menschliche Entwicklung nachdenken, konzentrieren wir uns darauf, uns selbst zu optimieren und nicht unsere Technologie.
Der zweite Teil regt uns an, es besser zu machen. Unsere Schulen werden einigermaßen ihrem Anspruch gerecht, solide ausgebildete Arbeiter und Angestellte zu produzieren, die ordentlich gedrillt sind in den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Doch in Zeiten, in denen durch Automatisierung und Globalisierung traditionelle Jobs wegfallen, müssen traditionelle Schulmodelle eben auch neuen Schulformen weichen, die Kreativität und Zielstrebigkeit fördern. Ein Handwerker will ästhetische Arbeiten abliefern, er kann geschickt mit den geeigneten Werkzeugen umgehen und ist in seinem Element, wenn er seine Techniken beherrscht. Es besser zu machen bedeutet, bei der menschlichen Kreativität anzusetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder Mittel entwickeln, um sich selbst auszudrücken und ihren Platz in der Welt zu finden. Dieses angewandte Lernen ist unser hehres Ziel.
Der Schlussteil erklärt, warum wir uns engagierenmüssen. Die Bildung unserer Kinder ist unsere große Aufgabe und bleibt die wichtigste Verpflichtung der Menschheit. Doch in den letzten Jahren hat sie mehr und mehr ihre ureigene menschliche Prägung verloren. Die Schulen lehnen sich immer stärker an Paradigmen der Produktion oder des Markts an, suchen Effizienz und Wettbewerb. Das hat uns große Fortschritte bei der Lese- und Schreibfähigkeit beschert und Prüfungsleistungen verbessert, aber gleichzeitig lässt es die Schüler in einem brutalen Wettkampf um die Spitzenplätze antreten, engt die Parameter des Lernens ein und lässt als einzigen Maßstab den ökonomischen Output gelten. In Zukunft müssen wir die ethischen und humanistischen Dimensionen des Lernens wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Engagement bedeutet, unser Bildungssystem um ein gemeinsames Wertesystem herum aufzubauen, nicht um neue Technologien, und es eher wie ein Ökosystem zu betrachten als als Wirtschaftsunternehmen. Das Gedeihen der Menschheit und unseres Planeten hängt davon ab, wie wir unsere soziale und emotionale Intelligenz entwickeln. Wir müssen lernen, zu kooperieren und gemeinsam die Zukunft zu bauen, die wir uns wünschen.
Unser Ausgangspunkt bildet eine stabile Grundlage. Nie war es besser, Schüler zu sein, als heute. 1,2 Milliarden Kinder gehen zur Schule. Vor ihnen stehen von Lima bis Lucknow über 50 Millionen Lehrer, die fast alle begeistert, qualifiziert und engagiert sind.[5] Doch wenn wir nicht ganz schnell die Art und Weise, wie Kinder lernen, an die sich wandelnden Bedürfnisse der Welt von heute anpassen, droht uns der Verlust einer ganzen Generation. 600 Millionen dieser Kinder bewältigen derzeit nicht die Grundlagen, geschweige denn die Fertigkeiten, die sie für ihren Erfolg brauchen.[6] Unterdessen bindet uns die Erfahrung an die Vergangenheit. In Sachen Schule fühlt sich jeder als Experte. Die meisten von uns haben mindestens zwölf Jahre – mehr als die legendären 10 000 Stunden – in Klassenräumen verbracht. Aber wir haben das Falsche gelernt. Das Fach Lernen ist nicht wirklich eine Kunst und noch keine Wissenschaft – paradoxerweise wirkt es manchmal so, als gäbe es darin bis heute kein profundes, einheitliches Expertenwissen.
Dabei ist es hier und jetzt an der Zeit, dieses Wissen zu vereinen. Wenn wir neu denken, es besser machen und engagiert bleiben, können wir in der Schulbildung eine neue Aufklärung herbeiführen, die dafür sorgen wird, dass immer mehr Kinder ihr Potenzial voll entfalten können. Wie die Physiker ihre Weltformel haben, müssen wir in der Pädagogik nach der Entfaltung der gesamten Menschheit streben. Für den Homo sapiens ist Weisheit – Lernen – das Alleinstellungsmerkmal, das uns von unseren evolutionären Vorfahren unterscheidet. Die Kultivierung dieses Merkmals sollte das höchste Ziel der Menschheit sein. Wir müssen diesen technologischen Umbruch nutzen – angesichts einer joblosen Zukunft, versiegenden Ressourcen und führerlosen Autos –, um einen Schritt zurückzutreten und uns eine Welt auszudenken, die die menschliche Entwicklung in den Mittelpunkt stellt. Alles hängt davon ab, wie gut wir das schaffen.
Wieder scheitern – besser scheitern
Ein Jahr später stand meine Klasse vor dem Übertritt in die 11. Klasse. Bis zu den ersten Abschlussprüfungen waren es noch etwas mehr als sechs Monate. Schon bald würden sie in weiterführende Schulen und Universitäten von der Schule abgehen. Ihre Noten wären der einzige Leistungsnachweis, den sie ihren künftigen Schulen oder Arbeitgebern vorweisen könnten. Der andere Weg, also Arbeitslosenquoten von über 50 Prozent für Schulabgänger ohne qualifizierenden Abschluss, war keine Option. Da waren sich alle einig.
Eines Tages standen wir vor einer besonders schwierigen Passage von Macbeth. Fabrice, ein Fünfzehnjähriger, der im Kongo geboren und über eine mehrjährige Station in Rotterdam nach London gekommen war, kämpfte mit einem Gedanken. Er war Anführer einer Gruppe von Unruhestiftern gewesen, die allmählich doch Spaß am Lernen entwickelten. Wir sprachen gerade über Regieanweisungen und diskutierten die möglichen Entscheidungen eines Regisseurs, wie die Szene darzustellen wäre, in der Macbeth den Dolch vor sich sieht: »Ist das ein Dolch, was ich vor mir erblicke (…)?« Für die Frage, die ich gestellt hatte, musste man mehrere abstrakte Gedankengänge miteinander verknüpfen: Wie würde es sich auf das Verständnis des Publikums von Macbeths Charakter auswirken, ob der Regisseur sich entschied, den Dolch tatsächlich zu zeigen oder eben nicht?
Das Problem war absolut auf der Höhe von Platons Höhlengleichnis. Amir, ein zierlicher Teenager aus Afghanistan, der als Unruhestifter in meine Klasse versetzt worden war, schnipste mit dem Finger und wollte dringend eine Antwort loswerden. Wegen seiner frischen und kulturell andersartigen Perspektiven – er glaubte fest an die bösen Zauberkräfte von Katzen – war er begeistert, dass es in Macbeth um Zauberei und Hexenkunst ging, und hatte auf dieser Grundlage so überzeugende wie originelle Gedanken zu Shakespeare entwickelt. Fabrice überlegte weiter.
»Ja!« rief er plötzlich. »Ich hab’s!«
Während Amir mit hochgerecktem Finger auf seinem Stuhl auf und ab hüpfte, sprach Fabrice ganz ruhig weiter. Es war einer der wenigen Momente, in denen ich förmlich sah, wie in meinem Klassenzimmer gelernt wurde. Fast hörte ich die Zahnräder in seinem Gehirn schnurren. Er vollbrachte gerade eine neue, komplexe Denkleistung.
»Wenn wir den Dolch sehen, denken wir vielleicht, dass die Hexen Zauberei angewandt haben.«
»Und wenn wir den Dolch nicht sehen?«, fragte ich weiter.
»Wenn wir den Dolch nicht sehen, denken wir …« Er legte die Stirn in Falten. Amir hüpfte weiter. Plötzlich erhellte sich Fabrice’ Gesicht von der Erkenntnis: »Wir würden denken, dass er krass durchgedreht ist!«
Er wandte sich zu Amir und hielt den Finger an die Lippen, wie ein Fußballer, der gerade ein Tor gegen den Erzrivalen geschossen hatte.
Es war ein Wendepunkt. Fabrice’ Abschlussexamen wurden mit A und B bewertet – und Amir schrieb A und A*. In den Abschlussprüfungen schaffte fast die ganze Klasse zumindest das C, das sie brauchten, um weiter auf die Schule gehen zu können.
Ich war in Hochstimmung. Doch zugleich war ich auch unbefriedigt. Die Kids hatten es geschafft, aber nur im Kleinen. Sie hatten die erforderlichen Noten für weiterführende Schulen, aber viel mehr hatten wir ihnen nicht bieten können. Mit dem richtigen Einsatz – und einem besseren Lehrer – hätten sie exzellent abschneiden können. Sie waren mit großen Rückständen in meine Klasse gekommen, viele von ihnen konnten nach acht Schuljahren weder ordentlich lesen noch schreiben, und wir freuten uns zwar über ihre Cs, aber die Welt würden sie damit nicht verändern. Zudem war ich nicht sicher, ob wir wirklich Fortschritte gemacht hatten. Meine Bemühungen hatten viel Schweiß – und Tränen – gekostet, aber wissenschaftlich fundiert waren sie nicht. Dass ich anfangs so inkompetent und fantasielos gewesen war, hatte uns wertvolle Lernzeit gekostet. Bei all dem, was wir heute über das Denken wissen, über das Gehirn, den Körper, über das menschliche Verhalten und das Leistungsvermögen, können wir doch sicher bessere Ansätze entwickeln! Und angesichts der Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, müssen wir das auch!
Der kleine Erfolg, den ich mit meiner 10. Klasse erlebte, gab mir die Zuversicht, dass die Macht der Bildung im 21. Jahrhundert das Leben des Einzelnen und ganze Gesellschaften voranbringen kann. Nur müssen wir es richtig anpacken. Wir müssen neu über das Potenzial unserer Jugend nachdenken, müssen sie besser für die Arbeitsmittel von heute ausstatten, und sicherstellen, dass wir sie alle mitnehmen. Jedes Kind lernt im Grunde gern, aber unsere Systeme setzen nicht auf dieses Potenzial, sondern hemmen es eher. An diesem Tag machte ich mich auf die Reise. Vom Silicon Valley aus sollte sie mich durch neue Länder führen, in neue Rollen und in neue Klassenzimmer, um herauszufinden, wie wir vielleicht anfangen können.
Wenn diese Kinder es schaffen konnten – von einem rückständigen Anfangspunkt aus und mit einem neuen Lehrer –, dann können das alle Kinder. In dieser komplexen, rastlosen und sich schnell wandelnden Welt besteht die Kunst darin, die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle so weit kommen.
Teil 1
Neu denken
1 Künstliche Intelligenz
Hüte dich vor Computerfreaks, auch wenn sie Geschenke bringen!
Wen die Götter vernichten wollen, den nennen sie vielversprechend.
Cyril Connolly
Aufmarsch der Roboterlehrer
Brett Schilke saß in einem Hinterzimmer im Hauptsitz der Singularity University im kalifornischen Mountain View und sprach über die Zukunft. Seit seiner Schulzeit fühlte er sich berufen, das Lernen zu revolutionieren. »Ich war eins dieser Kinder«, sagte er, »die immer fragen: ›Erklärt mir, warum ich das lernen soll.‹ Ich hatte einen Lehrer, der mich einfach ankotzte. Er antwortete mir jedes Mal dasselbe – vielleicht kommt das ja mal bei Wer wird Millionär? Und ich dachte jedes Mal, hast du wirklich nichts Besseres zu bieten? Kann ich bitte gehen?«
Schilke hatte im Bildungsbereich gearbeitet, seit er das College abgeschlossen hatte, natürlich mit Bestnoten. Er war ein unverhohlener Enthusiast: Abenteurer, Erzieher und Anstifter, der – Willkommen in Kalifornien! – gern Geschichten erzählte, Wortspiele liebte und seine Kumpels abklatschte. Nachdem er zunächst Initiativen zur Kultur-, Kunst- und Bildungsförderung in Sibirien und Siebenbürgen geleitet hatte – »Ja, in Sibirien ist es kalt, und nein, in Siebenbürgen gibt es keine Vampire«[1] –, war er vor ein paar Jahren in den Mittleren Westen zurückgekehrt und hatte dort die Organisation IDEAco geleitet, eine gemeinnützige Bildungsinitiative mit Projekten wie City X, ein Lernprogramm für Kinder zur Problemlösung und zum 3D-Drucken. Dann kam er an die Singularity University, deren Gründer Ray Kurzweil, Guru der Zukunftsforschung und Autor von Menschheit 2.0: Die Singularität naht, in dieser Einrichtung »Leader fortbilden, sie inspirieren und ihnen ermöglichen will, exponentielle Technologien zu nutzen, um die großen Herausforderungen der Menschheit anzugehen«.[2]
»Singularität« ist Kurzweils Bezeichnung für einen hypothetischen Punkt in der Zukunft, an dem die künstliche Intelligenz unser menschliches Denken Billionen Mal überflügeln wird; das führt zu einer neuen Zivilisation, die in der Lage ist, »ihre physischen und geistigen Fähigkeiten über alle gegebenen Grenzen hinweg zu erweitern«, indem wir mit unserer Technik verschmelzen.[3] Ein cooler Ansatz, vielleicht ein bisschen gruselig. Kurzweil, der heute den KI-Bereich bei Google leitet, entwarf damit eine Utopie, in der unser erweitertes Bewusstsein unvorstellbare kognitive Leistungen vollbringt – andere dagegen fürchten, dass der Mensch sich einem hyperintelligenten Roboter auf Gedeih und Verderb ausliefern wird. Die Singularity University – unter Anhängern SU – ließe sich als Kurzweils Versuch verstehen, das Ergebnis in seinem Sinn zu beeinflussen.
Brett Schilke war kürzlich zum Leiter der Abteilung Youth and Educator Engagement der SU befördert worden. Seine Arbeit besteht darin, sich wie besessen mit der Zukunft des Lernens zu beschäftigen – die er sehr scharf von Bildung oder Schule unterscheidet.[1]
Hinter ihm hing ein Gemälde von einem Roboter auf einer Harley-Davidson, die von einem Berg von Eis-Donuts in einen goldenen Horizont sprang. Er sprach schnell, die Gedanken schossen aus ihm heraus wie Popcorn in der Mikrowelle.
»Es ist eine wahnsinnig aufregende Zeit, um, tja, am Leben zu sein«, sagte er. »Das klingt vielleicht blöd, aber es stimmt. Es ist einfach toll. Es ist so überraschend, was man Tag für Tag tun kann.«
Er sah mich mit seinen hellen Augen an.
»Es ist geradezu geil.«
Er sprach gerade davon, wie die Technologie die Welt verändert und wie die Welt – und unsere Schulen – sich mit ihr verändern müssen. Im Silicon Valley ist der Gedanke, dass wir Menschen zu mehr fähig sind, genauso ein Gemeinplatz wie der Glaube, Technologie sei eine rein positive Macht. Schilke hatte dieses Elixier geschluckt. Und er fügte hinzu, wir müssten gemeinsam lernen und kreativ werden, um unser maschinen-assistiertes Potenzial voll zu entfalten. Nur aus historischen Gründen sei es noch nicht so weit.
»Unser System wurde für die industrielle Revolution entworfen. So ist das moderne Bildungssystem entstanden. Es musste massive Arbeitskraft produziert werden, die einfache Aufgaben immer und immer wieder ausführen konnte. Und wie erreicht man das? Tja, wir schnappen sie uns, wenn sie noch ganz jung sind, und bringen ihnen bei, still zu sitzen und sich zu melden.«
Er schnaufte vor Erregung.
»Es ging eben darum, eine fast schon militarisierte Masse von Menschen aufzubauen.«
Er hatte damit weitgehend recht. Die Bildungssysteme sind in der Tat von einem militaristischen Modell beeinflusst. In den 1830er-Jahren hatte der damalige Erziehungsminister von Massachusetts, Horace Mann, eine im ganzen Bundesstaat gültige Schulform eingeführt, die die Grundlage der kostenlosen Schulbildung in den USA wurde. Inspiration hatte er bei einem Besuch in Preußen gefunden, dem Land der strengen Hierarchien, des Gehorsams und des militärischen Drills; Friedrich der Große hatte dort ein halbes Jahrhundert zuvor mit dem Generallandschulreglement das weltweit erste staatliche Schulsystem per Gesetz verankert. Dieses Paradigma erstarkte durch das Gedankengut der Industrialisierung, der Mechanisierung und der Massenproduktion und wurde schließlich zur Vorlage für Schulsysteme, die bald weltweit eingeführt wurden. Doch Computer und andere neue Technologien, so Schilke, stellen heute diesen Ansatz infrage.
Ich hatte meine Reise in die globale Lernrevolution im Silicon Valley begonnen, um herauszufinden, wie die Techno-Humanisten der Bay Area es schafften, unseren Blick auf die Zukunft so stark zu beeinflussen. Und ich wollte wissen, was uns künstliche Intelligenz über die Leistungskraft unseres eigenen Verstands verraten kann. Wird menschliches Lernen irgendwann ganz obsolet, wie manche meinen, oder können wir mithilfe von Computern unsere Denkfähigkeit in ungeahnte Höhen steigern? Meines Erachtens laufen wir Gefahr, unsere eigenen, natürlichen Fähigkeiten zu unterschätzen, die sich in Millionen Jahren der Evolution passgenau herausgebildet haben – und sollten das Lernen im digitalen Zeitalter überdenken. Wenn wir unser Gehirn besser begreifen und herausfinden, wie wir unsere Technologien klug einsetzen, wäre das Potenzial womöglich weit höher, als wir ahnen.
Als Erstes müssen wir verstehen, so Schilke, dass wir nicht einfach nur in die neuesten Gadgets investieren müssen, sondern unser Verständnis vom Lernen radikal verändern.
»Die SU will Lehrer für die größeren technologischen und sozialen Trends fit machen, die uns noch bevorstehen«, erklärte er. »Wir unterrichten 3D-Druck nicht als 3D-Druck, als Berufsqualifikation wie in der Ausbildung zum Buchhalter. Wir unterrichten 3D-Druck, um 3D-Denken zu fördern, um zu lernen, wie man Ideen konzeptualisiert.«
Dieser Fokus auf höhere Denkprozesse erfährt zunehmende Unterstützung aus der Forschung. Zwei Wirtschaftswissenschaftler an der Martin School in Oxford, einem Forschungsinstitut, das gesellschaftlichen Wandel prognostizieren und Strategien zum Umgang damit entwerfen soll, errechneten vor ein paar Jahren, dass von den 702 Berufen, die (nach ihrer Berechnung) Menschen derzeit ausüben, etwa die Hälfte schon bald von Maschinen mit Künstlicher Intelligenz übernommen werden könnten.[4] Im Lauf der Industrialisierung hatten die Roboter Muskelarbeit ersetzt, und in der Ära der Digitalisierung werden sie sich an die Kopfarbeit machen. Das bedeutet eine zweifache Herausforderung an die Schule – erstens muss sie die neuesten Technologien in den Lernprozess integrieren, und zweitens Inhalte für eine sinnvolle Schulbildung neu definieren. Wenn irgendjemand auf der Welt wusste, wie man diesen Herausforderungen begegnen konnte, dann, so dachte ich, war das ein Technikfreak wie Schilke.
Zuvor hatten wir einen Rundgang über das Gelände der SU gemacht, ein ehemaliges Forschungsinstitut der NASA mit Militärbasis, das von einer riesigen, entkleideten Baustruktur überragt wurde, dem Skelett eines alten Hangars, in dem in den 1950er-Jahren Luftschiffe gebaut wurden. Die leer stehende Halle nutzte Google manchmal für exklusive Mitarbeiterfeiern – ihr Firmengelände grenzt auf drei Seiten daran. Gleich hinter dem Zaun sahen wir den Flugplatz Moffett Field, wo der Hightech-Gigant führerlose Transportflugzeuge testet; Barack Obama war dort mit der Airforce One gelandet, wenn er in der Bay Area zu Besuch war. Hoch über uns kreiste ein Adler, die Proto-Drohne der Natur.
Schilke genoss es sehr, dass die SU von all diesen Innovationen umgeben war. Er zeigte auf den baufälligen McDonald’s des Flugplatzes, der längst umgenutzt wurde. »Da drin läuft ein Projekt, bei dem die Mondoberfläche kartografiert werden soll«, erklärte er. »So cool. Sie nennen es McMoon.« Sämtliche führenden Hightech-Unternehmen waren hier versammelt: Tesla, Carnegie Mellon, Moon Express. Weiter hinten ragten die Türme des NASA-Testzentrums für Raketenmotoren, auf dem Parkplatz standen überall die neuesten Hybrid- und Elektroautos herum. Die Sonne schien, im Hintergrund erhoben sich die Berge und die massigen Lagerhallen der früheren Regierungsinstitution, die jetzt von freundlich lächelnden Hightech-Unternehmen genutzt wurden – das hier war das Zentrum alles Neuen in der Welt. Es war berauschend.
Letzter Halt auf unserer Runde sollte der sogenannte Classroom sein. Aufgeregt redete Schilke von den Spielsachen, die wir dort vorfinden würden. Als ich Fabrice und Amir unterrichtete, bestand die neueste Technik aus ramponierten Laptops, die dem Fortschritt eher im Weg standen. Jetzt konnte ich es kaum erwarten, was ich für Gadgets zu sehen bekommen sollte, Hörsäle für virtuelle Realität und Roboterlehrer, 3D-Drucker und Nano-Materialien. Ich dachte an Neo, der in Matrix in Sekunden Lerninhalte in sein Gehirn herunterlud. Vielleicht stand die Technologie wirklich kurz davor, das Lernen zu revolutionieren. Vielleicht barg dieser Raum die Zukunft der Schule.
Ich war auf den Geschmack gekommen. So schlecht war das Elixier gar nicht.
Sind Computer die neuen Bücher, die neuen Fernseher?
Für Menschen, die sich ausschließlich damit befassen, andere für die Zukunft fit zu machen, sind wir Lehrer erstaunlich zurückhaltend beim Zugriff auf das Neue. Unsere eigene Erfahrung impft uns mit Vorurteilen. Bei uns war die Schule schließlich auch nur, wie sie eben war, und aus uns ist doch auch etwas geworden! In der St James’ Primary School gab es in den 1980er-Jahren garantiert keinen einzigen Computer. Meine Lehrerin in der 1. Klasse – Mrs Calcutt – malte unsere ersten Wörter und Zahlen mit Kreide auf (als Wurfgeschosse benutzten wir sie nur ganz selten). Unsere Arbeitsmittel waren Stifte, Papier und Bücher. Wir schrieben mit der Hand und entdeckten nach und nach die Bewohner von Letterland, von Annie Apple bis Zig Zag Zebra. Es war absolutes No-Tech. Und wenn das bei uns funktioniert hat, sagen wir uns jetzt, dann wird das auch bei unseren Kindern funktionieren.
Ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Potenzial der neuesten Technologie, das Lernen zu verändern, ist durchaus angebracht. Der Glanz des Neuen hat eine gewisse Hypnosekraft. 1922 prognostizierte etwa Thomas Edison eine dramatische Wende im öffentlichen Schulwesen:
Ich glaube, der Film ist dazu bestimmt, unser Schulsystem zu revolutionieren (…) In ein paar Jahren wird er den Einsatz von Schulbüchern weitgehend, wenn nicht völlig ersetzen. Ich würde sagen, aus den Schulbüchern, wie sie heute geschrieben werden, erreichen wir durchschnittlich nur etwa zwei Prozent effizientes Lernen (…) Durch das Medium Film dagegen (…) sollte es möglich sein, eine hundertprozentige Effizienz zu erreichen.[5]
Der Trend ging weiter. Überwältigt davon, wie sehr die Werbung Gewohnheiten und Verhalten der Amerikaner grundlegend beeinflussen vermochte, ließ sich Präsident Lyndon Johnson 1966 zu der Äußerung hinreißen, die Welt habe »leider nur einen Bruchteil der Lehrer, die sie bräuchte«, was sich aber durch »Erziehungsfernsehen« kompensieren ließe.[6] Keine dieser Revolutionen hat schließlich stattgefunden – außer ich saß einfach nur in den falschen Klassenzimmern.
Dabei haben neue Technologien das Lernen wiederholt tatsächlich radikal verändert. Vor 5000 Jahren konnten die Menschen mit der Erfindung der Schrift Wissen über Raum und Zeit überliefern und es außerhalb der Köpfe speichern wie nie zuvor. Auch damals gab es Skeptiker: So beklagt sich etwa Sokrates im Phaidros über das geschriebene Wort und argumentiert, es untergrabe unser Gedächtnis und entferne uns von echter Wahrheit.[2] Doch dass die Transformation stattfand, war nicht mehr zu leugnen. Lernen war nicht länger durch die Qualität des Lehrers definiert, den man sich leisten konnte; und die Entwicklung des Wissens beschränkte sich nicht mehr auf den Dialog zweier Menschen. Über Raum und Zeit hinweg konnten nun Gedanken ausgetauscht und vielfältig angepasst, neue Gedankenstrukturen konnten aufgebaut werden. Diese Transformation wurde vor etwas mehr als 500 Jahren noch erweitert, als die Erfindung des Buchdrucks und die ersten volkssprachlichen Bibeln einen Wendepunkt im Zugang zu Wissen markierten. Die Verfügbarkeit von reichlich billigen Büchern spielte eine unermessliche Rolle beim enormen Anstieg der Lese- und Schreibfähigkeit in der westlichen Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Es sah so aus, als hätten unsere Eltern recht: Bücher sind tatsächlich besser für uns als Fernsehen. Und wenn wir noch zweifeln, wie die Technologie sich auf die heutige Bildung auswirken wird, müssen wir uns demnach diese Frage stellen: Sind Computer die neuen Bücher oder die neuen Fernseher?
Warum Computer vielleicht Bücher hoch zwei sind
Ein Maßstab für die Bildung eines Menschen ist sein Intellekt, und als Arena, in der dieser sich unter Beweis stellen lässt, galt lange die zerebrale Welt des Schachspiels. Der Showdown zwischen Boris Spasski und Bobby Fischer von 1972, der vor der Kulisse des Kalten Kriegs stattfand, zog gerade deshalb die Welt in den Bann, weil er sich als Sieg der amerikanischen über die sowjetische Intelligenz konstruieren ließ (ungeachtet der Tatsache, dass Fischer ein Kind europäischer Einwanderer war). Während der junge Draufgänger und der alte Meister sich beim Jahrhundertspiel in Reykjavik am Schachbrett gegenübersaßen, grübelten Wissenschaftler in den USA über einer scheinbar harmloseren Frage: Kann ein Schachcomputer einen Menschen besiegen?
1972 gab es bereits recht deutliche Hinweise darauf, dass die Antwort Ja lautete, zumindest auf Amateurniveau. 1967 entwickelte eine Gruppe von Studenten am MIT einen Computer namens Mac Hack IV, der gegen den Philosophieprofessor Dr. Hubert Dreyfus antreten sollte. Er war ein guter Amateurspieler und ein genialer Kopf und meinte verächtlich, kein Computer könnte auch nur ein 10-jähriges Kind im Schach schlagen.[7] Trotz dieser Überheblichkeit musste Dr. Dreyfus schließlich klein beigeben: Er verlor gegen die Maschine. Im selben Jahr wurde der Mac Hack IV zum ersten Computer, der ein offizielles Turnierspiel gewann. Mit der Zeit wuchsen sich solche Herausforderungen zu einem wahren Kriegsschauplatz zwischen Mensch und Maschine aus. Der begehrteste Skalp musste schwer erarbeitet werden – der des führenden Schachweltmeisters.
Nach jahrzehntelangem Experimentieren meinte 1997 ein Team bei IBM, sie hätten endlich eine Maschine entwickelt, die das schaffen konnte. In einer Neuauflage des Jahrhundertspiels von 1972 sollte sich Deep Blue (sein Vorfahre Deep Thought war nach dem allwissenden Supercomputer in Douglas Adams’ Per Anhalter durch die Galaxis benannt), die erste denkende Maschine, mit dem führenden menschlichen Schachmeister Garri Kasparow messen, der im Jahr zuvor in Philadelphia eine ähnliche Maschine geschlagen hatte. Das Rückspiel fand in New York statt, wo Deep Blue, unterstützt von einem Team von Software-Entwicklern (denen später vorgeworfen wurde, sie hätten den Computer regelwidrig unterstützt),[8] den Großmeister in einem spannenden, kontroversen Spiel mit 3,5 zu 2,5 besiegte.[9]
1:0 für die Roboter.
Es war zwar eine große Sache – Maschinen konnten denken! –, aber so groß war sie nun auch wieder nicht – sie konnten eben nur wie Maschinen denken. Kasparow schrieb später: »Deep Blue war nur auf die Art und Weise intelligent, wie ein programmierbarer Wecker intelligent ist. Wobei es keineswegs ein Trost war, gegen einen 10 Millionen-Dollar-Wecker zu verlieren.«[10] Abgesehen davon war Schach doch ein ziemliches Nischenthema. Beim menschlichen Intellekt geht es schließlich nicht nur darum, Schachpartien zu gewinnen, und die Aufgabe der Schule besteht in mehr als darin, Schachweltmeister hervorzubringen.
Bei IBM vergaß man vielleicht, auf wessen Seite man stand – jedenfalls ließ man es darauf nicht beruhen. Offenbar hatten sie ein besonderes Vergnügen daran, der Menschheit eins auszuwischen. Nach der Kasparow-Partie suchten sie nach einer neuen Herausforderung und landeten bei der amerikanischen Quizshow Jeopardy! Hier musste die Maschine spezifisch menschliche Fähigkeiten vorweisen können, unter anderem die Aneignung von viel nutzlosem Pubquiz-Wissen und die Fähigkeit, die Mehrdeutigkeiten und Wortspiele zu interpretieren, die das Spiel ganz entschieden prägen. Die Entwickler machten sich also an den Bau einer Maschine, die eher wie ein Mensch denken konnte, und nannten sie Watson (offenbar sahen sie in unseren künftigen Herrschern doch eher onkelhafte Handlanger).
In einer alle Zuschauerrekorde brechenden Fernsehausstrahlung besiegte Watson 2011 die größten Jeopardy!-Champions aller Zeiten, Brad Rutter und Ken Jennings. Und das noch nicht einmal knapp: Bei Spielende hatte Jennings 24 000 Dollar gewonnen, Rutter 21 600 Dollar und Watson 77 147 Dollar – damit strich IBM die Million Dollar Preisgeld ein (und spendete sie für gemeinnützige Zwecke). Jennings kommentierte später: »So wie im 20. Jahrhundert Fabrikjobs durch neue Fertigungsroboter ersetzt wurden, waren Brad und ich die ersten Arbeiter aus der Wissensindustrie, die wegen der neuen Generation von ›denkenden Maschinen‹ ihren Job verloren« – der Beruf des ›Quizshow-Kandidaten‹ wäre damit wohl der erste, den Watson überflüssig gemacht hatte, aber sicher nicht der letzte.[11]
Bücher hatten zwar einen Paradigmenwechsel bei der Form der Kodifizierung, Speicherung und Weitergabe von Wissen ermöglicht, doch denken konnten sie nicht. In den letzten 50 Jahren hat sich jedoch erwiesen, dass Computer Wissen nutzen, anwenden und sogar generieren können. Deep Blue bewies mit seinem Sieg gegen Kasparow bemerkenswerten taktischen Scharfsinn, spielte Millionen Positionen durch und führte scheinbar kreative Züge aus, um den Großmeister auf die falsche Fährte zu locken. Watson kam mit Mehrdeutigkeit und Wortspielen zurecht und verfügte über mehr als 200 Millionen Seiten abstruses Wissen. Damit war er im strengen Sinn immer noch nur künstlich intelligent (er konnte zum Beispiel keinen auch noch so einfachen Witz machen), aber die Bandbreite des Computerhirns nahm sichtlich zu. In gewisser Hinsicht war er tatsächlich eine denkende Maschine.
Mit seiner Begeisterung für das Potenzial der künstlichen Intelligenz, unser Lernen aufzuwerten, stand Brett Schilke nicht allein da. Einst hatten Schrift und Buch die kognitive Entwicklung des Menschen revolutioniert, und jetzt, so schien es mir, standen Computer kurz vor derselben Revolution. Im Silicon Valley liegt auch eine der ersten Schulen, die umfassend in unsere neuen Herrscher, die Computerlehrer investiert – im Drohnenflug gerade einmal zwanzig Meilen von der SU entfernt. Wie ich hörte, übernahmen dort Computer das Unterrichten, und ich fragte mich, wie sich das auf die Denkleistung unserer Kinder auswirkt. Ich beschloss, mir das einmal anzusehen.
Die Lehr- und Lernmaschinen
Es war ein heller Oktobermorgen, und während die Angestellten im Silicon Valley sich ihren Starbucks-Kaffee aus dem Drive-in holten, versammelten sich die 400 Schüler der Rocketship Fuerza Community Prep auf dem Schulhof. Sie hatten gerade die »Startrampe« absolviert, ein tägliches Ritual, mit dem die Direktorin, Ms Guerrero, die jungen Rocketeers übers Mikrofon für den Unterricht startklar machte – Fahneneid, Tanz und Gesang sowie Preisüberreichung für Leistungen wie »Charakterstärke« und »ganas«.[3] Das Highlight war das gemeinsam gesungene You Gotta Be von Des’ree und ein Tanz mit der gesamten Schule – einschließlich Eltern – zu Shake It Off von Taylor Swift.
»Für die Kinder ist das wie der Morgenkaffee«, sagte eine Lehrerin. So sah es auch aus. Als die Rocketeers gruppenweise abzogen – Die Broncos! Die Spartaner! –, waren sie enthusiastisch.
Die merkwürdige Terminologie aus der Welt der Raumfahrt war ganz bewusst gewählt. Die Rocketship Prep startete 2007 als Vorreiter einer Reihe von Schulen an der Westküste, die ganz bewusst auf dem Technologie-Tsunami surfen wollten. Einer der beiden Gründer war der Software-Unternehmer John Danner. Er erkannte die Möglichkeit, das wachsende Potenzial des Maschinenlernens dafür zu nutzen, den Schulbesuch für jedes Kind zu personalisieren. Außerdem entspricht die kostengünstige Replizierbarkeit digitaler Tools ganz seinem Geschäftsmodell. Schnell würden sie eine hyper-effiziente Schulform testen und anpassen, die in zwanzig Jahren 2,5 Millionen Kinder in landesweit 2500 Schulen erreichen sollte. Wenn KIJeopardy! gewinnen konnte, dann konnte sie auch ein paar Grundschulkindern Mathe beibringen.
Danners Mitbegründer der Schule war Preston Smith, altgedienter Coach und Starlehrer, der in San José äußerst erfolgreiche Schulen für Kinder aus Randgruppen geleitet hatte. Bei unserem Treffen in seinem Innenstadtbüro setzte er mir auseinander, wie denkende Maschinen sich allmählich im Schulalltag nützlich machen. »In bestimmten Lernbereichen, die wirklich anstrengend zu unterrichten sind, hat die Technologie ihren Platz. Ich denke da etwa an Mathe, und die Möglichkeiten zur Visualisierung. Nachhaltiges Üben. So haben Lehrer den Kopf freier, weil sie wirklich viel zu viel können, um mit all ihren Kindern einzeln Laute und Buchstaben zu üben. Wir rechnen da in Sachen Zeit. Es hilft meinen Lehrern, wenn sie das nicht unterrichten müssen. Damit können sie effizienter werden. Und gleichzeitig erreicht mein Rocketeer diese Leistungsstufe schneller. Damit gewinnen wir Zeit für mehr kritisches Denken, mehr höhere Denkprozesse. Und genau das ist unser Ziel.«
Rocketship spielte mit hohem Einsatz bei der Frage, wie Technologie und insbesondere die KI bestimmte Lernerfahrungen automatisieren kann.
Der Ansatz beruht auf dem sogenannten Learning Lab, einem Lernlabor, in dem die Kinder jeden Tag eine Zeit lang von intelligenten Maschinen betreut werden.
Als die Kinder mit dem Frühstück fertig waren, gingen Ms Guerrero und ich dorthin. Das Lernlabor ist ein höhlenartiger, 180 Quadratmeter großer Raum mit Whiteboards an jeder Wand – ein Klassenzimmer X.0. In der Mitte saßen zwei erwachsene Betreuer hinter einem kreisförmigen Tresen. Zu beiden Seiten standen in sechs langen Reihen Tische mit Blick auf die Whiteboards, und daran saßen einhundert Fünfjährige. Alle trugen die unverwechselbare lila Rocketship-Uniform, alle hatten vor sich ein Laptop stehen und auf den Ohren überdimensionierte Kopfhörer, wie Mini-Lehrlinge in einem Weltraumzeitalter-Seminar. Die Hälfte arbeitete auf ST Math, einer Rechenplattform im Internet, die andere Hälfte an dem Leseprogramm Lexile. Eifrig lösten sie ihre Aufgaben und nahmen mich komischen, 1,90 m großen Besucher gar nicht wahr.
Abgesehen von dem sachten Klappern kleiner Finger auf den Tastaturen, war es im Raum fast unheimlich still.
Ich beugte mich vor, um zuzusehen, was ein kleines Mädchen da tat. Sie hieß Martha und spielte ein Computerspiel – in den frühen Neunzigern hätte es nach Hightech ausgesehen –, bei dem sie ein rudimentäres Raumschiff durch einen Asteroidenschwarm steuerte; mit mäßigem Erfolg. Ich wies Ms Guerrero darauf hin.
»Es ist schwer für sie, sich so lange zu konzentrieren«, sagte sie. »Das Programm belohnt sie daher mit einem Spiel.«
An der Wand hingen Schilder zur Erinnerung, welches Verhalten im Lab erwartet wird. FUERZA bedeutet ausbuchstabiert etwa »Augen nach vorne, volle Aufmerksamkeit, Blick folgt dem Sprecher, Respekt im Umgang, eifrige Teilnahme, alle viere auf dem Boden«: LAZER bedeutete »In einer Reihen aufstellen, Arme an die Seite, Mund zu, Augen nach vorn, fertig zum Gehen«. Es gab auch Motivationssprüche.
Wenn sich nicht endlich jemand wie du kümmert, wird nichts jemals besser hier. Glaube mir!
Dr. Seuss[12]
Ob du meinst, du schaffst es, oder ob du meinst, du schaffst es nicht – du hast auf jeden Fall recht.
Henry Ford[13]
Es war ein positives, bewusstes Lernumfeld – ein Büro für Kinder.
Als Martha ihr Raumschiff gelandet hatte, präsentierte ihr der Computer eine neue Aufgabe. Es war Winter. Sie hatte zehn Schneebälle auf Lager und warf jetzt acht auf ihre Freundin. Wie viele waren noch übrig? Auf dem Bildschirm war die Rechnung viermal unterschiedlich visualisiert. Zuerst eine Zahlenreihe von 1 bis 10. Martha klickte schnell jede Zahl an: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann hörte sie auf. Für jeden Klick bekam sie einen grünen Haken. Dann ein Kasten mit zwei Reihen von jeweils fünf Schneebällen. Wieder klickte sie in der oberen Reihe jeden an, dann noch drei von der unteren Reihe, und wieder bekam sie acht grüne Haken. Sie arbeitete flüssig. Als Drittes war die Rechnung aufgeschrieben als 10 – 8 = []. Sie tippte eine 2. Noch ein grüner Haken. Und zuletzt eine Textaufgabe: Wenn ich acht von zehn wegnehme, was bleibt übrig? Sie tippte die Antwort: z-w-e-i.
Früher hätte ein Lehrer diese Rechnungen präsentiert und bearbeitet. Die Kinder hätten alle dieselben Aufgaben gelöst, dann die Blätter getauscht und sorgfältig die Arbeit des Nachbarn verbessert. Das Geniale an diesem System hier ist, dass jedes einzelne Kind eine Folge von Übungen macht, die speziell seinen Lernbedürfnissen angepasst sind. Wenn ein Kind eine Schwäche im Multiplizieren zeigt, merkt das die Software bei der Datenanalyse und sorgt dafür, dass Multiplikationsaufgaben in verschiedenen Formen ausführlich geübt werden. Wenn das Kind keine Fehler macht, steigert die Software die Komplexität der Rechnungen. Ist ein Tipp nötig oder eine kleine Aufmunterung, liefert das ein Avatar auf dem Bildschirm. Ein Lehrer ist überflüssig. Auch ein anderes Kind, das die Leistung benotet. 70 bis 90 Minuten verbringen die Kinder hier jeden Tag im Lab – eine ganze Menge Rechenaufgaben.
Zurück in Prestons Büro, dachte ich über den Spruch nach, der auf der lila Wand im Konferenzraum prangte.
Wenn ein Kind nicht so lernt, wie wir unterrichten, sollten wir es so unterrichten, wie es lernen kann.
»Für uns ist das eine Frage des Zeitmanagements«, sagte er. »Es gibt immer mehrere Kanäle. Einmal der Unterricht in der Klasse mit direkter Anleitung. Dann kommt man in eine Niveaugruppe, in der man sich möglicherweise auch seine eigene Zeit nehmen kann. Dann folgt das Lernlabor mit dem individuell angepassten Niveau, und man bekommt es noch einmal vorgesetzt. Eventuell wird man für ein spezielles Tutorat im Labor ausgewählt. Wenn also ein Kind schwache Leistung zeigt, bekommt es denselben Inhalt bis zu sechs Mal in unterschiedlichen Formaten präsentiert, sechs Mal anders an einem einzigen Tag. Bisher haben wir noch kein ausreichendes Analysesystem, aber irgendwie müssen wir herausfinden, welche Methode für jedes Kind die beste und wirksamste ist. Wenn wir das geschafft haben, ist die Optimierung wirklich verblüffend.«
Diese Optimierung gehörte zum Personalisierungstrend beim Lernen, der Preston so begeisterte. Hier funktionierte sie. Die Schüler an Rocketship-Schulen sind erfolgreich. Sehr sogar. In Mathe liegen sie im Vergleich zu ihrer sozio-ökonomischen Gruppe in der Stadt auf der 90. Perzentile, in Sprachen auf der 85. Zudem spart die Technik sehr viel Lehrerstunden ein. Bei meinem Besuch waren vier Klassen im Lernlabor, also etwa einhundert Kinder. Durch eine Labor-Sitzung werden also sechs Lehrerstunden eingespart. Die beiden erwachsenen Betreuer sind junge Hilfslehrer am Anfang ihrer Lehrerausbildung.
Trotzdem war es ein wenig beunruhigend, wie hier von Optimierung und Effizienz geredet wurde. Lässt Rocketship sich allzu bereitwillig auf das unerbittliche Paradigma der Maschine ein? Immerhin sind die Rocketeers noch Kinder und keine Bürokräfte. Viele Jahre nach dem Deep Blue-Match schrieb Garri Kasparow, ihm sei aufgefallen, dass die KI-Befürworter sich zwar über das Ergebnis gefreut hatten, über die Art und Weise, wie es zustande gekommen war, aber trotzdem enttäuscht waren. »Statt eines Computers, der dachte und Schach spielte wie ein Mensch, mit menschlicher Kreativität und Intuition, hatte er wie eine Maschine gespielt, die systematisch 200 Millionen mögliche Schachzüge pro Sekunde bewertet und mit roher Rechengewalt siegt.«[14] Heute besteht das Risiko darin, dass die Fortschritte in künstlicher Intelligenz unsere eigenen intellektuellen Fähigkeiten auf Maschinenniveau reduzieren. Der schmale Grat des maschinenbasierten Lernens könnte womöglich leicht unmenschlich werden.
Preston gab zu, dass die Rocketships anfangs die rohe Rechengewalt auf ihrer Seite hatten und sich als »großer lila Gorilla« gerierten. Wenn in Schulzimmer ein Software-Entwickler vor den Kindern stehe, sei nicht immer klar, ob sie eigentlich Schulen betrieben oder ein Technik-Imperium aufbauten. Doch heute hätten sie den Menschen viel stärker im Blick. Ihre erste Priorität sei personalisiertes Lernen oder »Einsatz und Anpassung der neuesten Hilfsmittel und Software, damit Schüler mehr lernen können«, daneben konzentrierten sie sich aber auf Talententwicklung und den Einfluss der Eltern. »Wir waren Uber, jetzt wollen wir Lyft sein«, sagte er mit Bezug auf den neuen, fahrerfreundlichen Konkurrenten des Fahrdienstleisters. Auf der Technikseite brachte die größte Lektion nur geringen Gewinn ein: eine etwas bessere Version eines Programms, verlässlichere Daten als Entscheidungsgrundlage, etwas mehr eingesparte Zeit.
Kann ein System so effizient werden, dass eines Tages alles Lernen ausschließlich in betreuten Lernlabors stattfindet? Das glaubt Preston nicht.
»Diesen ganzen Blödsinn von ›Dann gibt es keine Schulen mehr, die Kinder lernen dann von zu Hause aus‹ nehme ich niemandem ab. Und halte es außerdem für schlecht.«
Grinsend blickt er auf.
»Unsere Kinder müssen lernen, sozial zu interagieren. Jemandem eine zu knallen und sich zu entschuldigen. Und der andere muss ihm sagen: ›Das hat wehgetan! Und es verletzt mich, dass du mir eine geknallt hast!‹ Wir haben soziale Normen, die Kinder lernen müssen.«
Ich nickte. Im Labor selbst entwickeln die Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten, aber nur in einem sehr engen Sinn. Überall in der Rocketship-Schule sah ich auch unglaubliche Lehrer, die mit den Schülern großartige Arbeit leisteten. Das stand immer noch im Mittelpunkt des Lernens. Zum Glück. Was die Kinder im Lernlabor lernen, musste ich unwillkürlich denken, ist doch genau die Art kognitiver Fertigkeiten, die sie für die meisten leicht automatisierbaren Jobs wie Nummer 702 (Telefonmarketing) qualifizieren und nicht für kreativere Beschäftigungen wie Nummer 1 (Physiotherapeut), wenn man der Oxford Martin-Studie zur Automatisierung von 702 Berufen glaubt. Fertigkeiten, die man am Computer üben kann, sind doch genau die, die sich dank eben dieser Maschinen auch leicht automatisieren lassen. Ist das ein notwendiger Schritt in der Entwicklung der Kinder oder ein krasser Fehler, der die Rocketeers und ihre Gefährten eines Tages ins Abseits führen wird?
Vielleicht kommen die Roboterlehrer doch nicht
Der Blödsinn, von dem Preston redete, kam nicht von einer Seite allein. Vielmehr hatte er sich – so läuft das eben in der Welt der automatisierten Intelligenz – seine eigene Logik geschaffen.
Viel Schwung erhielt er durch einen preisgekrönten TED-Talk von Sugata Mitra über das Loch in der Mauer.[15] Jahre zuvor hatte Mitra in Neu-Delhi direkt neben einem Slum gearbeitet. Er fragte sich, warum – besonders im Umgang mit Computern – immer reiche Kinder als hochbegabt galten und arme Kinder nicht. Er beschloss, ein Experiment durchzuführen, und stellte einen einzelnen Computer mit Internet-Anschluss (diebstahlsicher, Monsun-sicher und wahrscheinlich auch Erwachsenen-sicher) an die Grenzmauer zum Slum. Als Mitra den Computer anschaltete, umringten ihn neugierige Kinder, die wissen wollten, was er damit vorhatte. Weil er sein Experiment nicht beeinflussen wollte, ließ er sie einfach damit allein. Als er wiederkam, stellte er fest, dass etwas Bemerkenswertes passiert war. »Etwa acht Stunden später sah ich, wie sie das Netz durchstöberten und einander zeigten, wie das geht«, berichtete er. »Ich sagte: ›Das ist unmöglich, weil … Wie kann das sein? Sie wissen gar nichts.‹«[16] Seine Schlussfolgerung war verblüffend: Mit Unterstützung der geeigneten Technologie können Kinder einander selbst unterrichten.
Auf dieser Basis entwickelte sich Mitras Idee von der Selbstorganisierten Lernumgebung (Self-Organising Learning Environment, SOLE). Die Formel ist ganz einfach. Man stellt den Lernenden eine große Recherchefrage – etwas, das ihren Forschertrieb anregt – und feuert sie ein bisschen an – etwa durch jemanden, der hinter ihnen steht und jedes Mal, wenn sie etwas machen, sagt: »Wow, sag mal, wie hast du das denn gemacht? Wie geht es weiter? Echt, als ich so alt war wie du, hätte ich das nie hingekriegt!«; er nennt das die »Oma-Methode«. Dann hält man sich zurück und wartet auf den Lernprozess.
Mitra erhielt damals für seinen weitsichtigen Vortrag den mit einer Million Dollar dotierten TED-Preis. Seine Dankesrede nutzte er, um eine neue Vision von Schule zu bewerben, für die man Computer brauche, Omas (echte Omas aus anderen Ländern mit viel Zeit, die per Skype zur Unterstützung hereingebeamt wurden) sowie eine Infrastruktur zum Online-Lernen. Ausnahmslos überall einsetzbar, zugänglich für jedes Kind, das über ein Endgerät und eine Internetverbindung verfügt. Die Botschaft war absolut klar: Wir können Schulen, wie wir sie kennen, verabschieden und die »Schule in der Cloud« begrüßen.
Die Rede enthielt wichtige Erkenntnisse: Digitale Technologien ermöglichen inzwischen den Zugang zu allen online verfügbaren Inhalten; die Methodologie lässt sich schnell ausbauen; Lehrer können weltweit herumgebeamt werden. Bald darauf kam die Khan Academy auf, eine riesige Online-Bibliothek mit Mathe-Tutorials, ursprünglich gegründet von einem Mitarbeiter bei Microsoft, Salman Khan, der seinem Cousin in einem anderen Bundesstaat Nachhilfe geben wollte; inzwischen steht sie Millionen Lernenden weltweit zur Verfügung. Beide Projekte profitierten von einem wichtigen Silicon Valley-Mythos: Technologie hat ein Ziel, und dieses Ziel ist die Lösung aller Probleme auf der Welt. Willkommen in unserer gesunden, fetten, Technik-Utopie! Einige Skeptiker warnen zwar davor, diese Projekte als die Heilsbringer der künftigen Schulbildung anzusehen, doch andere prognostizieren bereits eine neue Ära des Lernens. Gib einem Kind einen Laptop, und es bringt sich alles andere selbst bei.
Der Schulbezirk Los Angeles (LAUSD) beschloss, genau das zu tun. 2013 wurde bekannt gegeben, dass jeder Schüler in der Stadt ein mit der Software des Schulbuchverlags Pearson ausgestattetes iPad erhalten würde. Mit 1,3 Milliarden Dollar eine der ehrgeizigsten Investitionen in technische Schulausstattung, die es in den USA je gegeben hatte.
Es wurde ein Fiasko.
Ganze Lkw-Ladungen von iPads wurden an die Pilotschulen geliefert. Viele blieben ungenutzt in den schwarzen Transportkoffern liegen, weil die Lehrer für ihren Einsatz im Unterricht schlecht geschult waren. Findige Schüler fanden heraus, wie sich die eingebauten Sperren für Nicht-Lernsoftware hacken ließen. Schließlich sah sich der Leiter der Instructional Technology Initiative gezwungen, den Vertrag aufzulösen, weil nur fünf Prozent der Kinder dauerhaften Zugang zu der Pearson-Software der App hatten. Schlimmer noch: Es tauchte ein E-Mail-Verkehr zwischen Apple/Pearson und dem Leiter der Schulbehörde auf, in dem dieser seine Begeisterung äußerte, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten – und das ein ganzes Jahr bevor die öffentliche Ausschreibung auch nur angelaufen war.[17] Das iPad-Fiasko von Los Angeles rief auch einen früheren Fall ins Gedächtnis, bei dem jedes Kind in Thailand zur Lernunterstützung ein Tablet erhielt. Das Ergebnis? Mangels geeigneter Lehrerschulung sank das Leistungsniveau insgesamt ab.[18]
Obendrein ergab eine kleine Überprüfung durch Experten, dass Sugata Mitras »Loch in der Mauer« auch nicht ganz das war, wonach es zunächst aussah. Obwohl er Schulen für obsolet erklärt hatte, stellte sich heraus, dass die Computer, die er für sein Programm installiert hatte, üblicherweise in den Schulgebäuden der Slums standen. Mitra selbst argumentierte, die »Loch in der Mauer«-Geräte funktionierten viel besser, wenn sie in Lernprogramme integriert seien, die von guten Lehrern verwaltet wurden.
Dass der entscheidende Lernfaktor womöglich die Lehrer und nicht ihre Hilfsmittel sind, wurde bei der Jagd nach der technologischen Innovation offenbar häufig übersehen. Die schnell zunehmende Vernetzung und die wachsende Leistungsfähigkeit der Computer hatte ein ganzes Pantheon neuer Lerngötter heraufbeschworen, vom »flipped classroom« (umgedrehter Unterricht) über adaptive Lernumgebungen, integriertes Lernen bis zur Personalisierung. Dennoch häufen sich nicht etwa die Belege. Wie eine OECD-Studie an Zehntausenden Kindern in über vierzig Ländern ergab, schneiden Kinder umso schlechter bei bestimmten Tests ab, je mehr Zeit sie am Computer verbringen.[19] Behörden erwarteten fälschlicherweise, die Geräte würden ganz von selbst die Produktivität steigern, und vergaßen dabei die Lehrer. Die Länder, die erheblich in die Technologie investierten, wiesen in den Tests durchschnittlich »keine erkennbare Verbesserung« auf. Der Report kam zu dem Schluss: »Wer die Technologien des 21. Jahrhunderts einfach der Lernpraxis des 20. Jahrhunderts überstülpt, kann die Effektivität des Lehrens nur verwässern.«
1:1 im Spiel Roboter gegen Menschen.
Allerdings geht es ja nicht darum abzustreiten, dass Technologie Lernprozesse verbessern kann. Die Ergebnisse der OECD-Studie, der Studie aus Thailand und des Experiments vom »Loch in der Mauer« sind eindeutig. Computer können das Lernen verändern – aber nur, wenn sie von Experten eingesetzt werden. Dem OECD