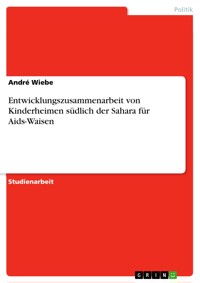Wie wichtig ist Bewegung für Grundschulkinder? Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung und das Wohlbefinden im digitalen Medienzeitalter E-Book
André Wiebe
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Immer häufiger leiden in Deutschland schon Grundschulkinder unter Haltungsauffälligkeiten, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Schwächen. Dies ist in erster Linie auf mangelnde Bewegung zurückzuführen. Laut WHO sollten Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten sportlich aktiv sein – ein Wert, der im digitalen Zeitalter längst nicht mehr erreicht wird. André Wiebe deckt auf, wie das Bewegungsverhalten von Kindern aktuell aussieht. In den Jahren 2009 bis 2012 erreichten gerade mal 31 Prozent der deutschen Grundschulkinder den empfohlenen Mindestwert an körperlicher Aktivität. Doch warum ist dieser Wert so gering? Wiebe beleuchtet die unterschiedlichen Lebensbereiche von Kindern und wertet aktuelle Studien aus. Er veranschaulicht, welche Veränderung in den vergangenen Jahren eingetreten ist und ob der Abwärtstrend zwingend negativ ist. Seine Publikation ist ein wichtiger Wegweiser für die Soziale Arbeit mit Grundschulkindern. Aus dem Inhalt: - Bewegungsmangel; - Digitale Medien; - Smartphone; - Soziale Netzwerke; - Adipositas; - KiGGS-Studie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 68
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2019
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Bewegung in der Entwicklung
2.1 Bewegung als kindliches Grundbedürfnis
2.2 Wirkung auf kognitive Fähigkeiten
2.3 Wirkung auf die körperliche Verfassung
2.3.1 Motorik
2.3.2 Körperliche Gesundheit
2.3.3 Folgen von Bewegungsmangel
2.4 Bewegung und soziale Entwicklung
3 Der Einfluss von Bewegung auf die Entwicklung des Selbst
3.1 Der Einfluss von Bewegung auf das Selbstkonzept
3.2 Der Einfluss von Bewegung auf die Selbstwirksamkeit
3.3 Negative Entwicklung des Selbst durch Bewegungsmangel
4 KiGGS-Studie
4.1 Allgemeine Informationen
4.2 Relevante Ergebnisse für die vorliegende Arbeit
5 Bewegung von Grundschulkindern heute und Möglichkeiten zur weiteren Gestaltung von Bewegung
5.1 Bewegungsräume
5.1.1 Sozialraum
5.1.2 Lebenswelt
5.1.3 Sozialökologische Zonen
5.2 Digitale Medien als Mitverursacher für Bewegungsmangel
6 Wohlbefinden
6.1 Subjektives und objektives Wohlbefinden
6.2 Körperliche Aktivität und Gesundheitszustand
6.3 Körperliche Aktivität und Ausgeglichenheit
7 Abschlussreflexion
7.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
7.2 Appell an die soziale Arbeit
8 Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Prävalenz von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität pro Tag (WHO-Empfehlung erreicht) nach Altersgruppen und Geschlecht im Vergleich zwischen KiGGS Welle 1 und KiGGS Welle 2
Abbildung 2: Übergewichtsprävalenz (einschließlich Adipositas) nach Geschlecht, Altersgruppen und sozioökonomischem Status (s. S.)
Abbildung 3: Entwicklung von Übergewicht und Adipositas von der KiGGS-Basiserhebung und der KiGGS Welle 2
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: „Sport treiben allgemein“, „Im Sportverein aktiv“ und „WHO-Empfehlung erfüllt“ - Häufigkeit der Sportaktivität nach Geschlecht und Altersgruppen
1 Einleitung
„Bewegung ist ein Grundphänomen menschlichen Lebens, der Mensch ist von seinem Wesen her darauf angewiesen“ (Zimmer 2009, S. 17).
Leben ist Bewegung – Bewegung ist Leben. Ohne Bewegung wäre Leben nicht nur undenkbar, sondern schlichtweg unmöglich. Überlebenswichtige Vorgänge, wie beispielsweise Herzschlag und Atmung, sind nur durch Bewegung (Muskelkontraktionen) möglich. Das benötigte Ausmaß an aktiver Bewegung ist heutzutage allerdings abhängig von der Lebenssituation des Individuums. Bei erwachsenen Menschen kann die körperliche Betätigung in direktem Zusammenhang mit ihrem Gesundheitszustand stehen (vgl. Haskell 2000, S. 930). Insbesondere in der Entwicklung von Kindern ist sie laut Zimmer und weiteren führenden Experten von immenser Bedeutung:
„Kindheit ist eine bewegte Zeit, in keiner anderen Lebensstufe spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit“ (Zimmer 2009, S. 16; vgl. auch Billmeier/Ziroli 2014, S. 123).
Dies wirft die Frage auf, wie das aktuelle Bewegungsverhalten von Kindern aussieht. Es soll in dieser Arbeit allerdings speziell um Grundschulkinder gehen, um die Thematik etwas einzugrenzen. Es treten immer häufiger Haltungsauffälligkeiten, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Schwächen und Bewegungsbeeinträchtigungen bei Kindern auf (vgl. Zimmer 2008, S. 23). Diese gesundheitlichen Probleme lassen sich auf einen Bewegungsmangel zurückführen, welcher sich in den letzten Jahren vergrößert hat: Laut der World-Health-Organisation ((WHO), deutsch: Weltgesundheitsorganisation) sollten Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten sportlich aktiv sein. Nur 31 % der Grundschulkinder erreichten in den Jahren 2009 bis 1012 nach einer Studie des Robert Koch-Instituts dieses empfohlene Mindestmaß an körperlicher Aktivität (vgl. Manz u.a. 2014, S. 844). In der „zweiten Welle“ der Studie, in den Jahren 2014 bis 2017 waren es sogar nur noch 26,4 % (vgl. Finger u.a. 2018, S. 26). Gleichzeitig ist ein deutlicher Anstieg der Mediennutzung bei Kindern zu beobachten, welcher laut Spitzer sogar schon besorgniserregend hoch ist (vgl. Spitzer 2012, S. 11-12). Auch hierzu gibt es bereits Studien und Forschungsergebnisse, aufgrund derer sich eindeutige Aussagen treffen lassen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll hierauf näher eingegangen werden. Korreliert also der steigende Gebrauch von digitalen Medien mit der Bewegungsabnahme im Kindesalter? Dies würde bedeuten, dass wenn Bewegung das Wohlbefinden fördert, digitale Medien einen Grund für dessen Verschlechterung darstellen würden. Sogar das Jugendwort 2015 hat etwas mit dem immer weiter verbreiteten Smartphone zu tun: Es lautet „Smombie“ (vgl. Spitzer 2016, S. 8). Diese Zusammenführung der beiden Wörter Smartphone und Zombie (ein willenloser Mensch ohne Seele) sagt aus, dass manche Menschen durch die fast pausenlose Beschäftigung mit dem Mobiltelefon, in ihrer eigenen, digitalen Welt gefangen werden. Außerdem verdeutlicht es, wie sich hierdurch sogar die Persönlichkeit verändern kann und diese teilweise nicht mehr wiederzuerkennen ist.
Kinder haben unterschiedlichste Möglichkeiten und Situationen um Bewegung zu erfahren. Sie sollten im Alltag die Gelegenheit zur aktiven sportlichen Betätigung haben. Aber wie sieht die aktuelle Bewegungssituation in den verschiedenen Lebensbereichen von Kindern aus? Um diese Frage zu beantworten werden in dieser Arbeit die aktuellen Ergebnisse der KiGGS-Studie herangezogen und teilweise mit früheren Ergebnissen verglichen um die gesellschaftliche Veränderung und die Tendenzen von kindlicher Bewegungsaktivität innerhalb der letzten Jahre erkennen zu können.
Warum ist Bewegung so wichtig und welche Auswirkungen hat sie im Kindesalter? Dieses Thema wurde bereits vielfältig bearbeitet und soll auf wissenschaftlicher Grundlage in meiner Arbeit wiedergeben werden. Hierzu wird im Folgenden insbesondere die Literatur der Sportwissenschaftlerin Prof. Dr. Renate Zimmer herangezogen. Welche Bedeutung hat Bewegung in der kindlichen Entwicklung für das Wohlbefinden von Grundschulkindern im digitalen Medienzeitalter? In dieser Arbeit möchte ich herausstellen, ob nach neuesten Erkenntnissen körperliche und sportliche Aktivität von Grundschulkindern in Deutschland gefördert werden sollten und ob dadurch ihr Wohlbefinden gesteigert werden kann. Was genau definiert also dieses Wohlbefinden und welche Rolle spielt das eigene Wohlbefinden in der Entwicklung eines Kindes? Wie wirkt sich körperliche Aktivität auf dieses aus?
Für eine möglichst inhaltlich adäquate Bearbeitung des Themas wird im Folgenden die Bedeutung von Bewegung in der kindlichen Entwicklung beschrieben (Kapitel 2). Hierzu wird erst Bewegung als kindliches Grundbedürfnis erläutert (Kapitel 2.1). Anschließend wird die Wirkung von Bewegung auf kognitive Fähigkeiten (Kapitel 2.2) und dann die körperliche Verfassung (Kapitel 2.3) betrachtet. Dieses Kapitel wird in Motorik (Kapitel 2.3.1), körperliche Gesundheit (Kapitel 2.3.2) und die Folgen von Bewegungsmangel (Kapitel 2.3.3) unterteilt. Dann wird der Zusammenhang zwischen Bewegung und sozialer Entwicklung hergestellt (Kapitel 2.4). Folgend wird der Einfluss von Bewegung auf die Entwicklung des Selbst beschrieben (Kapitel 3). Dazu wird zuerst dargestellt wie Bewegung das Selbstkonzept (Kapitel 3.1) und die Selbstwirksamkeit (Kapitel 3.2) beeinflussen kann. Schließend werden noch die möglichen Folgen von Bewegungsmangel auf das Selbst aufgezeigt (Kapitel 3.3). In diesem Zusammenhang wird die KiGGS-Studie (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) vorgestellt (Kapitel 4). Hierzu werden zuerst allgemeine Informationen über die Studie dargestellt (Kapitel 4.1) und dann die für diese Arbeit relevanten Ergebnisse vorgestellt (Kapitel 4.2). Anschließend wird die heutige Bewegung von Grundschulkindern und Möglichkeiten zur weiteren Gestaltung von Bewegung thematisiert (Kapitel 5) und unterschiedliche Bewegungsräume betrachtet (Kapitel 5.1), nämlich der Sozialraum (Kapitel 5.1.1), die Lebenswelt (Kapitel 5.1.2) und die sozialökologischen Zonen (Kapitel 5.1.3). Im Anschluss werden die digitalen Medien als Mitverursacher des aktuellen Bewegungsmangels analysiert (Kapitel 5.2). Dann wird auf das Wohlbefinden eingegangen (Kapitel 6) und dabei zuerst subjektives und objektives Wohlbefinden definiert (Kapitel 6.1). Nachfolgend wird die Verbindung von sportlicher Aktivität und dem Gesundheitszustand (Kapitel 6.2) und von sportlicher Aktivität und der Ausgeglichenheit (Kapitel 6.3) untersucht. Die Abschlussreflexion (Kapitel 7) unterteilt sich in die Zusammenfassung und Schlussfolgerungen der Arbeit (Kapitel 7.1) und den daraus resultierenden Appell an die soziale Arbeit (Kapitel 7.2).
2 Bewegung in der Entwicklung
Die Thematik Bewegung ist zu groß, um sie allumfassend im Rahmen dieser Arbeit bearbeiten zu können. Deshalb wird im Folgenden kurz der Umfang von Bewegung erläutert, welcher hier thematisiert werden soll. Die sogenannte Alltagsbewegung umfasst die regelmäßigen, alltäglichen Bewegungstätigkeiten, wie Gehen, Spielen usw. Allerdings ist in dieser Arbeit der Aspekt der körperlichen Aktivität wichtiger. Bouchard und Shepard definierten den Begriff „körperliche Aktivität“ im Jahr 1994 so, dass durch Bewegung ein von Muskeln produzierter, erheblicher Energieverbrauch verursacht wird[1] (vgl. Bouchard/Shepard 1994, S.77).