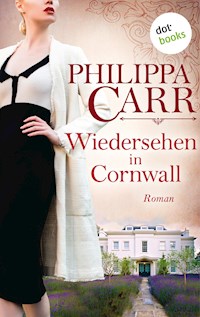
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Töchter Englands
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Liebe, die Frauen und der Krieg: der Schicksalsroman „Wiedersehen in Cornwall“ von Bestsellerautorin Philippa Carr jetzt als eBook bei dotbooks. Wer gibt dir Halt, wenn die Welt um dich herum zusammenbricht? England, 1939: Mit der Kriegserklärung an Deutschland ist die Hoffnung auf eine friedliche Einigung der feindlichen Mächte gestorben. Auch die Zwillingsschwestern Dorabella und Violetta werden von den Stürmen der Zeit erfasst. Während Violetta ihren Geliebten in den Krieg ziehen lassen muss, fühlt sich Dorabella hin- und hergerissen zwischen zwei Männern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: dem Franzosen Jacques und dem ebenso attraktiven wie mysteriösen Captain Brent von der britischen Armee. Aber ist er wirklich der Mann, für den Dorabella ihn hält? Ohne sich dagegen wehren zu können, werden die Schwestern in ein abgründiges Spiel verwickelt, das sie von Cornwall nach London führen wird – und in größte Gefahr! Eine Zeit der Ängste, Hoffnungen und Träume: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt in der Saga „Die Töchter Englands“ große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Wiedersehen in Cornwall“ von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wer gibt dir Halt, wenn die Welt um dich herum zusammenbricht? England, 1939: Mit der Kriegserklärung an Deutschland ist die Hoffnung auf eine friedliche Einigung der feindlichen Mächte gestorben. Auch die Zwillingsschwestern Dorabella und Violetta werden von den Stürmen der Zeit erfasst. Während Violetta ihren Geliebten in den Krieg ziehen lassen muss, fühlt sich Dorabella hin- und hergerissen zwischen zwei Männern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: dem Franzosen Jacques und dem ebenso attraktiven wie mysteriösen Captain Brent von der britischen Armee. Aber ist er wirklich der Mann, für den Dorabella ihn hält? Ohne sich dagegen wehren zu können, werden die Schwestern in ein abgründiges Spiel verwickelt, das sie von Cornwall nach London führen wird – und in größte Gefahr!
Eine Zeit der Ängste, Hoffnungen und Träume: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt in der Saga »Die Töchter Englands« große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen!
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe November 2017
Copyright © der Originalausgabe 1993 Philippa Carr
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »We’ll meet again«.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/mutus7 und Dasha Muller
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-116-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wiedersehen in Cornwall« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
Wiedersehen in Cornwall
Roman
Aus dem Englischen von Michaela Link
dotbooks.
Nächtliche Besucher
An jenem Morgen im März stand ich nach einer fast durchwachten Nacht mit dem ersten Tageslicht auf. Die alte Mrs. Jermyn hatte auf Jermyn Priory eine Dinnerparty gegeben, um meine Verlobung mit ihrem Enkelsohn zu feiern – eine Feier, die von der Tatsache überschattet war, daß Jowan am folgenden Tag an die Front mußte.
Ich hatte mit seinem Heiratsantrag gerechnet, seit er mir eines Tages im September – kurz nach der Kriegserklärung – gesagt hatte, er würde sich zur Armee melden.
Seit unserer ersten Begegnung fühlten wir uns schon zueinander hingezogen: Damals hatte ich mich auf das Land der Jermyns vorgewagt, war prompt vom Pferd gefallen und von ihm gerettet worden. Man könnte beinahe sagen, daß dies der Anfang vom Ende einer uralten Fehde zwischen den Familien Tregarland und Jermyn gewesen war. Allerdings war ich eigentlich keine Tregarland und nur durch meine Zwillingsschwester Dorabella, die ich damals besuchte, mit dieser Familie verschwägert; denn Dorabella hatte einen Tregarland geheiratet.
Nicht daß Jowan sich auch nur im geringsten für die Fehde interessiert hätte; er belächelte sie, betrachtete sie als eine Narretei, die von den Einheimischen geliebt und deshalb gehegt und gepflegt wurde. Und doch hatte sie die beiden Familien jahrelang voneinander ferngehalten – bis wir uns entschlossen, sie im heiligen Stand der Ehe zusammenzuführen.
Sobald der Krieg vorüber war, wollten wir heiraten.
»In sechs Monaten vielleicht«, sagte Jowan. »Oder sogar noch früher.«
Manchmal schien es mir, als nähme Jowan alles, wie es kam, und machte es sich dann passend. Vielleicht war er mir deshalb während der schrecklichen Zeit, die ich durchgemacht hatte, eine solche Hilfe gewesen.
Jowan war bei seiner Großmutter aufgewachsen, da seine Mutter sehr früh gestorben war. Jermyn Priory hatte er erst vor wenigen Jahren geerbt – in etwas heruntergekommenem Zustand, denn Jowans leichtlebiger Onkel hatte den Besitz vernachlässigt – und seither bemühte er sich, dort alles wieder in Ordnung zu bringen. Und das tat er mit großem Erfolg. Er liebte das Haus, in dem er seine Jugendjahre verbracht hatte, bevor er zu seinem Vater nach Neuseeland gegangen war. Sein Vater war vor seinem Onkel gestorben, und so war der ganze Besitz nun an Jowan gefallen.
Ich bewunderte ihn ebenso wie seine Großmutter wegen seiner entschlossenen Zielstrebigkeit. Sie konnte nicht von ihm sprechen, ohne ihren Stolz auf ihren Enkel verbergen zu können.
»Jowan weiß immer sofort, was getan werden muß«, erzählte sie mir eines Tages. »Für ihn gibt es kein ›das geht nicht‹. Er liebt dieses Land genauso wie ich, und es ist nur recht und billig, daß es jetzt ihm gehört.«
Um so überraschter war ich, als er sich spontan entschloß, seinen Besitz zu verlassen und sich freiwillige zum Dienst in der Armee zu melden. Aber aus seiner Sicht schien sein Entschluß ganz einleuchtend zu sein: Der Krieg mußte zum Wohl des ganzen Landes gewonnen werden, und das schloß Jermyn Priory ein. Er hatte einen hervorragenden Verwalter, der mit einem fähigen Gehilfen zusammenarbeitete. Beide waren beträchtlich älter als er, verheiratet und hatten Familien, die versorgt werden mußte. Er sei am ehesten entbehrlich, sagte er, und er vertraue darauf, daß die beiden Männer sich in seiner Abwesenheit um das Gut kümmern würden.
»Wir werden mit den Deutschen im Handumdrehen fertig sein«, sagte er.
Während der letzten Monate hatte ich nicht viel von ihm zu sehen bekommen. Ab und zu hatte er Urlaub, aber nie sehr lange. Das war einer der Gründe, warum ich in Cornwall blieb – ein anderer Grund war meine Schwester, die nichts von meinem Aufbruch wissen wollte.
Jowan war zur Artillerie gegangen, deren Übungsplatz am Lark Hill auf der Salisbury-Ebene und damit vom Sitz der Tregarlands nicht weit entfernt lag.
Wie wir diese Urlaubstage genossen! Welche Zukunftspläne wir schmiedeten! Immer wenn er bei mir war, fühlte ich mich beschwingt und optimistisch, doch sobald er zum Dienst zurückkehrte, erfaßte mich ein Gefühl böser Vorahnungen, da ich wußte, daß der Tag unserer Trennung immer näher rückte.
Jetzt war er da.
Meine Eltern waren sehr erfreut über unsere Verbindung, und Jowans Großmutter und ich waren bereits gute Freunde geworden. Alles hätte einfach wunderbar sein sollen, aber wie konnte es das angesichts der drohenden Kriegsgefahr.
Als ich mich gewaschen und angekleidet hatte, war es immer noch sehr früh. Ich hatte das Gefühl, daß ich hinaus in die frische Morgenluft mußte; also zog ich mir einen Mantel an und ging zu meinem Lieblingsplatz im Garten.
Das Haus der Tregarlands lag wie eine Festung auf einem Felsen mit Blick über das Meer. Die Gärten reichten bis hinunter zum Strand, der ursprünglich Privatbesitz gewesen war. Jedoch hatten die Tregarlands dort ein Wegerecht einräumen müssen, weil die Strandspaziergänger sonst über die gefährlichen Klippen hätten klettern müssen, um ihren Weg fortzusetzen, was so gut wie unmöglich war, wie ich selbst einmal feststellte, als die Flut mich überraschte.
Ich setzte mich auf eine Bank, die an einem schönen Platz zwischen blühenden Büschen aufgestellt war, und blickte hinaus aufs Meer. Sehr bald schon würde Jowan irgendwo auf der anderen Seite dieses Gewässers sein. Bestimmungsort unbekannt. Es war nutzlos, mir vorzumachen, daß er sich nicht in Gefahr begab.
Ich hörte Schritte und sah, als ich den Kopf hob, Dorabella, meine Schwester, auf mich zukommen. Sie lächelte.
»Ich habe dich gehört«, sagte sie. »Und dann aus meinem Fenster gesehen.«
»Es ist noch sehr früh«, sagte ich.
»Der Morgen ist der schönste Teil des Tages, habe ich mir sagen lassen. Was ist los, Vee?«
Manchmal benutzte sie die Kurzfassung meines Namens, Violetta; und heute morgen schwang in ihrer Stimme ein Hauch von Zärtlichkeit mit. Sie wußte, was ich empfand.
Dorabella und ich waren keine eineiigen Zwillinge, aber dennoch gab es ein festes Band zwischen uns; meine Schwester hatte es einmal ›das Spinnwebband‹ genannt.
Sie hatte gesagt, dieses Band sei sehr stark und unzerreißbar, aber gleichzeitig so fein, daß keiner außer uns beiden von seiner Existenz wußte. Es war von jeher da gewesen und würde immer da sein. Ich glaube, damit hatte sie recht.
Dorabella war eher leichtfertig, aber hinreißend; ich dagegen galt als die Vernünftige, die Praktische. Stets umgab sie eine irreführende Aura der Zerbrechlichkeit, die ihre Wirkung auf das andere Geschlecht nie verfehlte. Ich hatte um ihre größere Anziehungskraft immer gewußt, war aber niemals – oder jedenfalls nur höchst selten – eifersüchtig darauf gewesen.
Wenn ich darüber nachdachte, wohin ihre Impulsivität sie gebracht hatte, ängstigte ich mich um sie, und ich war mir sicher, daß ihre jüngste Leichtfertigkeit eine nachhaltige Wirkung auf sie haben würde. Ihre überstürzte Heirat mit Dermot Tregarland hatte Folgen heraufbeschworen, die uns alle bestrafen. Ja, wenn diese Heirat nicht gewesen wäre, hätte ich Jowan nie kennengelernt. Und hätte in diesem Augenblick nicht dort gesessen.
Ich sah sie an. Ja, die jüngsten Ereignisse hatten selbst sie ernüchtert. Ich hatte Angst um sie, aber was sie auch tat, ich würde nie aufhören, sie zu lieben. Nichts würde daran jemals etwas ändern.
Sie nahm meine Hand und sagte: »Keine Sorge. Ihm wird nichts geschehen. Das spüre ich einfach. Er ist zum Überleben geboren. Genau wie ich, und ich erkenne in ihm eine verwandte Seele.«
»Was dich betrifft, hast du sicher recht«, erwiderte ich.
Sie sah mich reumütig an und bat mich mit einem kurzen einfühlsamen Blick um Verzeihung für all die Ängste, die wir ihretwegen ausgestanden hatten. Ich hatte ihr schon längst vergeben, genauso wie unsere Eltern.
»Natürlich habe ich recht«, sagt sie. »Der Krieg wird bald vorbei sein. Und er wird ... als Held zurückkehren. Ich höre schon die Hochzeitsglocken läuten. Die Familien werden sich versammeln und diese törichte Fehde zwischen den Tregarlands und den Jermyns wird für alle Zeiten ein Ende finden! Die ganze Sache war doch ziemlich lächerlich, findest du nicht auch?«
»Und du, Dorabella, was wirst du tun? Wirst du hierblieben, bei den Tregarlands?«
Sie wirkte nachdenklich; also war ihr bereits der Gedanke gekommen fortzugehen.
»Es wird alles anders sein«, sagte sie. »Du wirst die Herrin von Jermyn Priory werden.«
»Nein, das ist die alte Mrs. Jermyn.«
»Oh, sie wird dir freundlich den Vortritt lassen. Sie freut sich ja so, daß du ihren kleinen Liebling heiratest. Wenn dieser elende Krieg vorbei ist, werde ich es hier wohl aushalten können, wenn du in der Nähe bleibst. Wir alle leben ja jetzt in einer unsicheren Zeit, nicht wahr? Niemand kann irgendwelche Pläne machen. Wir wissen nicht, was im nächsten Augenblick geschehen kann. Dieser Krieg ... was glaubst du, wie lange er dauern wird?«
»Ich weiß es nicht. Wir hören pausenlos, daß wir uns wacker schlagen, aber die Deutschen schienen sehr stark zu sein. Es ist schwer zu sagen, ob wir wirklich alles erfahren oder ob man uns nicht manches vorenthält.«
»Du siehst zu schwarz, Vee.«
»Ich wüßte nur gern, wie's wirklich ist.«
»Unwissenheit ist manchmal ein Segen, vergiß das nicht.«
»Aber nicht, wenn die Wahrheit uns eines Tages dann doch einholt, was ja unter gewissen Umständen durchaus möglich ist.«
»Jetzt aber Schluß damit! Ich weiß, daß Jowan weggeht und du dir natürlich Sorgen machst, aber immerhin sind wir beide hier zusammen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. Das beste von allem ist für mich, daß wir Nachbarn sein werden. Und daran mußt du immer denken.«
»Und du hast Tristan.«
»Auf den die liebe Tante Violetta Besitzansprüche erhebt, ebenso wie Nanny Crabtree, die sicherlich glaubt, daß er mehr ihr gehört als mir. Ich frage mich, ob dieses Kind weiß, wie viele Menschen es für sich beanspruchen. Wenn ich ihn auf den Arm nehme, denkt Nanny Crabtree jedesmal, ich würde ihn fallenlassen.« Plötzlich wurde sie ernst. »Nach dem, was geschehen ist, hat sie wahrscheinlich das Gefühl, daß man mir nicht trauen kann. Sie war es – und du natürlich –, die ihn vor der verrückten Matilda gerettet hat, als ich nicht da war ... nicht war, wo ich hätte sein sollen.«
»Das gehört der Vergangenheit an.«
»Wirklich? Glaubst du nicht, daß die Dinge, die wir tun ... die wirklich wichtigen Dinge ... niemals Vergangenheit sein werden? Ihre Folgen bleiben für alle Zeiten bestehen!«
»So darfst du nicht denken.«
»Die meiste Zeit tue ich das auch nicht, aber dann sind die Gedanken plötzlich wieder da und lassen mir keine Ruhe. Ich bin mit einem Liebhaber durchgebrannt. Ich habe meinen Mann und mein Kind sitzen lassen ... und jetzt bin ich wieder zurück. Mein Mann ist tot, und ohne dich und Nanny Crabtree wäre mein Kind vielleicht ermordet worden. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie mir da manchmal zumute ist.«
»Hauptsache, du hast deine Lektion gelernt ...«
Da änderte sich plötzlich ihre Stimmung, und sie brach in lautes Gelächter aus.
»Gegen dich komme ich einfach nicht an«, sagte sie. »Das ist typisch unsere Violetta. Immer muß sie die Wahrheit predigen, immer muß sie sich heroisch mit den Problemen der widerspenstigen kleinen Zwillingsschwester herumschlagen – und vergißt dabei nie, die Moral von der Geschichte zu erklären.«
»Irgend jemand muß es ja tun!«
»Ja, das stimmt, und du hast es immer getan. Glaub ja nicht, das würde ich vergessen. Ich vergesse es nie. Das ist auch der Grund, warum ich dich in der Nähe haben möchte und es gleich mit der Angst zu tun bekomme, wenn du nicht da bist. Ich werde nie vergessen, wie du damals diese Geschichte für mich erzählt hast. Und ich weiß, wie sehr du es haßt zu lügen. Ich war mit meinem Geliebten durchgebrannt. Ich hatte meine Flucht gut getarnt, es sollte so aussehen, als sei ich ertrunken ... als sei ich schwimmen gegangen, hätte mein Handtuch und meine Sandalen dort am Strand zurückgelassen ... doch stattdessen überquerte ich bereits den Kanal und befand mich auf dem Weg nach Paris. Und was hast du getan? Du hast dir eine Geschichte für mich ausgedacht. Ich bin hinausgeschwommen, habe das Bewußtsein verloren, eine Yacht hat mich aufgefischt ... ach, was für eine herrliche Geschichte!«
»Sie war ziemlich unglaubwürdig, und wir wären niemals damit durchgekommen, wenn nicht ausgerechnet in diesem Augenblick der Krieg ausgebrochen wäre und die Leute wichtigere Dinge im Kopf hatten als das launenhafte, rücksichtslose Verhalten einer leichtfertigen jungen Frau.«
»Du hast ganz recht, liebe Schwester, wie immer. Aber jetzt verstehst du doch, warum ich nicht ohne dich leben kann? Selbst Tregarland wird für mich annehmbar, weil du meine Nachbarin wirst, wenn du deinen Jowan heiratest. Dann heißt du Jermyn und ich Tregarland. Und so wird am Ende doch noch alles gut, nicht wahr?«
»Das kann man jetzt noch nicht sagen.«
»Du bist also fest entschlossen, schwarz zu sehen. Aber sagt dir nicht einer deiner vielen Grundsätze, daß das nicht sehr hilfreich ist?«
»Ich möchte eben den Tatsachen ins Auge sehen.«
»Ich weiß. Und manchmal habe ich das Gefühl, als würde die Vergangenheit niemals aus diesen Mauern weichen. Sie sitzt in allen Ritzen dieses Hauses. Matilda Lewyth mit ihrem Wahnsinn. Sie scheint immer noch hier zu sein. Und dann ist da natürlich Gordon. Was geht wohl in ihm vor? Seine Mutter eine Mörderin ... die ihren Lebensabend in einer Irrenanstalt zubringt ...«
»Gordon ist einer der vernünftigsten Männer, die ich kenne. Er wird die Dinge sehen, wie sie sind. Seine Mutter wollte Tregarland für ihn und hat zugelassen, daß dieser Wunsch zu einer Besessenheit wurde. Der alte Mann hat sie bis aufs Blut gereizt. Er war boshaft und schadenfroh. Er wollte sehen, wie sie reagierte. Nun, sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, und jetzt gäbe er alles darum, diese Dinge ungeschehen machen zu können. In gewisser Hinsicht gibt er sich die Schuld an allem – und es läßt sich nicht leugnen, daß er wirklich seinen Teil zu diesem Drama beigetragen hat. Aber nun ist alles vorüber. Gott sei Dank konnten wir Matilda daran hindern, Tristan etwas anzutun. Und jetzt ist sie in sicherer Obhut, Tristan ist bei Nanny Crabtree und allen anderen im Haus Hahn im Korb. Selbst der alte Mr. Tregarland hält seinen Enkelsohn für das wunderbarste Kind auf der Welt. Tristan ist in Sicherheit. Das ist das wichtigste, und daran müssen wir immer denken.«
»Aber ich kann mich von meiner Schuld nicht frei machen. Ich hätte hier sein müssen. Dermot könnte noch leben.«
»Dermot war schwer verletzt. Er wußte, daß er sich nicht wieder erholen würde, und hat sich deshalb das Leben genommen. Aber das ist alles Vergangenheit.«
»Was denken die Leute von mir? Sie müssen doch einen Verdacht haben.«
»Sie denken überhaupt nicht viel über dich nach. Sie haben wichtigere Dinge im Kopf und machen sich Sorgen, was auf dem Kontinent geschieht. Wo wird Hitler als nächstes einmarschieren? Wir sind im Krieg. Die Affäre von Mrs. Dermot Tregarland mit einem französischen Künstler ist im Vergleich zu den Ereignissen in Europa völlig unerheblich. Und so unwahrscheinlich deine Geschichte auch klingt, die Leute sind doch bereit, dir die Sache mit dem Gedächtnisverlust zu glauben, weil es sie eigentlich nicht besonders interessiert.«
»Du hast wie immer recht«, sagte sie. »Und das wichtigste von allem ist, daß du hier bist. Du wirst Jowan Jermyn heiraten, und der unglückselige, lang verflossene Liebhaber kann in Frieden ruhen. Meine liebe Schwester Violetta kam nach Tregarland und brachte alles wieder ins Lot.«
Wir lachten und saßen dann noch eine Weile schweigend da. Sie gab mir Kraft, und ich wußte, daß auch ich ihr Kraft gab. Es ist wunderbar, einen Menschen zu haben, der einem so nah steht, daß er fast ein Teil von einem selbst sein könnte. So war es von Anfang an, und so würde es immer bleiben.
Wie so oft wußte sie auch jetzt, was ich dachte. Nur wenige Male in unserem Leben waren wir uns fern gewesen – kurzzeitig, als sie mit dem französischen Künstler durchgebrannt war und diesen ›Unfall‹ inszeniert hatte, um die Wahrheit zu verschleiern.
Ich war davon überzeugt, daß sie nie wieder etwas derart Törichtes tun würde – und trotzdem hatte ich während der Zeit des Bangens keinen Augenblick geglaubt, daß sie wirklich tot war. Ich denke, sie hatte daraus gelernt, und wußte, daß sie es nie wieder zulassen durfte, daß wir getrennt werden.
»Laß uns ins Haus gehen und frühstücken«, sagte sie schließlich.
Zum Frühstück war auf Tregarland gut zwei Stunden lang gedeckt, so daß wir die Mahlzeit ganz nach unseren jeweiligen Tagesplänen etwas früher oder später einnehmen konnten. James Tregarland selbst erschien mittlerweile nur noch selten bei Tisch. Der Tod seines Sohnes und das Schicksal seiner Haushälterin hatten ihn zutiefst getroffen. Er war sich einer gewissen Mitschuld an den Geschehnissen in seinem Haus bewußt, die in der einen oder anderen Weise Auswirkungen auf uns alle hatten, wenn auch am wenigsten, so schien es, auf Matildas Sohn Gordon. Er war eine extrem praktische, zupackende Natur, und von ihm hing das Wohl des Gutes ab. Er machte weiter, als hätte sich kaum etwas geändert. Ich hatte schon immer gewußt, daß er ein bemerkenswerter Mann war.
Wir ich schon sagte, bekamen wir James Tregarland beim Frühstück nur noch selten zu sehen, und auch an diesem Morgen waren Dorabella und ich allein.
Eines der Stubenmädchen brachte die Post. Es waren zwei Briefe von meiner Mutter dabei – einer für jede von uns. Sie schrieb immer zwei Briefe, auch wenn sie beide inhaltlich kaum unterschieden.
Wir öffneten sie, und ich las:
Meine liebste Violetta,das Leben ist ungewiß hier, und ich mache mir ein wenig Sorgen um Gretchen. Es ist eine schlimme Zeit für sie. Sie hat solche Angst um ihre Familie in Deutschland. Gott allein weiß, was ihnen dort geschieht, und jetzt, da Edward in Bälde nach Übersee geht ... Stell Dir vor, er wird gegen ihre Landleute kämpfen! Die Ärmste ist furchtbar unglücklich. Du kannst dir ja denken, wie es jetzt um sie steht. Natürlich hat sie immer noch die kleine Hildegarde, und darüber bin ich so froh. Das Kind ist ein solcher Trost für sie.
Sie ist jetzt eine Weile bei uns gewesen. Es ist nicht leicht, in einem Land zu leben, das mit dem eigenen Land Krieg führt.
Ich habe überlegt, ob Du sie nicht vielleicht für ein Weilchen nach Cornwall einladen könntest. Ich schreibe auch Dorabella deswegen, da sie diejenige ist, die die Einladung aussprechen muß. Gretchen hatte Euch beide immer so gern, und es würde ihr sicher guttun, mit Leuten ihres eigenen Alters zusammenzusein. Wegen der Verdunklungen und all dieser Dinge ist das Reisen heutzutage natürlich schwierig – vor allem mit Kindern –, aber wenn Ihr sie und die kleine Hildegard ein Weilchen zu Euch holen würdet, würde ihr das sicher helfen.
Außerdem könnte Hildegarde Tristan Gesellschaft leisten, und ich bin sicher, Nanny Crabtree würde die Kleine mit Freuden übernehmen.
Das arme Gretchen! Die Leute wissen, daß sie Deutsche ist. Man hört es an ihrem Akzent, und jetzt, da Edward nicht mehr hier ist ... Nun, Du kannst Dir sicher vorstellen, wie schwierig es für sie ist.
Sprich mit Dorabella darüber. Ich hoffe wirklich, Ihr könnt sie zu Euch nehmen.
Mir und deinem Vater hat es sehr leid getan, daß wir nicht zu Deiner Verlobungsfeier kommen konnten. Aber wir möchten Dich wissen lassen, daß wir sehr erfreut darüber sind. Wir haben Jowan beide sehr gern. Dein Vater hält ihn für einen hervorragenden Verwalter, und wir sind sicher, daß ihr beide sehr glücklich miteinander sein werdet. Wie schön, daß Du auf diese Weise auch in Dorabellas Nähe sein kannst.
Mit ganz lieben Grüßen von Vater und mirDeine Mutter
Dorabella blickte von ihrem Brief auf. »Gretchen«, sagte sie.
Ich nickte.
»Natürlich muß sie herkommen«, sagte sie.
»Natürlich«, wiederholte ich.
Gretchen traf ungefähr zwei Wochen später ein. Dorabella fuhr zum Bahnhof, um sie abzuholen, und ich begleitete sie.
Man konnte sehen, daß Gretchen nicht glücklich war. Sie hatte genauso viel Angst um Edward wie ich um Jowan, und keine von uns beiden konnte irgend etwas über die Vorgänge an der Front in Erfahrung bringen. Außerdem quälte sie noch die zusätzliche Angst um ihre Familie in Bayern, von der sie seit geraumer Zeit nichts mehr gehört hatte.
Die kleine Hildegarde war ein bezauberndes Kind. Tristan wurde im November drei Jahre alt, und Hildegarde war etwa fünf Monate jünger. Sie war ein Einzelkind, ein dunkler Typ wie ihre Mutter, ohne eine Spur von Edwards Blond.
Nanny Crabtree stürzte sich sogleich mit Freuden auf sie, und Tristan war offensichtlich froh, Gesellschaft zu haben.
Nanny Crabtree befand sich seinerzeit in einem Zustand milder Rebellion wegen ›der beiden Racker da oben‹.
Weil man feindliche Luftangriffe befürchtete, waren überall im Lande Kinder aus den Großstädten evakuiert und in Privathäusern auf dem Land einquartiert worden. Zwei dieser Kinder waren zu uns gekommen, und sie waren nun Nanny Crabtrees »Racker«.
Das Dachgeschoß über dem Kinderzimmer wurde zum Teil von Dienstboten bewohnt. Die Räume dort waren groß und weitläufig, aber merkwürdig zugeschnitten wegen der Dachschräge. Zwei davon dienten jetzt unseren beiden jungen Gästen als Schlafzimmer. Sie waren Brüder und kamen aus Londons East End, Charley und Bert Trimmell, elf und acht Jahre alt. Nanny Crabtree hatte ein Auge auf die beiden, überwachte ihre Mahlzeiten und sorgte dafür, daß sie sich regelmäßig wuschen und zusammen mit den anderen Kindern, die in den Poldowns oder der näheren Umgebung einquartiert waren, in East Poldown zur Schule gingen. Da in der Schule in Poldown nicht genug Platz für alle Kinder war, hatte man den Lehrern und Lehrerinnen, die ihre Schüler hierher begleitet hatten, im Rathaus einige Räume zur Verfügung gestellt; und so gingen die Neuankömmlinge weiter zusammen mit ihren Freunden in die Schule.
Diese Kinder, die mit verlorenem Blick, Namensschildern um den Hals und Gasmasken über der Schulter hier angekommen waren, taten uns ungeheuer leid.
Gordon war damals sofort ins Rathaus gegangen, wo sie sich alle versammelt hatten, und mit den beiden Trimmells zurückgekommen.
Nanny Crabtrees Rebellion war nur eine oberflächliche Erscheinung, da sie letztlich die erste war, die sich ins Zeug legte und sich um die Kinder kümmerte; aber Veränderungen gefielen ihr grundsätzlich nicht, und nur darum ging es ihr eigentlich.
»Arme kleine Würmer«, nannte sie die evakuierten Kinder. »Das ist wahrhaftig nicht leicht für sie, einfach so aus ihrem Zuhause weggerissen zu werden. Aber wie dem auch sei, sie müssen lernen, wie es hier zugeht, und je eher, desto besser. Ich könnte diesen Hitler umbringen.«
Als Charley eines Tages mit Schrammen im Gesicht und zerrissener Jacke zurückkam, war sie ausgesprochen ungehalten – vor allem, als er sich hartnäckig weigerte, ihr zu erzählen, wie das alles passiert war.
»Bei uns hier gibt es so etwas nicht, hörst du. Du mußt dich benehmen. Du bist hier nicht in irgendwelchen Hinterhöfen.«
Charley schwieg weiterhin beharrlich und sah sie mit einem Ausdruck verschleierter Verachtung in den Augen an, den sie schon zuvor einmal bemerkt hatte. Dieser Blick verärgerte Nanny Crabtree, weil ihr bewußt war, daß sie sich nicht über die Unverschämtheiten eines Jungen beklagen konnte, der überhaupt nichts gesagt hatte.
Später erzählte sie mir davon.
»›Charley Trimmell‹, habe ich gesagt, ›du mußt lernen, jawohl, das mußt du‹. Und er stand einfach nur da, sah mich trotzig an ... und sagte kein einziges Wort.«
»Es mußt schrecklich sein für diese Kinder«, erwiderte ich. »Stellen Sie sich nur vor, man holt sie aus ihrem Heim und von ihren Familien weg und schickt sie zu Fremden.«
Nanny nickte. »Arme Würmer, aber sie müssen eben lernen, daß das Leben kein Zuckerschlecken ist.«
Ich glaube, es tat ihr später ziemlich leid, als sie erfuhr, auf welche Weise Charley verletzt wurde.
Sie hörte es von Bert, mit dem es sich leichter reden ließ. Er erzählte ihr, daß die Jungen in East Poldown es auf ihn abgesehen hatten, ihn immer wieder aufgezogen und gehänselt hatten. Sie hatten ihn in den Fluß werfen wollen, weil er nicht wie sie schwimmen konnte und so merkwürdig sprach. Sie hatten sich bereits alle um ihn geschart, und er rief aus Leibeskräften nach seinem Bruder. Schließlich kam Charley – der getreue Charley –, stürzte sich auf die johlende Meute und teilte dermaßen Prügel aus, daß alle seine Peiniger davonliefen, nicht ohne dem noblen Verteidiger jedoch auch einige Kratzer beizubringen.
»Warum hat er mir das denn nicht erzählt«, beklagte sich Nanny Crabtree, »statt mich einfach nur so anzusehen, wie er das immer tut?«
»Kinder reagieren nicht immer vernünftig«, entgegnete ich.
Nach diesem Zwischenfall herrschte Waffenstillstand zwischen Nanny und Charley. Nein. Es war mehr als das. Sie kamen beide aus London; sie kannten sich in der Hauptstadt aus und besaßen diese eigenartige Schläue und den unerschütterlichen Glauben, daß sie, weil sie Bürger der größten Stadt der Welt waren, mit jenen, die dieses Privileg nicht teilten, mir Mitleid haben konnten.
Kurze Zeit später erzählte Charley Nanny von seinem Zuhause. Er saß in ihrem Zimmer zusammen mit seinem Bruder Bert, der sich nur höchst ungern von Charley entfernte, und Nanny fand heraus, daß der Vater der Jungen zur See fuhr. Er war vor dem Krieg Matrose gewesen und die meiste Zeit nicht zu Hause, eine Tatsache, die die beiden Jungen kaum bedauerten. Ihre Mutter arbeitete als Bardame, und da sie bis spät in die Nacht fort war, mußte Charley sich um Bert kümmern.
»Die beiden haben einen guten Kern«, meinte Nanny später. »Charley ist ein kluger Kopf, und Bert glaubt natürlich, aus seinen Augen würden ihm Sonne, Mond und sämtliche Stern entgegenleuchten. Ich bin froh, daß wir die beiden hier haben. Wir hätten es weit schlimmer treffen können.«
So kam es, daß Nanny Crabtree mit Tristan und Hildegarde im eigentlichen Kinderzimmer und den Trimmells auf dem Dachboden, wie sie es formulierte, ›ein volles Programm‹ hatte, und uns allen war klar, daß sie es nicht ernst meinte, wenn sie gelegentlich über ihr Schicksal räsonierte.
Inzwischen ging eine Woche um die andere ins Land. Der Feldzug in Norwegen verlief nicht erfolgreich, und es gab keine Nachrichten von Jowan. Ein Tag war fast wie der andere. Dorabella, Gretchen und ich gingen mit den Kindern zum Strand und sahen zu, wie sie Sandburgen bauten. Sie spielten gern dicht am Wasser und ließen ihre Sandhaufen von den Wellen umspülen, so daß ringsum kleine Gräben entstanden. Es war schön, ihr Geschrei und ihr Lachen zu hören.
Gelegentlich waren wir in Poldown, wo die Straßen jetzt regelrecht überfüllt zu sein schienen. Die Einwohnerzahl war stark gestiegen, und es machte Spaß, dem Durcheinander von Cockney-Dialekt und Kornisch zu lauschen. Zuerst hatten die Kinder einige Schwierigkeiten, einander zu verstehen, aber die anfängliche Skepsis und das Mißtrauen gegenüber Fremden waren, so hatte ich den Eindruck, in gewissem Maße verschwunden.
Vieles hatte sich verändert, und ich dachte oft an die Zeit, als ich vor Dorabellas Hochzeit zum ersten Mal hier war, wie anheimelnd hatte alles gewirkt, und wir hatten meine Mutter und ich über den alten kornischen Aberglauben gelacht. Dann hatte ich Jowan kennengelernt ... Immer kehrten meine Gedanken irgendwann zu Jowan zurück.
Manchmal kam Dorabella nicht mit an den Strand, und Gretchen und ich gingen allein mit den Kindern. Wir konnten offen miteinander reden. Es gab keinen Grund, unsere Ängste voreinander zu verbergen, denn es waren ja die gleichen.
Oft ertappte ich sie dabei, wie sie mit traurigem Blick übers Meer schaute. Gretchen hatte in ihrem Leben so viel gelitten, daß sie immerzu mit Katastrophen rechnete. Bei mir lagen die Dinge anders. Ich war bei hingebungsvollen Eltern in einer Atmosphäre von Liebe und Zärtlichkeit aufgewachsen. Mein Leben war völlig gradlinig verlaufen – bis zu diesem Besuch in Bayern. Das war der Schlüssel gewesen, der dem Drama die Tür geöffnet hatte.
Wie anders hätte sich wohl alles entwickelt, wen wir niemals dorthin gefahren wären! Gretchen hätte ich vielleicht kennengelernt, weil Edward sie bereits kannte und sich zu ihr hingezogen fühlte; aber Dorabella und ich hätten niemals Dermot Tregarland getroffen. Und ich wäre nie an diesen Ort hier in Cornwall gekommen. Aber ich durfte nicht vergessen, daß ich dann auch niemals Jowan kennengelernt hätte.
Es war kaum zu glauben, daß es erst fünf Jahre her war, daß wir in dem Café in der Nähe des Schlosses gesessen hatten und Dermot an uns vorübergeschlendert war. Ein Engländer in einem fremden Land trifft auf Landsleute – und natürlich bleibt er stehen, um mit ihnen zu reden. Damit hätte die Sache auch schon zu Ende sein können. Aber dann kam jene schreckliche Nacht, in der die Hitlerjugend das Schloß überfallen und versucht hatte, es in Schutt und Asche zu legen, weil seine Bewohner Juden waren.
Niemals würde ich das vergessen. Auch Dorabella würde immer daran denken müssen. Ich hätte nie geglaubt, daß so etwas Entsetzliches möglich war. Dies war meine erste Erfahrung mit seelenloser Grausamkeit und Brutalität. Mein Leben lang würde ich das nicht mehr vergessen.
Plötzlich legte Gretchen ihre Hand auf meine.
»Ich weiß, woran du denkst«, sagte sie.
Ich drehte mich zu ihr um und sagte: »Ich wünschte, wir würden endlich eine Nachricht erhalten. Was, glaubst du, geht dort drüben vor?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, es geht ihnen gut. Vielleicht werden wir ja bald etwas von ihnen hören.«
»Wenn sie diesen Leuten in die Hände fallen ... diesen Leuten, die damals nachts im Schloß waren.«
»Sie wären Kriegsgefangene. Aber meine Familie ist jüdisch. Darum ging es damals. Ach Violetta, du kannst es nicht vergessen, nicht wahr?«
»Nein«, sagte sie. »Niemals.«
»Ich fürchte, ich werde meine Familie nie wiedersehen.«
»Du hast jetzt Edward, Gretchen – Edward und Hildegarde.«
Sie nickte.
Aber die Traurigkeit wollte nicht von ihr abfallen, und mir wurde auf einmal klar, daß sie wegen der vielen Tragödien, die sie erlebt hatte, immer Angst haben würde, das Glück könne ihr wieder untreu werden.
Eine Weile saßen wir ruhig da, schauten übers Meer und dachten an die Menschen, die wir liebten, bis schließlich Tristan kam. Er war den Tränen nahe, weil der Henkel von seinem Eimer abgerissen war.
»Tante Vee, mache heil«, sagte er.
Ich nahm den Eimer und stellte fest, daß man lediglich den Draht wieder in die Schlinge einhaken mußte. Mühelos tat ich, was nötig war, und Tristan sah mich mit breitem Lächeln an; für ihn war es selbstverständlich, daß ich ihm helfen konnte.
Wenn doch nur all unsere Probleme so leicht gelöst werden könnten!
Mittlerweile war es Mai geworden. Das Wetter war herrlich. Der Frühling war die schönste Jahreszeit in Cornwall. Es schien beinahe als würde das Meer, ruhig und sanftmütig, die Felsen zärtlich liebkosen, wenn es bei Flut den Strand hinaufkroch.
Das friedliche Bild stand in scharfem Widerspruch zu der Angst, die uns quälte. Mittlerweile ließ sich die Tatsache, daß der Krieg einen für uns ungünstigen Verlauf nahm, nicht mehr leugnen. Niemand sprach mehr davon, daß die Sache nur ein paar Wochen dauern würde.
Man hatte uns aus Norwegen vertrieben, und es stand fest, daß es nicht mehr lange dauern würde, bis der Sturm auch über Westeuropa losbrach. Der Premierminister, Mr. Neville Chamberlain, war zurückgetreten, und Winston Churchill hatte sein Amt übernommen. Der scheidende Premierminister hielt eine bewegende Rede, in der er das Land bat, sich um unseren neuen Anführer zu scharen. Aber unser frisch ernannter Premierminister erklärte uns, daß er nichts zu bieten hätte außer Blut, Mühsal, tränen und Schweiß, und daß uns eine Prüfung von allerschmerzlichster Art bevorstände und viele lange Monate des Kämpfens und des Leidens.
Ich erinnere mich noch gut an diese Rede. Es war keine Aufzählungen unserer Siege, sondern die bittere Wahrheit, die da aus dem Radio schallte, und ich glaube, genau das war es, was wir damals brauchten. Einige Ausschnitte daraus haben sich mir unauslöschlich eingeprägt.
»Sie werden fragen: Was ist unsere Politik? Ich erwidere: Unsere Politik ist, Krieg zu führen zu Wasser, zu Land und in der Luft, mit all unserer Macht und mit aller Kraft, die Gott uns verleihen kann; es gilt Krieg zu führen gegen eine ungeheuerliche Tyrannei, die in dem finsteren, trübseligen Katalog des menschlichen Verbrechens unübertroffen bleibt.«
Ich fühlte mich sofort wieder in jenen Raum im Schloß zurückversetzt und erinnerte mich an den Gesichtsausdruck des jungen Mannes, der seine brutale Schlägerbande dorthin geführt hatte. Es war finster, es war trübselig; es war im Katalog des menschlichen Verbrechens noch nie dagewesen.
»Sie fragen: Was ist unser Ziel?« fuhr der Premierminister fort. »Ich kann es mit einem Wort nennen: Sieg – Sieg um jeden Preis ... Auf denn, laßt uns gemeinsam vorwärts schreiten mit vereinter Kraft.« Es war der Beigeschmack jener Inspiration, die uns aufrecht halten und uns während der vor uns liegenden finsteren Jahre Mut geben sollte.
Aber wenigstens waren wir nun auf schlechte Nachrichten gefaßt. Und das war ein Glück, denn die Berichte klangen immer verzweifelter. Die Deutschen waren auf dem Vormarsch durch Flandern, während der helle Sonnenschein Cornwall schöner denn je erscheinen ließ.
In den ersten sechs Monaten hatte der Krieg für uns eine Form angenommen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Wir selbst befanden uns in akuter Gefahr und mußten der Möglichkeit ins Auge sehen, daß vielleicht auch unsere kostbare Insel in Gefahr stand.
Und Jowan und Edward und all die anderen, die mitten im Kampfgetümmel waren, wie mochte es denen ergehen?
Mit jedem Tag wuchs unsere Angst.
Ich verspürte den Drang, allein zu sein. Immer häufiger holte ich Starlight aus dem Stall, die Stute, die ich in der Zeit geritten hatte, als ich noch mit Jowan ausging.
Es war an einem Morgen im Mai. In ein oder zwei Wochen war es Juni – und das herrliche Wetter hielt an.
Ich wollte der Gegenwart entfliehen, und so ritt ich häufig zu den Plätzen hinüber, die ich mit Jowan besucht hatte. Vor allem unsere erste Begegnung war mir noch gut in Erinnerung, als ich mich ohne Erlaubnis auf das Land der Jermyns vorgewagt hatte. Also ritt ich zu dem Feld hinüber, auf dem ich vom Pferd gestürzt war. Damals waren wir zu einem Gasthaus namens ›The Smithy's‹ gegangen, und Jowan hatte darauf bestanden, daß ich zur Beruhigung einen Brandy trank. Das Gasthaus verdankte seinen Namen der Tatsache, daß es direkt neben einer Schmiede stand.
Wie sehr ich mich doch nach jenen Tagen zurücksehnte!
Als ich gerade an der Schmiede vorbeireiten wollte, kam Gordon Lewyth heraus.
»Guten Morgen«, sagte er. »Was tun denn Sie in diesem Teil der Welt? Es gibt doch hoffentlich keine Probleme mit Starlight?«
»Nein«, erwiderte ich. »Ich bin nur zufällig vorbeigekommen.«
»Ich habe Samson hergebracht. Er hat einen Huf verloren.«
»Gehen Sie jetzt wieder zurück?« fragte ich.
»Ich hatte eigentlich vor, eine Kleinigkeit zu Mittag zu essen und zu warten, bis das Pferd beschlagen ist. Wollen Sie nicht mit mir essen?«
Ich fühlte mich stark an meinen ersten Besuch hier erinnert, nur daß mir diesmal Gordon gegenübersaß, nicht Jowan. Und genau wie damals kam Mrs. Brodie, die Frau des Gastwirts, an unseren Tisch. Ich erinnerte mich, noch genau wie neugierig sie seinerzeit war. Die Schwester der neuen Mrs. Tregarland und Jowan Jermyn! Eine Begegnung der verfeindeten Familien! Sie würde natürlich von meiner Verlobung mit Jowan wissen. So etwas gab immerhin reichlich Stoff für Klatsch und Tratsch.
Jetzt sagte sie: »Einen schönen Tag, Miss Denver, und auch Ihnen, Mr. Lewyth. Heute gibt es Hackbraten. Kann ich sehr empfehlen. Angeblich eins meiner besten Gerichte. Mehr kann ich in diesen Zeiten nicht anbieten, fürchte ich.«
»Trinken Sie Wein oder lieber Cidre?« fragte Gordon.
Ich entschied mich für Cidre.
»Irgendwelche Nachrichten von Mr. Jermyn, Miss Denver?«
»Ich fürchte nein.«
»Nun, wahrscheinlich haben die da drüben alle Hände voll zu tun. Schließlich müssen sie die Deutschen wieder dahin zurückschicken, wo sie hingehören. Aber es wird jetzt nicht mehr lange dauern, denken Sie an meine Worte.«
Ich lächelte sie an. Gordons Blick kreuzte sich mit meinem, und ich erkannte Mitgefühl in seinen Augen.
»Sie muß es sehr zu spüren bekommen, wie sich die Zeiten geändert haben«, sagte ich, als Mrs. Brodie gegangen war.
»Nicht anders als wir alle.«
Ich sah die Traurigkeit in seinen Augen, und einen Moment lang war ich wieder im Kinderzimmer, in jener Nacht, als Nanny Crabtree und ich seine Mutter daran gehindert hatten, Tristan zu töten. Wir hatten ihn sofort hergeholt, und ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie er wie betäubt in der Tür gestanden hatte, als er schließlich die Wahrheit erkannte.
Ich verspürte ein tiefes Mitleid mit ihm und dachte mit Bewunderung daran, wie schnell er sich damals von dem Schock erholt und die Situation unter Kontrolle gebracht hatte, wie stoisch er alles Nötige veranlaßt hatte, wie zärtlich er mit seiner armen, irregeleiteten Mutter umgegangen war.
Nach einer Weile hörte ich mich sagen: »Und wie ging es ihr bei Ihrem letzten Besuch?«, bevor mir klar wurde, daß wir überhaupt nicht von ihr gesprochen hatten; aber er zeigte sich nicht überrascht. Wahrscheinlich gab es kaum einen Moment, an dem er nicht an sie dachte.
Er erwiderte: »Ihr Zustand ist ziemlich stabil, obwohl sie mich manchmal erkennt und manchmal ...«
»Es tut mir leid. Ich hätte nicht davon sprechen sollen. Es muß sehr schlimm für Sie sein.«
»Es nützt nicht, die Dinge totzuschweigen«, erwiderte er. »So etwas ist immer gegenwärtig, ob wir nun davon reden oder nicht.« Er lächelte mich an. »Mit Ihnen kann ich reden, Violetta. Und in gewisser Weise hilft mir das.«
Ich war ein wenig erschrocken. Ich hätte es nie für möglich gehalten, daß er vielleicht Hilfe brauchte. Er wirkte immer so selbstbewußt. Aber auch für den selbstsichersten Menschen mußte die Feststellung, daß seine Mutter eine Mörderin war, schockierend sein.
»Es tut weh, sie so zu sehen«, fuhr er fort. »Ihr armer Verstand wandert hilflos umher, versucht, ein Stückchen Wirklichkeit zu fassen zu bekommen. Und, Violetta, ich kann nur hoffen, daß ihr genau das niemals gelingen wird. Es ist besser für sie, so zu leben wie jetzt, als sich an die Wahrheit zu erinnern.«
Ich nickte. »Sie hat all das für Sie getan, Gordon. All diese Intrigen ... Ihre ganze Besessenheit ist nur ihrer Liebe zu Ihnen entsprungen.«
»Ich weiß«, erwiderte er. »Ich werde das nie vergessen. Wenn sie sich mir doch nur anvertraut hätte. Ich hoffte genau wie sie, daß mein Vater mich anerkennen würde. Es stimmte ja, daß ich das Gut wieder vorwärtsgebracht hatte und daß ich der einzige war, der sich dafür interessierte. Aber meine Mutter war nicht seine Frau, und da war Dermot ... und dann Tristan. Ich wollte irgendwo mein eigener Herr sein. Wahrscheinlich hätte ich früher oder später auch etwas gefunden. Es wäre kein Gut wie das der Jermyns oder Tregarlands gewesen, das ist klar. Aber ein eigenes Haus, wie klein es auch sein mag, ist eben doch etwas ganz besonderes.«
»Sie sind ein Teil von Tregarland, Gordon. Sie lieben es. Es ist Ihr Leben.«
»Wenn doch nur ...«
Ich berührte kurz seine Hand.
»Es hat keinen Sinn zurückzublicken. Wir müssen nach vorn schauen, und wir befinden uns mitten in einem schrecklichen Krieg. Keiner von uns weiß heute, was ihm morgen widerfahren wird. Die Dinge stehen nicht zum besten, nicht wahr?«
»Wahrhaftig nicht«, erwiderte er. »Die Deutschen fallen in Holland und Belgien ein. Als nächstes wird Frankreich an die Reihe kommen.«
»Sie scheinen leider auf ganzer Linie Erfolg zu haben.«
»Sie waren auf den Krieg vorbereitet. Wir nicht. Während der ganzen letzten zehn Jahre, als die Labour-Partei, die Liberalen und einige der Konservativen Abrüstung gepredigt haben, hat Hitler sich ob unserer blinden Torheit ins Fäustchen gelacht, hat seine Waffen geschmiedet und auf den richtigen Augenblick gewartet. Er ist gekommen. Sie waren bereit und wir nicht.«
»Aber wir machen uns jetzt bereit.«
»Nun ja, ich würde sagen, man schließt die Stalltür zu, nachdem das Pferd auf und davon ist. Den Spruch kennen Sie doch sicherlich?«
»Ja. Aber jetzt werden wir kämpfen.«
»Am Ende werden wir siegen, davon bin ich überzeugt. Denn jetzt, da uns die Gefahr einmal bewußt geworden ist, sind wir alle eines Sinnes. Aber wir werden für die Blindheit früherer Generationen büßen müssen, da wir ohne sie vielleicht überhaupt nicht am Krieg beteiligt wären. Wenn man die Zeit doch nur zurückdrehen und manches noch einmal von vorn anfangen könnte! Jetzt können wir nur noch den Tatsachen ins Auge sehen. Vielleicht hätte ich auch schneller begriffen, was mit meiner Mutter geschah, wenn ich klüger gewesen wäre. Aber leider ist uns die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen, nicht gegeben. Ich denke, wir sollten immer bereit sein, uns der Wahrheit zu stellen, statt uns etwas vorzumachen, um uns über den Augenblick hinwegzutrösten.«
»Ist es wirklich so schlimm?«
»So schlimm, wie es nur sein kann, wir stehen kurz vor der Niederlage, denke ich. Aber das Land hat einen starken Kampfgeist – daran besteht kein Zweifel, und wenn man uns mit dem Rücken an die Wand drängt, stehen wir genausogut unseren Mann wie jeder andere. Aber machen wir uns nichts vor. Die Deutschen haben sich dieses Lügenmärchen ausgedacht, daß Großbritannien und Frankreich in Holland und Belgien einfallen wollen und daß Deutschland diese Länder ›beschützen‹ wird. Die Holländer und die Belgier sehen das natürlich anders und setzen sich zur Wehr, aber es sind beides kleine Länder, darüber hinaus unvorbereitet, und die Deutschen sind gut ausgerüstet und diszipliniert, nachdem sie sich über zehn Jahre lang mobil gemacht haben. Ohne jeden Zweifel werden sie die beiden Länder bald besiegt haben.«
»Unsere Männer sind da drüben«, sagte ich schaudernd.
Gordon wich meinem Blick aus.
»Ach, Gordon, was wird sonst noch alles geschehen?« fragte ich.
»Die Menschen dort kämpfen für ihre Heimat. Das verleiht ihnen besondere Kräfte«, sagte er. »Eines Tages wird sicherlich die Wende kommen. Manchmal meine ich, ich sollte dabei sein, aber wir müssen den Betrieb auf dem Gut aufrechterhalten, und einige von uns müssen hierbleiben. Aber Sie wissen bestimmt, daß es Befürchtungen gibt, Deutschland könnte nicht nur die Niederlande und Belgien, sondern auch Frankreich bezwingen.«
»Aber dort gibt es doch die Maginotlinie.«
»Die ist bisher noch nicht auf die Probe gestellt worden, und es sieht sehr schlecht aus. Wissen Sie, daß eine Organisation zum Schutz unseres eigenen Landes aufgebaut wird?«
»Sie meinen die ›Freiwillige Ortsverteidigung‹?«
»Anthony Eden ist der neue Verteidigungsminister, und er hat jüngst davon gesprochen. Sie wissen, was das zu bedeuten hat?«
»Wir müssen uns gegen eine Invasion schützen?«
»Wenn Frankreich fällt ...«
»Das ist gewiß unmöglich!«
»Wie Sie sagen, es gibt die Maginotlinie. Aber Belgien und Holland sind trotz ihrer Tapferkeit leicht zu bewältigen, und da Frankreich, wie wir selbst, unvorbereitet ist ... Wir müssen auf alles gefaßt sein.«
»Aber Hitler wird es doch niemals gelingen, in England einzufallen?«
»Es wird nicht leicht sein. Immerhin gibt es den Kanal.«
»Dem Himmel sei Dank für den Kanal.«
»Nun, jetzt bereiten wir uns ja auf alles vor. Darum wird ja auch die ›Freiwillige Ortsverteidigung‹ aufgebaut. Sie wissen ja, wie mir zumute ist, weil ich noch hier in der Heimat bin, also ... habe ich mich dort gemeldet.«
»Ich weiß. Aber Sie sind wirklich hier nicht entbehrlich, Gordon.«
»Das wurde mir sehr deutlich gesagt. Also haben ich mich dieser neuen Organisation, die wie eine Armee geführt wird, angeschlossen. Und ich werde für unsere Gruppe in dieser Gegend verantwortlich sein.«
»Das freut mich, Gordon. Ich weiß, daß Sie Ihre Sache gut machen werden.«
»Ich hoffe, daß es nie zu einer Invasion kommen wird. Aber vielleicht ist es das Beste, realistisch zu sein und die schlechten Möglichkeiten genauso wie die guten zu bedenken.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wenn wir uns auf eine Invasion vorbereiten, heißt das noch lange nicht, daß es sie auch wirklich geben wird.«
»Je besser wir darauf vorbereitet sind, desto weniger wahrscheinlich wird es, daß sie tatsächlich stattfindet.«
Ich verfiel in Schweigen und dachte wie immer an Jowan und Edward, die auf dem Kontinent waren. Ich versuchte, nicht ständig an die Entbehrungen zu denken, unter denen sie litten, und an die Gefahren, in denen sie schweben konnten. Aber das war unmöglich.
Gordon wußte das. Es war typisch für ihn, daß er nicht versuchte, eine zwanglose Unterhaltung in Gang zu halten, so wie viele andere es getan hätten. Er wußte nur allzu gut, daß er mich damit nicht von meinen Ängsten befreien würde. Statt dessen sprach er weiter über die neue Organisation und darüber, wie enthusiastisch jene Männer waren, die zu alt oder aus anderen Gründen nicht geeignet für den aktiven Militärdienst waren.
Als wir Smithy's verließen, war Samson bereits fertig beschlagen, und wir kehrten zusammen nach Tregarland zurück.
Ich brauche nicht zu berichten, was im weiteren Verlauf dieses wunderschönen Mais geschah. Es ist wohlbekannt, daß eine Katastrophe auf die andere folgte. Die Deutschen hatten die vielgepriesene Maginotlinie prompt umgangen. Sie marschierten durch Frankreich und hatten bis zum letzten Sonntag des Monats Boulogne erreicht.
Wir gingen an diesem Tag alle zur Kirche. Es war ein Tag des Gebets, im ganzen Land, im ganzen Empire; der König und die Königin nahmen zusammen mit der Königin der Niederlande, die nach der Eroberung ihrer Heimat in England Zuflucht gesucht hatte, an einem Gottesdienst in Westminster Abbey teil.
Das britische Expeditionskorps war zusammen mit anderen alliierten Truppen von den vorrückenden Deutschen nach Dünkirchen zurückgedrängt und dort von den übrigen Verbänden abgeschnitten worden. Die historische Rettungsaktion begann. Die Navy schickte alle verfügbaren Schiffe, um die Männer zurückzuholen, und Hunderte von zivilen Booten beteiligten sich an der Evakuierung.
Es war eine Zeit großer Angst und fester Entschlossenheit bei all denen, die dazu beitragen konnten, unsere Soldaten heimzuholen.
Was in diesen unvergeßlichen Tagen geschah, grenzte beinahe an ein Wunder. Die See war ruhig, als ob unsere Gebete erhört worden seien. Die Deutschen verbreiteten über Rundfunk, daß die britische Armee vernichtet, der Sieg in Reichweite sei und daß die britischen Inseln bald ebenso unter deutscher Herrschaft stehen würden wie Frankreich, Belgien, Holland und ganz Westeuropa.
Unsere Geschichte kennt viele Beispiele von Entschlossenheit und Heldenmut, hat viele Kämpfe in aussichtsloser Position gesehen – und des Namens Dünkirchen wird man sich immer mit Hochachtung erinnern.
Es herrschte gedämpfte Freude, als der Premierminister uns erklärte, daß fast drei Viertel der Männer sicher wieder nach Britannien zurückgebracht worden waren. Das sei kein Sieg, erklärte er in düsterem Ton. Vielmehr seien wir wie durch ein Wunder gerade noch einmal davongekommen. Aber wir müßten den Tatsachen ins Gesicht sehen: Frankreich stand vor dem Zusammenbruch; es würde sich den Deutschen fügen, um Frieden zu erlangen; die Niederlande befanden sich in den Händen des Feindes; und jetzt stand die Schlacht um Britannien bevor.
Der Premierminister sprach mit all der leidenschaftlichen Beredsamkeit, die so charakteristisch für ihn und so ermutigend für uns alle was: »Britannien wird sich niemals unterwerfen«, erklärte er.
Unserer Soldaten waren wieder zu Hause. Und ich hoffte von Herzen, daß Jowan zu denen gehörte, die man von Dünkirchen aus in Sicherheit gebracht hatte.
Also wartete ich.
Die Tage vergingen, aber es gab keine Nachricht von Jowan.
Dorabella sagte: »Du kannst dir das Durcheinander vorstellen. Eine dreiviertel Million Soldaten trifft plötzlich ein. Da muß es ja Verzögerungen geben.«
Meine Mutter rief an, mit guten Neuigkeiten. Wir sollten es Gretchen sofort weitersagen. Edward war wieder daheim. Er war mit dem Expeditionskorps aus Dünkirchen evakuiert worden. Und im Augenblick befand er sich in einem Lazarett in Sussex. »Gretchen! Gretchen!« rief ich. »Edward ist wieder zu Hause!«
Sie stand neben mir und rief: »Was? Was?«
»Gretchen muß sofort nach Hause kommen«, sagte meine Mutter. »Ja, ja, Gretchen, sind das nicht wunderbare Neuigkeiten?« Nein, sie hatte ihn noch nicht gesehen. Aber sie würde ihn in dem Lazarett in Horsham besuchen. Sie hatte es gerade erst erfahren. Nein, er war nicht schwer verletzt. Irgendeine Kleinigkeit. Gretchen brauche sich keine Sorgen machen. Meine Mutter dachte praktisch und machte bereits Pläne. Vielleicht könnten wir Hildegarde zunächst einmal auf Tregarland behalten. Dann könnte Gretchen direkt nach Caddington kommen, und von dort aus könnten sie alles regeln.
Gretchen schien etwas verwirrt zu sein, aber überglücklich. Dorabella nahm sie in die Arme. Aber ich wollte das Gespräch mit meiner Mutter noch nicht beenden.
Sie sagte: »Noch keine ... keine Nachricht von Jowan?«
»Nein«, erwiderte ich.
»Sie wird schon kommen«, sagte sie bestimmt.
»Ich bete darum.«
»Schatz«, sagte meine Mutter, »wir sind immer bei dir. Melde dich, wenn du etwas erfährst ... sofort. Ich bin mir sicher, daß wir bald bessere Nachrichten erhalten werden.«
Ich lächelte schwach. Mit dem Feind auf unserer Türschwelle? Und das Land in Alarmzustand wegen der drohenden Invasion? Mit der ganzen Streitmacht Deutschlands, die uns am anderen Ufer des Kanals gegenüberstand? Und keine Nachricht von Jowan.
Aber dennoch mußte ich daran denken, daß Edward zurückgekehrt war. Edward war in Sicherheit.
»Lieber Gott«, betete ich, »laß Jowan zu mir zurückkehren.«
Gretchen verließ uns noch am gleichen Tag, und das Warten ging weiter. Ich schaute hinauf in den klaren, blauen Himmel und ärgerte mich ein wenig darüber, daß die Welt gerade jetzt so schön sein konnte. Als ob man uns damit sagen wollte: So könnte es sein ohne die Narretei der Menschen.
Tag für Tag wartete ich. Wo war Jowan? War er einer der Soldaten, die gefallen waren, bevor sie gerettet werden konnten? Oder gehörte er zu dem Rest des Korps, der zurückgelassen worden war?
Edward war nicht schwer verwundet. Er hatte ein paar Splitter am rechten Arm, die entfernt werden mußten. Dann würde er sich nach einem kurzen Urlaub, den er zusammen mit Gretchen verbringen konnte, wieder bei seinem Regiment in Südwestengland zurückmelden.
Meine Mutter meinte gleich, es wäre dann besser für Gretchen, wieder zu uns zu kommen, weil sie es dann nicht so weit zu ihm hätte. Und sie war davon überzeugt, daß der Aufenthalt bei uns Gretchen gut getan hatte.
Das glückliche Gretchen! Der glückliche Edward! Und immer noch keine Nachricht von Jowan.
Wie sich die Tage dahinschleppten! Jeden Morgen, wenn ich nach einer gewöhnlich lethargischen Nacht aus den quälenden Träumen erwachte, die ein Spiegelbild meiner Ängste bei Tage waren, fragte ich mich, was der nächste Tag wohl bringen mochte. Und obwohl sich die Ereignisse überschlugen, nahm mich allein eine Frage in Anspruch: Wo war Jowan? Wenn ich es nun niemals erführe? Wie konnte das Schicksal so grausam sein, mir erst das Glück zu zeigen, das hätte meins werden können, und es mir dann wegzuschnappen.
Der Zusammenbruch Frankreichs ging schnell vonstatten, der Mythos von der unüberwindbaren Maginotlinie verpuffte, Marschall Pétain mußte um einen Waffenstillstand nachsuchen, und wir standen schließlich allein da.
Und in mir keimte langsam die Furcht auf, Jowan würde vielleicht niemals zurückkehren.
Die Lage war ernst. Die Deutschen beherrschten die Häfen am Kanal, und die Schlacht um England hatte begonnen. Wir schwebten in ständiger Gefahr und wußten in keinem Augenblick sicher, ob dies nicht unser letzter sein würde.
Eine Morgens kamen Dorabella und ich zum Frühstück herunter und setzten uns zu Gordon, der noch eine Tasse Kaffee trank, bevor er gehen wollte.
»Ich wollte etwas mit Ihnen besprechen«, sagte er. »Es ist möglich, daß als Flüchtlinge getarnte feindliche Agenten in unser Land eindringen. Es verkehren immer noch kleine Boote auf dem Kanal. Wir müssen wachsam sein, und wir sollten also, wenn solche Boote ankommen, alle Insassen überprüfen, bevor wir ihnen erlauben, an Land zu gehen. Die Sache ist etwas heikel, weil es sich hauptsächlich um echte Flüchtlinge handeln wird, aber es wird bestimmt auch einige geben, die alles riskieren, um bei uns einzudringen. Wir werden entlang der Küste Wachen aufstellen. Die gefährdetsten Bereiche sind natürlich die weiter im Osten, da dort die Entfernung zum Festland so viel kürzer ist. Aber einige werden es vielleicht trotzdem in Cornwall versuchen, weil sie sich versprechen, hier eher unentdeckt zu bleiben. Jedenfalls müssen wir darauf vorbereitet sein.«
»Das wird ja immer toller«, sagte Dorabella.
Gordon warf ihr einen leicht verzweifelten Blick zu.
»Toll, ja«, sagte er. »Und mehr als das. Wir befinden uns in akuter Gefahr, wissen Sie. Wir müssen Tag und Nacht bereit sein. Tagsüber sieht man ja jedes Boot. Glücklicherweise gibt es an dieser Küste nicht viele Stellen, wo man leicht landen kann. Aber alle, die dafür in Frage kommen, müssen beobachtet werden, und ich werde dafür sorgen, daß das auch geschieht. Der Strand unterhalb dieses Hauses ist jedenfalls eine dieser Stellen, und für diesen kleinen Küstenabschnitt sind wir verantwortlich. Ich stelle einen Plan auf und sorge dafür, daß der Strand bei Dunkelheit immer von zwei Wachen beobachtet wird. Sie beide werden sicherlich auch ihren Teil übernehmen wollen, und einige vom Personal und von den Leuten aus der Nachbarschaft werden mitmachen, so daß sie nicht so oft Dienst haben werden.«





























