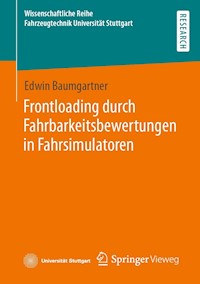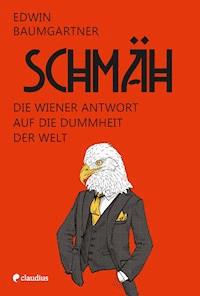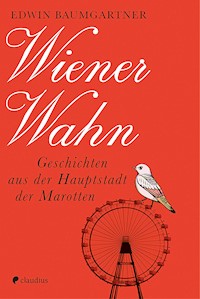
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Wiener Urgestein Edwin Baumgartner, bekannt für seinen humorigen Stil, erzählt in einem fiktiven Kaffeehausgespräch über Persönlichkeiten wie Bruno Kreisky, Helmut Zilk, die Habsburger und natürlich nicht zu vergessen, den Kaiser Franz Joseph und Ferdinand I. und über deren Kuriositäten und Besonderheiten. Natürlich dürfen auch Wolfgang Amadeus Mozart und seine geliebte Constanze nicht fehlen, um die zu betonen, die die Originalität Wiens geprägt haben. So manch schrulliger, aber liebenswerter Sonderling huscht durch die Erzählungen über die Geschichte Wiens. Um es auf wienerisch zu sagen: Es ist eine Wesensart der Wiener, einen Pecker zu haben, ohne Schmäh, denn genau dieser macht die Gemütlichkeit Wiens ja aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IM BUCH KOMMT SIE ALS DIE LEKTORIN MEINES VERTRAUENS VOR. DAS IST SIE. UND NOCH VIEL MEHR.
FÜR PETRA
Copyright © Claudius Verlag, München 2020
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München unter Verwendung von © BlazJ/shutterstock.com (Riesenrad) und © Vextok/shutterstock.com (Vogel)
Layout: Mario Moths, Marl
Gesetzt aus der Sabon LT
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, 2020
ISBN 978-3-532-60074-0
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Wien und die Wiener (quasi ein Prolog)
Die früheren Zeiten
Der Piwonka
Die Kaiser
Der Nandl
Der Zilk
Der Kreisky
Die Reichsgräfin und der Baron
Der Waldheim
Der Mozart
Die Mozart und die Einzi
Der Marcello
Der Zobl
Der Pfaff vom Kahlenberg
Die Tante Hilde
Der Kyselak
Die Unbeugsamen
Die Chernel
Der Calafati
Die Indianer
Der Hörbiger
Die Tante Gusti
Der Schachspieler
Die Barbie-Schwestern und die Saxophonspielerin
Der Narrendattel
Ludwig van Beethoven
Der Waluliso
Der Altenberg
Die Zornbinkel
Der Cap
Der Adriano
Der Auhirsch
Der Pompfüneberer
Die Ingrisch
Der Psychologe
Der Tod
Der Basilisk
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
WIEN UND DIE WIENER(QUASI EIN PROLOG)
Das ist aber schön, dass ich Sie hier treffe. Wie, als hätten wir uns verabredet, würde ich sagen, wenn wir uns nicht verabredet hätten. Aber wir haben uns verabredet, Sie und ich, und jetzt treffen wir einander, und es ist mir eine Riesenfreud’.
Sie haben eh noch nicht lange gewartet, hoffe ich? Wissen S’, die Tram1 hat eine Störung gehabt, deshalb habe ich mich um die paar Minuten verspätet.
Was gibt’s Schöneres in Wien, als dass wir uns hier treffen, grad in dem Kaffeehaus und grad heut’. Wollen Sie lieber draußen sitzen? Ich richte mich ganz nach Ihnen.
Herr Ober!
Wobei, wissen Sie, ich sitze lieber drinnen. So herrlich kann die Sonne nicht scheinen, und so schön kann die Amsel nicht zwitschern: Kaffeehaus ist für mich der Samtbezug auf den Bänken, und wenn die Marmortischplatte da und dort ein bisserl ausgeschlagen ist, gehört das dazu. Was hätten wir denn draußen? – Blechtische und Blechsessel. Na ja, und die Sonne halt. Aber Sonne und Kaffeehaus, das verträgt sich irgendwie nicht.
Den Schatten von ein paar Bäumen hätten wir natürlich auch, wollen Sie sagen, der würde grad recht zur Sonne passen? – Jo, eh2. Wissen Sie, wenn ich im Schatten von einem Baum sitzen will, dann geh’ ich zu einem Heurigen. Sie können übrigens gerne mitkommen.
In einem Kaffeehaus brauche ich, ich hab’s schon gesagt, eine Sitzbank mit Samtbezug, ein bisserl abgewetzt und durchgesessen, bitteschön, oder einen Holzsessel mit einer Sitzfläche ohne Polsterung, übrigens nach Möglichkeit rund, die Sitzfläche, und wenn der Sessel beim Niedersetzen knarrt und so tut, als würde er unter meinem Gewicht zusammenbrechen, dann ist das grad recht, weil er ja nur so tut als ob, der Sessel, in Wahrheit ist es ihm ganz wurscht, ob die Person, die sich auf ihn setzt, fünfzig, hundert oder hundertfünfzig Kilo hat. Das Knarren ist sozusagen seine Unmutsäußerung. Grantig ist er, der Sessel, und Grant ist eine charakteristische Äußerung des Wiener Gemüts. Darum gehört der knarrende Sessel zu einem Wiener Kaffeehaus dazu. Grantig ist er, weil er was zu tun bekommen hat, der Sessel, er muss einen Gast tragen, manchmal muss er auch einen Gast ertragen, und das mit einem Körperteil … Seien Sie ehrlich: Wären Sie gerne ein Sessel? Ich nicht.
Was nehmen Sie? Den Kaiserschmarrn könnt’ ich empfehlen, wie immer.
So, Herr Ober, wir nehmen zweimal den Kaiserschmarrn, bitte, dazu einen großen Braunen und für mich einen Einspänner – oder, nein: bringen Sie mir doch bitte einfach eine Melange.
Und jetzt verraten Sie mir, bitte, wie Sie auf die Idee kommen, ich soll Ihnen was erzählen über Wiener mit einem Pecker3 und Wiener Originale? Das läuft ja sowieso oft aufs Gleiche hinaus. Über solche Leute kann ich Ihnen schon allerhand erzählen, so ist das nicht. Ich frage mich nur, über wen allen ich Ihnen was erzählen soll in einem vernünftigen Rahmen, so, dass wir nicht hier übernachten müssen. Ich hätte zwar nichts dagegen, aber beim Herrn Ober bin ich mir weniger sicher. Wenn ich anfange mit dem Thema, hör’ ich nämlich lang nicht mehr auf.
Wissen Sie, wo das Wort „Spinner“ herkommt? Ich hab’s nachgeschaut, extra für Sie, als Sie mir angekündigt haben, Sie möchten, so wie Sie sich vornehm ausgedrückt haben, von mir etwas über die Wiener mit einem Spleen erfahren. Spinner kommt wirklich vom Spinnen, also einen Faden spinnen, aber gemeint ist ein falscher gedanklicher Faden. Für mich geht die Bedeutung noch weiter: Für mich sind die Spinner die Menschen, die sich in eine eigene Welt so einspinnen, dass sie sozusagen in der Mitte des Knäuels ihrer Ideen sitzen. Da sind alle dabei, die Spinner, die Eigenbrötler, die Käuze, die Narren, die Orginale, die mit einem Pecker, also kurz: die Wiener.
Wissen sie, ich mag diese Leute, die mit einem Pecker, die Spinnerten und die Sonderlinge, ich mag sie sehr, und wenn ich von ihnen erzähle, geht’s quer durch den Gemüsegarten. Da sind Kaiser dabei und Leute, denen man auf der Gasse begegnet. Manche sieht man täglich, ohne zu wissen, wie sie heißen. Sieht man sie ein paar Tage nicht, fragt man sich, was los ist mit ihnen, weil es doch eine liebe gewohnheit ist, ihnen zu begegnen, sie gehören zu einem guten Tag wie der Kaffee, der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang, und zwar in dieser Reihenfolge, bitte, und man atmet auf, wenn man sie ein paar Tage später wieder trifft. Wie das halt ist in einem Grätzel4. Sogar aus meiner eigenen Familie muss ich Ihnen was erzählen, denn wenn die Tante Gusti keinen Pecker gehabt hat, dann hat niemand jemals einen Pecker gehabt, und niemand wird jemals einen Pecker haben. Von der Tante der Lektorin meines Vertrauens muss ich Ihnen auch was erzählen, Ihnen darf ich es weitersagen, das hat mir die Lektorin meines Vertrauens erlaubt. Wir sind ja unter uns.
Grad in Wien ist es überhaupt keine Schande, einen Pecker zu haben oder ein Sonderling zu sein oder ein Original. Sie müssen nämlich wissen: In Wien ist nur einer normal, der einen Pecker hat. Ein Wiener, der keinen Pecker hat, hat einen Pecker, oder er ist kein Wiener.
Wien ist ja immer voll mit Menschen gewesen, die so ein bisserl, wie soll ich sagen: etwas Außergewöhnliches an sich gehabt haben. Ich glaube sogar, Wien zieht diese Menschen an, so, wie der Nordpol die Magnetnadel von einem Kompass. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Das hat schon in den ganz alten Zeiten angefangen mit den Spinnern, damals, bei den Römern, als Wien noch Vindobona geheißen hat. Der Kaiser Marc Aurel5 zum Beispiel: Statt, dass er zu Hause bleibt, Orgien feiert und im Circus ein paar Tierhetzen, Gladiatorenkämpfen und Seeschlachten zuschaut und was sonst noch für einen gestandenen Alt-Römer eine Hetz6 gewesen ist, zieht er nach Oberpannonien, wo es wirklich kalt ist und windig ist, und wo weit und breit keine frische Barbe zu bekommen ist und keine ordentliche Fischlake7, und schreibt eines der klügsten Bücher über Gelassenheit, das je verfasst worden ist. Kann gut sein, dass er damit auf Vindobona reagiert hat. Er hat das Buch quasi zu seiner eigenen Beruhigung geschrieben, davon bin ich überzeugt. Jeder, der unter Nervosität leidet und mit dem modernen Leben nicht zurechtkommt, sollte sich diese „Selbstbetrachtungen“ zu Gemüte führen. Danach schaut die Welt wieder anders aus, und zwar besser. Ein römischer Kaiser, der zu Bescheidenheit und Gelassenheit rät – das nenne ich einen Spinner! Aber vielleicht war er es, der den Wienern ihre Lebensweise in die Wiege gelegt hat:
Wenn der Herrgott net will, nutzt es gar nix,
sei net bös’, net nervös, denk, es war nix.
Renn’ nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum,
denn der Herrgott weiß immer, warum.
Das ist der Refrain aus einem Wienerlied, das der Hans Moser8 gesungen hat. Wenn der Marc Aurel nicht Kaiser geworden wäre, wäre er vielleicht der erste Wienerlied-Dichter geworden. Das Zeug dazu hätte er gehabt, das Verständnis für die Wiener Seele, meine ich.
Manche Wiener sind nur einen Moment lang spinnert. Das blitzt eine Sekunde lang auf, und schon hat man das Gefühl, das Gegenüber, just wegen seiner Spinnerei, schon eine halbe Ewigkeit zu kennen. Sie wissen schon, was ich meine. Diesen wunderbaren Wiener Spinnern verleiehe ich allen den Adelstitel. Ja, ich kann das, obwohl ich kein Kaiser bin, und obwohl der Adel in Österreich bei Strafe abgeschafft ist. Ja, wirklich, wenn einer unrechtmäßig einen Adelstitel führt, kann das mit einer Geldbuße in der Höhe von 14 Cent geahndet werden. Stellen Sie sich vor, was da auf die Jahrln zusammenkommen kann. 50 Jahre einen Adelstitel führen, kostet glatt 210 Euro. Eigentlich hätt’ ich Lust, mir das zu leisten. Sie auch?
Aber der Adelstitel, den ich verleihe, das ist kein echter, also kein strafbarer, sondern der Volksadelstitel. Der ist kein „von“, kein „Freiher“, kein „Edler“, kein „Graf“ oder sonst was, das ist der bestimmte Artikel vor dem Namen. Dann wird aus Bruno Kreisky „der Bruno Kreisky“ oder „der Kreisky“ und aus Kaiser Ferdinand I. wird der Kaiser Ferdinand, wenn man ihn nicht gleich „der Nandl“ nennt. So ist das mit dem Volksadelstitel, und den verleihe ich gerne – aber nur an die Würdigen, also an die Sonderlinge und die mit einem Pecker.
Apropos Kaiser und Kreisky: Also die früheren Zeiten – ich sage Ihnen …
DIE FRÜHEREN ZEITEN
Jetzt muss ich Ihnen was erzählen, und zwar über die früheren Zeiten.
Die früheren Zeiten, die sind ein Lieblingsthema von den Wienern. Sie hängen gern diesen früheren Zeiten nach. Nur variieren die früheren Zeiten ganz individuell. Der eine meint die Zeiten unter dem Kaiser Franz Joseph, der andere die unter dem Bundeskanzler Bruno Kreisky, der für die Wiener gewissermaßen ein Ersatzkaiser gewesen ist. Davon erzähle ich Ihnen ein bisserl später. Der Wiener beäugt alles Neue misstrauisch, und auch, wenn er es nicht offen sagt, denkt er meistens: „Za wos brauch ma des?9“ Ich glaube, dass wegen der Einstellung sogar die Revolution im Jahr 1848 weitgehend erfolglos war. Die Revolutionäre mochten schon berechtigte Anliegen gehabt haben, und der Nandl, also der Kaiser Ferdinand, hat nicht so recht gewusst, wie er damit umgehen soll. Das erzähl ich Ihnen auch ein bisserl später, das würde jetzt zu weit führen.
Jedenfalls: Da wird eine Revolution gemacht, aber die Einstellung der Wiener dazu ist wohl gewesen: „Revoetian dan’s? Za wos brauch ma des?“10 Und schon war es vorbei mit der Revolution. Kein Herrscher konnte sich eines treueren Volkes erfreuen. Nur wie der Kaiser einen Unfried gemacht hat im Ersten Weltkrieg, da war’s halt aus mit der Gutmütigkeit des Volkes. So sind die Österreicher und ganz speziell die Wiener: Die Gemütlichkeit währt lange, das Leben im „Jo, eh“ gar ewig. Aber dann, wenn die Gemütlichkeit endet und mit ihr das „Jo, eh“, dann heißt’s beim Wiener nur noch „drah di ham“11. So haben sie’s mit dem Kaisertum und mit dem Adel gehalten, die Wiener.
Aber was wollte ich Ihnen eigentlich erzählen? – Ach ja, von den früheren Zeiten und den Spinnern und Sonderlingen. Ihnen, den Spinnern und Sonderlingen, ist man damals viel öfter begegnet als heute. Aber nicht weil die Zeiten so gut waren, damit fange ich nicht an, sondern im Gegenteil. Verklären tut man sie heute, die früheren, die alten Zeiten. So gut sind sie gar nicht gewesen.
Natürlich mag der Stadt ein wenig Farbe verloren gegangen sein. Aber viel von dem, was aus den Menschen Sonderlinge gemacht hat, haben die sozialen Zustände verschuldet, und zwar, weil sie damals viel schlechter waren als heute. Wenn Sie mich fragen, ich find’s gut, dass es zum Beispiel die Strottern12 heute nur noch als eine großartige Wienerlied-Gruppe gibt.
Schauen Sie nicht so ungläubig. Wien ist eine großartige Stadt. Allerdings ist nicht alles an Wien immer Sachertorte mit Schlag13 gewesen. Wien hat immer seine salzigen Seiten gehabt – und hat sie bis heute. Die ehemalige Kaiserresidenz ist das Bild, das Wien bis heute von sich bewahren will. Das ist ein bisserl wie bei einer Frau, die nicht mehr ganz jung ist, aber auf Facebook die Fotos von sich als Dreißigjährige hineinstellt, obwohl sie jetzt mit fünfundvierzig oder auch fünfzig noch schöner aussieht, weil jedes Fältchen in ihrem Gesicht eine Kostbarkeit ist. Genau so ist es mit Wien.
Das Wien der Kaiserzeit, das ist die junge Frau, die schön ist, aber auch oberflächlich: Sie sieht nicht das Elend der Zugereisten. Wissen Sie, wieso so viele Wiener tschechische Nachnamen haben? Viele sind Nachfahren der Ziegelbem14. So hat man die Arbeiter in den Ziegeleien genannt. Diesen Sklavendienst haben zumeist tschechische Einwanderer geleistet. Die sind mit viel Hoffnung gekommen, weil das Leben in den Kronländern für sie noch schlechter gewesen ist. Ein Sprichwort aus dieser Zeit geht so:
Es gibt nua a Kaiserstadt.
Es gibt nua a Wien.
De Wiena san draußn,
de Bem, de san drin.
Wien ist für die Zuwanderer aus allen Teilen der Donaumonarchie die Hoffnung auf ein besseres Leben gewesen. Aber nicht für alle hat sich das Leben verbessert. Nicht nur die Zugereisten, auch gebürtige Wiener haben oft Schiffbruch erlitten. Wer keine Arbeit gefunden hat oder keine mehr leisten hat können, hat als Strotter in den Kanälen der Stadt nach etwas Verwertbarem gefischt.
Auch das ist Wien gewesen – und auch das: Schon die Christlich-Sozialen haben sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg um eine Verbesserung der Zustände bemüht. Der Bürgermeister Karl Lueger15 ist zwar ein Antisemit gewesen, aber er hat ein soziales Gewissen gehabt und, neben der Hochquellwasserleitung, Spitäler und Kinderheime bauen lassen, die Gas- und Elektrizitätsversorgung kommunialisiert, womit sich das jeder leisten hat können. Obendrein hat er die Verkehrsinfrastruktur verbessert. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Sozialisten die Stadtregierung übernommen und halten sie bis heute. Nur die nicht demokratischen Zeiten sind eine Unterbrechung gewesen.
Die Sozialisten haben in den Zwanzigerjahren mit ihren Gemeindebauten die Stadt geprägt. Aus der ganzen Welt sind Politiker nach Wien gereist, um sich Anregungen zu holen, wie man das Leben in einer Stadt für alle Bevölkerungsschichten verbessern kann.
Schauen Sie sich einmal dieses andere Wien an, das neben der Habsburgerherrlichkeit besteht. Die großen Höfe sind ja fast Burgen und Schlösser des Proletariats. Ihre Architektur hat bei den Konservativen für Unruhe gesorgt, weil sie in den Bauwerken etwas Militärisches gewittert haben. Wer solche Wohnfestungen baut, plant eine gewalttätige Auseinandersetzung. Die hat es dann ja auch gegeben, aber das ist eine Geschichte – wenn ich Ihnen die erzähle, sitzen wir in einer Woche noch da. Der Karl-Marx-Hof im 19. Bezirk ist solch eine architektonische Meisterleistung. Es gibt eine noch imponierendere Anlage, nämlich den Sandleitenhof in Ottakring. Das ist genau genommen eine Siedlung, von der jeder Teil seinen eigenen Charakter hat, der sich dennoch in das Gesamtbild einfügt.
Und es gibt ein Wiener Geheimnis, das hat nichts mit Bauwerken zu tun, sondern mit dem Charakter der Wiener. Die sind durch Generationen davon geprägt, dass Wien eine Vielvölkerstadt ist. Wien ist vielleicht die erste, sicher aber eine der ersten richtigen Weltstädte gewesen in dem Sinn, dass nicht die Welt in ihr zu Gast gewesen, sondern heimisch geworden ist. Tschechen, Slowaken, Ungarn, Polen, Italiener, Kroaten, Serben und Rumänen – was weiß ich, wer noch aller gekommen ist aus den Kronländern des Habsburgerreichs und natürlich aus den Bundesländern, in der Hoffnung, in Wien Fuß zu fassen.
Der Wiener hält Wien zwar für den Nabel der Welt, und eigentlich ist für ihn jeder ein Ausländer, der nicht aus Wien kommt. Aber der Wiener hat schon seinerzeit spätestens die Kinder von einem, der als Tscheche zugereist ist, als Wiener betrachtet. Wer ein Wiener sein will, ist für den Wiener ein Wiener. Deshalb hat einer, der in Wien versucht, Menschen ihrer Herkunft wegen gegeneinander auszuspielen, einen schweren Stand. Nicht das moderne Wien hat er gegen sich, im Gegenteil: Er rennt gegen den Wiener Geist an, gegen die Tradition Wiens als Hauptstadt des habsburgischen Vielvölkerstaates. Und nur ein Ang’rennter16 rennt in Wien gegen die Wiener Tradition an.
Wien tut alles, um die sozialen Zustände laufend zu verbessern. Sogar meine Generation spürt das deutlich. Zum Beispiel kann ich mich noch gut erinnern: Wie ich ein Kind war, da haben an der Tür oft die Hausierer geklingelt. Das sind alles arme Hunde gewesen. Reich geworden ist keiner von seinem Geschäft. Eine Viechsarbeit ist das obendrein gewesen. Sie müssen bedenken: Die meisten Häuser haben entweder keinen Aufzug gehabt oder einen, den nur die Hausbewohner aufsperren haben können. Die Hausierer haben Stiegen steigen müssen, hinauf und hinunter, samt dem schweren Zeug, das sie mit sich geführt haben, um es an der Tür anzubieten, und meistens hat man sie ihnen vor der Nase zugeschlagen, die Tür.
Meiner Großmutter hat einer ganz besonders leidgetan. Ein zartes Männlein ist das gewesen, klein und mager, mit einem eingefallenen Gesicht, einer spitzen Nase und einem Wust an weißen Haaren, auf denen ein viel zu kleiner Filzhut gesessen ist, eine Filzjacke hat er angehabt, so abgetragen wie der Hut, und noch dazu war ein Bein etwas lahm. Das Zniachtl17 hat Honig verkauft und Spitzwegerichsaft. Der Honig ist in dicke Gläser gefüllt gewesen und der Spitzwegerichsaft in dicke Glasflaschen. Das alles hat er in einem Rucksack transportiert und in zwei großen Taschen aus Leder, das schon ganz zerschlissen war. Sie können sich vorstellen, wie er geschleppt hat. Meine Großmutter hat ihm immer zwei Gläser Honig und zwei Flaschen Spitzwegerichsaft abgekauft. Ich glaube, sie hat das nur gemacht, weil sie ihm seine Last erleichtern hat wollen. Honig hat sie nämlich verabscheut, und auch ich habe nie Honig von ihr bekommen. Wahrscheinlich hat sie den Honig, den sie dem Zniachtl abgekauft hat, an irgendjemanden verschenkt. An den Spitzwegerichsaft kann ich mich aber erinnern, hellgelb und picksüß ist er gewesen. Ich habe ab und zu ein Glas davon bekommen, stark mit Wasser verdünnt. Meine Großmutter hat einmal in der Woche einen Teelöffel unverdünnt eingenommen. Das beuge dem Husten vor, hat sie gesagt.
Kaum hat meine Großmutter dem Hausierer die paar Schilling18 gegeben gehabt, die er für den Saft und den Honig verlangt hat, hat er gesagt: „Deaf i eana jetzt no wos vualesn?19“ Meine Großmutter hat gewusst, was kommt. „Nadüalich20“, hat sie, gutmütig wie sie gewesen ist, geantwortet. Der Hausierer hat eine Bibel aus dem Rucksack hervorgeholt, die ist völlig zerlesen gewesen, hat sie irgendwo aufgeschlagen, kurz nach vor und zurück geblättert, dann hat er gesagt: „Ah ja, da hamma scho was.21“ Dann hat er ihr zwei, drei Verse aus der Bibel vorgelesen, von denen er gemeint hat, dass sie gerade jetzt passen. Meine Großmutter hat an Gott geglaubt, sie ist auch in die Kirche gegangen, aber sie ist nicht so religiös gewesen, dass sie in der Bibel gelesen hätte. Katholiken machen das sowieso nicht so häufig wie Protestanten. Das hängt mit der Tradition ihrer Glaubensrichtungen zusammen. Wenn der Hausierer aus der Bibel vorgelesen hat, hat ihm meine Großmutter ganz ruhig zugehört und am Schluss „vergelt’s Gott“ gesagt. Der Hausierer hat gestrahlt, und ich bin sicher, er hat nicht gestrahlt wegen des kleinen Geschäfts, das er mit meiner Großmutter gemacht hat, sondern weil er ihr aus der Bibel vorlesen hat dürfen.
Auch eine alte Frau ist öfter gekommen. Klein ist sie gewesen und gebeugt. Meine Großmutter hat im fünften Stock gewohnt. Wenn sie bei ihr geläutet hat, ist sie außer Atem gewesen, hat gehustet und gekeucht. Meine Großmutter hat sie immer hereingebeten und sie in der Küche ausruhen lassen. Sie hat ihr ein Glas Wasser gegeben und ein Stück Gugelhupf, wenn vom Sonntag noch einer dagewesen ist. Die Frau hat Büschel von getrocknetem Lavendel verkauft. Sie hat sich in Positur geworfen als hätte sie einen Auftritt in der Wiener Staatsoper. Dann hat sie, mit zittriger Stimme und kurzatmig vom Stiegensteigen, das alte Lied der Lavendelweiber gesungen: „Lavendel kaft’s, fümf Schülling zwaa Boschn Lavendel. Lavendel kaft’s!22“ Das Lied hat sie sich nie nehmen lassen. Es ist für sie so eine Art Vorbedingung gewesen, um überhaupt ein Geschäft anbahnen zu dürfen, denn erst, nachdem sie das Lied gesungen hat, hat sie ihre Ware angeboten. Meine Großmutter hat ihr immer ein paar Büschel Lavendel abgekauft. Sie hat sie in die Wäschekästen gelegt. Alle Wäsche hat bei meiner Großmutter nach Lavendel gerochen. Heute noch glaube ich, denke ich an meine Großmutter, den Geruch von Lavendel in der Nase zu haben – oder den von Kölnischwasser, das ist meiner Großmutter das liebste Parfum gewesen.
Wenn wir uns so darüber unterhalten, merke ich, dass auf gewisse Weise auch meine Großmutter ein Original gewesen ist. Wir werden ihr sowieso noch einmal begegnen in Zusammenhang mit einem anderen Original, nämlich mit dem Bruno Kreisky.
Ja, schauen Sie, Original ist man oder ist man nicht. Es kommt nicht darauf an, ob einer berühmt ist, ob einer ganz hoch oben steht oder ganz tief unten. Abgesehen davon, wer sagt schon, was hoch oben und was tief unten ist? Ich kenne welche, die ganz hoch oben sind, aber für mich sind sie ganz tief unten, und ich kenne welche, die sind ganz tief unten, aber für mich sind sie ganz hoch oben. Es kommt nur darauf an, wie man es nimmt.
Jedenfalls sucht sich keiner aus, ein Original zu sein, nicht einmal in Wien. Man sagt nicht einfach: Ich werde ein Original, oder gar: Wenn ich schon sonst nichts erreicht habe, dann will ich wenigstens ein Original sein. Ich meine, es gibt schon Leute, die genau so handeln, nur sind die dann am Ende gar nichts, weder sind sie ein Original, noch sind sie sie selbst. Ein Original ist man, oder man entwickelt sich zu einem, ganz ohne eigenes Zutun. So ist das. Bei manch einem Original kennt man nicht einmal den Namen. Viele Marktfrauen waren Originale, zum Beispiel die Helga Barischitz. Die ist im Grund gar nichts Besonderes gewesen, und doch ist sie tief in meinem Gedächtnis mit ihrem rosigen Gesicht, der Haube und der Brille mit den runden Gläsern. Einen Fleisch- und Wurststand hat sie gehabt auf dem Brigittamarkt. Meine Großmutter und sie haben immer schmähgeführt. Einmal hat die Frau Barischitz gesagt, es sei vor einigen Jahren im Winter so kalt gewesen, dass ihr das Feuer im Kamin eingefroren ist. Hab’ ich Ihnen das schon einmal erzählt? Das ist der erste richtige Schmäh gewesen, den ich gehört habe. Die ist ein richtiges Original gewesen, die Frau Barischitz. Im ganzen Grätzel hat man sie gekannt und gemocht, weil sie es verstanden hat, jedem Menschen den Tag ein bisschen aufzuhellen, selbst wenn es schon ein wolkenloser Sommertag gewesen ist.
Apropos Original: Also die G’schicht’ mit der Tante Friedl und dem Oskar Piwonka – ich sage Ihnen …
DER PIWONKA
Jetzt muss ich Ihnen was erzählen, und zwar über den Piwonka.
Dabei weiß ich gar nicht viel über den Oskar Piwonka, aber das bisserl, das ich weiß, ist es wert, einen Zuhörer zu finden. Ich selber hab’ es von der Friedl Dallabona erfahren, die ich immer nur Tante Friedl genannt habe, obwohl sie keine Verwandte gewesen ist, sondern die Freundin meiner Großmutter mütterlicherseits.
Aber bevor ich Ihnen was über den Piwonka erzähle, muss ich Ihnen was über die Gemeindebauten erzählen, sonst haben Sie nichts davon, von der Geschichte über den Piwonka, meine ich.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist Wien eine kranke Stadt gewesen. Durch den Krieg sind ja die Kronländer verloren gegangen. In ihnen ist der Nationalismus erwacht. Entweder hat man die Alt-Österreicher vertrieben, oder sie sind von selber gegangen, weil sie gewusst haben, dass sie nicht mehr Fuß fassen können in Prag, in Brünn oder in Budapest. Natürlich sind sie in die Hauptstadt gezogen in der Hoffnung, dass sie sich dort durchschlagen können. Schließlich, haben sie gedacht, sind sie Landsleute, und Landsleuten werden die Wiener schon helfen.
Die Wiener haben aber nicht helfen können. Die Wiener haben nämlich selbst nichts gehabt. Die Nachwirkungen des Krieges haben einen Versorgungsengpass heraufbeschworen, eine richtige Hungersnot. Durch den Zuzug der Vertriebenen und der Auswanderer ist Wien aus allen Nähten geplatzt. Manche Historiker schätzen, dass mehr als zwei Millionen Menschen in der Stadt gewohnt haben, die damals gerade etwas mehr als eineinhalb Millionen verkraftet hätte. Dann ist die spanische Grippe ausgebrochen, und der Tod hat ein großes Fest gefeiert – aber das erzähle ich Ihnen später.
Jedenfalls haben die Sozialisten begriffen, dass es so nicht weitergehen kann in Wien, weil eine Stadt immer nur so gesund ist wie ihre Bevölkerung und umgekehrt. Bei den Wahlen im 1918er-Jahr haben die Sozialisten in Wien die absolute Mehrheit erreicht gehabt. Jetzt beginnen sie mit einem großen Experiment. Sie haben der Revolution abgeschworen – Revolutionen sind sowieso nie was gewesen für die Wiener, das sieht man schon an den lahmen Versuchen vom 1848er-Jahr. Die Wiener Sozialisten haben darauf gesetzt, dass sie die Wiener überzeugen können. Sie haben sich vorgenommen, Wohnungen für alle zu bauen und allen ärztliche Versorgung und Bildung zu ermöglichen.
Das Bauen ist an vorderster Stelle gestanden. Der Wiener Gemeindebau hat Schule gemacht. Aus der ganzen Welt sind Architekten und Stadtplaner nach Wien gekommen, um sich anzuschauen, was da entstanden ist und entsteht. Diese Gemeindebauten, Höfe genannt, sind irgendwie die Burgen und Schlösser des Sozialismus. Nach den damals neuesten Erkenntnissen sind sie gebaut worden mit hellen Wohnungen und großen Flächen in den Innenhöfen, viele davon begrünt oder mit Brunnen ausgestattet, was im Sommer die Temperaturen senkt.
Aber das Leben im Gemeindebau hat auch Schattenseiten gehabt. Eine davon ist gewesen, dass nur Frauen in die Waschküchen gedurft haben. Die Zeiten sind für jede Mieterpartei genau geregelt gewesen. Für eine Mutter hat das ziemlich unangenehm sein können, denn was soll sie in ihrer Waschzeit mit den Kindern machen? Da ist sie auf Fremdbetreuung angewiesen gewesen.
Ein anderes Kuriosum sind die Kontrollore gewesen. Ihnen hat man jederzeit die Tür öffnen müssen. Die Kontrollore sind immer unangemeldet gekommen. Sie haben nachgeschaut, ob die Wohnung sauber ist und zusammengeräumt und auch, ob die Möbel passen. Nicht jedes Möbelstück ist akzeptiert worden. Es hat so eine Art Ideal-Einrichtung gegeben, von der die Mieter nicht viel abweichen haben dürfen. Wenn die Kontrollore etwas gefunden haben, was zu beanstanden gewesen ist, dann haben sie die Mieter verwarnt, eine entsprechende Notiz gemacht, und wenn das Beanstandete bei der nächsten Kontrolle nicht behoben gewesen ist, hat das Folgen haben können. Zum Beispiel hat man Frauen, die nicht ordentlich aufgeräumt oder die Wohnung nicht genügend sauber gehalten haben, in Putzkurse geschickt.
Damit komme ich zum Oskar Piwonka, wie ihn mir die Tante Friedl geschildert hat.
Der Piwonka ist solch ein Kontrollor gewesen. Im Ersten Weltkrieg hat er an der französischen Front gekämpft und dabei ist er an der rechten Hand verletzt worden. Nach dem Krieg ist er Kontrollor in Sandleiten gewesen, dem größten und ehrgeizigsten Gemeindebau von Wien, in dem auch die Tante Friedl mit ihrem Mann gewohnt hat. Es hat ein paar Kontrollore gegeben. Für die Tante Friedl ist der Piwonka zuständig gewesen.
Was soll ich Ihnen über die Tante Friedl und ihren Mann, den Hans Dallabona, erzählen, den ich nie kennengelernt habe, weil er lange, bevor ich zur Welt gekommen bin, gestorben ist? Der Hans hat bei den Wiener Elektrizitätswerken gearbeitet, die Tante Friedl ist eine Hausfrau gewesen, wie es damals üblich gewesen ist. Beide waren sie aus gutbürgerlichen Familien, die aber im Ersten Weltkrieg fast alles verloren haben. Dennoch ist die Tante Friedl ihr Lebtag lang eine Kaisertreue geblieben. Kennengelernt haben die beiden einander in einer Aufführung von der „Lustigen Witwe“ vom Franz Lehár noch vor dem Krieg. Wie der Hans dann zurückgekommen ist, haben die beiden geheiratet. Und heilfroh sind sie gewesen, wie sie eine Gemeindewohnung bekommen haben.
Die Tante Friedl nun ist nicht schlampig gewesen, und der Hans auch nicht. Die beiden haben nur andere Interessen gehabt, als die Wohnung aufzuräumen. Die Tante Friedl ist narrisch nach Operette und Theater gewesen, der Hans auch und nach Büchern obendrein. Besonders verehrt haben die beiden den „Faust“ vom Goethe. Der Hans hat sogar richtige „Faust“-Studien betrieben und jeden Groschen, den er nicht für das tägliche Leben und das Theater ausgegeben hat, in Bücher gesteckt, die sich mit dem „Faust“ befasst haben.
Der Piwonka also kommt eines Tages zwecks Kontrolle. Er klopft an, die Tante Friedl öffnet ihm, es bleibt ihr nichts anderes übrig. Der Hans ist in der Kanzlei. Der Piwonka sieht, dass die Wohnung nicht ordentlich aufgeräumt ist. Er ist kein besonders großer Mann, der Piwonka, und ziemlich mager ist er, und was am meisten hervorsticht, ist eine Nase, die ihm aus dem Gesicht springt wie der Dolch, den der Brutus gegen den Caesar gezückt hat. Die Stimme vom Piwonka ist hoch und schnarrend und alle paar Wörter streut er ein Äh ein, ob es an der Stelle passt oder nicht.
„Des is owa, äh, a Sauhaufn, Frau Siebeat“, sagt der Piwonka. „Des gfoed ma, äh, goa net. Schaun S, Frau Siebeat, äh, so geht des net“, schnarrt der Piwonka. „Vastengan S mi“, schnarrt der Piwonka, „i maan des net bees, äh, weu, wia kummat i dazua. Owa i muaß a, äh, Vawoanung ausschbrechn, äh, und i wiad se bittn“, schnarrt der Piwonka, „des ollas in Uadnung z bringan, dass ma kane Diffarenzn hom bein nexdn Moe“, schnarrt er und verschwindet.
Die Tante Friedl ist ganz desparat23. Ordnung machen, nimmt sie sich vor. Schade, eigentlich, denn jetzt weiß sie genau, wo was liegt, und der Hans weiß es auch. Nur, erinnert sie sich, wie sie das letzte Mal Ordnung gemacht hat, haben sie und der Hans nachher gar nichts mehr gefunden.
Am Abend erzählt sie dem Hans die Geschichte, und der Hans sagt, das sei doch kein Problem, sie soll beim nächsten Mal einfach freundlicher sein zum Piwonka, ihm einen Kaffee anbieten oder ein Stamperl24 Schnaps oder beides.
Dauert nicht lang, der Hans ist wieder in der Arbeit, kommt der Piwonka. Noch bevor er irgendwas sagen kann, fragt ihn die Tante Friedl, ob er vielleicht ein Häferl Kaffee will oder ein Stamperl Schnaps. Der Piwonka ist dem Schnaps nicht abgeneigt. Er kippt das Stamperl mit einer Inbrunst, als würde er es noch mit der Zunge ausschlecken, vielleicht macht er das auch, bedankt sich, und dann schnarrt er los, was alles nicht in Ordnung ist und dass die Wohnung ein Sauhaufen ist, und wenn sich nichts ändert, dann sieht er schwarz, dann muss die Tante Friedl in einen Putzkurs.
Die Tante Friedl ist noch desparater als bei ersten Mal. Sie erzählt am Abend alles dem Hans, und der Hans sagt, die Tante Friedl soll halt dem Piwonka zum Stamperl Schnaps ein Schmalzbrot anbieten, das wird schon was nützen.
Genau so macht’s die Tante Friedl. Der Piwonka verschlingt das Brot mit dem Grammelschmalz, als hätte er mindestens drei Tage nichts gegessen. Dann schlürft er das Stamperl Schnaps, die Tante Friedl glaubt schon, dass er das Schnapsstamperl gleich samt dem Schnaps schluckt, und dann schnarrt der Piwonka los, dass er bei dem Sauhaufen wirklich nicht mehr beide Augen zudrücken kann, „des geht nimma, san S ma eh net bees, äh, i muaß des mochn, es is hoed a Vuaschrifd“, schnarrt der Piwonka und wedelt der Tante Friedl drohend mit dem Mittelfinger vor der Nase, weil ihm der Zeigefinger, mit dem man normalerweise drohen würde, im Krieg weggeschossen worden ist. „Des is jetzd wiaklech des, äh, ollaletzde Moe“, schnarrt der Piwonka, „bein nexdn Moe san S, äh, in Putzkuas, äh, so laad s ma duat“, schnarrt der Piwonka mit dem Ringfinger wedelnd.
Die Tante Friedl weiß sich keinen Rat mehr, und der Hans auch nicht, also muss man doch ans Ordnungmachen gehen.
Am Wochenende haben die beiden keine Lust dazu, am Montag mag die Tante Friedl nicht, und am Dienstag verschiebt sie die freudlose Arbeit auf Mittwoch. Allerdings steht der Piwonka schon am Dienstagabend wieder vor der Tür. Diesmal macht ihm der Hans auf. „Kontrolle“, schnarrt der Piwonka und schiebt sich an ihm vorbei. Die Tante Friedl kommt nicht einmal dazu, dem Piwonka ein Stamperl Schnaps und ein Grammelschmalzbrot anzubieten, fängt der Piwonka gleich zu schnarren an, jetzt sei, äh, der Putzkurs fällig, daran führe, äh, kein Weg vorbei. Das ganze Bitten von der Tante Friedl nützt nichts. Der Hans resigniert gleichfalls. Er legt der Tante Friedl die Hand auf die Schulter und singt sozusagen tröstend vor sich hin: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“25
Da geht ein Ruck durch den Piwonka. „Des is aus da ,Fledamaus‘“, schnarrt er ohne ein einziges Äh. Und dann stimmt er an: „Bist du’s, lachendes Glück“, und so schnarrend seine Stimme beim Sprechen ist, so geschmeidig klingt sie, wenn er singt. „Das ist aber ,Der Graf von Luxenburg‘ vom Lehár“, sagt der Hans.
„Sowieso“, sagt der Piwonka. Dann singt er die ganze Nummer so schön vor, dass der Lehár seine Freude dran hätt’.
„An Ihnen ist ein Tenor verloren gegangen“, sagt der Hans.
„I woet, äh, Schauschbüla wean“, schnarrt der Piwonka, „owa mia hom ka Gööd ghobd fia goa nix. Jetzd schleich i mi maunchmoe ins Buagdeata eine oda, äh, in a aundas Deata. Wissen S, fia mi is da ,Faust‘ des greßte.“
Jetzt geht ein Ruck durch den Hans. „Für mich auch“, sagt er und beginnt:
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein;
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.
Der Piwonka schnarrt: „Ostaschbaziagang. Kenn i.“ Und dann fährt er mit seiner schönen Stimme, mit der er gesungen hat, und in fast makellosem Hochdeutsch, dem man nur an manch einem Wort den Angehörigen der Arbeiterklasse anhört, mit dem Wagner fort:
Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren,
Ist ehrenvoll und ist Gewinn;
Doch würd’ ich nicht allein mich her verlieren,
Weil ich ein Feind von allem Rohen bin.
„I kaun den ,Faust‘ auswendig“, schnarrt der Piwonka, „hoed net gaunz, valleicht, owa fost.“
Was sich daran anschließt, ist keine Belehrung über Ordnung. Die drei unterhalten sich über das Theater und über Operetten, sie streuen Monologe ein und singen Melodien an, und alles geht durcheinander, weil allen der Mund übergeht, und der Piwonka ist selig, weil er endlich jemanden gefunden hat, mit dem er über seine geheime Leidenschaft reden kann, und die Tante Friedl ist selig und der Hans ist auch selig, weil sie unter ihren Freunden und in ihren Familien niemanden haben, mit dem sie ihre Freude an Operette und Theater teilen haben können.
Dann aber stellt zu guter Letzt die Tante Friedl doch die bange Frage, was jetzt mit der Ordnung und dem Putzkurs ist. „A wos“, schnarrt der Piwonka, „owa san S so guat und mochn S, äh, wiaklech sauwa, weu i söwa kaun zwoa a Äugal zuadruckn, owa waun a aundara kummt, dea waaß von ana Faust nua, wia ma s auffehoet26.“
Die Tante Friedl hat dann wirklich saubergemacht und ein bisserl aufgeräumt. Ab und zu ist sie unterwegs, auf dem Areal von Sandleiten, dem Piwonka begegnet. Meistens hat er ganz normal gegrüßt mit „Hawe d Ehre“, aber wenn er sozialistisch gegrüßt hat mit der Faust, hat die Tante Friedl gewusst, dass er auf eine Inspektion vorbeikommt. Dann hat sie die mittlerweile blitzblanke und aufgeräumte Wohnung noch ein bisserl sauberer gemacht. Und bei den Inspektionen hat der Piwonka nie wieder auch nur herumgeschaut, sondern hat sich gleich in Positur geworfen und eine Operettennummer gesungen oder eine Stelle aus dem „Faust“ zum besten gegeben.
Wie dann die Nationalsozialisten gekommen sind, hat sich ihnen der Piwonka zuerst begeistert angeschlossen, aber es hat nicht lang gedauert, und er ist in den Widerstand gegangen, so wie der Hans, der auf einem Aug blind von der Front zurückgekommen ist. Nach dem Krieg ist der Piwonka zu den Kommunisten gegangen, weil er in ihnen die Garanten gegen ein Wiedererwachen des Nationalsozialismus gesehen hat, und der Hans und die Tante Friedl sind für die Amerikaner gewesen, weil sie der Auffassung waren, das stärkste Gegengift gegen den Nationalsozialismus ist die Demokratie. Aber die drei haben sich weiter getroffen und ihre eigenen Operetten- und „Faust“-Abende veranstaltet. Richtige Freunde sind sie geworden über alle Gegensätze und Grenzen hinweg.
Apropos Tante Friedl und kaisertreu: Also die Kaiser – ich sage Ihnen …
DIE KAISER
Jetzt muss ich Ihnen was erzählen, und zwar über die Kaiser.
Vom Nandl werden wir noch gesondert reden – Sie wissen eh, der Ferdinand I., der so ein bisserl seltsam gewesen ist. Von den Habsburgern haben ja viele einen Pecker gehabt, nicht nur der Ferdinand, auch etliche der anderen Kaiser sind G’spritzte27 gewesen.
Jetzt wett’ ich mit Ihnen um einen Apfelstrudel, den ich hier sehr empfehlen kann, dass Sie an die Habsburger denken. Recht so. Wenn es heißt: „österreichische Kaiser“, hat jeder ein Bild vom Franz Joseph vor Augen und von der Maria Theresia, obwohl die ihr Leben lang nur eine Erzherzogin gewesen ist. Der Kaiser, das ist ihr Mann gewesen, der Franz I. Stephan, ein Lothringer. Genau genommen, ist damit die Linie der Habsburger-Kaiser unterbrochen. Aber wenigstens ist eine Habsburgerin die Frau vom Kaiser gewesen, gerade so, wie eine Frau von einem Arzt in Wien eine Frau Doktor ist, sogar dann, wenn sie selbst was ganz Anderes studiert hat, meinetwegen Architektur, womit sie eine Frau Diplomingenieur wäre, oder Altphilologie, was sie zu einer Frau Magister machen würde. Aber wenn sie einen Arzt heiratet, ist sie eine Frau Doktor. Grad so ist die Maria Theresia eine Kaiserin gewesen.
Jo, eh, die Lektorin meines Vertrauens sagt auch immer, ich soll darauf nicht gar so herumreiten, grad heute geht es doch um Gleichberechtigung, was ich ja gut finde, aber ich kann deshalb doch, und wenn ich es noch so möchte, eine Erzherzogin nicht zu einer Kaiserin machen, nicht einmal dann, wenn sie selber sich so gefühlt hat und die Geschichte eher sie verzeichnet als ihren Mann.
Nach dessen Tod ist ihr Sohn Kaiser geworden. Jetzt hat die Dynastie halt Habsburg-Lothringen geheißen. Merken Sie was? „Habsburg“ steht an erster Stelle, obwohl der Franz Stephan gerade nach damaligem Verständnis zuerst kommen hätte müssen, und der ist, wie ich Ihnen gerade erzählt habe, ein Lothringer gewesen. Da hat’s also doch sowas Ähnliches gespielt wie Gleichberechtigung. Aber kommen wir zum Sohn von der Erzherzogin Maria Theresia und ihrem kaiserlichen Gemahl – der, der Sohn, meine ich, war nämlich ein rechter Spinner.
Dabei gilt der Joseph II.28 als der große Reformer unter den Kaisern. Das ist er bestimmt gewesen. Er hat keinen Stillstand geduldet. Selbst ist er inkognito als „Graf von Falkenstein“ in der Kutsche durch Europa gereist und hat sich angehört, was die Probleme der Menschen sind. In seinen Verordnungen hat er sich strikt an der Nützlichkeit orientiert. Zum Beispiel: Sind religiöse Auseinandersetzungen nützlich oder schaden sie dem Zusammenleben aller? – Also Religionsfreiheit. Oder: Was bringen Folter und Todesstrafe? – Ergo schafft er beides ab29. Wer produziert mehr und besser: Ein Bauer, der auf eigene Verantwortung arbeitet, oder ein Leibeigener? – Also weg mit der Leibeigenschaft.
Soweit ist alles bestens. Aber mit den Auswüchsen seiner Kontrollsucht sind die wenigsten zurechtgekommen. Ich meine: Es ist ja schön, wenn sich der Kaiser höchstpersönlich um die Einzelheiten der Staatsgeschäfte kümmert, aber muss er gleich auch die Zahl der Kerzen regeln, die bei einem Gottesdienst entzündet werden? Den Komponisten hat er untersagt, lange Messen zu schreiben. Das mutwillige Schreien und Händeklatschen auf der Gasse hat er per Gesetz verboten, er hat bestimmt, wieviel Petersilie in der Küche von Schloss Schönbrunn verbraucht werden darf, und er hat sich für straffällig gewordene Adelige eine besondere Buße einfallen lassen: Sie mussten die Straße kehren. Obendrein hat er für die Theater angeordnet, dass kein Stück ein tragisches Ende haben darf. William Shakespeares „Romeo und Julia“ beispielsweise endet mit dem Wiener Schluss in einer fröhlichen Hochzeitszeremonie. Schmähohne.
Sogar die Art des Begräbnisses hat der Kaiser geregelt. Natürlich ist es ihm auch da um die Nützlichkeit gegangen. Der Körper soll schnell verwesen. Ein Sarg ist da nur hinderlich, und außerdem ist es eine Verschwendung, eine Truhe einzugraben, die könnte man schließlich mehrfach verwenden. Ergo schreibt der Kaiser Joseph den Sparsarg vor, der nach ihm auch Josephinischer Klappsarg heißt. Das ist eine Truhe, deren Boden aus einer Klappe besteht. Der Leichnam wird, in ein Tuch gewickelt, hineingelegt, zum Grab transportiert, der Sarg wird über das Grab gestellt und die Klappe betätigt. Schon plumpst der Leichnam in die Grube. Die Klappe wird geschlossen und der Sarg wartet auf seinen nächsten Benützer. Sie können sich denken, was in Wien los gewesen ist, wo vielen eine „scheene Leich“30 mehr zählt als ein schönes Leben. Am 23. August 1784 hat der Kaiser die Verordnung erlassen, am 27. Jänner 1785 hat er sie wieder zurückgenommen. Richtig grantig ist der Kaiser da gewesen – warten Sie, das muss ich Ihnen wörtlich vorlesen: „Da ich sehe und täglich erfahre, daß die Begriffe der Lebendigen leider noch so materiell sind, daß sie einen unendlichen Preis darauf setzen, daß ihre Körper nach dem Tode langsamer faulen und länger ein stinkendes Aas bleiben: so ist mir wenig daran gelegen, wie sich die Leute wollen begraben lassen; und werden sie also durchaus erklären, nachdem sie die vernünftigen Ursachen, die Nutzbarkeit und Möglichkeit dieser Art Begräbnisse gezeigt habe, ich keinen Menschen, der nicht davon überzeugt ist, zwingen will, vernünftig zu seyn, und daß also ein jeder, was die Truhen anbelangt, frey thun kann, was er für seinen todten Körper zum Voraus für das Angenehmste hält.“
Es kommt aber noch grotesker: Der Kaiser hat befunden, dass Pfeffernüsse31 schädlich seien und sie deshalb verboten. Das ist so eine Art Wiener Pfeffernuss-Prohibition gewesen. Obendrein hat er sich vor Farbe im Gesicht geekelt. Deshalb hat er darauf gedrängt, dass sich die Hofdamen nicht schminken, und er hat Harlekine verabscheut.
Auch seinem Neffen und Nachfolger, dem Franz I.32, hat er mit seinem ewigen Tadel das Leben so schwer gemacht, dass der Franz sich lieber in Gesellschaft von Blumen aufgehalten hat, weil die nicht die ganze Zeit motschkern33. Seine Leidenschaft für alles Pflanzliche hat dazu geführt, dass er liebend gerne mit der Gießkanne in der Hand unterwegs gewesen ist, Unkraut gejätet und Rosen beschnitten hat. Er hat höchstderoselbst einen Garten gestaltet und ihn 1823 für alle Bürger geöffnet. Seither heißt er Volksgarten – und er schaut heute noch so aus, wie seine Majestät es für gut und richtig befunden hat. Auf dem Gelände von Laxenburg hat er einen künstlichen Teich anlegen lassen mit einer Insel in der Mitte, auf der hat er ein Kitsch-Schloss errichtet. Dann hat er sich ans Ufer der künstlichen Insel gesetzt und nach Dingen geangelt, die er zuvor selbst in den Teich geworfen hat.
Außerdem hat der Kaiser Franz sehr gerne Geige gespielt, nur leider nicht gut. Partout hat er im Quartett des Badener Bürgermeisters Johann Nepomuk Trost mitspielen wollen. Kann man einem Kaiser sein Begehr verweigern? Aber der Trost hat den Kaiser an die Zweite Geige gesetzt. Seine Majestät soll gegrantelt haben: „Aber in Wien spiel ich die Erste Geige.“
Über den Rudolf II.34