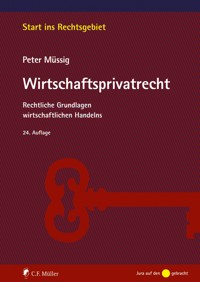
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wirtschaftsprivatrecht bezeichnet die Summe aller privatrechtlichen Rechtsgrundlagen, die das wirtschaftliche Geschehen und die Beziehungen aller an ihm Beteiligten zueinander regeln. Es erfasst eine Fülle von Rechtsgebieten, vor allem Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht, zudem Wettbewerbsrecht, gewerblichen Rechtsschutz sowie Prozessuales und Insolvenz. Die wesentlichen Grundprinzipien, Strukturen sowie Verknüpfungen werden einprägsam und anwendungsbezogen erläutert. Die Konzeption zielt darauf ab, dem Leser die Systematik und das Ineinandergreifen der Rechtsmaterien übersichtlich, klar strukturiert und gut verständlich vor Augen zu führen. Zahlreiche praxisnahe Beispiele, prägnante Schaubilder sowie Leitfragen zur Lernkontrolle machen das Buch besonders anschaulich und nutzerfreundlich. Das Lehrbuch richtet sich insbesondere an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsrechts und verwandter Studiengänge, die sich in die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Strukturen ökonomischen Handelns einarbeiten und fundiertes Basiswissen erlangen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Wirtschaftsprivatrecht
Rechtliche Grundlagen wirtschaftlichen Handelns
von
Peter Müssig
24., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Autor
Prof. Dr. iur. utr. Peter Müssiglehrte als ordentlicher Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht am Fachbereich Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences; er ist jetzt Emeritus.
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-8983-7
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2024 C.F. Müller GmbH, Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Wer aktiv am Wirtschaftsleben teilnimmt, der kommt am Wirtschaftsprivatrecht und seinen wesentlichen Prinzipien nicht vorbei:
Der „homo oeconomicus“ nimmt Rechtsbeziehungen zu anderen auf, er schließt Verträge, tauscht Leistungen und Güter aus, wird als Unternehmer tätig, gründet Gesellschaften, muss sich dem Wettbewerb stellen, tritt selbst als Konsument auf, ist Verbraucher, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, hat mit Zahlungsverkehr zu tun, nimmt oder vergibt Kredite, muss sie sichern, u.v.m.
Mit den juristischen Voraussetzungen und Wirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten befasst sich das vorliegende Buch; es erläutert entsprechende Rechtsgrundlagen und Rechtsregeln.
Sie finden sich, ungeachtet des die Basis bildenden BGB, in einer Vielzahl einzelner Gesetze – diese Vielfalt macht ihre Handhabung für Studierende und Praktiker nicht einfach. Daher werden für das Wirtschaftsleben wesentliche Rechtsgrundsätze hier im Zusammenhang dargelegt:
Wer sich die Grundlagen des privaten Wirtschaftsrechts erschließen möchte, kann sich anhand dieses Grundrisses ein Basiswissen über besonders wirtschaftsrelevante Rechtsgebiete, ihre Prinzipien und Verknüpfungen, aneignen. So wendet sich das Buch insbesondere an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsrechts und anderer Studiengänge, die die wirtschaftsprivatrechtlichen Rahmenbedingungen und Strukturen ökonomischen Handelns kennenlernen wollen bzw. kennen müssen; ebenso an Jura-Studenten/innen in den ersten Semestern, die sich in die Grundprinzipien einarbeiten möchten.
Die Vorauflage hat, ebenso wie ihre Vorgängerinnen, wiederum schnell erfreuliche Aufnahme gefunden. In der gerade auch daher erforderlich gewordenen vorliegenden aktualisierten Neuauflage ist die Grundkonzeption wiederum beibehalten worden, neue Aspekte, vielfältige jüngste, zum Teil sehr erhebliche, Gesetzgebungsaktivitäten, insbesondere bezüglich des Personengesellschaftsrechts, bzw. aktuelle Rechtsprechung sind wiederum eingearbeitet, weitere instruktive Beispiele eingefügt.
Miltenberg, im April 2024 Peter Müssig
Inhaltsübersicht
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1Einführung
2Rechtliche Grundbegriffe
3Rechtssubjekte – Personen des Rechtsverkehrs
4Rechtsobjekte – Gegenstände des Rechtsverkehrs
5Abstraktionsprinzip
6Rechtsgeschäftliche Grundlagen
7Stellvertretung
8Schuldverhältnisse
9Leistungsstörungen/Pflichtverletzungen
10Wirtschaftsrechtlich relevante Vertragstypen
11Ungerechtfertigte Bereicherung
12Unerlaubte Handlungen; Deliktsrecht
13Geschäftsführung ohne Auftrag
14Gefährdungshaftung
15Sachenrecht
16Arbeitsrecht
17Gesellschaftsrecht
18Wettbewerbsrecht
19Gewerblicher Rechtsschutz
20Prozessuales; Insolvenz
Zur Vertiefung – Literatur, Kommentare, Fachzeitschriften, Rechtsprechung, Internetadressen
Stichwortverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
1Einführung
2Rechtliche Grundbegriffe
2.1Systematik3
2.2Privates/öffentliches Recht4
2.3Privatrechtsgebiete5
2.4Wirtschaftsprivatrecht6
2.5Privatautonomie7
2.6Rechtsanwendung; Arbeitstechnik8 – 12
2.6.1Subsumtion9
2.6.2Anspruch10
2.6.3Rechtssprache11
2.6.4Rechtsprechung; Rechtsfindung12
2.7(Privat-)Rechtsgeschichte13
3Rechtssubjekte – Personen des Rechtsverkehrs
3.1Natürliche Personen15 – 24
3.1.1Natürliche Personen als Rechtsträger – Rechtsfähigkeit16
3.1.2Natürliche Personen als Handelnde – Handlungsfähigkeit17 – 20
3.1.2.1Geschäftsfähigkeit18
3.1.2.2Deliktsfähigkeit19
3.1.2.3Verschuldensfähigkeit20
3.1.3Natürliche Personen als zu Schützende21 – 23
3.1.3.1Schutzbereiche22
3.1.3.2Verbraucher23
3.1.4Wohnsitz24
3.2Juristische Personen25 – 27
3.2.1Begriff26
3.2.2Eingetragener Verein27
3.3Personenverbände/rechtsfähige Personengesellschaften28
3.4Kaufleute29 – 51
3.4.1Begriff des Kaufmanns30 – 33
3.4.1.1Gewerbe31
3.4.1.2Betreiben32
3.4.1.3Handelsgewerbe33
3.4.2Arten der Kaufleute34 – 40
3.4.2.1Kaufmann kraft Gewerbebetriebs35
3.4.2.2Eingetragener Kleingewerbetreibender36
3.4.2.3Eingetragener Land- oder Forstwirt37
3.4.2.4Kaufmann kraft Eintragung38
3.4.2.5Kaufmann kraft Rechtsscheines39
3.4.2.6Handelsgesellschaften; Kaufmann kraft Rechtsform40
3.4.3Beginn und Ende der Kaufmannseigenschaft41
3.4.4Auswirkungen der Kaufmannseigenschaft42
3.4.5Firma43 – 49
3.4.5.1Prinzipien44
3.4.5.2Arten45
3.4.5.3Firmenbildung46
3.4.5.4Firmengrundsätze47
3.4.5.5Firmenschutz48
3.4.5.6Firmenfortführung49
3.4.6Handelsregister; Unternehmensregister50
3.4.7Handelsbücher51
3.5Handelsgesellschaften52
3.6Unternehmer53
4Rechtsobjekte – Gegenstände des Rechtsverkehrs
4.1Sachen55 – 63
4.1.1Einteilung der Sachen56 – 59
4.1.1.1Bewegliche Sachen57
4.1.1.2Unbewegliche Sachen58
4.1.1.3Teilbare und unteilbare Sachen59
4.1.2Bestandteile einer Sache60
4.1.3Zubehör61
4.1.4Nutzungen/Früchte62
4.1.5Sachgesamtheiten63
4.2Rechte64 – 72
4.2.1Absolute und relative Rechte65
4.2.2Persönlichkeitsrechte66
4.2.3Gestaltungsrechte67
4.2.4Herrschaftsrechte68
4.2.5Gegenrechte69 – 72
4.2.5.1Einreden70
4.2.5.2Einwendungen71
4.2.5.3Prozessuale Einreden72
4.3Rechtsdurchsetzung73 – 77
4.3.1Private Rechtsdurchsetzung74
4.3.2Rechtsmissbrauch75
4.3.3Zeitliche Grenzen76
4.3.4Termine; Fristen77
4.4Rechtsgesamtheiten78 – 80
4.4.1Vermögen79
4.4.2Unternehmen/Betrieb80
5Abstraktionsprinzip
5.1Grundlagen82
5.2Weitere Ausprägungen83
6Rechtsgeschäftliche Grundlagen
6.1Rechtsgeschäft85
6.2Arten der Rechtsgeschäfte86 – 96
6.2.1Regelungsgegenstand87
6.2.2Anzahl88
6.2.3Unter Lebenden/von Todes wegen89
6.2.4Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte90
6.2.5Kausale und abstrakte Geschäfte91
6.2.6Handelsgeschäfte92 – 95
6.2.6.1Begriff93
6.2.6.2Kaufmännische Rechtsgeschäfte; Besonderheiten94
6.2.6.3Handelskauf95
6.2.7Verbrauchergeschäfte96
6.3Willenserklärung97 – 119
6.3.1Willensäußerung98 – 100
6.3.1.1Erklärung99
6.3.1.2Schweigen des Kaufmanns100
6.3.2Wille101 – 105
6.3.2.1Handlungswille102
6.3.2.2Erklärungsbewusstsein103
6.3.2.3Geschäftswille104
6.3.2.4Motiv105
6.3.3Abgrenzung106 – 110
6.3.3.1Rechtsgeschäftsähnliche Handlung107
6.3.3.2Realakt108
6.3.3.3Unerlaubte Handlung109
6.3.3.4Gefälligkeitsverhältnis110
6.3.4Arten der Willenserklärung111 – 117
6.3.4.1Ausdrückliche Willenserklärung112
6.3.4.2Stillschweigende Willenserklärung113
6.3.4.3Empfangsbedürftige Willenserklärung114
6.3.4.4Nicht empfangsbedürftige Willenserklärung115
6.3.4.5Willenserklärung unter Anwesenden116
6.3.4.6Willenserklärung unter Abwesenden117
6.3.5Wirksamkeit der Willenserklärung118
6.3.6Auslegung der Willenserklärung119
6.4Form der Rechtsgeschäfte120
6.5Bedingungen; Befristungen; Zustimmung121
6.6Vertrag122 – 133
6.6.1Angebot123
6.6.2Annahme124
6.6.3Dissens125
6.6.4Rückgängigmachung126 – 128
6.6.4.1Rücktritt127
6.6.4.2Widerruf128
6.6.5Arten von Verträgen129
6.6.6Vertragsfreiheit130 – 132
6.6.6.1Grundsätzliches131
6.6.6.2Gleichbehandlung/Antidiskriminierung132
6.6.7Vertragliches Vorfeld133
6.7Allgemeine Geschäftsbedingungen134 – 142
6.7.1Rechtsgrundlagen135 – 140
6.7.1.1Begriff136
6.7.1.2Einbeziehung137
6.7.1.3Überraschungsklauseln138
6.7.1.4Unklarheitenregel139
6.7.1.5Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit140
6.7.2Inhaltskontrolle141
6.7.3Anwendungsbereich142
6.8Mängel des Rechtsgeschäfts143 – 153
6.8.1Inhaltliche Schranken144 – 147
6.8.1.1Nichtigkeit145
6.8.1.2Unwirksamkeit146
6.8.1.3Schwebende Un-/Wirksamkeit147
6.8.2Willensmängel148 – 153
6.8.2.1Bestandteile der Willenserklärung149
6.8.2.2Fallgruppen150
6.8.2.3Bewusste Willensmängel151
6.8.2.4Unbewusste Willensmängel152
6.8.2.5Unzulässige Beeinträchtigung der Willensbildung153
7Stellvertretung
7.1Begriff155
7.2Arten156 – 162
7.2.1Gesetzliche Vertretung157
7.2.2Organschaftliche Vertretung158
7.2.3Rechtsgeschäftliche Vertretung159 – 162
7.2.3.1Erklärung160
7.2.3.2Arten der Vollmacht161
7.2.3.3Erlöschen der Vollmacht162
7.3Abgrenzungen163 – 168
7.3.1Mittelbare Stellvertretung164
7.3.2Bote165
7.3.3Erfüllungsgehilfe166
7.3.4Verrichtungsgehilfe167
7.3.5Besitzdiener168
7.4Voraussetzungen der wirksamen Stellvertretung169 – 173
7.4.1Zulässigkeit der Vertretung170
7.4.2Vertretungsmacht171
7.4.3Offenkundigkeit172
7.4.4Willenserklärung des Vertreters173
7.5Wirkung der Stellvertretung174
7.6Vertretung ohne Vertretungsmacht175
7.7Grenzen der Vertretungsmacht176 – 179
7.7.1Gesetzliche Vertretungsmacht177
7.7.2Insichgeschäft178
7.7.3Missbrauch der Vertretungsmacht179
7.8Sonderformen kaufmännischer Stellvertretung180 – 196
7.8.1Hilfspersonen des Kaufmanns181 – 183
7.8.1.1Selbstständige Hilfspersonen182
7.8.1.2Unselbstständige Hilfspersonen183
7.8.2Prokura184 – 188
7.8.2.1Erteilung185
7.8.2.2Umfang186
7.8.2.3Beschränkungen durch Vereinbarungen187
7.8.2.4Erlöschen188
7.8.3Handlungsvollmacht189 – 195
7.8.3.1Erteilung190
7.8.3.2Arten191
7.8.3.3Umfang192
7.8.3.4Beschränkungen durch Vereinbarungen193
7.8.3.5Außendienst194
7.8.3.6Erlöschen195
7.8.4Ladenvollmacht196
8Schuldverhältnisse
8.1Begriffe198
8.2Entstehung199 – 202
8.2.1Gesetzliche Schuldverhältnisse200
8.2.2Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse201
8.2.3Anbahnung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse202
8.3Leistungspflichten203 – 212
8.3.1Leistungsinhalt204 – 206
8.3.1.1Leistungsbestimmung205
8.3.1.2Treu und Glauben/Rücksichtnahme206
8.3.2Haupt- und Nebenpflichten207
8.3.3Einzel-/Dauerleistungspflichten208
8.3.4Stück-/Gattungsschulden209
8.3.5Geldschulden210
8.3.6Zinsschulden211
8.3.7Wahlschuld212
8.4Leistungszeit213
8.5Leistungsort214
8.6Beteiligung Dritter215 – 219
8.6.1Leistung durch Dritte216
8.6.2Leistung an Dritte217
8.6.3Vertrag zu Gunsten Dritter218
8.6.4Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter219
8.7Gläubiger- und Schuldnermehrheit220
8.8Abtretung von Forderungen221 – 226
8.8.1Voraussetzungen222
8.8.2Abstraktheit223
8.8.3Wirkung224
8.8.4Formen225
8.8.5Anderweitige Forderungsübergänge226
8.9Schuldübernahme, Schuldbeitritt227
8.10Leistungszurückbehaltung228
8.11Vertragsstrafe229
8.12Schadensersatz230 – 236
8.12.1Anspruchsgrundlagen231
8.12.2Begriff232
8.12.3Art233
8.12.4Umfang234
8.12.5Kausalität235
8.12.6Anspruchsberechtigter236
8.13Anspruchsverpflichteter237 – 240
8.13.1Schuldner238
8.13.2Vertragsrechtliche Zurechnung239
8.13.3Deliktsrechtliche Zurechnung240
8.14Beendigung241 – 254
8.14.1Erfüllung242
8.14.2Erfüllungssurrogate243 – 254
8.14.2.1Hinterlegung244
8.14.2.2Aufrechnung245
8.14.2.3Erlassvertrag246
8.14.2.4Negatives Schuldanerkenntnis247
8.14.2.5Novation248
8.14.2.6Aufhebungsvertrag249
8.14.2.7Vergleich250
8.14.2.8Konfusion, Konsolidation251
8.14.2.9Rücktritt, Widerruf252
8.14.2.10Kündigung253
8.14.2.11Vertragsbeendigung254
9Leistungsstörungen/Pflichtverletzungen
9.1Systematik256
9.2Verschulden257
9.3Unmöglichkeit258 – 263
9.3.1Begriff, Arten259
9.3.2Regelungsbereiche260 – 263
9.3.2.1Leistungspflicht des Schuldners261
9.3.2.2Gegenleistung262
9.3.2.3Auswirkungen263
9.4Schuldnerverzug264 – 267
9.4.1Begriff265
9.4.2Voraussetzungen266
9.4.3Rechtsfolgen267
9.5Gläubigerverzug268 – 272
9.5.1Begriff269
9.5.2Voraussetzungen270
9.5.3Rechtsfolgen271
9.5.4Kaufmännischer Selbsthilfeverkauf272
9.6Mängelhaftung, Gewährleistung273
9.7Vertragsverletzung274 – 276
9.7.1Regelungsbereiche275
9.7.2Rechtsfolgen276
9.8Verschulden bei Vertragsanbahnung (culpa in contrahendo)277 – 279
9.8.1Regelungsbereiche278
9.8.2Rechtsfolgen279
9.9Störung der Geschäftsgrundlage280 – 282
9.9.1Regelungsbereiche281
9.9.2Rechtsfolgen282
9.10Verletzung nachvertraglicher Pflichten283
10Wirtschaftsrechtlich relevante Vertragstypen
10.1Überblick285
10.2Kaufvertrag286 – 301
10.2.1Vertragsgegenstand287
10.2.2Pflichten des Verkäufers288
10.2.3Pflichten des Käufers289
10.2.4Folgen von Pflichtverletzungen290
10.2.5Gefahrenübergang291
10.2.6Rechtsmängel; Rechtskauf292
10.2.7Sachmängelgewährleistung293 – 297
10.2.7.1Sachmangel294
10.2.7.2Rechte des Käufers295
10.2.7.3Verbrauchsgüterkauf296
10.2.7.4Kaufmännische Untersuchungs- und Rügeobliegenheit297
10.2.8Eigentumsvorbehalt298
10.2.9Sonderformen des Kaufes299
10.2.10Gutgläubiger Erwerb des Eigentums300
10.2.11Internationales Kaufrecht301
10.3Werkvertrag302 – 314
10.3.1Vertragsgegenstand303
10.3.2Pflichten des Unternehmers304
10.3.3Pflichten des Bestellers305
10.3.4Nebenpflichten306
10.3.5Leistungsstörungen307 – 309
10.3.5.1Gefahrenübergang308
10.3.5.2Mängelhaftung des Unternehmers309
10.3.6Kündigung310
10.3.7Sicherungsrechte des Unternehmers311
10.3.8Werklieferungsvertrag; Verbrauchervertrag über die Herstellung digitaler Produkte312
10.3.9Pauschalreisevertrag, Reisevermittlung und Vermittlung verbundener Reiseleistungen313
10.3.10VOB/VOL314
10.4Dienstvertrag315 – 326
10.4.1Vertragsgegenstand; Abgrenzung316
10.4.2Selbstständige/unselbstständige Dienstverhältnisse317
10.4.3Pflichten des Dienstverpflichteten318
10.4.4Pflichten des Dienstberechtigten319
10.4.5Nebenpflichten320
10.4.6Vertragsstörungen321
10.4.7Ende des Dienstverhältnisses322
10.4.8Geschäftsbesorgungsverträge323 – 326
10.4.8.1Geschäftsbesorgung324
10.4.8.2Zahlungsdienste325
10.4.8.3Kartenzahlung326
10.5Mietvertrag327 – 338
10.5.1Vertragsgegenstand328
10.5.2Pflichten des Vermieters329
10.5.3Pflichten des Mieters330
10.5.4Nebenpflichten331
10.5.5Vermieterpfandrecht332
10.5.6Haftung für Mängel333
10.5.7Ende des Mietverhältnisses334
10.5.8Wechsel der Mietparteien335
10.5.9Leasing336
10.5.10Pachtvertrag337
10.5.11Franchising338
10.6Darlehensvertrag339 – 345
10.6.1Vertragsgegenstand340
10.6.2Pflichten des Darlehensgebers341
10.6.3Pflichten des Darlehensnehmers342
10.6.4Kündigung343
10.6.5Bankeinlagen344
10.6.6Verbraucherdarlehensrecht345
10.7Bürgschaftsvertrag346 – 350
10.7.1Übersicht über Kreditsicherungsmittel347
10.7.2Vertragsgegenstand348
10.7.3Rechtsstellung des Bürgen349
10.7.4Sonderformen350
10.8Verbraucherverträge - besondere Vertrags- bzw. Vertriebsformen351 – 358
10.8.1Grundsätze351
10.8.2Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge353
10.8.3Fernabsatzverträge354
10.8.4Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr; Online-Marktplätze355
10.8.5Bereichsausnahmen356
10.8.6Widerrufsrecht des Verbrauchers357
10.8.7Verträge über digitale Produkte358
10.9Verträge mit selbstständigen kaufmännischen Hilfspersonen359 – 381
10.9.1Handelsvertretervertrag360 – 364
10.9.1.1Charakteristika361
10.9.1.2Pflichten der Parteien362
10.9.1.3Vertragsverhältnisse363
10.9.1.4Beendigung364
10.9.2Handelsmaklervertrag365 – 369
10.9.2.1Grundsätzliches366
10.9.2.2Pflichten der Parteien367
10.9.2.3Rechtsverhältnisse368
10.9.2.4Beendigung369
10.9.3Kommissionsvertrag370 – 376
10.9.3.1Prinzipielles371
10.9.3.2Pflichten der Parteien372
10.9.3.3Besondere Rechte des Kommissionärs373
10.9.3.4Vertragsverhältnisse374
10.9.3.5Beendigung375
10.9.3.6Kommissionsagent376
10.9.4Vertragshändlervertrag377 – 381
10.9.4.1Grundsatz378
10.9.4.2Pflichten der Parteien379
10.9.4.3Vertragsbeziehungen380
10.9.4.4Beendigung381
10.10Kaufmännische Transport- und Lagerverträge382 – 396
10.10.1Frachtvertrag383 – 387
10.10.1.1Prinzipielles384
10.10.1.2Pflichten der Parteien385
10.10.1.3Vertragsbeziehungen386
10.10.1.4Haftung387
10.10.2Speditionsvertrag388 – 392
10.10.2.1Grundsätzliches389
10.10.2.2Pflichten der Parteien390
10.10.2.3Vertragsbeziehungen391
10.10.2.4Haftung392
10.10.3Lagervertrag393 – 396
10.10.3.1Grundsatz394
10.10.3.2Pflichten der Parteien395
10.10.3.3Vertragsbeziehungen396
11Ungerechtfertigte Bereicherung
11.1Grundtatbestände398
11.2Rechtsfolgen399
11.3Leistungskondiktion400
11.4Bereicherung „in sonstiger Weise“401
12Unerlaubte Handlungen; Deliktsrecht
12.1Haftungsprinzipien403
12.2Grundtatbestand, § 823 I BGB404 – 411
12.2.1Tatbestand405 – 408
12.2.1.1Rechtsgutsverletzung406
12.2.1.2Verletzungshandlung407
12.2.1.3Haftungsbegründende Kausalität408
12.2.2Rechtswidrigkeit409
12.2.3Verschulden410
12.2.4Rechtsfolge: Schadensersatz411
12.3Verstoß gegen Schutzgesetze, § 823 II BGB412
12.4Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung413
12.5Einstandspflicht für den Verrichtungsgehilfen, § 831 BGB414 – 420
12.5.1Verrichtungsgehilfe415
12.5.2Widerrechtliche Schadenszufügung416
12.5.3Handeln in Ausführung der Verrichtung417
12.5.4Exculpation418
12.5.5Rechtsfolge419
12.5.6Gesamtschuldnerische Haftung420
12.6Produkthaftung421 – 432
12.6.1Gewährleistungspflichten422 – 424
12.6.1.1Gewährleistungsansprüche423
12.6.1.2Garantien424
12.6.2Deliktsrechtliche Haftung425 – 428
12.6.2.1Herstellerhaftung426
12.6.2.2Herstellerpflichten427
12.6.2.3Beweislast428
12.6.3Haftung nach dem ProdHaftG429 – 431
12.6.3.1Prinzipien430
12.6.3.2Haftungsausschlüsse, -beschränkungen431
12.6.4Produktsicherung nach dem ProdSG432
13Geschäftsführung ohne Auftrag
13.1Begriff434
13.2Rechtsfolgen435 – 439
13.2.1Berechtigte GoA436
13.2.2Unberechtigte GoA437
13.2.3Irrtümliche Geschäftsführung438
13.2.4Angemaßte Geschäftsführung439
13.3Bedeutung440
14Gefährdungshaftung
14.1Grundsatz442
14.2Prinzipien443
14.3Anwendungsbereiche444 – 454
14.3.1Kfz-Halterhaftung445
14.3.2Produkthaftung446
14.3.3Haftung nach dem HaftPflG447
14.3.4Luftverkehrshaftung448
14.3.5Haftung für Gewässerschäden449
14.3.6Haftung für Kernanlagen450
14.3.7Haftung für Umweltschäden451
14.3.8Tierhalterhaftung452
14.3.9Arzneimittelhaftung453
14.3.10Gentechnik-Haftung454
15Sachenrecht
15.1Übersicht456
15.2Prinzipien457
15.3Eigentum458 – 469
15.3.1Formen459
15.3.2Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb an beweglichen Sachen460 – 463
15.3.2.1Einigung461
15.3.2.2Übergabe462
15.3.2.3Berechtigung463
15.3.3Gesetzlicher Eigentumserwerb an beweglichen Sachen464
15.3.4Eigentumserwerb an Grundstücken465 – 468
15.3.4.1Auflassung466
15.3.4.2Eintragung467
15.3.4.3Berechtigung468
15.3.5Schutz469
15.4Besitz470 – 474
15.4.1Funktion471
15.4.2Arten472
15.4.3Erwerb, Verlust473
15.4.4Besitzschutz474
15.5Grundpfandrechte475 – 478
15.5.1Hypothek476
15.5.2Grundschuld477
15.5.3Rentenschuld; Reallast478
15.6Pfandrecht479
16Arbeitsrecht
16.1Arbeitsrechtsbereiche481
16.2Grundlagen482 – 498
16.2.1Arbeitnehmer/Arbeitgeber483
16.2.2Arbeitsverhältnis/Arbeitsvertrag484 – 487
16.2.2.1Grundsätzliches485
16.2.2.2Rechtsquellen/Gestaltungsfaktoren486
16.2.2.3Benachteiligungsverbote/Gleichbehandlung487
16.2.3Zustandekommen488 – 494
16.2.3.1Vertragsrechtliche Grundlagen489
16.2.3.2Anbahnung490
16.2.3.3Probearbeitsverhältnis491
16.2.3.4AGB-Kontrolle vorformulierter Vertragsinhalte492
16.2.3.5Betriebsübergang493
16.2.3.6Arbeitnehmerüberlassung494
16.2.4Fehlerhaftes Arbeitsverhältnis495
16.2.5Nebenpflichten496
16.2.6Weisungsrecht497
16.2.7Nebentätigkeiten498
16.3Leistungsstörungen499 – 508
16.3.1Wechselseitiger Leistungsaustausch500
16.3.2Vergütung ohne Arbeitsleistung501 – 507
16.3.2.1Krankheit502
16.3.2.2Feiertage503
16.3.2.3Urlaub504
16.3.2.4Persönliche Verhinderung505
16.3.2.5Annahmeverzug506
16.3.2.6Betriebs-/Wirtschaftsrisiko507
16.3.3Schlechtarbeit508
16.4Arbeitnehmerhaftung509 – 513
16.4.1Schädigung des Arbeitgebers510
16.4.2Schädigung von Arbeitskollegen511
16.4.3Schädigung Dritter512
16.4.4Arbeitgeberhaftung513
16.5Beendigung514 – 522
16.5.1Grundsätzliches515
16.5.2Arbeitgeberkündigung516 – 519
16.5.2.1Ordentliche Kündigung517
16.5.2.2Außerordentliche Kündigung518
16.5.2.3Änderungskündigung519
16.5.3Kündigungsschutz520
16.5.4Befristungen521
16.5.5Rechtsfolgen bei Beendigung522
16.6Kaufmännische Sonderregeln523
16.7Kollektives Arbeitsrecht524 – 527
16.7.1Grundbegriffe525
16.7.2Tarifvertragsrecht526
16.7.3Betriebsverfassungsrecht527
17Gesellschaftsrecht
17.1Grundbegriffe; Überblick529 – 542
17.1.1Gegenstand530
17.1.2Wahl des Gesellschaftstypus; Vertragsgestaltung531
17.1.3Einteilung der Gesellschaften532 – 537
17.1.3.1Grundsatz533
17.1.3.2Sonderformen534
17.1.3.3Personen- und Kapitalgesellschaften535
17.1.3.4Handelsgesellschaften536
17.1.3.5Gesellschaften europäischen Rechts537
17.1.4Geschäftsführung und Vertretung538
17.1.5Gründung539 – 541
17.1.5.1Personengesellschaften540
17.1.5.2Kapitalgesellschaften541
17.1.6Ausscheiden eines Gesellschafters542
17.2Die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts543 – 556
17.2.1Begriff der GbR544 – 546
17.2.1.1Grundsätzliches545
17.2.1.2Erscheinungsformen546
17.2.2Gesellschaftsvertrag547
17.2.3Gesellschaftszweck548
17.2.4Gesellschafterpflichten549
17.2.5Gesellschafterrechte550 – 552
17.2.5.1Mitwirkungsrechte551
17.2.5.2Vermögensrechte552
17.2.6Geschäftsführung und Vertretung553
17.2.7Ende der GbR554
17.2.8Gesellschafterwechsel555
17.2.9Steuerrechtliche Aspekte556
17.3Die offene Handelsgesellschaft557 – 579
17.3.1Begriff der oHG558 – 560
17.3.1.1Grundsätzliches559
17.3.1.2Charakteristika560
17.3.2Gesellschaftsvertrag561 – 567
17.3.2.1Vertragsabschluss562
17.3.2.2Vertragspartner563
17.3.2.3Gesellschaftszweck564
17.3.2.4Gemeinschaftliche Firma565
17.3.2.5Keine Haftungsbeschränkung566
17.3.2.6Handelsregistereintragung und Wirksamkeit567
17.3.3Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)568 – 571
17.3.3.1Selbstgestaltung569
17.3.3.2Spezifika570
17.3.3.3Geschäftsführung571
17.3.4Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter zu Dritten (Außenverhältnis)572 – 575
17.3.4.1oHG als Außengesellschaft573
17.3.4.2Vertretung574
17.3.4.3Haftung575
17.3.5Ende der oHG576
17.3.6Gesellschafterwechsel577
17.3.7Prozessualia578
17.3.8Steuerrechtliches579
17.4Die Kommanditgesellschaft580 – 606
17.4.1Begriff der KG581 – 583
17.4.1.1Grundsätzliches582
17.4.1.2Charakteristika583
17.4.2Gesellschaftsvertrag584 – 588
17.4.2.1Vertragsschluss585
17.4.2.2Vertragspartner586
17.4.2.3Gesellschaftszweck587
17.4.2.4Firma588
17.4.3Haftungsverhältnisse gegenüber Gesellschaftsgläubigern589 – 592
17.4.3.1KG590
17.4.3.2Komplementäre591
17.4.3.3Kommanditisten592
17.4.4Eintragung593
17.4.5Rechtsstellung der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)594 – 596
17.4.5.1Komplementäre595
17.4.5.2Kommanditisten596
17.4.6Rechtsverhältnisse der Gesellschafter und der Gesellschaft zu Dritten (Außenverhältnis)597 – 600
17.4.6.1Außengesellschaft598
17.4.6.2Vertretung599
17.4.6.3Haftung600
17.4.7Ende der KG601
17.4.8Steuerrechtliche Aspekte602
17.4.9Sonderformen603 – 606
17.4.9.1GmbH & Co. KG604
17.4.9.2Publikumsgesellschaften605
17.4.9.3KGaA606
17.5Die stille Gesellschaft607 – 625
17.5.1Begriff der stillen Gesellschaft608 – 612
17.5.1.1Grundsätzliches609
17.5.1.2Typische stille Gesellschaft610
17.5.1.3Atypische stille Gesellschaft611
17.5.1.4Charakteristika612
17.5.2Gesellschaftsvertrag613 – 616
17.5.2.1Vertragsschluss614
17.5.2.2Gesellschafter615
17.5.2.3Gesellschaftszweck616
17.5.3Rechtsbeziehungen der Gesellschafter617 – 620
17.5.3.1Gesellschaftsvertrag618
17.5.3.2Rechte und Pflichten des Geschäftsinhabers619
17.5.3.3Rechte und Pflichten des stillen Gesellschafters620
17.5.4Rechtsverhältnis zu Dritten621
17.5.5Gesellschafterwechsel622
17.5.6Auflösung der stillen Gesellschaft623
17.5.7Prozessualia624
17.5.8Steuerrechtliches625
17.6Die Partnerschaftsgesellschaft626 – 637
17.6.1Grundsätzliches627 – 629
17.6.1.1Begriff der Partnerschaft628
17.6.1.2Rechtsnatur629
17.6.2Entstehung630 – 632
17.6.2.1Partnerschaftsvertrag631
17.6.2.2Eintragung632
17.6.3Name633
17.6.4Innenverhältnis634
17.6.5Personelle Veränderungen635
17.6.6Außenverhältnis636
17.6.7Steuerliches637
17.7Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung638 – 659
17.7.1Begriff der GmbH639 – 642
17.7.1.1Grundsätzliches640
17.7.1.2Bedeutung641
17.7.1.3Abgrenzung zur AG642
17.7.2Gründung der GmbH643 – 646
17.7.2.1Gesellschafter644
17.7.2.2Errichtung645
17.7.2.3Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)646
17.7.3Firma647
17.7.4Gesellschaftsvermögen648
17.7.5Rechtsstellung der Gesellschafter649
17.7.6Stellung der Geschäftsführer650 – 654
17.7.6.1Grundsätzliches651
17.7.6.2Geschäftsführung652
17.7.6.3Vertretung653
17.7.6.4Haftung654
17.7.7Aufsichtsrat655
17.7.8Satzungsänderungen656
17.7.9Auflösung und Liquidation657
17.7.10Steuern658
17.7.11GmbH & Co. KG659
17.8Die Aktiengesellschaft660 – 692
17.8.1Begriff der AG661 – 667
17.8.1.1Rechtsperson662
17.8.1.2Bedeutung663
17.8.1.3Erscheinungsformen664
17.8.1.4Abgrenzung zur GmbH665
17.8.1.5Aktionär, Aktie, Grundkapital666
17.8.1.6Börsennotierte/nicht börsennotierte AG667
17.8.2Gründung der AG668 – 673
17.8.2.1Einfache Gründung669
17.8.2.2Qualifizierte Gründung670
17.8.2.3Nachgründung671
17.8.2.4Haftung672
17.8.2.5Gesetzliche Gründung673
17.8.3Firma674
17.8.4Aktien675
17.8.5Gesellschaftsvermögen; Haftung676
17.8.6Rechtsstellung des Aktionärs677 – 680
17.8.6.1Erwerb/Verlust678
17.8.6.2Rechte679
17.8.6.3Pflichten680
17.8.7Organe der AG681 – 684
17.8.7.1Vorstand682
17.8.7.2Aufsichtsrat683
17.8.7.3Hauptversammlung684
17.8.8Rechnungslegung und Gewinnverwendung685
17.8.9Kapitalveränderungen686 – 688
17.8.9.1Kapitalerhöhungen687
17.8.9.2Kapitalherabsetzungen688
17.8.10Auflösung und Liquidation689
17.8.11Steuern690
17.8.12Kommanditgesellschaft auf Aktien – KGaA691
17.8.13Verbundene Unternehmen692
17.9Die eingetragene Genossenschaft693 – 713
17.9.1Grundsätzliches694 – 698
17.9.1.1Begriff der eG695
17.9.1.2Rechtsperson696
17.9.1.3Erscheinungsformen697
17.9.1.4Betätigung698
17.9.2Gründung der eG699
17.9.3Firma700
17.9.4Haftungsverhältnisse701
17.9.5Rechtsstellung des Mitglieds702 – 705
17.9.5.1Erwerb/Verlust703
17.9.5.2Rechte704
17.9.5.3Pflichten705
17.9.6Organe der Genossenschaft706 – 710
17.9.6.1Vorstand707
17.9.6.2Aufsichtsrat708
17.9.6.3Generalversammlung709
17.9.6.4Vertreterversammlung710
17.9.7Genossenschaftsregister711
17.9.8Pflichtprüfung712
17.9.9Steuern713
17.10Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung714 – 728
17.10.1Begriff der EWIV715
17.10.2Gesellschaftsvertrag716 – 721
17.10.2.1Vertragsabschluss717
17.10.2.2Vertragspartner718
17.10.2.3Gesellschaftszweck719
17.10.2.4Firma720
17.10.2.5Keine Haftungsbeschränkung721
17.10.3Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)722
17.10.4Rechtsverhältnisse gegenüber Dritten (Außenverhältnis)723 – 726
17.10.4.1Außengesellschaft724
17.10.4.2Vertretung725
17.10.4.3Haftung726
17.10.5Ende der EWIV727
17.10.6Steuern728
17.11Die Europäische (Aktien-)Gesellschaft729 – 731
17.11.1Begriff der SE730
17.11.2Grundprinzipien731
18Wettbewerbsrecht
18.1Übersicht733
18.2Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)734 – 738
18.2.1Kartellverbote735
18.2.2Marktbeherrschung736
18.2.3Fusionskontrolle737
18.2.4Europäisches Kartellrecht738
18.3Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)739 – 744
18.3.1Wettbewerbsrechtliche Generalklausel740 – 742
18.3.1.1Voraussetzungen741
18.3.1.2Unlauteres Handeln742
18.3.2Sondertatbestände; Rechtsfolgen743
18.3.3Rechtsdurchsetzung744
19Gewerblicher Rechtsschutz
19.1Übersicht746
19.2Patente747
19.3Gebrauchsmuster748
19.4Design749
19.5Markenrecht750
19.6Urheberrecht751
19.7Arbeitnehmererfindungen752
20Prozessuales; Insolvenz
20.1Zivilgerichte754
20.2Mahnverfahren755
20.3Zwangsvollstreckung756
20.4Außergerichtliche Streitbeilegung757
20.5Verbraucherstreitigkeiten758
20.6Insolvenzverfahren759 – 763
20.6.1Grundsätze760
20.6.2Eigenverwaltung761
20.6.3Restschuldbefreiung762
20.6.4Verbraucherinsolvenz763
Zur Vertiefung – Literatur, Kommentare, Fachzeitschriften, Rechtsprechung, Internetadressen
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abs.
Absatz
Abt.
Abteilung
ADHGB
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch
ADSp
Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen
a.E.
am Ende
AEntG
Arbeitnehmer-Entsendegesetz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.
alte Fassung
AFG
Arbeitsförderungsgesetz
AG(en)
Aktiengesellschaft(en)
AGB(en)
Allgemeine Geschäftsbedingung(en)
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AktFoV
Aktionärsforumsverordnung
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative
AnfG
Anfechtungsgesetz
AO
Abgabenordnung
ArbGG
Arbeitsgerichtsgesetz
ArbnErfG
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz
ArbStättVO
Arbeitsstättenverordnung
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
arg.
argumentum (Argument aus …)
Art.
Artikel
ArzneimittelG
Arzneimittelgesetz
AtomG
Atomgesetz
AÜG
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
AWG
Außenwirtschaftsgesetz
BAGE
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes, Amtliche Sammlung
BAT
Bundesangestelltentarifvertrag
BBankG
Bundesbankgesetz
BBauG
Bundesbaugesetz
BBG
Bundesbeamtengesetz
BBiG
Berufsbildungsgesetz
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BEEG
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BeurkG
Beurkundungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGB-InfoVO
Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BJagdG
Bundesjagdgesetz
BMG
Bundesmeldegesetz
BNatG
Bundesnaturschutzgesetz
BORA
Berufsordnung für Rechtsanwälte
BörsG
Börsengesetz
BPersVG
Bundespersonalvertretungsgesetz
BRAO
Bundesrechtsanwaltsordnung
Brüssel I a
VO (EU) Nr. 1215/2012 v. 12.12.2012
Bsp.
Beispiel
bspw.
beispielsweise
BUrlG
Bundesurlaubsgesetz
BV (II. BV)
(Zweite) BerechnungsVO nach dem 2. WohnungsbauG
bzgl.
bezüglich
BZRG
Bundeszentralregistergesetz
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
cic
culpa in contrahendo
CISG
Convention on Contracts for the International Sale of Goods
CMR
Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr
COVBekG/GesRuaCOVBekG
G über Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
cpcf
culpa post contractum finitum
Dax
Deutscher Aktienindex
DepotG
Depotgesetz
ders.
derselbe
DesignG
Designgesetz
d.h.
das heißt
dies.
dieselbe(n)
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DM
Deutsche Mark
DRiG
Deutsches Richtergesetz
DrittelbG
Drittelbeteiligungsgesetz
DrohnenVO
VO zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten – DrohnenVO
DSGVO
EU-Datenschutzgrundverordnung
EFTA
European Free Trade Association
EFZG
Entgeltfortzahlungsgesetz
EGAktG
Einführungsgesetz zum AktG
EGBGB
Einführungsgesetz zum BGB
EGHGB
Einführungsgesetz zum HGB
EGScheckG
Einführungsgesetz zum Scheckgesetz
EG
Europäische Gemeinschaft
eG(en)
eingetragene Genossenschaft(en)
eGbR
eingetragene Gesellschaft(en) bürgerlichen Rechts
EGG
Gesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr
EGV
EG-Vertrag
EGZPO
Einführungsgesetz zur ZPO
einschl.
einschließlich
e.K.
eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau
e. Kfm.
eingetragener Kaufmann
e. Kfr.
eingetragene Kauffrau
EnWG
Energiewirtschaftsgesetz
ErbbauRG
Erbbaurechtsgesetz
ESt
Einkommensteuer
EStG
Einkommensteuergesetz
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuroEG
Euro-Einführungsgesetz
EuroVO
VO (EG) Nr. 974/98 v. 3.5.1998
e.V.
eingetragener Verein
evtl.
eventuell
EWIV(en)
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung(en)
EWIVG
Gesetz zur Ausführung der EWG-VO über die EWIV
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV
EWG-Vertrag
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
f.
folgende (Seite, Paragraph)
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FernUSG
Fernunterichtsschutzgesetz
ff.
fortfolgende (Seiten, Paragraphen)
G
Gesetz
GBO
Grundbuchordnung
GbR
Gesellschaft(en) bürgerlichen Rechts
GBV
Grundbuchverfügung (VO zur Ausführung der GBO)
GebO
Gebührenordnung
gem.
gemäß
GenG
Genossenschaftsgesetz
GenTG
Gentechnikgesetz
GewO
Gewerbeordnung
GewSt
Gewerbesteuer
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GG
Grundgesetz
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft(en) mit beschränkter Haftung
GmbHG
GmbH-Gesetz
GoA
Geschäftsführung ohne Auftrag
grds.
grundsätzlich
griech.
griechisch
GüKG
Güterkraftverkehrsgesetz
GuV
Gewinn und Verlust
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG
Geldwäschegesetz
h
Stunde
HaftpflG
Haftpflichtgesetz
HAG
Heimarbeitsgesetz
h.M.
herrschende Meinung
HGB
Handelsgesetzbuch
HinSchG
Hinweisgeberschutzgesetz
HOAI
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HR
Handelsregister
HRA
Handelsregister, Abteilung A
HRB
Handelsregister, Abteilung B
HRefG
Handelsrechtsreformgesetz
HRV
Handelsregisterverordnung
HS
Halbsatz
i.A.
im Auftrag
IHK
Industrie- und Handelskammer
insb.
insbesondere
InsO
Insolvenzordnung
i.d.F.v.
in der Fassung vom
i.d.R.
in der Regel
IPR
Internationales Privatrecht
i.S.d.
im Sinne des/der
ital.
italienisch
i.Ü.
im Übrigen
i.V.
in Vollmacht/in Vertretung
i.V.m.
in Verbindung mit
Jhdt.
Jahrhundert
JugArbSchG
Jugendarbeitsschutzgesetz
jur.
juristisch(e)
KAGB
Kapitalanlagegesetzbuch
kfm.
kaufmännisch
Kfm.
Kaufmann
Kfz
Kraftfahrzeug(e)
KfzPflVVO
Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung
kg
Kilogramm
KG(en)
Kommanditgesellschaft(en)
KGaA
Kommanditgesellschaft(en) auf Aktien
km
Kilometer
KSchG
Kündigungsschutzgesetz
KStG
Körperschaftssteuergesetz
KVO
Kraftverkehrsordnung
KWG
Kreditwesengesetz
LadenschlG
Ladenschlussgesetz
lat.
lateinisch
LebensmittelG
Lebensmittelgesetz
LG
Landgericht
Lkw
Lastkraftwagen
Ltd.
Limited
LuftfzRG
Gesetz über Rechte an Luftfahrzeugen
LuftVG
Luftverkehrsgesetz
MarkenG
Markengesetz
MFKRegV
MusterfeststellungsklagenregisterVO
MiLoG
Mindestlohngesetz
mind.
mindestens
MindArbBedG
Mindestarbeitsbedingungengesetz
Mio.
Million(en)
MitbestG
Mitbestimmungsgesetz
MoPeG
Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Mrd.
Milliarde(n)
MuSchG
Mutterschutzgesetz
MWSt
Mehrwertsteuer
NachweisG
Nachweisgesetz
n.F.
neue Fassung
Nr./Nrn.
Nummer/Nummern
oHG(en)
offene Handelsgesellschaft(en)
OLSchVO
Orderlagerscheinverordnung
OLG
Oberlandesgericht
OWiG
Ordnungswidrigkeitengesetz
p.a.
per annum
PAngVO
Preisangabenverordnung
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PartGmbB
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
PBefG
Personenbeförderungsgesetz
PfandLV
PfandleihVO
PflVG
Pflichtversicherungsgesetz
PflZG
Pflegezeitgesetz
phG
persönlich haftender Gesellschafter
Pkw
Personenkraftwagen
PostG
Postgesetz
PersBefG
Personenbeförderungsgesetz
PrKlG
Preisklauselgesetz
ProdHaftG
Produkthaftungsgesetz
ProdSG
Produktsicherheitsgesetz
PStG
Personenstandsgesetz
pVV
positive Vertragsverletzung (Forderungsverletzung)
R
Recht
RDG
Rechtsdienstleistungsgesetz
REITG
Gesetz über deutsche Immobilien-AGen mit börsennotierten Anteilen (Real-Estate-Investment-Trust-Gesetz)
RGBl.
Reichsgesetzblatt
Rom I
VO (EG) Nr. 593/2008 v. 17.6.2008
Rom II
VO (EG) Nr. 864/2007 v. 11.7.2007
RPflG
Rechtspflegergesetz
Rspr.
Rechtsprechung
RVG
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
s.
siehe
S.
Seite(n)/Satz/Sätze
s.a.
siehe auch/auf
s.o.
siehe oben
s.u.
siehe unten
SCE
Societas Cooperativa Europaea
ScheckG
Scheckgesetz
SchiffsRG
Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken
SchlichtVerfVO
Verordnung über das Verfahren der Schlichtungsstellen für Überweisungen
SchwarzArbG
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SE
Societas Europaea (Europäische Gesellschaft)
SEAG
SE-Ausführungsgesetz
SEBG
SE-Beteiligungsgesetz
SE-RL
SE-Richtlinie
SE-VO
SE-Verordnung
SGB
Sozialgesetzbuch
SigG
Signaturgesetz
sog.
sogenannt(e/er)
SprAuG
Sprecherausschussgesetz
StBerG
Steuerberatergesetz
stG
stille Gesellschaft
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
str.
strittig
StVG
Straßenverkehrsgesetz
SZR
Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds
TierSchG
Tierschutzgesetz
TMG
Telemediengesetz
TV
Tarifvertrag
TVG
Tarifvertragsgesetz
TVöD
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
u.
und/unten
u.a.
und andere/unter anderem
UG(en)
Unternehmergesellschaft(en)
UKlaG
Unterlassungsklagengesetz
UmweltHG
Umwelthaftungsgesetz
UmwG
Umwandlungsgesetz
UmwStG
Umwandlungssteuergesetz
UN
Vereinte Nationen
UrhG
Urheberrechtsgesetz
URV
Unternehmensregisterverordnung
USt
Umsatzsteuer
UStG
Umsatzsteuergesetz
usw.
und so weiter
u.U.
unter Umständen
u.v.m.
und viele(s) mehr
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.
von/vom
v.a.
vor allem
vgl.
vergleiche
VAG
Versicherungsaufsichtsgesetz
VerschG
Verschollenheitsgesetz
VDuG
Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz
VG
Verwertungsgesellschaft
VgV
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
VO
Verordnung
VOB
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VSBG
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
VVG
Versicherungsvertragsgesetz
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
WährungsG
Währungsgesetz
WE(en)
Willenserklärung(en)
WEG
Wohnungseigentumsgesetz
wg.
wegen
WG
Wechselgesetz
WHG
Wasserhaushaltsgesetz
WissZeitVG
Wissenschafts-Zeitvertragsgesetz
WoVermG
Wohnungsvermittlungsgesetz
WpHG
Wertpapierhandelsgesetz
WPO
Wirtschaftsprüferordnung
WRV
Weimarer Reichsverfassung
z.B.
zum Beispiel
ZKG
Zahlungskontengesetz
ZPO
Zivilprozessordnung
z.T.
zum Teil
ZVG
Zwangsversteigerungsgesetz
zzgl.
zuzüglich
z. Zt.
zur Zeit
1Einführung
1
Leitübersicht 1:Einführung
[Bild vergrößern]
a)
Warum ist die Kenntnis des Privatrechts für die Teilnahme am Wirtschaftsleben wichtig?
b)
Welche Ziele verfolgt die vorliegende Darstellung?
Das Privatrecht stellt einen der wesentlichsten Bereiche des gesamten Rechtssystems dar. Für jeden – als Privatperson, Verbraucher, Unternehmer, Mitarbeiter, Selbstständiger oder Unselbstständiger, Anbieter oder Nachfrager etc. – ist es von maßgeblicher Bedeutung. Das Privatrecht zu kennen, insbesondere mit seinen wesentlichen Rechtsprinzipien vertraut zu sein, ist gerade für den „homo oeconomicus“ unerlässlich:
Wie nimmt er am Rechtsverkehr teil? Worauf ist zu achten, um Willensentschlüsse rechtswirksam umzusetzen? Welche Pflichten ergeben sich innerhalb bestehender Rechtsbeziehungen? Welche Regeln sind bei der aktiven Gestaltung und Teilnahme am Wirtschaftsleben zu beachten?
Die Kenntnis der für die Wirtschaft relevanten Bereiche des Privatrechts ist besonders für Juristen bzw. Wirtschaftsrechtler wichtig – aber Betriebswirte und Ingenieure sowie wirtschaftsberatende Freiberufler kommen ebenfalls nicht umhin, sich damit zu beschäftigen; denn auch betriebswirtschaftliches, wirtschaftsberatendes bzw. ingenieurpraktisches Handeln findet nicht im regelungsfreien Raum statt. Es wird vielmehr durch die (Privat-) Rechtsordnung in vielfältigster Weise bestimmt. Welche wirtschaftlichen bzw. unternehmerischen Ziele erreichbar sind, wie sie verfolgt und durchgesetzt werden können, lenkt der Gesetzgeber durch eine Fülle von Vorschriften.
Was nutzen (vermeintlich) gute Geschäfte, wenn sie rechtlich unstimmig sind und zu Streitigkeiten, Forderungsausfällen, Haftungsfällen, (Anwalts-, Prozess-)Kosten und Ärger führen?
Wirtschaftsprivatrechtliche Kenntnisse sind daher gerade nicht nur Sache des Juristen bzw. Wirtschaftsrechtlers, sondern eines jeden, der am Wirtschaftsleben teilnimmt und es maßgeblich gestaltet – also insbesondere auch Betriebswirte, Ingenieure, sowie sonstige wirtschaftsnahe Berufe. Wirtschaftlicher Erfolg ist nämlich regelmäßig gerade auch davon abhängig, rechtliche Fehler zu vermeiden und (ggf. mit spezieller rechtskundiger bzw. anwaltlicher Hilfe) rechtlich gesicherte Wege zu gehen.
Der vorliegende Grundriss stellt dementsprechend einführend Grundzüge der wesentlichen Grundlagen des privaten Wirtschaftsrechtes vor. Er verfolgt dabei (ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben) die Konzeption, Grundstrukturen wichtiger, wirtschaftsrelevanter Rechtsbereiche integrierend darzustellen, um dem Leser so einen – durch vielfältige Beispiele und Schaubilder veranschaulichten – Blick auf die Zusammenhänge zu ermöglichen; die einzelnen Kapitel sind durch vielfache Querverweise verknüpft, um die Verbindungen der einzelnen Rechtsbereiche aufzuzeigen. Das Buch rückt das wirtschaftsbezogene Privatrecht in einen gemeinsamen Kontext. Die Fülle der Rechtsgrundlagen, vielfach strittigen Rechtsfragen und -probleme erweist sich dabei als besondere Herausforderung; angesichts der vielgestaltigen gesetzes-, vertrags-, rechtsprechungs- und rechtslehrebezogenen Problemfelder des Wirtschaftsprivatrechts kommt gerade den auf den S. 563 ff. gegebenen Hinweisen auf weiterführende, vertiefende Literatur sowie die einschlägige Rechtsprechung ihre besondere Bedeutung zu.
Zur Arbeitstechnik noch folgende Hinweise:
Zum Studium des Rechts und der rechtlichen Grundlagen ist es unumgänglich, die einschlägigen Gesetzesvorschriften sogleich aufzuschlagen und nachzulesen. Das ist zwar zunächst durchaus mühevoll, zur Gewinnung rechtlichen Grundverständnisses (und zur Gewöhnung an die Rechtssprache) aber unabdingbar.
Angesichts der Vielgestaltigkeit des (Wirtschaftsprivat-)Rechts ist es auch ganz besonders wichtig, sich bei der Beurteilung eines Sachverhaltes, einer Rechtsfrage bzw. bei Tätigung von Vermögensdispositionen nicht etwa nur auf einen gefundenen Paragraphen oder eine Buch- bzw. Literatur-Textstelle „zu stürzen“, sondern ebenso darauf zu achten, dass es dazu durchaus noch andere rechtlich zu bedenkende Gesichtspunkte sowie (ggf. divergierende, auch eigenwillige bzw. sogar irrige) Rechtsmeinungen (s.u. 2.6.4) geben kann. Hierbei ist i.d.R. einschlägige Rechtsprechung bzw. vertiefende Fachliteratur (Lehrbücher, Kommentare, Handbücher, Aufsätze in Fachzeitschriften; siehe die S. 563 ff.) heranzuziehen. Wegen der sich stets ändernden, komplexer werdenden bzw. der Schnelllebigkeit und Fülle der Gesetzgebung sowie der ständigen Entwicklung der Rechtsprechung ist gerade auch darauf zu achten, nicht etwa mit überholten, sondern mit jeweils gültigen Gesetzestexten und aktueller Fachliteratur bzw. Rechtsprechung zu arbeiten.
Wichtiger Hinweis:Im Übrigen gilt: Autor und Verlag streben nach größter Sorgfalt, sind aber vor Irrtümern, Fehlern sowie Änderungen nach Drucklegung, für die sie weder Haftung noch Gewährleistung übernehmen, nicht gefeit; für Hinweise, Anregungen und Kritik sind sie dankbar (www.cfmueller-verlag.de).
2Rechtliche Grundbegriffe
2
Leitübersicht 2:Rechtliche Grundbegriffe
[Bild vergrößern]
a)
Was ist Recht?
b)
Was ist unter den Begriffen objektives bzw. subjektives Recht zu verstehen?
c)
Welche Rechtsbereiche gehören zum (Wirtschafts-)Privatrecht?
d)
Wie „funktioniert“ juristische Subsumtionstechnik?
e)
Wie wird Recht „gefunden“?
f)
Wie hat sich das (Privat-)Recht historisch entwickelt?
Was ist Recht? Was ist Gesetz? Was ist gerecht?
Recht, Gesetz, Gerechtigkeit sind nicht einfach zu bestimmende Begriffe; sie sind Schlüsselbegriffe der Rechtswissenschaft bzw. Jurisprudenz, die sich vornehmlich mit der Suche nach bzw. mit dem „richtigen“ Recht, dem Wissen vom Rechten und Unrechten, sowie den Wegen der Rechtserkenntnis beschäftigt.
Recht sei die Kunst des Guten und Gerechten (lat. ius est ars boni et aequi), das Recht als praktizierte Gerechtigkeit bezwecke regelmäßig zu gebieten, verbieten, erlauben bzw. zu strafen, und es gebiete, ehrenhaft zu leben, niemanden zu verletzen und jedem das Seine zu gewähren (lat. honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere) – so beschrieb es etwa schon vor langer Zeit das römische Recht (s.u. 2.7).
Eingedenk dessen, dass jeder Mensch von Natur aus mit unveräußerlichen Rechten („dem Rechte, das mit uns geboren ist“) ausgestattet ist (sog. Naturrecht, überpositives Recht), bedarf es zum Ausschluss von Willkür gerade auch des in förmlichen Verfahren, staatlich gesetzten, kodifizierten sog. positiven Rechts. Dessen privatrechtliche Grundlagen bilden insbesondere die Anerkennung des Vertrages, der Ausgleich für Verletzungshandlungen sowie das Privateigentum einschließlich des Erbrechts.
Ungeachtet grundsätzlicher definitorischer bzw. rechtsphilosophischer Aspekte sind jedenfalls einige begriffliche Grundlagen zu beachten – der Umgang mit Recht und Gesetz erfordert die Kenntnis einiger wesentlicher Grundbegriffe.
2.1Systematik
3
Die Rechtsordnung hat die Funktion, das Zusammenleben der Bürger verbindlich zu regeln, Konflikte zu entscheiden und einen Ausgleich zwischen privatem und öffentlichem Interesse herbeizuführen.
Rechtsfahren im Straßenverkehr (verbindliche formale Ordnungsregelung); verbindliche Regelungen bzw. Entscheidungen, etwa durch Gerichte, bei Streitigkeiten von Bürgern (Konfliktlösung/-entscheidung); Beschränkung privaten Eigentums zugunsten allgemeiner Interessen (Interessenausgleich zwischen Eigen-/Allgemeininteressen).
Recht im objektiven Sinne nennt man dabei sämtliche Rechtsgrundsätze, die sich entweder aus dem Gewohnheitsrecht oder dem gesetzten Recht (den Rechtsnormen bzw. Gesetzen, s.u. 2.6.4) ergeben. Durch langdauernde Übung und Anwendung entwickeltes Gewohnheitsrecht (Jedermannsrecht),
Holz-, Beeren-, Eicheln-, Bucheckern-, Maronen-, Pilzsammeln in öffentlichen Wäldern, Handstraußpflücken auf Wiesen, Kehrpflichten,
findet sich immer seltener; die weitaus meisten Bereiche hat mittlerweile der Gesetzgeber geregelt (s.a. § 39 III BNatG).
Das von ihm gesetzte (kodifizierte, positive) Recht steht dabei in einer Normenhierarchie, bei der die niederrangige Norm immer im Einklang mit der höherrangigen stehen muss:
-
Grundgesetz als ranghöchste Rechtsquelle,
die Grundrechte der Art. 1, 2 ff. GG;
-
von Bund und Ländern erlassene Rechtsnormen, sog. Gesetze im formellen Sinn,
das BGB, die ZPO;
-
von der Exekutive erlassene Rechtsverordnungen,
die BGB-InfoVO, die StVO;
-
autonome Satzungen nichtstaatlicher Verbände, etwa der Gemeinden,
Bebauungsplan, Flächennutzungsplan,
-
oder von Tarifvertragsparteien,
normativer Teil von Tarifverträgen.
(Dazu gehören aber nicht die Satzungen von Vereinen, vgl. § 25 BGB.)
Die Verkehrssitte, der Handelsbrauch und technische Normen (z.B. DIN-Normen) sind – weil nicht von einem rechtssetzungsbefugten Organ erlassen – ebenso wenig Rechtsnormen wie die ständige Rspr. der Gerichte; allerdings erwächst der Gerichtsgebrauch, wenn er allgemein anerkannt wird, in Ausnahmefällen zur ständigen Übung bzw. zum Gewohnheitsrecht.
Die Regeln zum kfm. Bestätigungsschreiben (s.u. 6.3.1.2), die Anerkennung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (s.u. 3.1.3.1); etwa früher die culpa in contrahendo (s.u. 9.8) oder die positive Vertragsverletzung (s.u. 9.1, 9.7).
Aus dem objektiven Recht können Befugnisse des Einzelnen erwachsen, sog. subjektive Rechte. Man kennt sie (s.a. unten 4.2) in Form der
-
Herrschaftsrechte,
Eigentum, §§ 903 ff. BGB;
-
Forderungsrechte,
Kaufpreiszahlungsanspruch, § 433 II BGB;
-
Gestaltungsrechte,
Anfechtungsrecht i.S.d. § 123 BGB.
Auf das nationale Recht wirkt gerade auch internationales Recht ein. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Europarecht. Dieses bestimmt das gesetzgeberische Handeln, aber auch die Rspr. in erheblichem Maße. Eine Vielzahl von nationalen gesetzlichen Bestimmungen geht auf die Umsetzung europarechtlicher Vorgaben zurück, insbesondere auf Begleitgesetze zu EU-Verordnungen und vor allem Richtlinien der Europäischen Union, vgl. Art. 288 AEUV.
Die Regelungen der §§ 286, 312 ff., 327 ff., 355 ff., 434 ff., 474 ff. BGB; verbraucherrechtliche Schutzvorschriften, etwa im ProdHaftG, UWG, AGG, Reisevertragsrecht, bei Fernabsatzgeschäften, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verbraucherkaufverträgen; die Einführung des Euro; Antidiskriminierungs-, Schutzregeln im Arbeitsrecht – man sieht es diesen Bestimmungen somit gar nicht an, dass sie im internationalen bzw. Europarecht wurzeln.
Bei Sachverhalten mit Auslandsberührung gelten grds. die Regeln des sog. Internationalen Privatrechts (IPR).
Die Art. 3 ff. EGBGB, einschlägige Staatsverträge, europarechtlich insb. die Regeln der Rom I- bzw. Rom II-VO bzgl. des auf vertragliche sowie außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbaren Rechts.
Im grenzüberschreitenden Warenverkehr gilt ggf. das UN-Kaufrecht (CISG). Dieses regelt den internationalen Warenverkehr im Unternehmensbereich bei Import- und Exportverträgen (s.u. 10.2.11).
2.2Privates/öffentliches Recht
4
Systematisch von größter Bedeutung ist des Weiteren die Unterscheidung der Rechtsnormen in die Bereiche des öffentlichen sowie des privaten Rechts. Diese Differenzierung kannte bereits das römische Recht (s.u. 2.7), das beschrieb, das öffentliche Recht (das ius publicum) befasse sich mit den Verhältnissen des Gemeinwesens/Staates, das private Recht (das ius privatum) demgegenüber mit dem Nutzen der Einzelnen/Bürger.
Schaubild 1:Einteilung des Rechts
[Bild vergrößern]
Das öffentliche Recht regelt die Organisation des Staates und anderer hoheitlich handelnder Verbände, bestimmt die Beziehung zwischen Bürger und Staat bzw. anderen Trägern öffentlicher Gewalt, und ordnet das Verhältnis der Verwaltungsträger untereinander. Aus Sicht des Bürgers ist ein Rechtsverhältnis vornehmlich dann ein öffentlich-rechtliches, wenn ihm ein Hoheitsträger im Über- und Unterordnungsverhältnis oder jedenfalls gerade in seiner Eigenschaft als Träger von hoheitlicher Gewalt entgegentritt.
Erteilung einer Baugenehmigung; Erlass eines Steuerbescheids; Versetzung eines Beamten. Hier ergehen im Interesse der Allgemeinheit regelmäßig Verwaltungsakte (vgl. § 35 VwVfG) bzw. Bescheide.
Zum öffentlichen Recht gehören etwa folgende
das Staatsrecht (GG, Länderverfassungen, Staatsverträge), Völker- u. Europarecht (UN-Vertrag, EU-Vertrag, EU-Richtlinien), Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht: VwVfG; Besonderes Verwaltungsrecht: z.B. BBauG, BBG, WasserhaushaltsG, LadenschlußG, GewO, LebensmittelG, sowie das gerade unternehmerische Entscheidungen wesentlich mitbestimmende Steuerrecht – EStG, GewStG, KStG, UmwStG, AO etc. –), das Strafrecht (StGB, OWiG) sowie das Gerichtsverfassungs- und Prozessrecht (GVG, ZPO, StPO). Streitigkeiten im Bereich des öffentlichen Rechts entscheiden grundsätzlich die Verwaltungsgerichte (vgl. § 40 VwGO).
Demgegenüber ist das Privatrecht derjenige Teil der Rechtsordnung, der die Rechtsbeziehungen der Einzelnen zueinander auf der Basis von Gleichordnung und Selbstbestimmung regelt. Das Privatrecht bezieht sich also auf das „Recht des Mein und Dein“. Hauptgestaltungsmittel hierbei ist der Vertrag, also der gemeinsame Wille der Beteiligten (s.u. 6.6). Auch Träger öffentlicher Gewalt (Staat, Gemeinde) können daran beteiligt sein, wenn sie nicht hoheitlich, sondern fiskalisch wie „normale Bürger“ handeln.
Eine Verwaltungsbehörde kauft Schreibmaterialien, mietet Räume, stellt Arbeitnehmer ein.
Privatrechtliche Rechtsstreitigkeiten gehören als „bürgerliche Rechtsstreitigkeiten“ i.S.d. § 13 GVG grundsätzlich vor die ordentlichen Gerichte (s.u. 20). Weithin wird das Privatrecht auch Zivilrecht genannt (lat. civis – Staatsbürger).
Beispiele zur gleichbedeutenden Bezeichnung der Begriffe „Bürgerliches Recht“ bzw. „Zivilrecht“ sind etwa: BGB (in Deutschland), ABGB (Allgemeines BGB, in Österreich [s.u. 2.7]), bzw. ZGB (Zivilgesetzbuch, in der Schweiz).
Schaubild 2:Öffentliches/privates Recht
[Bild vergrößern]
2.3Privatrechtsgebiete
5
Im Bereich des Privatrechts unterscheidet man drei große Rechtsgebiete:
-
Bürgerliches Recht,
-
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht,
-
Arbeitsrecht.
Kerngebiet des Privatrechts ist das Bürgerliche Recht (es wird im Sprachgebrauch oftmals mit dem Zivilrecht an sich gleichgesetzt). Seine Hauptkodifikation ist das BGB (mit dessen fünf Büchern: Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht). Dazu gehören auch die das BGB ergänzenden Nebengesetze (etwa AGG, UKlaG, BGB-InfoVO, ProdHaftG). Die im BGB geregelten allgemeinen Grundsätze, insbesondere diejenigen in seinen ersten drei Büchern – Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht – gelten ebenso in den sonstigen privatrechtlichen Sondermaterien, soweit sich dort nicht vorrangigere Spezialregelungen finden (sog. leges speciales).
Neben dem Bürgerlichen Recht als dem allgemeinen Privatrecht stehen die bestimmte Sachgebiete regelnden bzw. für bestimmte Berufsgruppen geltenden Sonderprivatrechte: So das Handels-, Gesellschafts- und private Wirtschaftsrecht (insbesondere HGB, GmbHG, AktG, GenG, UWG, GWB, ScheckG, WG) – dieses kaufmännische Sonderrecht wird durch die spezifische Interessenlage der Kaufleute und Handelsgesellschaften bestimmt –, und ebenso das Arbeitsrecht, das sich grundsätzlich auf die für die abhängigen, unselbstständigen Arbeitsverhältnisse geltenden Rechtsregeln bezieht.
Die Gesetzgebungskompetenz für das Bürgerliche Recht liegt gemäß Art. 74 Nr. 1 GG beim Bund (vgl. etwa auch Art. 4 Nr. 13 der Deutschen Reichsverfassung vom 16.4.1871 [bzw. sog. „lex Miquel-Lasker“]).
Schaubild 3:Einteilung des BGB
[Bild vergrößern]
2.4Wirtschaftsprivatrecht
6
Der Begriff des Wirtschaftsprivatrechts hat sich mittlerweile etabliert. Zwar ist er nicht gesetzlich definiert, aber man versteht darunter in einer ganzheitlichen Betrachtung den wirtschaftlich relevanten Teil des Privatrechts: Also ökonomisch bedeutsame Rechtsregeln aus dem Bürgerlichen Recht (vornehmlich die ersten drei Bücher des BGB), dem Handels- und Gesellschaftsrecht, dem Wertpapier-, Wettbewerbsrecht und gewerblichen Rechtsschutz sowie der Rechtsdurchsetzung in Zivilprozess, Zwangsvollstreckung und Insolvenz, und dazu (jedenfalls im weiteren Sinne) auch das Arbeitsrecht. Wirtschaftsprivatrecht bezeichnet somit die Summe aller privatrechtlichen Rechtsgrundlagen, welche das wirtschaftliche Geschehen und vor allem die Beziehungen der an ihm Beteiligten zueinander regeln, also etwa zwischen Herstellern, Verkäufern, Kaufleuten, Unternehmern, Verbrauchern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, usw. Das Wirtschaftsprivatrecht ist damit Teil des Wirtschaftsrechts, das die Summe aller für die Wirtschaft bzw. das Wirtschaften relevanten Rechtsgebiete darstellt.
Öffentlich-rechtliches Pendant des Wirtschaftsprivatrechts ist das öffentliche Wirtschaftsrecht (auch verkürzt Wirtschaftsverwaltungsrecht genannt), das die hoheitliche Lenkung der Wirtschaft bezweckt und alle wirtschaftsverfassungs- und wirtschaftsverwaltungsrechtlichen staatlichen Regeln erfasst, die das Wirtschaften regulieren.
Gewerbe-, Handwerks-, Telekommunikations-, Energie-, Außenwirtschaftsrecht; insbesondere geht es dabei um Wirtschaftsplanung, -lenkung, -überwachung, -förderung, -information, -infrastruktur, unter besonderer Beachtung nationaler und internationaler, insbesondere europarechtlicher, Vorgaben.
Neben dem Wirtschaftsprivatrecht und dem öffentlichen Wirtschaftsrecht zum Wirtschaftsrecht zu zählen ist im Übrigen auch das Wirtschaftsstrafrecht, das sich auf die Ahndung missbilligter Verhaltensweisen, die gegen wirtschaftsrechtliche Verhaltensnormen verstoßen, bezieht.
Betrug, §§ 263 ff. StGB; Geldwäsche, § 261 StGB; Untreue, § 266 StGB; Kennzeichenverletzung, §§ 143 ff. MarkenG; aktienrechtliche Verfehlungen, §§ 399 ff. AktG.
Teilgebiet des Wirtschaftsrechts ist des Weiteren das Wirtschaftsvölkerrecht; dieses umfasst diejenigen völkerrechtlichen wirtschaftsbezogenen Regeln, die zwischen Staaten untereinander bzw. zwischen Staaten und Privatrechtssubjekten gelten.
Welthandelsrecht, Zoll-, Ein-, Ausfuhr-, Devisenkontrollrecht.
2.5Privatautonomie
7
Das Privatrecht wird geprägt vom Grundsatz der freien Selbstbestimmung des mündigen Bürgers, der sog. Privatautonomie (vgl. Art. 2 I GG, 152 S. 1 WRV). Der Einzelne kann bzw. soll seine Lebensverhältnisse und Rechtsbeziehungen eigenverantwortlich regeln und gestalten. Der Bürger vermag demzufolge Rechte und Pflichten zu begründen, zu ändern oder aufzuheben sowie – im Rahmen der durch die Gesetze und die Rechtsprechung abgesteckten Grenzen – eigenverantwortlich und eigenständig rechtsverbindlich zu handeln. Daher sind sogar die gesetzlichen Vorschriften selbst in weiten Bereichen nachgiebig bzw. dispositiv (= abdingbar), d.h., sie können durch abweichende Gestaltungen und Vereinbarungen ersetzt werden (so v.a. im sog. Schuldrecht; s.u. 6.6.6; 6.2.1).
In Abweichung von § 579 I BGB vereinbaren Mieter und Vermieter die Mietzinszahlung für ein Grundstück zum Monatsersten (vgl. die §§ 311 I, 241 I BGB; s.u. 10.5.3).
Die Privatautonomie kennzeichnen vornehmlich folgende Gesichtspunkte:
-
Formelle Gleichbehandlung aller Bürger;
-
Vertragsfreiheit (Freiheit, Verträge einzugehen und auszugestalten);
-
Vereinigungsfreiheit (Freiheit, sich etwa in Vereinen oder Gesellschaften zusammenzuschließen);
-
Testierfreiheit (Freiheit, über seinen Nachlass frei zu verfügen);
-
Privateigentum;
-
Eigentumsfreiheit (Freiheit zu tatsächlichen und rechtlichen Herrschaftshandlungen an beweglichen oder unbeweglichen Sachen);
-
Eingriffsbefugnisse des Staates in die Privatsphäre sind grundgesetzlich beschränkt.
Schaubild 4:Privatautonomie
[Bild vergrößern]
Gesetzliche Gleichbehandlungs- bzw. Antidiskriminierungsregeln schränken die Privatautonomie bzw. Vertragsfreiheit allerdings ggf. ein (s.u. 6.6.6.2, 16.2.2.3).
Die Benachteiligungsverbote des AGG.
Um im Rahmen der Privatautonomie Rechtsbeziehungen zu begründen, zu ändern oder aufzuheben, ist gesetzlich das Rechtsgeschäft als geeignetes Mittel vorgesehen (s.u. 6).
Kündigung eines Arbeitsvertrages (= einseitig); Abschluss eines Werkvertrages (= zweiseitig); Abschluss eines Gesellschaftsvertrages durch mehrere Kaufleute (= mehrseitig); s.u. 6.2.2 (s.a. die Schaubilder 40, 57 bzw. 81).
Allerdings sind besonders tragende bzw. bedeutsame Rechtsbereiche nicht dispositiv, vielmehr zwingendes Recht, von dem durch individuelle Vereinbarungen nicht abgewichen werden kann (sog. Typenzwang).
Die Übereignungsregeln des Sachenrechts (§§ 929 ff. BGB), die Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) oder die unerlaubte Handlung (§§ 823 ff. BGB), Formvorschriften (etwa die §§ 311b I, 766 S. 1, 623 BGB), die Regeln zur Gleichbehandlung (vgl. § 31 AGG) – Verstöße hiergegen führen regelmäßig zur Nichtigkeit, § 134 BGB (s.u. 6.8.1.1; 6.6.6).
2.6Rechtsanwendung; Arbeitstechnik
8
Nicht nur besondere ökonomische Geschicklichkeit von Verbrauchern und Unternehmern, vielmehr gerade auch Rechtskenntnisse und zutreffende Rechtsanwendung bestimmen wesentlich wirtschaftliche Tatsachen und Erfolge. Lebenssachverhalte sind rechtlich zu werten und die Rechtsfolgen festzustellen – nicht nur bereits geschehene Vorgänge, sondern auch künftige (insbesondere im Rahmen von Vertragsgestaltungen). Man muss daher den „technischen“ Umgang mit Gesetzen und ihre Auslegung lernen und beherrschen. Dies setzt die Kenntnis der Rechtsnormen, ihres Aufbaues und ihrer Prüfung voraus:
2.6.1Subsumtion
9
Der Gesetzgeber regelt in seinen Rechtsnormen eine Fülle unterschiedlicher Lebensvorgänge. Diese „Paragraphen“ sind daher regelmäßig abstrakt und generell gefasst. Zunächst wird mit den abstrakten Begriffen der Tatbestandsmerkmale der zu regelnde Sachverhalt beschrieben (sog. Tatbestand), danach wird daraus die Rechtsfolge gezogen.
Bei der Rechtsanwendung, also der rechtlichen Würdigung eines konkreten Lebenssachverhaltes, ist zu prüfen, ob ein bestimmter Sachverhalt den Erfordernissen bzw. Voraussetzungen einer Rechtsnorm entspricht – ist dem so, dann greift die im Gesetz genannte Rechtsfolge ein. Diesen Vorgang nennt man subsumieren bzw. Subsumtion.
Student S kauft im Elektronikladen des E ein Laptop (Lebenssachverhalt).
Dazu bestimmt § 433 I 1 BGB:
„Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache …“ (Obersatz).
S und E sind sich einig über Kaufgegenstand und Kaufpreis, haben also einen Kaufvertrag geschlossen, der E ist Verkäufer, das Laptop eine (bewegliche) Sache (Untersatz; Subsumtion).
… der E ist verpflichtet, dem Käufer S das Gerät zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen (Schlussfolge; Rechtsfolge). (Subsumtion bedeutet somit grds. die Unterordnung eines Besonderen unter ein Allgemeines.)
Tatbestand und Rechtsfolge, Voraussetzungsteil und Rechtsfolgenteil, benutzerfreundlich in einem Paragraphen(satz) zusammen (vgl. als weiteres Beispiel § 823 I BGB) finden sich nicht regelmäßig; die Gesetze enthalten oftmals auch unvollständige Rechtssätze, Begriffsbestimmungen, Verweisungen, die man erst zusammenführen muss, um einen Obersatz zu ermitteln.
Der Anspruch auf Rücktritt vom Kaufvertrag und Herausgabe des bereits gezahlten Kaufpreises (Zug-um-Zug gegen Herausgabe der bereits erhaltenen Ware) ergibt sich aus der Abfolge der §§ 433 I 2, 434 I 2 Nr. 1, 437 Nr. 2 1. Alt., 440, 323, 346 I, 348 BGB (s.u. 10.2.7.1).
2.6.2Anspruch
10
Das Privatrecht ist prinzipiell von individuellen Interessen und ihrer Durchsetzung gekennzeichnet. In aller Regel geht es darum festzustellen, wie die Rechtslage ist bzw. gestaltet werden kann. Der wesentliche Begriff in diesem Zusammenhang ist demzufolge derjenige des Anspruchs: Anspruch ist das Recht, von einem anderen ein Tun, Dulden oder Unterlassen begehren zu können (vgl. § 194 I BGB). Ob ein solcher Anspruch besteht, bestimmt sich danach, ob eine entsprechende rechtliche Basis vertraglicher bzw. gesetzlicher Art hierfür, d.h. die sog. Anspruchsgrundlage, vorhanden ist.
Die entscheidende Frage in der praktischen Rechtsanwendung lautet daher: „Wer will was von wem woraus?“ Man muss also den Anspruchsteller, den Anspruchsgegner, den Streitgegenstand und die Anspruchsgrundlage feststellen bzw. prüfen.
Schaubild 5:Geltendmachung eines Anspruchs
[Bild vergrößern]
Was der Anspruchsteller vom Anspruchsgegner fordert, kann durchaus, je nach seinem Interesse, recht unterschiedlich sein: so kommen als Anspruchsziele etwa Vertragserfüllung, Schadensersatz, Herausgabe von Gegenständen, Ersatz von Nutzungen oder Verwendungen, Beseitigung oder Unterlassung von Beeinträchtigungen in Betracht.





























