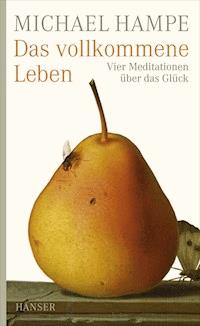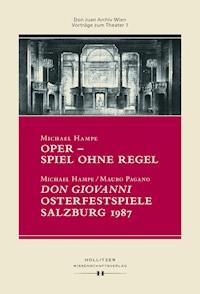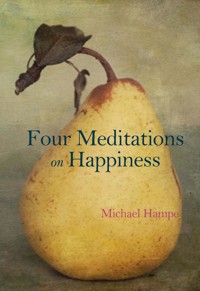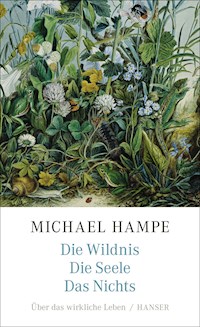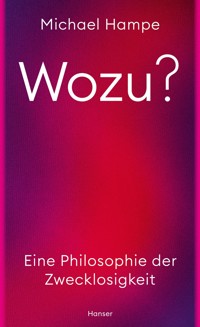
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Von der Geburt bis zum Tod: Was weiß die Philosophie über die Stationen unseres Lebens?
Was bedeutet es, auf die Welt zu kommen? Wir treffen Unterscheidungen und Bewertungen, noch bevor wir Begriffe bilden, sprechen und urteilen. Wir verlieben uns und begreifen, dass das Leben endlich ist. All das kann man philosophisch untersuchen: Entsteht da ein Subjekt? Warum braucht es einen „Sinn"? Wozu das alles? Kann man ein Leben mit all seinen Erfahrungen und Emotionen überhaupt in Worte fassen? Wenn wir uns aber nur über Ausschnitte unseres Lebens austauschen können, geraten Regeln und Zwecke ins Wanken, weil sie nur einen Teil unserer Existenz betreffen. Damit ist der Weg frei für eine Selbsterkundung, die eine größere innere Freiheit verspricht als die Jagd nach Zielen und die Suche nach Sinn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Von der Geburt bis zum Tod: Was weiß die Philosophie über die Stationen unseres Lebens?Was bedeutet es, auf die Welt zu kommen? Wir treffen Unterscheidungen und Bewertungen, noch bevor wir Begriffe bilden, sprechen und urteilen. Wir verlieben uns und begreifen, dass das Leben endlich ist. All das kann man philosophisch untersuchen: Entsteht da ein Subjekt? Warum braucht es einen »Sinn"? Wozu das alles? Kann man ein Leben mit all seinen Erfahrungen und Emotionen überhaupt in Worte fassen? Wenn wir uns aber nur über Ausschnitte unseres Lebens austauschen können, geraten Regeln und Zwecke ins Wanken, weil sie nur einen Teil unserer Existenz betreffen. Damit ist der Weg frei für eine Selbsterkundung, die eine größere innere Freiheit verspricht als die Jagd nach Zielen und die Suche nach Sinn.
Michael Hampe
Wozu?
Eine Philosophie der Zwecklosigkeit
Hanser
»Oder man könnte auch sagen, der erfüllt den Zweck des Daseins, der keinen Zweck außer dem Leben mehr braucht.«
Ludwig Wittgenstein, Tagebucheintrag vom 6.7.1916, Notebooks 1914—1916, S. 73
»… wie läßt sich das Phänomen Leben beschreiben wie läßt sich überhaupt noch irgendetwas beschreiben …«
Friederike Mayröcker, mein Herz mein Zimmer mein Name, Frankfurt am Main 1988, S. 7
»Gott ist Aufmerksamkeit ohne Ablenkung.«
Simone Weil, Cahiers 4, S. 132
»Als wir Kinder waren, gingen wir zum Meister eine Zeit lang, eine Zeit lang waren wir betört von eigener Meisterschaft; höre das Ende der Geschichte, die uns widerfuhr: Wie Wasser strömten wir und verschmolzen mit dem Wind.«
Omar Chajjâm (1048—1131), Wie Wasser strömen wir, S. 9
Was erschien
Vergangenen Winter habe ich eine entfernte Verwandte von Kagami (es macht nichts, wenn Sie grad nicht wissen, wer das ist) in der von uns so genannten wirklichen Welt gefragt, was autobiografische Philosophie sei. Da hat sie geantwortet:
»Autobiografische Philosophie ist eine Form der philosophischen Untersuchung, die persönliche Erfahrungen, Gedanken und Gefühle der Philosophin oder des Philosophen benutzt, um ihre philosophischen Ideen und Perspektiven zu entwickeln. Dieser Ansatz unterscheidet sich von traditioneller Philosophie, die sich häufig auf abstrakte Begriffe und logische Argumente stützt. Autobiografische Philosophie basiert auf der Idee, dass persönliche Erfahrungen und Emotionen eine legitime Quelle für Wissen und Einsichten sind. Autobiografische Philosophie kann viele Formen annehmen, von der persönlichen Reflexion einer Philosophin oder eines Philosophen in deren Schriften bis zur Verwendung von Lebenserfahrungen in ihrer Untersuchung und persönlichen Erzählungen in der Lehre. Einige Philosophinnen und Philosophen argumentieren, dass dieser Ansatz zu einem nuancierteren Verständnis der condition humaine führe, weil er abstrakte Begriffe mit den konkreten Erfahrungen von Individuen verbinde. Einige Beispiele von Philosophinnen und Philosophen, die autobiografische Elemente in ihren Arbeiten verwendeten, sind Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Friedrich Nietzsche. (Aber auch Seneca, Epiktet, Descartes, Montaigne, Kierkegaard und Cavell wären zu nennen.) Ihre Arbeiten offenbaren eine Menge über ihre eigene Lebenserfahrung, ihre persönlichen Gedanken und Gefühle und darüber, wie sie ihre philosophischen Ideen geformt haben. Es ist wichtig festzuhalten, dass autobiografische Philosophie keine philosophische Disziplin ist, sondern eher ein Ansatz, der in jedem Feld der Philosophie genutzt werden kann. Es ist ebenfalls wichtig zu sehen, dass Voreingenommenheiten in einer Philosophie Platz greifen können, die persönliche Erfahrungen verwendet.«1
Der Weg hinein
… in was hineingeraten? Enge und einzeln. Warum? Gab es eine falsche Bewegung? Von wem? Und wie wieder raus? Wohin? Weite, nicht einzeln. Eng und weit — ist Enge und einzeln schlecht und Weite gut? Bilder von Holzverschlägen vor Betonwänden, in denen es unmöglich ist, sich umzudrehen (eingesperrter Affe, der sprechen lernt), von Leibermassen, die weiterdrücken (Rinder, Menschen), oder ein Pferd, das mit der Kandare zurückgenommen wird. Jemand wird dicht auf den Boden gepresst, Kiefer wie eine Zange um den Nacken oder Knie auf dem Hals. Wolf im Wald liegend, schnell hechelnd, wach, Augen in den Himmel. Dann Schönheit leerer hoher Zimmer, eine sich plötzlich öffnende Lichtung im Wald, Meer, sich ruhig wiegend am Morgen oder stürmisch, ein Himmel, über den Wolken jagen, oder nur blau, klar, tanzende Möwen …
Wer redet hier dauernd? »Schlecht«, »gut« — ständig Bewertungen … kommen wie von selbst. Schon immer scheint es dieses Gerede gegeben zu haben, seit ich (wer?) mich erinnern kann. War es nie still? Oder kann ich mich nicht mehr an die Zeit erinnern, als es noch schwieg, aber ich vielleicht schon »auf der Welt war« (was für eine merkwürdige Wendung!)? Oder war ich noch gar nicht da, als es dies Gerede noch nicht gab? So vieles habe ich vergessen! Was gab es vorgestern zum Mittagessen? Keinen Schimmer.
Im Kindergottesdienst Geschichte vom Sündenfall: Sie und er essen vom Baum der Erkenntnis. Seitdem Rede von Gut und Böse. Seitdem dauernd Bewertungen, seitdem Leben als Einzelne. Anfang Geburt, Ende Tod, Enge der Zeit, Lebenszeit Einzelner. Alte Rede. Was war vorher? Eine Einheit, in der kein Bewerten stattfand? (Viel später aus dem Osten: »Wo weder Liebe noch Hass, ist alles offen und klar. Doch die kleinste Unterscheidung trennt Himmel und Erde in zwei. Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist nichts als eine Krankheit des Geistes.«) Vielleicht habe ich meine Existenz vor der Rede, vor all diesen Bewertungen einfach vergessen! Soll ich versuchen, mich so weit zurückzuerinnern, dass ich an eine Zeit vor der Rede denken kann? Doch wie sollte das gehen? Ich muss mich ja an der Rede entlanghangeln zurück in die Vergangenheit. Es gibt, so scheint es mir, die Vergangenheit nur in der Rede. Und wie sollte ich mir oder irgendjemand anderem sagen, was ich vergessen habe, falls es eine Zeit gegeben hat, in der ich noch keine Worte vergessen konnte, weil noch keine Rede »in mir« (wo ist das?) war? (»Je mehr Worte und Sorgen dich beherrschen, desto weiter entfernst du dich von der Wirklichkeit.«)
Und Bilder? Könnte ich nicht Bilder aus dieser Zeit erinnern und vergessen haben? Manche behaupten, sich an ihre Zeit im Mutterleib erinnern zu können. (Behaupte ich nicht!) Hatten sie Bilder im Kopf, oder tauchten Geräusche und Gefühle bei ihnen wieder auf? Aber was könnte für mich auf diesen Bildern zu sehen sein, an Geräuschen gehört, Gefühlen gefühlt worden sein ohne Rede? Habe ich den Herzschlag und Blutstrom meiner Mutter gehört, während ich als Fötus in der Fruchtblase schwebte? Doch was kann ich gehört haben, bevor ich die Wörter »Herz« und »Blut« kannte? Und als ich draußen war: Konnte ich da Mama und Papa sehen und fühlen, bevor ich »Mama« und »Papa« sagen konnte? Oder habe ich da nur Rundes mit Augen gesehen? Aber »rund« und »Augen« konnte ich ja auch noch nicht sagen, damals. Habe ich mich von irgendetwas oder irgendjemand unterschieden vor der Rede? Seit wann gibt es mich also eigentlich?
Welche angeborenen Gewohnheiten, dieses von jenem zu unterscheiden, existierten, bevor die Rede losging? Das Baby, das noch nicht spricht, kann im heißen Bad verbrüht werden. Dann schreit es. Es unterscheidet offenbar zwischen heiß und kalt, Schmerz und Lust, obwohl es noch nicht »heiß« und »kalt«, »Schmerz« und »Lust« sagen kann. Jedenfalls scheint es »uns Redenden« so, die wir es schreien hören, lächeln sehen. Aber unterscheidet und bewertet es (wer?) wirklich schon? Ist da schon jemand, der unterscheidet, oder wird einfach geschrien und gelächelt, je nachdem, was vorher geschehen ist? Alles scheint am Unterscheiden zu hängen. Trifft jemand Unterscheidungen, oder gibt es Einzelwesen, die bloß denken, sie träfen Unterscheidungen, weil unterschieden wird, »es unterscheidet«, so wie es blitzt oder der Atem geht, ohne dass jemand blitzt oder absichtlich atmet? Sind auch der Herzschlag und das Atmen ein Unterscheiden: Zusammenziehen und Entspannen? Auch »wirklich« und »nicht wirklich«, »tatsächlich« und »nur scheinbar existieren« sind Unterscheidungen in der Rede. Die Rede scheint notwendig immer ein Unterscheiden und Bewerten zu sein, weil sie ein Bestimmen ist (und jede Bestimmung auch eine Verneinung ist: Der Apfel ist hart und also nicht weich). Mein Denken ist diese Rede, also ist mein Denken Unterscheiden. Der Atem geht, das Unterscheiden geht. So scheint es mir in der Rede immer zuzugehen. Ich finde den Herzschlag und das Atmen in meinem Leib vor, ich finde die Rede vor, in mir und außerhalb von mir. Woher kommt diese unterscheidende Tätigkeit, ob sie nun in der Rede stattfindet oder vielleicht auch ohne sie? Woher kommt die Fähigkeit zum Fällen eines Urteils, in dem ein Subjekt von einem Prädikat getrennt wird?
Man kann zwei Formen des Urteils voneinander unterscheiden: das juristische und das philosophische. Die Richterin fällt das Urteil, dass der Angeklagte schuldig ist, und verurteilt ihn zu einer Gefängnisstrafe. Der Philosoph analysiert die Urteilstafel, die von möglichen Behauptungssätzen handelt. Auch von »behaupten« sprechen wir in zweierlei Hinsicht, reflexiv und nicht reflexiv: Ein Mensch kann sich in einem Kampf behaupten und jemand kann etwas behaupten, etwa, dass es morgen regnen wird. Das moralische und das richterliche Urteil, vor allem die Verurteilung, schließen Bewertungen ein, das schlicht behauptende Urteil nicht. Stellt die Richterin fest, dass der Angeklagte gestohlen hat, so stellt sie fest, dass er etwas getan hat, was er nicht tun sollte, was er nicht darf, was gegen das Gesetz verstößt. Wenn sich jemand in einem für ihn bedrohlichen Kampf behauptet, so ist das für ihn selbst gut, sofern Menschen nicht unterliegen wollen, während die Behauptung, dass der Apfel grün ist, zunächst nichts Gutes oder Schlechtes bedeutet. Doch dass für die explizit bewertende und nicht bewertende Rede im Deutschen dasselbe Wort verwendet wird: »Urteil«, könnte anzeigen, dass das Bewerten sehr tief in der Rede verwurzelt ist, ja dass die Rede immer auch Bewerten ist (wie schon Aristoteles nahelegte).
Gäbe es eine Zeit vor der Rede, wäre sie die Zeit vor dem Unterscheiden, vor Gut und Böse (das Paradies?) und dem bewertenden Denken (die Zeit des Anschauens?). Doch das ist Unsinn, denn »vor« und »nach« sind ja auch Produkte des Unterscheidens in der Rede. Ohne Rede und Denken, ohne dieses Unterscheiden gibt es für uns auch kein »vor« und kein »nach«. Denn auch die Erinnerung ist eine Art von Denken und Reden: So und nicht anders war das früher, vor dem, was jetzt ist. Das und das ist geschehen und jenes nicht. Ich bin zu heiß gebadet worden — damals. Wenn uns Bilder wieder in Erinnerung kommen ohne Rede, dann nicht als etwas von damals, scheint es mir. Denn wir erinnern jetzt. Jedes Mal, wenn ein Erinnerungsbild entsteht, geschieht dies in einer anderen Gegenwart. Es ist immer ein neues Bild. Oder gibt es ein Dokument der Erinnerung, das fix bleibt? Es gibt Papierfotos aus der Vergangenheit, die ich in die Hand nehmen kann. Ändert das etwas? Vielleicht. So ein Foto kann mich korrigieren. Ich dachte vielleicht, als ich mich erinnerte, dass es so und so war. Jetzt sehe ich auf dem Foto, dass es anders war. Gibt es in unserem Bewusstsein »Dokumente« oder vielleicht sogar so etwas wie »Filme«? »Dann lief der Film wieder in mir ab«, wird gesagt, »der Film, wie du mich damals geschlagen hast«. Ist das ein Denken? Vielleicht denken auch manche Tiere in solchen Bildfolgen und unterscheiden so zwischen dem Früheren und dem Späteren. Ich weiß es nicht. Ohne das Unterscheiden gibt es keine Zeit. Die Ursache und die Wirkung machen die Zeit, scheint mir. Doch das Unterscheiden von diesem Einzelnen und jenem Einzelnen macht die Ursache und die Wirkung. Ohne Einzelnes keine Ursache und keine Wirkung. Und ohne Ursache und Wirkung keine Zeit. Also ohne Einzelnes keine Zeit. Scheint mir. Ist es ein Geist, der so unterscheidet? Ein Geist im Unterschied zur Materie? Ist der Geist ein Einzelnes? Wo kommen diese Unterscheidungen zwischen dem Einzelnen und dem Nicht-Einzelnen, zwischen Geist und Materie nun wieder her? Etwa aus einem Geist? Drehe ich mich hier im Kreis? Das Unterscheiden scheint vor Geist und Materie, vor Ursache und Wirkung, vor der Zeit. Und vor dem Unterscheiden wäre das Nicht-Unterscheiden?
Was könnte das Unterscheiden ohne Rede sein? Unterscheidet nicht jede Zelle zwischen sich und ihrer Umwelt, wenn sie eine Membran ausbildet, durch die manches in ein »Inneres« hineinkann und anderes »draußen« bleiben muss? Unser Körper ist mit allem Möglichen verbunden, sagen die Wissenschaften von den Lebewesen, das in ihn eindringen kann und muss, damit er »sich erhalten« kann (wer erhält sich hier?): Luft beim Atmen, Wasser beim Trinken, Nahrung beim Essen. Auch Bakterien, die den Darm besiedeln und beim Verdauen »helfen«, gehören »zu uns«: unzählige Verbindungen, damit die sogenannte »Selbsterhaltung« gelingt (welches Selbst erhält sich hier?). Erhält sich jemand oder etwas oder dauert einfach nur ein Prozess an? Wenn ich krank werde, will ich wieder gesund werden, weiter durchhalten. Ist dieser Wille durchzuhalten eine Fortsetzung von sogenannten »Selbsterhaltungsmechanismen«, von denen ich nichts weiß, wie das Schließen einer Wunde, das Zusammenwachsen eines Knochens nach einem Bruch? Oder ist mein »Durchhaltewille« nichts anderes als ein bewusst gewordener Mechanismus, der überall in meinem Körper am Werk ist? Ist Leben nichts anderes als einerseits dieses Unterscheiden zwischen dem, was hineindarf, und dem, was draußen bleiben muss, und dann andererseits noch diese Anstrengung, die unterscheidende Tätigkeit und all das Weitere, was noch so in meiner Membran, in meinem Körper stattfindet, weiter durchzuhalten (wie Samuel Beckett vermutet zu haben scheint)?
Ich niese den Staub aus der Nase, ich huste die Gräte aus dem Hals, ich scheide Urin und Kot aus. Damit es weitergeht, damit die Erhaltung funktioniert, damit man durchhalten kann, wird anderes als fremd identifiziert und hinaustransportiert. Die Wissenschaft sagt vom Immunsystem: Es »wehrt ab«. Das Nervensystem lässt Reize herein. Ist der Körper also schon vor der Rede ein Unterscheidungs- und Bewertungssystem, weil er eine Durchhaltemaschine ist, die alles aus sich entfernt, was das Durchhalten behindern könnte? Oder ist der Körper nur von der Biologie so beschrieben worden? Verstehen wir ihn vielleicht grundsätzlich falsch? Woher die Schmerzen, wenn es nicht mehr weitergeht? Schon wenn eine alte Gewohnheit durchbrochen wird, tritt Unwohlsein auf. Warum dieses Weitermachen und der Widerstand gegen das Aufhören? Sind unsere Gesellschaften der Redenden ebenfalls solche Unterscheidungssysteme wie unsere Körper, eine Art Fortsetzung oder Spiegelung biologischer Mechanismen?
Zurück zur Erinnerung. Vielleicht funktioniert das Gedächtnis vor der erinnernden Rede so: Ich erlebe in späteren Jahren etwas, was ich benennen kann, und habe den Eindruck, dass ich es nicht zum ersten, sondern wiederholten Male erlebe. Ich höre beispielsweise das Geräusch einer Herzuhr, wie sie Neugeborenen zur Beruhigung ins Bettchen gelegt wird, auf der Geräusche vom Herzschlag und Blutfluss gespeichert und abzuhören sind, und denke: »Das habe ich doch schon einmal gehört, dieses Klopfen und Rauschen!« (Ich behaupte nicht, dass es mir so ergangen wäre!), so wie ich in ein Gebäck, das mir als Madeleine gereicht wird, beiße, es schmecke und denke: »Den Geschmack kenn ich doch!« Vielleicht ist es mir dann auch möglich, mich an die Situation zu erinnern, in der ich zuerst die Erfahrung gemacht habe, die sich heute als eine von mir in der Rede mit »Klopfen« und »Rauschen« benennbare wiederholt. Aber wie ist diese Erfahrung »in mir« »gespeichert« (wenn sie denn überhaupt gespeichert ist und nicht bei Bedarf neu erzeugt wird)?
Die benennbare Erfahrung kann nicht genau dieselbe Erfahrung sein wie die, die ich in der Rede »die ursprüngliche« nennen könnte und von der ein amerikanischer Philosoph (Wilfrid Sellars) einmal als »rohes Gefühl« der Kleinkinder gesprochen hat, wie von einem noch ungeschliffenen Rohdiamanten. Denn die Benennung muss sich auf die Art, wie etwas erfahren wird, auswirken (ob gestaltend und verfeinernd, wie bei einem Diamanten, der in eine bestimmte Form geschliffen wird, soll hier offenbleiben, denn es könnte ja auch verstellend und vergröbernd sein, was die Benennungen mit dem unbenannt Gegebenen anstellen). Und auch die Situation, in der ich etwas erfahre und mit einer Erinnerung vergleiche, ist eine andere als die, in der ich nur erfahre und nicht erinnere. Aber kann ich wirklich nur erfahren, ohne zu benennen, zu identifizieren, mich auf das, was ich erfahre, als nicht unter eine bestimmte Klasse von Gegenständen fallend beziehen? Manche scheinen danach zu streben oder darauf zu warten, dass sich eine solche Erfahrung einstellt, in der nicht benannt wird (man könnte sie »die Mystiker« nennen). Zweifellos muss es eine andere Erfahrung sein, einem Herzschlag und Blutstrom als Fötus in einer Fruchtblase zu lauschen, bevor man noch irgendeine Sprache beherrscht (wenn das denn eine Erfahrung ist und wenn »wir« das eine Erfahrung nennen wollen), als das Geräusch einer Herzuhr als Erwachsener zu hören, wenn man schon lange spricht, die als solche benannte Herzuhr dem eigenen Kind ins Bettchen legt und sich dabei erinnert, dass man dieses Klopfen und Rauschen schon einmal gehört hat.
Die, die schon älter waren als ich zu der Zeit, als ich noch nicht sprechen konnte, können vielleicht darüber Auskunft geben, wie ich ihnen damals erschien, so wie ich jetzt darüber reden kann, wie ganz junge Menschen, die noch nicht sprechen, mir erscheinen: Sie zappeln, brabbeln, trinken, scheiden aus. Es gibt ja Fotos: Da liegt jemand in Windeln auf einem Sessel, krabbelt über den Boden, grinst aus dem Kinderwagen hervor. »Das bist du!«, sagen die anderen, während sie mir die Papierbilder zeigen. »Aha!«, denke ich.
Es scheint keine Erfahrung vom Anfang des Bewusstseins geben zu können. Denn wie sollte man sich diesen Anfang vergegenwärtigen? Man müsste ihn erinnern. Doch wenn man ihn erinnern könnte, dann hätte man als ein Bewusstsein, das diesen Anfang erlebt, ja schon existieren müssen. Dann wäre es also gar nicht der Anfang des Bewusstseins gewesen. Es scheint auch kein Ende des Bewusstseins geben zu können. Denn wenn ich das Ende erleben könnte, wäre es nicht das Ende, sondern mein Bewusstsein würde über es hinaus bestehen, wenn vielleicht auch nur für einen Moment. Unsere ersten Erinnerungen können nicht den Anfang unseres Bewusstseins betreffen, unsere letzten Erinnerungen nicht sein Ende. Was mir in der Zeit erscheint, scheint immer nach dem Anfang des Bewusstseins zu liegen und vor seinem Ende. Oder das Bewusstsein scheint selbst nicht in der Zeit. (Eine sehr alte Einsicht.)
Meine erste Erinnerung: Ich grabe im Garten ein Loch (der Garten der Großeltern). Unter dem Küchenfenster, aus dem sie (die Großmutter) von Zeit zu Zeit herausschaut. Ich grub das Loch vor dem Erdbeerbeet, das sie sehen konnte, wenn sie in der Küche abwusch im Spülstein unter dem Fenster. Das Loch sollte so tief werden, dass ich ganz in ihm verschwinden konnte, mein Kopf nicht mehr zu sehen ist. Wollte ich zurück in eine Mutterhöhle? Wollte ich mich vorzeitig beerdigen? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere den Stolz, als das Loch tatsächlich immer tiefer wurde, sodass ich erst kaum noch, dann gar nicht mehr hinausschauen konnte, die Schwere der Schaufel, die sich windenden orangefarbenen Regenwürmer, die immer kühlere und feuchtere Erde, je tiefer ich grub, den Geruch der Erde. Ich erinnere mich nicht, dass ich damals schon etwas sagte. Der Kopf der Großmutter ist mir noch im Gedächtnis, wie sie freundlich herausschaut aus ihrer Küche, mir zunickt. Hat sie mir ein Glas Milch gereicht?
Die nächste Erinnerung ist eine mit Sprache: Nachdem er (mein Vater, oder war es mein Bruder?) mich zum Friseur geschleppt, der mein Haar mit einer Maschine viel zu kurz auf Stoppellänge geschnitten hatte, stehe ich am Schönen Brunnen in der Hildesheimer Straße und rede, rede aufgeregt, denn ich bin wütend, weil die Haare einfach viel zu kurz sind, nur noch Stoppeln! Ich wollte die Haare doch aber überhaupt nicht geschnitten haben! Ich hatte weinen müssen auf dem Friseurstuhl, der mit Extrakissen erhöht worden war, damit der Friseur sich nicht so weit herunterbücken musste zu meinem Kopf, um mein Haar zu schneiden. Da ging ich noch nicht zur Schule. Er, in einem hellen Anzug (es muss mein Vater gewesen sein, oder montiert mir hier irgendetwas sein Bild in die Erinnerung?), raucht eine Zigarette am Brunnen und lächelt. Ich rede auf ihn ein, ich protestiere in kurzen Hosen. Es muss im Sommer gewesen sein. Natürlich musste das Reden da schon lange vorher bei mir begonnen, sich in mir festgesetzt haben, denn ich erinnere, dass ich lange rede, Sätze, viele Sätze. Er schweigt, raucht, lächelt. Doch seit diesem frühen Nachmittag am Brunnen mit ihm, so erinnere ich mich, rede ich, und seitdem habe ich immer geredet, entweder zu anderen oder zu mir selbst.
Ich weiß aber aus der Beobachtung von anderen auch, dass einige verstummen, bevor sie wieder verschwinden; sie hören auf: erst zu reden und dann zu essen. Das leuchtet mir inzwischen ein. Wie soll man sonst den Zwängen (Engen) entkommen, in die man geraten ist? Der Weg hinauf und der Weg hinab sind derselbe: erst krabbeln, dann wacklig herumtorkeln, danach reden, reden, reden, sicheren Gangs. Dann wird der Gang wieder unsicher, einige rollen auf Rädern ein Weilchen durch die Welt wie am Anfang, weil die Beine sie nicht mehr tragen, die sie ehemals noch nicht trugen, und dann verstummen sie wieder, schreien und stöhnen vielleicht noch, wie sie als Kleinkinder geschrien und gestöhnt haben, und verschwinden dann.
Doch solange man redet, muss man so und so sprechen, nicht anders! Die Sprache ist das Regelsystem der Gemeinschaft. Um unter den anderen einen Platz zu finden, müssen wir lernen, uns nach den Regeln der Sprache zu richten (und natürlich noch nach tausend anderen Regeln, die mit denen der Sprache verbunden sind). Ich kann nicht über die Sprache und ihre Regeln verfügen, habe da keine Macht. Ich kann innerhalb des Regelsystems ein wenig reagieren. Es gibt Spielräume, gewiss, aber keine wirkliche Freiheit. Man kann es so oder so sagen, aber Autonomie (was für ein Wort! — wo kommt das nun wieder her?) über die Regeln, die haben wir nicht.
Bevor wir sprechen, während wir reden und auch zu der Zeit, zu der wir vielleicht wieder aufgehört haben, etwas zu sagen (vor dem Verschwinden), unterliegen wir noch anderen Zwängen als denen der Gemeinschaft der Redenden. Denn wir brauchen Wasser, Nahrung, Wärme. Schmerzen können sich bemerkbar machen, die wir zu vermeiden versuchen, indem wir nach Hilfe schreien. Oder wir geraten in Lustzustände, die wir verlängern wollen und deren Ende uns traurig macht. Auch das können wir nicht wählen, so wenig wie die Regeln der Sprache. Wir verfügen nicht über die Art und Weise, wie unser Körper funktioniert. Zwar gibt es auch hier Spielräume. Man kann sich Muskeln antrainieren und Hormone spritzen. Aber man braucht Muskeln, um sich zu bewegen. Und diese Muskeln brauchen Sauerstoff (sagt die Wissenschaft), Wasser, Nahrung. Ich gehe ein paar Stunden im Sommer durch die Stadt, und dann trinke ich, ohne weiter zu überlegen, aus einem Brunnen. Ich helfe Freunden beim Umzug, indem ich Bücherkisten Treppen hinaufschleppe, und abends verschlinge ich, ohne nachzudenken, das Doppelte von dem, was ich gewöhnlich um diese Zeit esse. So »funktioniere« »ich« oder »mein« Körper. Diese Zwecke werden verfolgt, ohne sich für sie entscheiden zu müssen (wie geht das, das »Sich-Entscheiden«?).
Eine lange Zeit unseres Lebens sind wir von irgendwelchen Formen fasziniert, werden von ihnen angezogen, Formen, die uns zu irgendeinem Handeln, beispielsweise zu einer geschlechtlichen Tätigkeit, veranlassen. Menschen sind getriebene Wesen, anders als die Steine, die ruhig daliegen. Durst, Hunger, geschlechtliche Sensationen feuern uns an, nach etwas Trinkbarem zu suchen, nach etwas zu essen, nach Betätigungsmöglichkeiten für die Sexualorgane. Wo ist da die Freiheit? In der Reflexion, wird gesagt. Man kann zurücktreten, wird gesagt, das Trinken, das Essen, den Sex unterlassen. Was ist diese Reflexion? Was ist dieses Reden mit mir selbst? Wer ist es, der zurücktritt von den Zwecken des Körpers, von den Zwecken, die mir später eingeredet werden? Wir sind »höhere« Wesen, wird gesagt, weil wir uns selbst Regeln geben können (dass ich nicht lache!).
Zuerst sind wir also Wesen mit einem bestimmten Körper, »etwas zum Leben«, wie gesagt worden ist (von Beckett). Oder sollte ich sagen: Wir sind in einen lebendigen Körper geraten? Aber wer könnte es sein, der da in den Körper gerät? Sollen wir ein Individuum, ein Selbst annehmen, das »vor« dem Körper, »vor« den sozialen Verhältnissen existierte? Ich wüsste nicht, wie eine solche Annahme gestützt werden könnte. Denn alles Reden von »vor« und »nach« und von »existieren« und »nicht existieren« setzt ja schon irgendeine Sprache mit ihren Unterscheidungen voraus. Und die Sprache haben wir nur in dieser Gemeinschaft der Redenden mit den anderen, in die wir nur eintreten können, weil wir einen Körper haben wie die anderen auch, einen anderen Körper zwar, aber doch einen ähnlichen. Was wäre das also für ein Einzelwesen, das »noch« keinen Körper hat und noch nicht irgendetwas oder irgendjemand in der Sprache einer Gemeinschaft identifiziert? Es scheint unmöglich, eine solche Annahme zu rechtfertigen.
Wir sind Wesen, die nach bestimmten Regeln funktionieren müssen, Regeln, an die wir uns gewöhnen und nach denen wir durchzuhalten haben, jedenfalls so lange, wie uns in der Rede (oder ist es »woanders«?) nicht die Möglichkeit erscheint, all das zu beenden. Es scheint die »Freiheit« geben zu können, nicht mehr den Zwecken des Körpers zu folgen, zum Beispiel nicht mehr zu essen oder auf andere Art und Weise die Funktionsweisen des Körpers zu unterbrechen, abzubrechen, nicht mehr durchzuhalten. (Bisher erschien mir das immer voreilig, jetzt zu versuchen, mit dem Durchhalten aufzuhören. Aber vielleicht ändert sich das.) Doch zunächst werden wir nach einer mehr oder weniger gelingenden Gewöhnung an unseren Körper und seine Grenzen und Funktionsweisen zu sprechenden Wesen unter den anderen Sprechenden. Die Rede setzt sich in uns fest, wie ein Pilz, der sich an einem Baum festsetzt (»language, it’s a virus!«). Und dann müssen wir uns auch an die Regeln des Sprechens gewöhnen. Denn sie verbinden uns mit den anderen, sodass wir uns mit den Regeln des Sprechens auch gleich an diese anderen Sprechenden gewöhnen. Außer als Körper sind die anderen mit uns nur als Sprechende verbunden. (Wie schön ist es, sich sprachlos mit jemand anderem zu verbinden!) Mit der Sprache versuchen die anderen unter anderem, die Impulse zu regulieren, die in unserem Körper aufsteigen. Wir dürfen nicht immer, so signalisieren sie uns, schreien, essen, uns entleeren, gewalttätig auf andere losgehen, Sex haben. Das sind die Bewertungen, für die wir uns nicht entscheiden, sondern an die wir uns ebenfalls gewöhnen müssen, wenn wir uns an die Rede gewöhnen. Wir werden abgerichtet (ein hartes Wort). Auch wenn die anderen uns mögen, uns als Vater und Mutter lieben, sie richten uns ab, mit ihrer Liebe und ihren Ermahnungen. Denn auch sie sind ja vom Pilz der Rede befallen, müssen ihn weitergeben.
Manchmal, später, können wir die Rede als eine Art Musik nehmen, als schönes Muster, können vergessen, was sie mit uns macht, so wie wir auch den Pilz unter das Mikroskop legen und schauen können, wie er in tausend Farben schillert. Was immer uns auch widerfährt in der Welt der tausend Zwecke, kann auch als ein selbstständiges Muster erfasst werden. Dann scheint die Welt anzuhalten und sich uns wie ein Bild, eine Melodie zu zeigen. Vielleicht wird die kindliche Freude an Regeln, die Nachahmung der Muster der Erwachsenen aus dieser Haltung geboren: Sie bemerken nicht, dass sie abgerichtet werden, sondern sehen nur die Muster, genießen ihre Entwicklung, so wie man den Vogelgesang genießen kann. Doch das sind wohl nur Anfänge und Unterbrechungen, die wie ein Wunder den Lauf auf den Schienen der Zwecksetzungen kurz anhalten können, so scheint es mir.
Wenn wir wieder verschwinden, verlassen wir häufig zuerst die Gemeinschaft mit den anderen (falls wir Zeit dazu haben, aufzuhören zu sprechen, und nicht durch einen Unfall oder eine andere Plötzlichkeit unser Körper zerstört wird). Danach hören die Funktionszusammenhänge unseres Leibes auf: die Verdauung, der Herzschlag, die Atmung, das Sehen, das klare Denken, erst ganz am Schluss das Gehör (so sagt man). Wir können nur begrenzt durchhalten in unserer Gemeinschaft und in unserem Leib. Doch ist da jemand, der durchhält? Oder sollte man besser (nach welchen Kriterien von »besser« und »schlechter«?) sagen: Es gibt bei den Lebewesen nur diese Bewegung des Durchhaltens, diese Anstrengung, die in den Komplexen der sozialen Gewohnheiten und der biologischen Mechanismen auftaucht, die eine Art Anstrengung ist, die immer größer wird, je länger es geht? Sollen wir all das Leben nennen: dieses Durchhalten für eine Weile nach den Regeln unseres Leibes und denen der Gemeinschaft der Sprechenden, diese Anstrengungen, einen organisch-sozialen Regelungszusammenhang aufrechtzuerhalten, in den irgendetwas (wer?) hineingeraten ist? Weil unser Leib auf bestimmte Weise strukturiert ist und bereits zu unterscheiden scheint und die Sprache, die wir erlernen, uns dieses und jenes zu unterscheiden und bewerten nahelegt, hat dieses Leben, das wir anscheinend durchhalten müssen (jedenfalls so lange, bis uns die »Freiheit« aufgeht, die Zwecke unseres Körpers nicht mehr zu erfüllen), eine bestimmte Form. Wir existieren in einer Lebensform (wie Wittgenstein es genannt hat). Ist das die Enge, diese Lebensform, dieses Zwangsgemisch aus sozialen Ansprüchen und biologischen Notwendigkeiten? Und weil wir uns an all das gewöhnen, fällt es uns schwer, das Leben aufzugeben, abzubrechen. Denn immer, wenn man abbricht, kommt der Schmerz, der körperliche oder sogenannte seelische. Gewohnheiten aufzugeben ist mühsam, weil man immer Schmerzen überwinden muss dafür — Entzug, scheint mir. Haben wir deshalb Todesangst?
Doch die Aufmerksamkeit, die gegeben sein muss, damit Gewohnheiten angenommen werden, die mal auf das, mal auf etwas anderes gerichtet ist und der es manchmal gelingt, sich abzuwenden von Zwängen, gehört auch sie zu diesem Leben? Auf welche Weise könnte sie Teil des Lebens sein? Sie scheint selbst keine Gewohnheit, die nur in einer bestimmten Lebensform existiert, sondern sie scheint beinahe allem Lebendigen eigen, schon beim Kleinkind da zu sein, das noch nichts sagt, aber versucht, etwas mit den Augen zu fixieren, oder den Kopf in die Richtung eines Geräusches dreht, das es hört.
Aufmerksamkeit
Menschen erscheinen, gewöhnen sich an einen Körper, den sie nicht gewählt haben — oder es entstehen Gewohnheiten in diesem Körper, indem es der Aufmerksamkeit gelingt, ihn von den »äußeren Körpern« unterscheiden zu lernen, meist über Lust- und Schmerzerfahrungen. Ich renne zum heißen Ofen, sie warnt mich: »Fass das nicht an!« Doch ich greife auf die Platte. Da hatte ich das Greifen schon lange gelernt; hatte vorher, wie ich es von anderen weiß, nach ihren Fingern, nach ihrer Brust, nach der Flasche gegriffen … den eigenen Finger in den eigenen Mund gesteckt. Saugende Reflexivität. War das der Anfang von mir? Entsteht auf diese Weise mein »eigener Leib« mit Lüsten und Schmerzen (nicht der Körper mit einem bestimmten Gewicht und einer bestimmten Anatomie)? Wer ist hier eigentlich der Besitzer, wenn ich von »meinem« Leib spreche im Unterschied zu den »äußeren« Körpern?
Dann lernen Menschen, weil sie wach und in ihrem Verhalten flexibel sind, zu sprechen. Es werden ihnen Ideen, Behauptungen, Erzählungen, Zielvorstellungen in die Köpfe gesetzt. Eine Sprache zu lernen bedeutet, in ein bestimmtes Leben zu geraten, liebend oder auch nicht liebend gezwungen zu werden, es auf eine bestimmte Weise zu führen, denn mit der Sprache geraten wir in eine Welt, in der auf bestimmte Weise gehandelt werden muss. Während dieses Abgerichtetwerdens lernen wir auch, dass »man« etwas erreichen kann, sogar muss. Das Erreichen liegt immer in der Zukunft, die besser als die Gegenwart sein soll, sein muss, auf die wir unsere Aufmerksamkeit zu richten haben. Das zu Erlernende muss ich richtig beherrschen, dann erreiche ich etwas in der Zukunft.
Müssen: »Musst du aufs Klo?«, fragt sie und: »groß oder klein?« »Du musst die schöne Hand geben«, sagt sie, »die rechte!« »Du musst nicht immer in der Nase bohren, nicht vor den Leuten.« »Du musst dich mehr anstrengen, sonst wird das nichts!« »Du musst noch deine Vokabeln lernen, morgen ist doch die Klausur!« »Du musst deine Tasche schon am Abend packen, dann hast du morgens nicht diese Eile!« »Du musst ein Konzept entwickeln bei einer langen Arbeit, sonst verlierst du den Überblick!« »Du musst monatlich etwas zurücklegen, sonst bildet sich kein Kapital!« »Du musst dich vorbereiten auf die Rente, sonst wird die Pensionierung ein Schock!« »Du musst eine Patientenverfügung schreiben, sonst weiß man nie, was sie mit einem machen im Krankenhaus am Ende!« Immer muss die Aufmerksamkeit »nach vorne« gerichtet sein, damit wir »vorsorgen« können.
Hatte ich eine Vorstellung von »der Zukunft«, bevor ich auf diese Lernprogramme gebracht wurde und das Müssen verstand? »Man« muss lernen, Gefahren (wie heiße Öfen) zu vermeiden, lernen, es so wie die anderen zu machen (die rechte Hand ausstrecken bei der Begrüßung). »Schau, wie der große Junge da drüben es macht, so musst du es auch machen, treten und den Lenker gerade halten«, sagt er. Wer nicht lernt, überlebt vermeintlicherweise nicht, »bringt« es zu nichts, kann nicht durchhalten. Durch das Lernen bekommt die Aufmerksamkeit eine zeitliche Ausrichtung auf die Zukunft: Projekte. Denn was man noch lernen muss, also jetzt noch nicht kann, liegt immer in der Zukunft, und man lernt es für das, was man in der Zukunft können oder gar sein will. Erst will man die Milch, den Daumen im eigenen Mund, den Brei, und dann will man jemand sein: ICH. »Lifelong learning, a growing mind«, höre ich im Diversity-Training. »Diversität macht alle Gruppen effizienter«, sagt die Psychologin. Wenn man gelernt hat, was man lernen soll, ist man in den Augen der Gemeinschaft besser geworden, weil man es gelernt hat. So entstehen die Projekte für mein Leben. Wird so mein ganzes Leben zu einem Projekt, in dem die Aufmerksamkeit auf die Zukunft ausgerichtet wird: dieses Spielzeug, diesen Sex, diesen Beruf? Meine Projekte bestimmen, was ich muss und will. Wird so die Aufmerksamkeit gefangen in der Enge der Zeit?