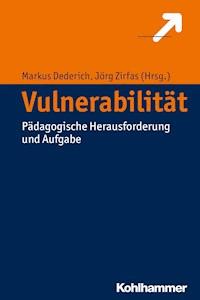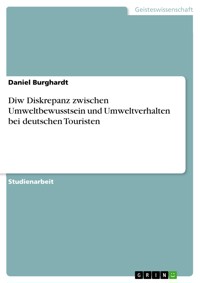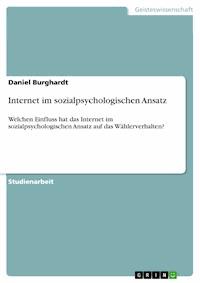Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 56/57 E-Book
Daniel Burghardt
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die »Zeitschrift für kritische Theorie« ist ein Diskussionsforum für die materiale Anwendung kritischer Theorie auf aktuelle Gegenstände und bietet einen Rahmen für Gespräche zwischen den verschiedenen methodologischen Auffassungen heutiger Formen kritischer Theorie. Sie dient als Forum, das einzelne theoretische Anstrengungen thematisch bündelt und kontinuierlich präsentiert. www.zkt.zuklampen.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Zeitschrift für kritische Theorie
Heft 56 – 57/2023
herausgegeben von Sven Kramer und Dirk Stederoth in Verbindung mit Gerhard Schweppenhäuser
zu Klampen
Zeitschrift für kritische Theorie, 29. Jahrgang (2023), Heft 56 – 57
Herausgeber: Sven Kramer und Dirk Stederoth in Verbindung mit Gerhard Schweppenhäuser
Geschäftsführender Herausgeber: Sven Kramer, Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Geschichtswissenschaft und Literarische Kulturen
Redaktion: Roger Behrens (Hamburg), Thomas Friedrich (Mannheim), Sven Kramer (Lüneburg), Susanne Martin (Gießen), Martin Niederauer (Frankfurt/M.), Gerhard Schweppenhäuser (Würzburg, Kassel), Dirk Stederoth (Kassel)
Korrespondierende Mitarbeiter: Maxi Berger (Wismar), Rodrigo Duarte (Belo Horizonte), Jörg Gleiter (Berlin), Christoph Görg (Kassel), Johan Frederik Hartle (Wien), Frank Hermenau (Kassel), Fredric Jameson (Durham, NC), Per Jepsen (Kopenhagen), Douglas Kellner (Los Angeles, CA), Claudia Rademacher (Bielefeld), Gunzelin Schmid Noerr (Frankfurt/M.), Jeremy Shapiro (New York, NY), Christian Voller (Lüneburg)
Redaktionsbüro: Alle Zusendungen redaktioneller Art bitte an das Redaktionsbüro:
Zeitschrift für kritische Theorie
Leuphana Universität Lüneburg
z. Hd. Prof. Dr. Sven Kramer
Universitätsallee 1, Geb. 5
D-21335 Lüneburg
E-Mail: [email protected]
www.zkt.zuklampen.de
Erscheinungsweise: Die Zeitschrift für kritische Theorie erscheint einmal jährlich als Doppelheft. Preis des Doppelheftes: 32,– Euro [D]; Jahresabo Inland: 28,– Euro [D]; Bezugspreis Ausland bitte erfragen. Berechnung jährlich bei Auslieferung des Heftes. Das Abonnement verlängert sich automatisch, wenn die Kündigung nicht bis zum 15.11. des jeweiligen Jahres erfolgt. Fragen zum Abonnement bitte an folgende Adresse:
Germinal GmbH
Verlags- und Medienhandlung
Siemensstraße 16
D-35463 Fernwald
Tel.: 0641/41700
Fax: 0641/943251
E-Mail: [email protected]
Die Ausgaben der ZkT sind auch elektronisch (im Abo oder kapitelweise) erhältlich, beziehbar über http://www.meiner-elibrary.de/zkt
Redaktionsbüro: Lukas Betzler
Umschlagentwurf: Johannes Nawrath
Layout und Satz: Frank Hermenau, Kassel
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ›http://dnb.d-nb.de‹ abrufbar.
Aufnahme nach 1995, H. 1; ISSN 0945-7313; ISBN 978-3-98737-008-3; ISSN (online) 2702-7864; ISBN (E-Book-PDF) 978-3-98737-396-1, ISBN (E-Book-Epub) 978-3-98737-395-4
Die Zeitschriftfür kritische Theorie erscheint mit Unterstützung der Leuphana Universität Lüneburg und der Universität Kassel.
Inhalt
Vorbemerkung der Redaktion
ABHANDLUNGEN
Christian TheinMenkes genealogische Formkritik des Rechts im Spiegel von Marx
Till SeidemannDurchbrechung des Idealismus. Grundlinien der Husserl-Rezeption Theodor W. Adornos
Oliver DeckerAutoritäre Dynamiken und binäre Ordnungen
SCHWERPUNKT I
Lukas Betzler und Christian VollerDie Lehre in der Kritischen Theorie. Einleitung in den Schwerpunkt
Liza MattutatOhne Lehrsatz und Methode. Kritische Theorie als geistige Praxis
Daniel BurghardtPädagogik des »Madigmachens«. Thesen zur Lehre in der Kritischen Theorie
Ricarda BiemüllerDer Beitrag des Instituts für Sozialforschung zur Demokratisierung der Universität nach 1945
Alex DemirovićDie Lust an der Theorie. Einübungen in dialektische Kritik
SCHWERPUNKT II
Kritische Theorie tut weh, wenn sie den Nerv trifft Christoph Türcke im Gespräch
Sebastian TränkleÄsthetik der Überwältigung. Zur Kunst in der Erregten Gesellschaft
DEBATTE
Karin StögnerKritische Theorie und feministisches Urteilen heute
Philip HoghFortschritt, materialistisch verstanden
EINLASSUNGEN
Karl Heinz HaagNotiz zu Horkheimer und Adorno
Günther MenschingErläuterungen zu Haags Argumentation
Gunzelin Schmid NoerrVorbemerkung zu Hermann Schweppenhäuser: »Die Frankfurter Schule. Max Horkheimer zum 75. Geburtstag«
Hermann SchweppenhäuserDie Frankfurter Schule. Max Horkheimer zum 75. Geburtstag
BESPRECHUNGEN
Cyrill MikschFilm und kritische Theorie. Ein Literaturbericht
Kritische Theorie – Neue Bücher des Jahres 2022 in Auswahl
Autorinnen und Autoren
Vorbemerkung der Redaktion
Der Autoritarismus gewinnt an Gefolgschaft – im demokratischen Europa und andernorts. Das untermauern empirische Forschungen wie die Leipziger Autoritarismus-Studien, es ist aber auch abzulesen an den europaweiten Wahlergebnissen von Populisten, Rechten und Neofaschisten. Diese bauen auf affektive Mobilisierung in den digitalen Kanälen und arbeiten dort mit Fake News, Halbwahrheiten,1 Manipulationen und KI-gestützter Propaganda.2 Die Idee der Mündigkeit ist ihnen fremd. In dem demagogischen Nebel des Postfaktischen bleibt Aufklärung unvermeidlich auf der Strecke. Reflektierte Kritik an der Propaganda der ›westlichen Wertegemeinschaft‹, die für den Wirtschaftskrieg der USA mit dem Hegemonial-Rivalen China mobilisiert werden soll, und Kritik an der ideologischen Einschwörung auf das Nordatlantische Militärbündnis werden im dominanten Diskurs der Bundesrepublik mitunter, zu Unrecht, mit den Plebisziten der ›Wutbürger‹ vermengt. Die Affinität der Letzteren zum »autoritären Nationalradikalismus«3 verweist indessen auf den fragilen Zusammenhang von Demokratie und politischer Mündigkeit, der in der politischen wie ideologischen Desorientierung dieser ›Bewegungen‹ gänzlich zu vermissen ist. Das unabhängige und eigenständige Denken in jedem und jeder Einzelnen zu stärken, gehört unabdingbar zur politischen Praxis jener Gemeinwesen, die alle Einzelnen mit der Entscheidung über die weitere Entwicklung des Ganzen betrauen. Wo Demokratie mehr sein soll als eine formale, verlangt sie nach dem qualitativ-partizipativen Moment. Nicht zuletzt, um eine solche Demokratie mit aufzubauen, kehrten Max Horkheimer und Theodor W. Adorno nach der militärischen Niederlage des Faschismus 1949 nach Deutschland zurück. In den Universitäten erkannten sie einen Ort, um aufklärendes Denken anzuregen. Über die Ausbildung hinaus vermittelten sie Bildung und legten die Grundlagen für Selbstbildungsprozesse. Wo möglich, sollten Formen blinder Vergesellschaftung zurückgedrängt und ein bewussteres Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinwesen befördert werden. Wo stehen wir in Bezug auf diese Probleme heute?
Der erste SCHWERPUNKT dieses Doppelhefts beschäftigt sich, 50 Jahre nach Horkheimers Tod, mit Fragen der Bildung und der Lehre in der Kritischen Theorie. In ihm sind Aufsätze von Liza Mattutat, Daniel Burghardt, Ricarda Biemüller und Alex Demirović versammelt. Er wurde von den Gastherausgebern Lukas Betzler und Christian Voller kuratiert, die ihre Herangehensweise einleitend begründen.
Ein zweiter SCHWERPUNKT ist Christoph Türckes Denken gewidmet. Damit gratuliert die ZkT ihrem Gründungsredakteur zum 75. Geburtstag. Vor allem aber möchte die Redaktion auf Türckes Werk hinweisen, in dem er in den vergangenen Jahrzehnten konsequent die Weiterentwicklung der Kritischen Theorie betrieben hat. Dies einmal in einigen großen Linien in den Blick zu nehmen, ist die Funktion eines Interviews, das wir mit Christoph Türcke geführt haben. Während manche über die zweite oder dritte ›Generation‹ der Kritischen Theorie sprechen und Kritik dergestalt personalisieren, historisieren und entschärfen, geht es Türcke jederzeit um die Aktualität eingreifenden Denkens. Diesem Impuls ist auch die Redaktion der ZkT verpflichtet. – Sebastian Tränkle rekonstruiert die tragenden Gedanken aus Türckes Monografie Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation und misst die Reichweite von Türckes dialektisch bestimmtem Begriff der Sensation in Bezug auf die Ästhetik aus, indem er mit dessen Hilfe das Musiktheaterwerk Résurrection (Regie: Romeo Castellucci, Musik: Gustav Mahler) kritisch analysiert. Dabei diskutiert er insbesondere die dort praktizierte Ästhetik der Überwältigung. Im Anschluss schlägt er vor, im Begriff der Sensation eine qualitative Differenzierung vorzunehmen.
In den ABHANDLUNGEN widmet sich Christian Thein der Auseinandersetzung mit Marx’ ›sozialer Kritik des Rechts‹, die Christoph Menke in seinem Buch Kritik der Rechte vorgenommen hat. Thein rekonstruiert detailliert Menkes Gegenentwurf einer genealogischen Formkritik des Rechts, der dem Recht einen eigenen ontologischen Status zuweist, um diesen dann anschließend mit der Marx’schen Analyse des Zusammenhangs von Warenform und Rechtsform zu konfrontieren. – Till Seidemann zeichnet die Grundlinien der Husserl-Rezeption Adornos nach. Dabei zeige sich, so die These, dass Adorno im Rahmen der Auseinandersetzung mit Husserl das eigentliche Programm seiner Philosophie einzulösen versucht, die Überschreitung des Idealismus hin zu einem undogmatischen Materialismus. Seidemann füllt damit eine bemerkenswerte Lücke der Adorno-Forschung. – Oliver Decker geht in methodologischer und inhaltlicher Perspektive auf Barbara Umraths Kritik der Leipziger Autoritarismus-Studien ein, die 2022 im Doppelheft 54/55 der ZkT erschienen ist. Im Anschluss an diese Auseinandersetzung – und mit Rekurs auf ältere feministische Positionen – entwickelt Decker einen Ausblick auf eine kritische Theorie der Genderpolitik.
In der auch in diesem Heft fortgesetzten DEBATTE über die aktuelle Ausrichtung kritischer Theorie zeigt Karin Stögner am Beispiel der gewaltvollen Unterdrückung von Frauen in islamistischen Staaten, wie Frauenfeindlichkeit und Autoritarismus im Hass auf Differenz verbunden sind. Ausgehend davon plädiert sie unter Einbezug der Authoritarian Personality für eine intersektionale Ideologiekritik, die sowohl die Multidimensionalität gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse als auch die Besonderheiten der Geschlechterherrschaft in den Blick bekommt. Eine solche Ausrichtung aktueller kritischer Theorie bilde den Ausgangspunkt für emanzipatorische Urteile, in denen die Leiderfahrungen der Subjekte als zugleich konkrete und gesellschaftlich vermittelte Ausdruck finden. – Philip Hogh geht der Frage nach, wie sich der Begriff des Fortschritts in der Kritischen Theorie verankern lässt und entfaltet zwischen Adornos Mahnung, den Fortschrittsbegriff nicht konkretistisch zu korrumpieren, und Jaeggis ›Freistellung‹ des Fortschrittsbegriffs eine dezidiert materialistische Lösung, die sich auf eine gattungsimmanente minimale Teleologie einer Vermeidung physischen und gesellschaftlichen Leidens gründet und zugleich in gänzlichem Kontrast zur kapitalistischen Teleologie der Verwertung und Ausbeutung steht.
In den EINLASSUNGEN werden, rückblickend auf wichtige Stationen der kritischen Theorie in Frankfurt nach Adornos Tod, zwei Texte bedeutender Schüler von Horkheimer und Adorno erstmals (in deutscher Sprache) veröffentlicht. Der Aufsatz von Hermann Schweppenhäuser erschien 1970 in der italienischen Zeitschrift Settanta. In Abstimmung mit Pollock und Horkheimer skizzierte Schweppenhäuser dort das zentrale Motiv der kritischen Theorie: das begrifflich artikulierte »Leiden am Bestehenden« und den »Widerstand dagegen«. Er stellte dieses Motiv einem italienischen Publikum vor, dessen Rezeption der kritischen Theorie unter anderem durch die 1966 erschienene Übersetzung der Dialektik der Aufklärung geprägt war. »Rückblickend versichert er sich wichtiger Stationen der Entwicklung der Frankfurter Schule« – schreibt Gunzelin Schmid Noerr in seinem Kommentar, der den ideengeschichtlichen und wissenschaftspolitischen Zusammenhang erläutert, in dem der Text entstand – »um angesichts des Auseinanderdriftens ihrer Teile« an die kritische Kraft zu erinnern, welche in deren »Einheit« bestanden hatte. – Karl Heinz Haag kritisierte Mitte der 1970er Jahre an der Dialektik der Aufklärung, dass die Autoren zwar »die Selbstzerstörung« erkannt hätten, »der die Aufklärung als nominalistische verfällt«, aber die philosophischen und geschichtlichen »Ursachen« nicht »bezeichnen« konnten, »welche die Aufklärung in den Bannkreis des Nominalismus geraten ließ«. Gegen die nicht hinreichend hergeleitete Identifikation von Wissenschaft und herrschaftlicher Zurichtung der Natur machte er geltend, dass eine präzise Kritik der Naturbeherrschung in der Moderne nur durch die »Unterscheidung des Wahren und Falschen in Realismus und Nominalismus zu gewinnen« sei. – Günther Mensching gibt Haags knappen Andeutungen in seinem Kommentar das volle Relief, indem er die Frankfurter Debatten zwischen Horkheimer, Adorno und Haag vergegenwärtigt. Er macht deutlich, dass es Haag nicht um philosophiegeschichtlich-akademische Korrekturen ging; worauf er hinauswollte, war eine theoretisch stringente Begründung der Kritik an der Ausbeutung der Natur.
In den BESPRECHUNGEN diskutiert Cyrill Miksch neuere Forschungen zum Thema ›Film und kritische Theorie‹.
ABHANDLUNGEN
Christian Thein
Menkes genealogische Formkritik des Rechts im Spiegel von Marx
In einem 2013 veröffentlichten Beitrag zu dem zwei Jahre zuvor an der Humboldt-Universität veranstalteten Kongress unter dem Titel Re-Thinking Marx – Philosophie, Kritik, Praxis hat Christoph Menke an das Marx zugewiesene »Programm einer sozialen Kritik des Rechts« zum einen produktiv angeschlossen und zum anderen auf Möglichkeiten der Überwindung von bei Marx zu diagnostizierenden Defiziten hinsichtlich einer adäquaten Fassung der »politischen Logik des Rechts« hingewiesen.1 Die Figur, die der sozialen Kritik des Rechts nach Marx zugrunde liege, sei die ideologiekritische Kennzeichnung des modernen bürgerlichen Rechtsstaates als eines solchen, der »Verhältnisse gleicher Anerkennung« propagiere und in dessen Form zugleich »das Recht des Stärkeren in anderer Form« – das meint die Form der »sozialen Verhältnisse von Herrschaft« – fortlebt.2 Dieser Selbstwiderspruch des bürgerlichen Rechts müsse nach Menke nun als notwendiger Schein dadurch entlarvt werden, dass das moderne Recht gegen den »simplen Reduktionismus« materialistischer Theorien als die »Bedingung der Existenz der sozialen Herrschaft« in ihrem Zusammenhang mit der »politischen Logik des Rechts« begriffen wird.3 Diesen großangelegten Versuch einer Rechtskritik hat Menke sodann in der 2015 erstmalig publizierten und von einer breiten philosophischen, soziologischen und rechtswissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommenen Schrift Kritik der Rechte unternommen.4 Im Folgenden möchte ich die grundlegende Argumentation des Entwurfs im Ausgang von Marx rekonstruieren und mit Blick auf seine gesellschaftskritischen Intentionen diskutieren. Hierzu werde ich in einem ersten Teil den von Menke aufgespannten methodischen Bogen einer genealogischen Formkritik des modernen Rechts in vier systematisch angelegten Schritten rekonstruieren (1.). In einem zweiten Teil möchte ich die im Rahmen dieses Bogens vollzogenen Bezugnahmen auf Marx unter methodologischen, normativen und gegenstandsbezogenen Gesichtspunkten herausarbeiten, um den Horizont eines zugleich konstruktiven und kritischen Gesprächs zwischen der Kritik der Rechte und der Kritik der Politischen Ökonomie zu eröffnen (2.).
1. Darstellung durch Rekonstruktion – Menkes Formkritik des modernen Rechts
Entscheidend für ein übergreifendes Verständnis der Zielsetzung von Menkes Kritik der Rechte ist erstens die dort vorgeschlagene Verhältnisbestimmung von Inhalt und Form der bürgerlichen Rechte (1.1), zweitens Grund, Durchführungsweise und Gegenstand der kritischen Rekonstruktion des modernen Rechts (1.2), drittens die Differenzbestimmung von Recht und Nichtrecht in ihrem Verhältnis zur Gewalt (1.3) sowie viertens die Problematisierung der kontingenten Grundfigur des modernen Rechts in Gestalt der subjektiven Rechte im Modus einer ontologischen Genealogie als Formkritik (1.4).
1.1. Inhalt und Form der bürgerlichen Rechte
Hinsichtlich der Bestimmung von Inhalt und Form des modernen bürgerlichen Rechts greift Menke zunächst mit Rekurs auf konservative Theoretiker wie Leo Strauss oder Michel Villey auf eine historische These über eine revolutionäre Veränderung im Begriff des Rechts in der Moderne zurück. Während demzufolge traditionelle vormoderne Gesellschafts- und Herrschaftsordnungen als Ordnungen der Ungleichheit bestimmt werden können – die Rede von einer Ungleichheit bezieht sich hier insbesondere auf Fragen der Machtverteilung in den Feldern des Urteilens und Regierens –, seien moderne bürgerliche Gesellschaften im Ausgang von ihrem revolutionären historischen Ursprung, der durch die Deklaration ihrer Verfassungen markiert und manifestiert wird, durch die Idee der Gleichheit in einem rechtsförmig spezifizierten Sinne geprägt: »Dagegen setzen die bürgerlichen Revolutionen die Gleichheit, und Gleichheit heißt für sie: gleiche Rechte.«5 Diese historische Einschnitts- und Umbruchthese hat Menke mit Blick auf die grundlegende Semantik der Gleichheitsidee bereits in seiner Textsammlung zu Spiegelungen der Gleichheit unter kritischen Gesichtspunkten ausformuliert: »Fragen wir nach den Pflichten und Rechten, die wir einander gegenüber haben, so ist die erste Antwort der Moderne, dass es Pflichten und Rechte der Gleichheit sind: Gleichheit ist die vorrangige Idee der Moderne.«6 Ebenso fokussiert Menke dort die Gleichheitsidee der Moderne extensional und intensional dahingehend, dass es sich nicht um ein Konzept von Gleichheit im Sinne von Gleichverteilung (von allem) an alle handelt, sondern um die »gleichmäßige Berücksichtigung von allen«7 – jeder soll als Person gleich viel zählen, aber nicht gleich viel bekommen. Hierbei wird in der Moderne von einer starken Idee der Gleichbehandlung in formaler und inhaltlicher Hinsicht ausgegangen, sodass der Gesetzgeber formal nur solche Regeln zu beschließen hat, die in ihrer Anwendung alle im gleichen Maße berücksichtigen. Zugleich sind diese normativen Regeln inhaltlich so bestimmt, dass jede und jeder in dieser Regelanwendung gleich viel zählt und niemand ein Vorrecht genießt.
Diese moderne Gleichheitsidee bestimme in der Moderne sowohl das Recht als auch die Moral in normativer Hinsicht. Für die Seite des Rechts bedeutet dies, dass sich der Gleichheitsbegriff auf die »Gleichheit der Rechte« bezieht und diese somit zur spezifischen »Formbestimmung der Rechte« wird: »Die entscheidende Tat der bürgerlichen Revolutionen ist daher nicht die Entscheidung für die Gleichheit. Sondern es ist die Entscheidung, der Gleichheit die Form der Rechte zu geben.«8 Menke rückt im weiteren Verlauf genau diese spezifisch moderne Formbestimmung der Gleichheit in den Blickpunkt seiner Untersuchung: Wie verfährt das liberale bürgerliche Denken, wenn es die zunächst inhaltliche Idee der Gleichheit als wesentliche Formbestimmung der Rechte ausweist? Die ganze Konzentration gilt demnach der Frage, warum und wie dieser Inhalt – die Idee der Gleichheit mit Blick auf den normativen Status dieser Gleichheit der Rechte eines und einer jeden Einzelnen als Person – im modernen Recht eine bestimmte, historisch spezifische und somit kontingente, nicht-neutrale Form angenommen hat. Diese spezifisch moderne Form der Rechte ist die der subjektiven Rechte der Person. Die zu stellende kritische Frage lautet demzufolge, warum überhaupt im bürgerlichen Recht »der Status der Gleichheit sich als subjektive Rechte der Person darstellt.«9
Bereits in der Einleitung zur Kritik der Rechte wird das Problem formuliert, das sich hinter dieser besonderen Form der gleichen bürgerlichen Rechte verbirgt: »Sie verbinden Normativität und Faktizität.«10 Die gemeinte Normativität besteht darin, dass die Rechte in verbindlicher Weise allgemeine Regeln formulieren, die Gleichheit sichern und durch die eine gleichmäßige Berücksichtigung aller ermöglicht und verwirklicht wird. Für Menkes formkritische Analyse ist nun in Absetzung von liberalen Vorannahmen entscheidend, dass die bürgerlichen Rechte dies nur unter der aktiven Hervorbringung und Voraussetzung von faktischen Bedingungen tun, die zugleich einer politischen Reflexion entzogen werden: »Die Normativität der bürgerlichen Rechte besteht in der Hervorbringung vor- und außernormativer Faktizität. Die Form der bürgerlichen Rechte ist der Ausdruck eines Umbruchs in der Seinsweise der Normativität: eines ontologischen Umbruchs.«11
Diese Textstelle transportiert zwei Thesen, die auseinander folgen: Der erste Satz bringt das Spezifische der Normativität bürgerlicher Rechte zum Ausdruck, die sich nicht nur auf eine vor- oder außernormative Faktizität beziehen, sondern eine solche zugleich hervorbringen. Und aus diesem Grunde ist die Form dieser bürgerlichen Rechte, die wiederum historisch spezifischer Natur ist, dem zweiten Satz zufolge der epochale Ausdruck eines Umbruchs in der Seinsweise der Normativität. Dieser Umbruch ist mit Blick auf die Wesensbestimmung dieser Epoche und der mit ihr verbundenen Epochenschwelle als ein ontologischer zu verstehen, da er eine klare Abgrenzung zu vormodernen Gesellschaftsordnungen markiert. Diese historische These von einem »ontologischen Umbruch in der Seinsweise der Normativität« der bürgerlichen Rechte in modernen Gesellschaften ist es sodann auch, die eine spezifische Methode zur Untersuchung und Aufdeckung dieses Umbruchs notwendig mache. Demzufolge gilt es, die der bürgerlichen Form der Rechte zugrundeliegende »radikale ontologische Neubestimmung der Normativität«12 nicht nur zu zeigen und zu erkennen, sondern auch zu verstehen, zu begreifen und zu erklären.13 Und ein solches Verstehen, Begreifen und Erklären der revolutionären und radikalen Veränderungen und Umbrüche im Begriff der rechtlichen Normativität sowie von »Normativität überhaupt«14 könne ausschließlich durch eine Einheit von Analyse und Kritik geleistet werden, durch deren Vollzug »die – ontologische, nicht historische – Genealogie der bürgerlichen Rechte«15 erkannt werde. Nur eine solche ontologische Genealogie ermögliche methodisch, was eine jede ethische oder moralische Kritik, die die bürgerlichen Rechte entweder an ihren eigenen oder an externen normativen Maßstäben misst, nicht zu leisten vermag. Sie konfrontiert die bürgerliche Rechtsform immanent mit ihrer Genesis und ihrem Grund statt mit ihren Absichten oder Zwecken: »Die wahre Kritik, die genealogisch verfährt, entwickelt aus dem Grund des Bestehenden einen radikalen Einspruch gegen das Bestehende.«16
1.2 Grund, Durchführung und Gegenstand der Kritik des modernen Rechts
Was Menke unter einer solchen Verfahrensweise einer ontologischen Genealogie versteht, die das von ihm verfolgte Programm einer »wahren – und nicht vulgären – philosophischen Kritik« durchführt, erschließt sich im Rahmen des inhaltlichen Argumentationsverlaufs der ersten drei Hauptkapitel von Kritik der Rechte. Hierbei ist auffällig, dass dem formulierten Anspruch zufolge nur diese genealogische Methode17 die Struktur des modernen Rechts verstehbar machen und dadurch in eine Kritik überführen kann. Grund ist der Vollzug eines immanenten Erschließungsaktes der Grundoperationen des Rechts, durch den zugleich die Verkehrungsfiguren des Rechts, die aus immanenten Gegensätzen, Widersprüchen, Paradoxien und Aporien hervorgehen, offengelegt werden sollen. Im Durchgang durch Menkes Argumentation scheint es auf der Darstellungsebene oftmals gar so zu sein, dass sich das methodische Vorgehen des kritischen Rechtsphilosophen über die detaillierte und minutiös anmutende Rekonstruktion der ontologischen Struktur des bürgerlichen Rechts im Darstellungsvollzug selbst entfaltet. So ist es dem Anspruch zufolge die Selbstreflexion des Rechts als dessen Grundoperation, die durch das genealogische Verfahren offengelegt wird: »Die moderne Form der Rechte ist die Selbstreflexion des Rechts – das Recht in der Form seiner Selbstreflexion.«18
Im Modus einer ontologischen Genealogie die Kritik der Rechte entfalten bedeutet entsprechend, dass der kritische Theoretiker die Selbstreflexion des Rechts immanent nachvollzieht und deren Bruchstellen und Paradoxien aufzeigt. Die Rede von einem »modernen Recht« gründet nach dieser genealogischen Darstellung der Gegenstandsentfaltung zwar in einer historisch anzusetzenden Umbruchsthese, aber der Begriff selbst wird zu einem strukturellen Begriff, der mit Blick auf diese aufs Wesentliche zielende Epochenbestimmung nur ontologisch gefasst werden könne: »Das moderne Recht ist dasjenige Recht, das selbstreflexiv ist.«19 Die Kategorie der »Selbstreflexion« bezeichnet demzufolge die Seinsweise des modernen Rechts und begründet zugleich »die spezifische Seinsweise des modernen Rechts aus dem Sein des Rechts«20. Diese historisch neue Seinsweise des modernen Rechts mit der ihr eigentümlichen Verbindung von Normativität und Faktizität ist sodann als der Ausdruck dieser reflexiven Grundoperation des Rechts zu verstehen.
Worin besteht nun konkret diese Bestimmung des Rechts durch das Prädikat der Selbstreflexivität? Nach der genealogischen Rekonstruktion verbinden sich im Selbstbezug des Rechts Prozessualität und Materialismus in einer spezifischen Weise. Grund ist, dass sich durch ihre permanente Selbstreflexivität die Form des modernen Rechts nicht nur selbst hervorbringt, sondern permanenten Wandlungen ausgesetzt ist; sie ist daher »die Form des sich verändernden, also geschichtlichen Rechts.«21 Diese Prozessualität des modernen Rechts gründet wiederum in dem notwendigen Bezug des Rechts auf das, was Menke zunächst die »nichtrechtliche, natürliche und sich der Form entziehende oder auch widersetzende Materie«22 nennt. Doch dieser Bezug beruht nicht auf einer äußerlichen oder externen Relation. Stattdessen sind die entstandenen oder entstehenden Rechte »Ausdruck der Wirksamkeit der Materie des Nichtrechts im Recht«, und die Grundoperation des Rechts, welche die Form der Rechte hervorbringt, ist die Affirmation genau dieser Wirksamkeit des Nichtrechts im Recht: »Der materielle Prozess oder die prozessuale Materie des selbstreflexiven Rechts ist der Grund der Form der Rechte.«23 Die gesuchte Verbindung von Normativität und Faktizität im Recht ist demzufolge keine äußerliche oder nachträgliche, sondern wird wirksam im Grund der Rechte und ist durch Prozessualität und Materialität gekennzeichnet. Im Inneren des Rechts vollzieht sich eine Differenz von Recht und Nichtrecht mit ontologischen und normativen Implikationen.
1.3 Zur Differenz von Recht und Nichtrecht als Ursprung der Gewalt
Im zweiten Hauptkapitel von Kritik der Rechte sowie in dem bereits 2011 erstveröffentlichten Essay Recht und Gewalt rekonstruiert Menke die ontologische Dimension dieser Differenz im Grund des Rechts mitsamt ihren normativen Implikationen. Es ist demzufolge das Spezifische des selbstbezüglichen Rechts, dass neben die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, die das moderne Recht verfahrenslogisch durch den unparteilichen Richter zu treffen hat, die Unterscheidung von Recht und Nichtrecht tritt. In Kritik der Rechte führt Menke diese Unterscheidung aus der Perspektive des Rechts als eine strukturelle und asymmetrische ein, im Unterschied zur normativen und symmetrischen zwischen dem aus evaluativer Rechtsperspektive positiven Recht und dem negativen Unrecht. Hinsichtlich des Nichtrechts trifft die normative Form des Rechts auf die Welt als einem äußerlichen Raum, sodass sich rechtliche Form und die »rechtsindifferente, daher – aus der Sicht des Rechts – formlose Materie«24 entgegenstehen. Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung aus der Perspektive des Rechts folgt aus dessen Selbstbezüglichkeit, in der es nicht nur zwischen Recht und Unrecht, sondern auch zwischen Akten des Gebrauchs dieser ersten Unterscheidung und solchen, in denen diese nicht gebraucht wird und die sich somit auf Nichtrecht beziehen, unterscheidet. Zwischen diesem »doppelstöckigen Unterscheidungsgebrauch«25 besteht eine interne Verknüpfung. In Recht und Gewalt führt Menke diesen Begriff des Nichtrechts in konkretisierter und anschaulicher Form ein, denn mit ihm wird die »Möglichkeit eines Außerhalb der Gerechtigkeit; die Möglichkeit der Nicht-Gerechtigkeit«26 bezeichnet. Das Nichtrecht als Außer- und Gegenrechtliches entzieht sich den normativen Ansprüchen des Rechts und bildet einen Raum des »Außerhalb des Rechts im radikalen Sinne«27, das dem Recht fremd gegenübersteht. Diese Möglichkeit einer radikalen Konfrontation des Rechts mit dem Anderen lauere noch »in jedem Akt des Unrechts«28. Für die philosophische Kritik von entscheidender Bedeutung ist die genealogische Erkenntnis, dass dieses Außer- und Gegenrechtliche – das Nichtrecht – durch die unterscheidende Normativität des Rechts hervorgebracht wird: »Der Grund dafür, dass das Recht durch das Nichtrecht unterbrochen werden kann, liegt im Recht selbst. Dieser Grund ist nichts anderes als die Unterscheidung von Recht und Nichtrecht.«29 Dem entspricht die bereits zitierte Ausgangsthese, dass die Normativität der bürgerlichen Rechte eine außerrechtliche Faktizität hervorbringt.
Die nichtrechtliche Welt wird von dem Recht grundsätzlich als »Durcheinander, Gerede, Zerstreuung, Eigensinn, Störung, Ablehnung, Gewalt«30 empfunden. Doch der Grund für diese Störgeräusche liegt im Recht selbst, in dem nach Menkes ontologischer Rekonstruktion sich durch die Unterscheidung von Recht und Nichtrecht eine »nicht zu schließende Lücke«31 auftut, da das Nichtrecht eigentlich nicht im Recht anwesend sein kann, und zugleich doch permanent in diesem wirksam ist. Das Recht bezieht sich »in sich auf sein Außen« und damit »auf sich im Unterschied zum Nichtrecht und sieht sich mit dem unlösbaren Problem konfrontiert, mit diesem Unterschied zu operieren.«32 Mit Luhmann33 sieht Menke das ontologische – und zunächst noch nicht normative – Grundproblem des modernen Rechts in dem Paradox, dass dieses durch seinen Selbstbezug sich auf seine eigene Form bezieht (als Form der Form) und dabei zugleich in diesem Selbstbezug mit der Unterscheidung dieser Form von ihrem Anderen (dem Nichtrecht) operieren muss: »Das Paradox ist: Der Bezug des Rechts auf seine Form ist notwendig oder rechtskonstitutiv – ohne ihn gibt es kein Recht – und unmöglich oder rechtsaussetzend – denn er bezieht das Recht auf das Nichtrechtliche, mit dem es nichts anfangen kann.«34
Dass wir es in dieser Beziehung zwischen Recht und Nichtrecht nicht nur mit einem ontologischen Problem zu tun haben, sondern dieses auch mit normativen Implikationen einhergeht, hat Menke unter Rekurs auf die Frage nach Genesis und Legitimität der Gewalt des Rechts thematisiert. Dass das auf der Idee der Gleichheit als Gleichberücksichtigung aller Personen beruhende moderne Recht ebenso gewaltförmig in Erscheinung tritt wie die Formen des traditionellen Rechts, liegt nach Menkes genealogischer Rekonstruktion wiederum in dessen Form begründet: »Weil in jedem Akt des Unrechts die Möglichkeit des Außer-, gar Gegenrechtlichen lauert […], kann das Urteil der Richter nur durch Furcht herrschen. Deshalb gehört Gewalt nicht zur Erscheinung, sondern zum Wesen des Rechts.«35 Nach den einschlägigen Formulierungen in der Kritik der Rechte »haust« die Gewalt des Rechts genau in dieser »Lücke«, in dem »Spalt« oder »Riss«, der sich zwischen der Abwesenheit und der Wirksamkeit des Nichtrechts im Recht auftut: »Dabei heißt Gewalt das Potential und die Effektivität eines Wirkens diesseits der normativen Logik. Gewalt ist die bloß faktische Durchsetzung.«36 Das Recht muss also eine Faktizität, die außerhalb seiner normativen Rechtslogik liegt, voraussetzen. Während jedoch die im Rahmen der Rechtslogik vollzogene richterliche Entscheidung zwischen Recht und Unrecht normativen Charakters sei, wird sowohl die gewaltförmige Operation des Rechts zur faktischen Rechtsdurchsetzung gegen die außer- oder gegenrechtlichen Interventionen als auch das Nichtrechtliche selbst als nicht-normativ gekennzeichnet. Und dieses nicht-normative, gewaltförmige Operieren des Rechts entlarvt Menke als Voraussetzung für das rechtlich-normative Operieren in der Rechtslogik. Aus diesem strukturellen Grund ist das Recht paradox verfasst: »Das Recht muss normativ und nichtnormativ zugleich sein, aber es kann nicht gleichzeitig normativ und nichtnormativ sein.«37
1.4 Genealogische Kritik des Positivismus der subjektiven Rechte
Ganz ähnlich funktioniert so auch die im dritten Hauptkapitel der Kritik der Rechte durchgeführte genealogische und zugleich ideologiekritisch orientierte Rekonstruktion der Grundfigur des bürgerlichen Rechts. Schon im Übergang vom zweiten zum dritten Kapitel deutet sich diese kritische Pointe der genalogischen Rekonstruktion der selbstreflexiven Struktur des modernen Rechts an, die nicht nur aus Bezugnahmen auf sich selbst und dem Anderen des Rechts besteht, sondern in diesem Zugriff auch aus Operationen der Hervorbringung. Denn die zur gesellschaftlichen Realität gewordene Gestalt, welche die Form der Rechte durch ihre Selbstreflexion angenommen hat, ist eine spezifische Erscheinungsform, die zwar als unbestrittene und historisch bis dato einzige Grundfigur des modernen Rechts auftritt, aber grundsätzlich nicht alternativlos ist. Diese Grundfigur der Rechte ist die der subjektiven Rechte. Menke schickt dem dritten Hauptkapitel von Kritik der Rechte,38 das sich in kritischer Absicht dieser Grundfigur des Rechts widmet, bereits seine Kernthesen in drei argumentativ strukturierten Variationen vorweg:
a) »Die Rechte sind die Rechte des Subjekts. Das bürgerliche Recht definiert die Rechte moderner Form als subjektive Rechte; die Definition der modernen Rechte als subjektive Rechte ist die Grundoperation des bürgerlichen Rechts. Durch diese Grundoperation aber gerät das bürgerliche Recht in Widerspruch mit sich selbst.«39
b) »Dabei darf das philosophisch Falsche in dem Gedanken des bürgerlichen Rechts nicht so verstanden werden, dass er falsch gemessen an einem anderen Gedanken, der ihm normativ entgegentritt, ist. Falsch ist er gemessen an sich selbst: Das Maß, nach dem der Gedanke des bürgerlichen Rechts falsch ist, ist sein Wesen, sein innerer Grund. Das bürgerliche Recht ist falsch, weil es sich selbst widerspricht.«40
c) »Das bürgerliche Recht und seine Grundfigur der subjektiven Rechte sind ontologisch falsch. […] Die Falschheit des Gedankens des bürgerlichen Rechts besteht darin, dass er eine Form von Positivismus ist. […] In seiner Grundfigur positiviert das bürgerliche Recht das materielle Andere des Rechts.«41
In a) fokussiert Menke noch einmal die spezifische historische Erscheinungsform des modernen Rechts – die subjektiven (bürgerlichen) Rechte – und antizipiert seine These, dass durch diese Operation das moderne Recht in einen Selbst-Widerspruch gerät. In b) wird darauf hingewiesen, dass – entsprechend der methodischen Intention einer genealogischen Aufdeckung ontologischer Strukturen – dieser Widerspruch nicht qua eines externen normativen Anspruchs aufzudecken ist, sondern sich mit Blick auf die eigene innere Wesensbestimmung des Rechts entfalten lässt. In c) wird die Falschheit der Grundfigur des modernen Rechts entsprechend als eine »ontologische Falschheit« markiert. Das Grundproblem scheint hier in einer Positivierung des materiellen Anderen des Rechts zu bestehen, durch die das Reflexionspotential des modernen Rechts unterlaufen wird. Menke spricht in diesen Textpassagen explizit von einer »Verleugnung der Reflexion« in zweierlei Hinsicht, nämlich in der Bezugnahme auf das Andere des Rechts selbst genau deshalb, weil dieser Bezug des Rechts auf sein Anderes dieses als etwas Vorgegebenes oder Gegebenes positiviert bzw. naturalisiert. Dadurch wird das Potential der Selbstreflexion nicht nur nicht ausgeschöpft, sondern die eigene Struktur verstellt und verkehrt. Mit Blick auf die Idee der subjektiven Rechte als der historisch spezifischen Grundfigur des modernen Rechts bedeutet dies: Durch den Empirismus und Positivismus des bürgerlichen Rechts als Denkform und Theorie42 wird über die Etablierung der subjektiven Rechte nicht ein Anderes des Rechts verrechtlicht, sondern eine bestimmte Vorstellung von einem Anderen erst hervorgebracht. Allerdings wird durch das positive moderne Recht und dessen theoretische Abbildung im Liberalismus dieser Akt der Hervorbringung nicht mehr reflektiert und stattdessen als Gegebenes vorausgesetzt: »Das bürgerliche Recht beruht auf einem Mythos des Gegebenen: Es versteht das Nichtrechtliche (oder Natürliche), auf das sich die Normativität des modernen Rechts als ihr Anderes selbstreflexiv in sich bezieht, als Gegebenes.«43
Die kritische Genealogie der ontologischen Struktur des modernen Rechts soll gegen ihre liberale Auffassung offenlegen, dass die Figur der subjektiven Rechte ihren Grund gerade nicht im Subjekt hat, »sondern im Recht, und zwar in der positivistisch verzerrten Selbstreflexion des bürgerlichen Rechts.«44 Sie ist deshalb nur als eine abgeleitete und kontingente Kategorie zu betrachten. Zur Kritik steht neben der Gestalt, die diese Grundfigur des modernen bürgerlichen Rechts in den subjektiven Rechten angenommen hat, die in dieser vollzogene Positivierung eines Außerrechtlichen und Nichtnormativen zu einer Tatsache: »Das bürgerliche Recht vollzieht die Selbstreflexion des Rechts in seiner Differenz vom Natürlichen so, dass es sich das Natürliche, das Nichtnormative, als Tatsache voraussetzt; das bürgerliche Recht versteht also die selbstreflexive Reproduktion der Differenz von Norm und Natur im Recht so, dass sie die Reifizierung des Natürlichen zum Gegebenen, zur Grundlage des Rechts verlangt. Das geschieht durch die Ermächtigung des Eigenwillens.«45
Die Dialektik zwischen Normativität und Faktizität vollzieht sich in der Grundfigur der subjektiven Rechte entsprechend auf mehreren Ebenen. In Form des Eigentumsrechts entfaltet sich ein Paradigma des zugleich ausschließenden und unbegrenzten Dürfens, das Menke mit Max Weber als einen Ermächtigungsakt begreift, der »ein neues Wollen- und Handelnkönnen« hervorbringt: »Die subjektiven Rechte des bürgerlichen Rechts definieren das Dürfen, das sie einräumen und sichern, als die gleiche Berechtigung des Subjekts zur Verwirklichung seines eigenen Willens (oder seines Eigenwillens).«46 Hierin besteht sodann auch der allgemein durch das Recht vollzogene Hervorbringungsakt von Subjektivität. Denn die Idee der Gleichheit wird durch die Erlaubnis und Ermächtigung, die das Recht allen Rechtspersonen zuspricht, als gleiche Berechtigung aller zur Verwirklichung eines eigenen Willens bestimmt. Die rechtliche Sicherung dieses zugrunde gelegten Eigenwillens wiederum nimmt sodann im bürgerlichen Recht zwei Gestalten an: »die Sicherung der privaten Sphäre uneingeschränkter Willkürherrschaft und des Erwerbs privater Vermögen durch soziale Teilhabe.«47 Diesen Annahmen über die Grundgestalten des bürgerlichen Rechts liegt Menke zufolge ein Positivismus zugrunde, nach dem den Entscheidungen der Rechtssubjekte für die Wahl von Zielen einerseits und die Bewertung von Mitteln und Ressourcen andererseits der Status und die Autorität einer Tatsache verliehen wird.
Entsprechend ist diese Ermächtigung von Subjekten qua Rechtspersonen immer schon als eine Form der Subjektivierung ausdeutbar: Nicht die Subjekte haben Rechte, sondern die Rechte sind deshalb subjektiv, »weil sie ein Subjekt hervorbringen.«48 Durch diese Formbestimmung der Rechte kommt es zu privaten, sozialen und politischen Selbstermächtigungen, da aus dem Dürfen ein Können wird und aus der Erlaubnis das Erlaubte; das Subjekt der privaten Rechte ist deshalb auch der Motor »der Veränderung der Rechte« in der politischen Dimension, da sie auch ein rechtliches Können im Rahmen der Mitwirkung an der Rechtserzeugung hervorbringen.49 Im Rahmen von Menkes Argumentation ist die Aufdeckung des Aktes der Hervorbringung entscheidend: »Die Erlaubnis bringt das Erlaubte, das sie vorauszusetzen scheint, hervor.«50
Drittens ist dasjenige, was durch diese Figur hervorgebracht und zugleich positivistisch vorausgesetzt wird, »die Form eines neuen Wollens«, nämlich »des Wollens nach eigenem Belieben«, sodass das neu hervorgebrachte gesellschaftliche Subjekt dasjenige einer »neuen Weise des Wollens«51 ist. Menke erörtert das bürgerliche Verständnis vom Eigenwillen insbesondere am Eigentumsbegriff und der diesem zugrundeliegenden (liberalen) Vermögenstheorie. Dieser zufolge gelten Interessen, Wünsche und Bedürfnisse als natürliche Gegebenheiten und werden sodann in eine rechtliche Form transferiert, ohne dass im Rahmen der Theoriebildung diese der Transformation zugrundeliegende Verkehrungsfigur einsichtig wird: »Die Form der subjektiven Rechte repräsentiert das Nichtrechtliche im Recht, als ob es ein Gegebenes wäre.«52 In einer Fußnote in dem gerade zitierten Beitrag unterscheidet und definiert Menke hinsichtlich des Gehalts der subjektiven Rechte noch einmal: »Der Inhalt der subjektiven Rechte ist der normative Status der Gleichheit. Hingegen ist die Materie der subjektiven Rechte das, was oder wozu sie berechtigen: die Interessen oder Bedürfnisse oder Freiheit bzw. die Vollzüge (gewöhnlich: Handlungen und Unterlassungen), in denen sie sich verwirklichen.«53
Durch den Positivismus der subjektiven Rechte wird diese kontingentspezifische Art der Verwirklichung als Repräsentation eines Vorgegebenen »hingenommen« und dadurch »unverändert gelassen«54. Konkret heißt dies, dass Individuen in der Moderne sich nicht aus einer Unbestimmtheit heraus zu Subjekten bestimmen, sondern »Eigentümer, Vertragsschließende, Kunde, Verkehrsteilnehmer, Empfänger staatlicher Leistungen, Teilnehmer an medialen und politischen Öffentlichkeiten« sind, und zwar in einer Weise, »dass das Ob und Wie der Inanspruchnahme dieser Rollen der privaten Willkür überlassen ist.«55 Wenn dementsprechend das bürgerliche Recht als eine Form verstanden wird, die den Eigenwillen des Subjekts voraussetzt und als gegeben konstatiert, dann ist das bürgerliche Recht positivistisch, »weil es von dem Wollen des Subjekts als Tatsache ausgeht.«56 Zugleich ist dieses Wollen im Rahmen der Form des subjektiven Rechts zweideutig, denn es kann nur eine bestimmte, nämlich durch die Normativität des Rechts vorgegebene Form annehmen – Ermächtigung und Einschränkung gehen Hand in Hand. Auch hier ist für Menke die Offenlegung des durch den Positivismus verdeckten Aktes der Hervorbringung entscheidend: »Wenn daher das bürgerliche Recht, durch die Form subjektiver Rechte, den Eigenwillen der Subjekte legalisiert, dann bedeutet dies nicht nur eine fundamental andere Bewertung, sondern die Hervorbringung eines neuen Begriffs und damit einer neuen Wirklichkeit des Wollens. Die Erlaubnis des Eigenwillens durch die Form der subjektiven Rechte ist eine ontologische Innovation.«57
Mit diesem argumentativen Schlusspunkt des dritten Hauptkapitels von Kritik der Rechte ist somit auch die Kernfrage geklärt, worauf sich die einleitende Rede von einem »ontologischen Umbruch in der Seinsweise des modernen Rechts«58 inhaltlich bezieht. Die genealogische Rekonstruktion, die Menke vollzieht, deckt auf, was die spezifische Erscheinungsform des bürgerlichen Rechts trotz ihrer reflexiven Struktur verdeckt und verzerrt: Das, was der Form der subjektiven Rechte als vorausgesetzt erscheint – ermächtigende Subjektivität und Eigenwille –, ist durch die Form des Rechts selbst hervorgebracht. Die Paradoxie des Rechts, die durch dessen selbstreflexive Figur der inneren Bezugnahme auf sich selbst und sein Anderes offengelegt wird, besteht somit nicht nur in der logischen Struktur des Rechts, sondern »hat deshalb auch einen paradoxen Status, eine paradoxe Existenz im Recht.«59 Im Inneren des Rechts entfaltet sich eine Dialektik von Normativität und Faktizität in den Gestalten von Recht und Nichtrecht, die das moderne Subjektverständnis erst hervorbringt: »Das Recht herrscht, indem es seine Subjekte zur Autonomie zwingt. […] Es ist gerade nicht die Logik der Souveränität, sondern die der Autonomie, die die Herrschaftsform des Rechts definiert.«60 Während das Gleichheitsideal das moderne Recht politisch an die Idee der egalitären Bürgerschaft bindet, führt die spezifische Darstellung der Gleichheit in der Form der subjektiven Rechte zu einem bestimmten Verständnis von Autonomie, nach dem der Befreiungsakt immer auch einen Begrenzungsakt darstellt. Zur methodischen und gegenstandsbezogenen Herausstellung der kritischen Perspektive auf die Grundstruktur der historischen Rechtsform der Moderne rekurriert Menke an entscheidenden Stellen auf Marx.
2. Menke und Marx – Ausgangsrätsel, Methode und Herrschaftskritik
Übergreifend spielen in der skizzierten Rahmenhandlung der Kritik der Rechte Bezugnahmen auf Marx eine wesentliche Rolle, die im Folgenden unter systematischen Gesichtspunkten fokussiert werden. Hierzu wird erstens der normative Ausgangspunkt der Kritik der Rechte unter Rekurs auf das im Vorwort angedeutete Rätsel dargelegt, das sich mit Marx hinsichtlich des modernen Rechts stelle und einer neuen Lösung bedarf (2.1). Zweitens wird die verfolgte methodische Analogie der Kritik der Rechte zur Kritik der politischen Ökonomie erläutert (2.2), um daran anschließend drittens den im Verlauf des Buches vollzogenen Rekurs auf Marx zur Bestimmung des Verhältnisses von subjektiven Rechten und sozialer Herrschaft zu diskutieren (2.3).
2.1 Marx’ Rätsel der bürgerlichen Rechte und Menkes Lösung
Die zum Ausgangspunkt der Kritik der Rechte gewählte historische und ontologische Umbruchsthese über die revolutionäre Entscheidung der bürgerlichen Revolutionen, der »Gleichheit die Form der Rechte zu geben«, stellt sich nach Menkes Einstieg in die Kritik der Rechte als ein Rätsel dar, auf das schon Marx hingewiesen hat.61 Er rekurriert hierzu auf eine Textstelle aus dem ersten Teil der frühen Abhandlung Zur Judenfrage, die Marx mit der Rätselmetapher einleitet. Als rätselhaft stellt sich dem jungen Marx ein innerer Widerspruch im Konstituierungsakt der bürgerlichen Gesellschaft dar, der als Widerspruch im Subjekt fortlebt: Die Gründung des politischen Gemeinwesens der bürgerlichen Gesellschaft durch ihre Deklarationen proklamiert zugleich in diesem feierlichen Akt »die Berechtigung des egoistischen, vom Mitmenschen und vom Gemeinwesen abgesonderten Menschen«62. Im nächsten Schritt sieht es Marx als »noch rätselhafter« an, dass auf der Ebene des politischen Gemeinwesens dessen Funktion mitsamt seinen Trägern – dem »Staatsbürgertum« – auf eine dienende Rolle gegenüber dem »egoistischen homme« reduziert werde.63 Funktional findet hier der frühen Kritik von Marx am bürgerlichen Staat und seinen Menschenrechtserklärungen zufolge eine Verkehrung statt zwischen der Sphäre, »in welcher der Mensch sich als Gemeinwesen verhält«, und jener, »in welcher er sich als Teilwesen verhält«, in dem die erstere unter die letztere »degradiert« werde.64 Menke liest hieraus in erster Linie die Konstatierung eines Gegensatzes zwischen dem politischen und dem privaten Subjekt auf der subjektiven Ebene sowie zwischen dem Akt des Politischen, der der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte zugrunde liegt, und der zugleich durch diese Erklärung stattfindenden »Degradierung der Politik« auf der gesellschaftlichen Ebene.65 Die politisch erklärten Rechte ermächtigen »den unpolitischen (›egoistischen‹) Menschen der bürgerlichen Gesellschaft« und werden dadurch zu einem bloßen Mittel herabgesetzt: »Das Rätsel der bürgerlichen Erklärung gleicher Rechte ist das Rätsel einer Selbstverkehrung: Sie ist der politische Akt der Ermächtigung des unpolitischen Menschen und damit die Selbstentmächtigung der Politik – die Politik der Entpolitisierung.«66 Auf der Zielperspektive führt diese paradoxale politische Entmächtigung des Politischen nach Sonja Buckels prägnanter Darlegung zur Etablierung einer »Sphäre des Sozialen jenseits der Politik«67, innerhalb der die Subjekte trotz des Scheins der ökomischen und kulturellen Freiheit zu permanenten Gegenständen eines endlosen Regierungshandelns werden. Zugleich ist es die scheinhafte »Naturalisierung des Sozialen«68, die den entpolitisierten Gesellschaftszusammenhang als einen dauerhaft krisenhaften etabliert.
Während Menke sich einverstanden zeigt mit Marx’ Explikation des Rätsels, ist ihm die Lösung, die dieser vorschlägt, »zu einfach«69. Als Grund führt er an, dass sich diese nur auf den Beweggrund für die angeführte Degradierung der Politik zu einem Mittel für die Durchsetzung der subjektiven Rechte bezieht: »Das Rätsel ist, dass die bürgerliche Revolution das politische Gemeinwesen zu einem Mittel für die Rechte des unpolitischen Menschen degradiert. Die Lösung dafür ist, dass die bürgerliche Politik durch die Erklärung der Rechte die bürgerliche Gesellschaft von der Politik emanzipiert.«70 Dieser von Marx diagnostizierte Emanzipationsschritt der Rechte des unpolitischen Menschen der bürgerlichen Gesellschaft als einer ökonomischen Verkehrsform von dem sich auf die Allgemeinheit beziehenden Staatsbürger funktionalisiert die politische Erklärung der Menschen- und Grundrechte im Sinne einer spezifischen Auffassung vom Menschen, die wiederum im Interesse einer herrschenden Klasse steht. Dadurch werde eine Widersprüchlichkeit im Subjekt produziert, für welche sich eben jene Klasse verantwortlich zu zeigen habe. Marx nehme dementsprechend den Beweggrund und die interessegeleiteten Zwecksetzungen der durch eine herrschende Klasse in Anspruch genommenen politischen Entpolitisierung der bürgerlichen Gesellschaft zum Ausgangspunkt seiner Kritik des bürgerlichen Rechts: »Marx sucht die – einfache – Lösung für das Rätsel der bürgerlichen Revolution in ihrer Wirkung, in der er ihr geheimes Ziel sieht.«71
Menke stimmt mit dieser Einschätzung der Wirkweise der Etablierung bürgerlicher Rechts- und Verkehrsformen zwar darin überein, dass die in diesem Rahmen etablierten gleichen Rechte als der »entscheidende Mechanismus« zu betrachten sind, »der die bürgerliche Gesellschaft politisch hervorbringt«72. Jedoch intendiert er im Unterschied zur Vorgehens- und Erklärungsweise des jungen Marx73 eine sich auf die Form des Rechts fokussierende Analyse dieses Rätsels durch genealogische Offenlegung der ontologischen Grundstruktur dieses Mechanismus entlang der Frage, »wie sie [die bürgerlichen Revolutionen, C. T.] dies [die Degradierung der Politik, C. T.] durch die Erklärung der Rechte tut.«74 Es ist also die Verfahrensweise des modernen Rechts, die durch die Kritik der Rechte in den Blick genommen wird, und es sind nicht ihre Wirkungen, denn diese sollen durch eine Analyse des Mechanismus erst erklärt werden. Durch diese theoretische Blickwinkelverschiebung soll das von Marx gestellte Rätsel einer richtigen Lösung zugeführt werden: »Das Wie der Rechte hat Vorrang vor ihrem Was, Warum und Wozu. Vor dem Gehalt, dem Zweck und der Wirkung der Rechte kommt ihre Form. Denn diese Form ist nicht neutral.«75
Auf der Zielgeraden der Argumentation in Kritik der Rechte zeigt Menke sodann, dass die Formbestimmung der Rechte als subjektive Rechte, die den Eigenwillen zu einer Tatsache positivieren, die im Rahmen von Sozialität notwendige Begrenzung und Beschränkung des für sich entgrenzten Eigenwillens rein quantitativ – und nicht qualitativ – im Sinne eines »Rückganges des Rechtlichen« begreift: »Das Subjekt der bürgerlichen Rechte zahlt für seine politische Ermächtigung den Preis der Entmächtigung der Politik.«76 Grund ist nach Menke, dass in der bürgerlichen Rechtsform die politische Teilhabe ausschließlich mit der Zweckbestimmung versehen wird, die »Legalisierung des Eigenwillens«77 im und durch den sozialen Raum zu vollziehen.
2.2 Methodische Analogie von Fragestellung und Verfahren bei Marx und Menke
Menkes oben dargelegte methodische Entscheidung für eine genealogische Formkritik gründet also in einem Rätsel, das der junge Marx zwar formuliert, aber zumindest in seinem Frühwerk noch nicht einer zureichenden Lösung zugeführt hatte: »Es ist daher das Rätsel, das Marx stellt, nicht die einfache Lösung, die er anbietet, das der Untersuchung den Weg weist: den Weg zu einer Analyse der bürgerlichen Form der gleichen Rechte.«78 Gegen den in direkter Weise herrschaftskritischen Lösungsversuch des jungen Marx wendet Menke interessanterweise eine methodische Figur, die er den ökonomiekritischen Schriften des späten Marx entnimmt und auf die er bereits in einer Fußnote des Vorwortes79 verweist. Im Rahmen der Wertformanalyse des Kapitals kritisiert Marx mit Blick auf die Analysen von Wert und Wertgröße insbesondere bei David Ricardo, dass dieser zwar den »in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt« habe.80 Jedoch sei vonseiten der liberalen politischen Ökonomie »niemals auch nur die Frage gestellt« worden, »warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsproduktes darstellt«81. Genau diese Fragestellung ist es dann auch, die Menke aus der gereiften Kritik der politischen Ökonomie übernimmt, um eine Kritik der Rechte in methodischer Analogie zu vollziehen. Zugleich setzt er sich von gesellschaftstheoretischen Prämissen ab, auf denen die ausgereifte Ökonomiekritik von Marx hinsichtlich ihrer Gegenstandsanalyse aufruht. Im Einleitungskapitel von Kritik der Rechte greift Menke hier wiederum auf eine Textstelle aus der im Sommer 1843 verfassten Kritik des Hegelschen Staatsrechts des jungen Marx82 zurück, um diese Kritikvariante, die sich der Erklärung und Kritik der »inneren Genesis einer Sache« zuwendet, von »vulgären Formen der Kritik« abzugrenzen.83 So konstatiert Menke in einem ergänzenden Beitrag zu methodologischen Fragen der Kritik der Rechte konkret mit Blick auf deren Verhältnis zur Kritik der politischen Ökonomie: »Dass die Kritik der Rechte diesem Modell folgt, besagt, dass sie in Analogie zur Kritik der politischen Ökonomie verfährt; die Kritik der politischen Ökonomie ist nicht die Grundlage der Kritik der Rechte – die Kritik der Rechte erfolgt also nicht so und dadurch, dass die Rechte auf die politische Ökonomie zurückgeführt und ihre Form durch sie erklärt würde. Die Kritik der Rechte muss vielmehr für das (bürgerliche) Recht dasselbe versuchen, das Marx für die (bürgerliche) Ökonomie getan hat.«84
Menke lehnt somit eine materialistische Verhältnisbestimmung von Rechts- und Warenform ab. Sonja Buckel hat seinen Ansatz entsprechend als einen rechtsphilosophischen markiert, der für sich in Anspruch nimmt, »das Recht als Recht aus sich selbst heraus« gemäß seinem inneren Sinn zu reflektieren.85 Menke beanspruche jedoch nicht, das Recht gesellschaftskritisch einzuordnen oder einen gesellschaftstheoretischen Beitrag zur Rolle des Rechts in der gesellschaftlichen Gesamtstruktur zu leisten. Und doch ist dieser methodische Ausgangspunkt von Menke in eben diesen gesellschaftstheoretischen Hinsichten nicht implikationsfrei. So konstatiert er für die von ihm vollzogene Kritik des modernen Rechts deren grundsätzliche Unabhängigkeit gegenüber dem sachlichen Bezugspunkt der Marx’schen Ökonomiekritik. Stattdessen sei es umgekehrt und ausschließlich »die normative Ordnung des Rechts« und somit »die bürgerliche Form der Rechte«86, die den sozialen Zusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft auf dem historischen Fundament der revolutionären Entscheidungen der Deklarationen seit dem späten 18. Jahrhundert ontologisch-strukturell hervorbringe. Auf diese These anspielend, verweist Buckel auf die Suggestion, dass es im Rahmen dieser Argumentation so erscheint, als ob »Gesellschaft – als naturalisierte – durch die subjektiven Rechte erst geschaffen werde«87.
Menke schlussfolgert auf der Grundlage seiner methodischen Prämissen, die die genealogische Formkritik als eine solche der immanenten Formbestimmungen des modernen Rechts vollziehen, dass die spezifische Normativität des bürgerlichen Rechts irreduzibel sowie herrschaftskonstitutiv und -funktional sei. Grund sei die spezifische Form, die die bürgerliche Gesellschaft durch diesen historischen Akt eines neuen Rechtskonzeptes angenommen habe: »Die Normativität der Rechtsverhältnisse muß um ihrer selbst willen geglaubt werden, damit sie soziale Herrschaft möglich macht. […] Das bürgerliche Recht ist durch seinen normativen Gehalt herrschaftskonstituierend.«88 Menke formuliert diese Thesen wiederum im Kontext einer Auseinandersetzung mit der Kritik der herrschaftskonstitutiven Funktion des bürgerlichen Privatrechts bei Marx, die den dritten systematischen Bezugspunkt in der Kritik der Rechte darstellt.
2.3 Kritik des Privatrechts – blinde Flecken bei Marx und Menke
Die These, dass das bürgerliche Recht ein neues Subjekt hervorbringt und reproduziert, konkretisiert Menke inhaltlich über den Vergleich mit dem traditionellen Recht. Im Gegensatz zu dessen Grundvorstellung einer Einbindung von Rechten in einen sittlichen Zusammenhang sei der positivierte Rückgriff auf einen Eigenwillen durch die Form der subjektiven Rechte als eine »ontologische Innovation« zu deuten, denn sie proklamiere »den nichtnormativen, unfreien, asozialen Willen als ein positives Vermögen«89. Diese Form der »Positivierung der normativen Indifferenz und asozialen Privatheit« bringe zugleich eine »Selbstpositivierung« mit sich, die mit einem Verlust an Negativität einhergehe: »Das Subjekt wird sich selbst positiv – zu einer Tatsache.«90 Die daraus folgende Entmächtigung der politischen und sittlichen Instanzen durch die Figur der subjektiven Rechte verhandelt Menke nun kritisch über eine Rekonstruktion des Zusammenhangs zwischen den beiden Gestalten des bürgerlichen Rechts – Privatrecht und Sozialrecht – mit sozialer Herrschaft. Leitend ist hierbei die bereits angeführte und über die Kritik der Rechte hinausweisende gesellschaftstheoretische These über den genealogischen Ursprung des durch das bürgerliche Recht hervorgebrachten Eigenwillens: »Es gibt den sittlich indifferenten, das Soziale privat appropriierenden Eigenwillen nur durch die normative Ordnung des Rechts: durch die bürgerliche Form der Rechte. Die bürgerliche Gesellschaft als der soziale Zusammenhang sittlich indifferenter Subjekte ist rechtlich hervorgebracht.«91
Demzufolge wird der Rekurs auf Marx hinsichtlich einer Genealogie der übergreifenden sozialen Herrschaftsform der bürgerlichen Gesellschaft in der Kritik der Rechte nicht mit Blick auf die gesellschaftstheoretische Kernthese über das Verhältnis von Waren- und Rechtsform in der Kritik der politischen Ökonomie vollzogen. Diese formuliert Marx direkt im Übergang von der Wertformanalyse zur Thematisierung der Grundstruktur des Austauschprozesses von Waren zu Beginn des zweiten Kapitels des Kapitals: »Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, so daß der eine nur mit dem Willen des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensaktes sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigne veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer.«92
Auch wenn die in der Textstelle verwendete Widerspiegelungsmetapher vage bleibt, so ist es doch plausibel, zumindest die folgenden von Marx verfolgten Implikationen für das Verhältnis von Waren- und Rechtsform anzunehmen. »Widerspiegelung« wird hier als ein vorläufiger Begriff für die Verhältnisbestimmung von Warenform und Rechtsform genutzt. Das ökonomische wie auch das rechtliche Verhältnis treten im Rahmen der von Marx geleisteten Formbestimmung zunächst als ein abstraktes Verhältnis auf, sodass auch die Herrschaftsverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft von abstrakter Art sind. Aus einer genealogischen Perspektive ist nach der von Marx in den Spätschriften unternommenen Analyse die ökonomische Form sowohl historisch als auch ontologisch in einem jedoch ausdeutbaren Sinne grundlegend für die (abstrakte) Rechtsform der bürgerlichen Gesellschaft. Zugleich sind die für die Warenförmigkeit konstitutiven Formbestimmungen nach Marx keine, die in einem spezifischen Konzept von einer subjektiven Willensstruktur münden. Neben der sich von der Kritik der Rechte unterscheidenden Fassung der Herkunftserklärung bürgerlicher Herrschaftsverhältnisse ist nach Marx die Vorstellung, in der bürgerlichkapitalistischen Gesellschaft würden die Rechtspersonen qua ihres Eigenwillens agieren, grundsätzlich falsch – denn der den Rechtspersonen zugeschriebene Wille »haust« nach der oben angeführten Textstelle »in jenen Dingen«, die durch die wechselseitige Bezugnahme aufeinander Warenform angenommen haben, auch wenn umgekehrt die Dinge als nützliche Gebrauchswerte sich »widerstandslos gegen den Menschen« zeigen.93
Gegenüber Marx schränkt Menke seinen Erklärungsanspruch hinsichtlich einer Offenlegung der »Grundstruktur der bürgerlichen Gesellschaft«94 in einer Fußnote noch einmal ein. Die These, dass diese Grundstruktur »durch die Form des bürgerlichen Rechts hervorgebracht wird«95, gilt demzufolge nicht für die »Grundstruktur der bürgerlichen Gesellschaft als solcher, sondern in rechtlicher Perspektive: sofern sie rechtlich hervorgebracht ist.«96 Menke bezieht sich positiv auf »Marx’ Einsicht« in die unter der Form der rechtlichen Freiheit versteckte Herrschaftsstruktur: »Die Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft ist der Inhalt der rechtlichen Freiheit, oder die rechtliche Freiheit ist die Form der sozialen Herrschaft.«97 Die Herrschaftskritik von Marx durchschaue entsprechend die Rede von Naturgesetzlichkeiten im ökonomischen Prozess und Willensanlagen in der anthropologischen Begründung als Ausdruck einer Verkehrungsfigur zwischen dem auf Freiheit und Autonomie abzielenden Anspruch auf gleiche rechtmäßige Ermächtigung, die allen Rechtspersonen zugesprochen wird einerseits, und dem Umschlag dieser Subjektfigur in ein rechtlich abgesichertes soziales Herrschaftsverhältnis andererseits: »Das bürgerliche Recht ist daher die ›andere Form‹ des Rechts des Stärkeren. Oder: Die rechtlichen Verhältnisse gleicher Anerkennung sind die sozialen Verhältnisse von Herrschaft, Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt in anderer Form – verwandelt in die Form der Gleichheit. Form und Inhalt des Rechts – so Marx immer wieder – stehen im Gegensatz; sie entsprechen sich nur so, dass sie sich widersprechen.«98
Der Widerspruch, den Menke hier mit Marx sprechen lässt, ist zunächst einer, den der junge Marx in seinen Frühschriften in den Blick genommen hat: Die Verkehrungsfiguren der bürgerlichen Gesellschaft nehmen dort verschiedene sowohl in sich als auch in ihrem Verhältnis zueinander widersprüchliche subjektive Personengestalten an, wie bourgeois und citoyen zum einen oder Lohnarbeiter und Kapitalist zum anderen. Interessanterweise verweist Menke99 jedoch gerade in diesem Kontext nicht auf die Frühschriften von Marx, sondern auf jene oben angeführte metaphorische Rede vom Rechtsverhältnis als einem Willensverhältnis, »worin sich das ökonomische Verhältnis selbst spiegelt.«100 Menke kritisiert eine reduktionistische Lesart dieser Textstelle im Sinne einer Ableitungsthese über die historische und strukturelle Herkunft des Rechts aus der ökonomischen Form.101 Stattdessen plädiert er auch gegen die »Prämisse der Homologie der sozialen Formen«102 dafür, die Figur des Rechts in ihrem Verhältnis zur Warenform als eine »andere Form« zu deuten: »Wenn das Recht in sich in Form und Inhalt gespalten, gar sich widersprechend ist, ist es ausgeschlossen, dass das Recht nichts als eine Widerspiegelung der materiellen Verhältnisse ist. Eine ›Widerspiegelung‹ sozialer Herrschaft ist es allenfalls in dem Sinn, dass es zugleich eine Verkehrung des Gespiegelten ins Gegenteil ist.«103 Gegen reduktionistische Lesarten ermögliche die Unterscheidung der Normativität des Rechts von den Herrschaftsformen die Einsicht in die herrschaftskonstituierende Form des bürgerlichen Rechts. Der so freigelegte normative Gehalt des bürgerlichen Rechts produziere jedoch aus sich heraus keinen emanzipatorischen Überschuss, der sich gegen diese Herrschaftsform selbst wenden ließe. Stattdessen führe er zu einer »internen Verbindung von Herrschaft und Recht: Herrschaft durch Recht.«104
Mit Blick auf den Gegenstand der Marx’schen Herrschaftskritik konstatiert Menke eine Einseitigkeit,105 denn dieser habe »das subjektive Recht in Orientierung am bürgerlichen Liberalismus nur als das Recht der privaten Sphäre individueller Wahl, als Recht der Willkür begriffen«106. Menke thematisiert diese Gestalt als jene des bürgerlichen Privatrechts, die Marx »als einzige strukturell notwendige Rechtsgestalt der bürgerlichen Gesellschaft«107 erkannt und deshalb die für die bürgerliche Gesellschaft spezifische Herrschaftsform »nur in einer Gestalt zu erfassen vermocht«108 habe. Hierbei handele es sich um »diejenige Herrschaft, die durch die rechtliche Ermächtigung der privaten Willkür hervorgebracht wird. Das ist die Herrschaft in der Sphäre der Produktion, die Herrschaft als Ausbeutung und Zwang.«109 Den Grund für diese einseitige Fokussierung von Herrschaft sieht er in der der Gesellschaftskritik von Marx zugrundeliegenden Bestimmung der bürgerlichen Gesellschaft als einer »politisch-ökonomischen Klassenherrschaft«110. Im Rahmen seiner Rekonstruktion der Verbindung von Privatrecht und sozialer Herrschaft rekurriert er auf einschlägige Textstellen aus den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie sowie dem Kapital unter rechtstheoretischen Gesichtspunkten: »Der Erwerb der Ware Arbeitskraft ist also deshalb der Erwerb einer besonderen Ware, weil er bedeutet, ein Recht über den zu gewinnen, der diese Arbeitskraft allein ausüben kann: Der Erwerb der Ware Arbeitskraft bedeutet ein Recht auf Herrschaft über den Arbeiter.«111