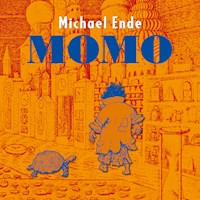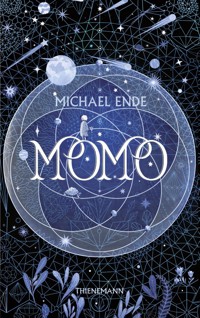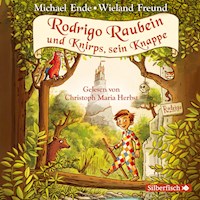9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: Edition Michael Ende
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Michael Ende ist nicht allein ein Erzähler großartiger Märchen und phantastischer Geschichten, er war auch ein scharfsinniger Denker, der sich Gedanken machte über den Zustand der Welt und sich um positive Zukunftsbilder bemühte. Sein Zettelkasten belegt diesen Doppelaspekt, denn es ist ein aufschlussreiches Lesebuch aus der Werkstatt eines Autors, der in der realen Welt der Menschen und in der Welt der Vorstellungen zu Hause ist. Das Lesebuch enthält Geschichten und Gedichte, Balladen und Lieder voller Poesie und Phantasie. Aber auch von der realen Welt der Menschen wird im Zettelkasten erzählt: Beobachtungen, Überlegungen und Aphorismen vermitteln überraschende Sichten auf die Welt und schärfen unser Bewusstsein für die Probleme unserer Zeit. Michael Endes literarische wie philosophische Versuche sind Belege für seine Bemühungen, Poesie ins Leben zu verweben, im Leben selbst aber Anregungen für eine lebens- und wünschenswerte Zukunft zu geben. Mit seinem Zettelkasten greift Michael Ende eine alte literarische Tradition auf. Dieses Werkstattbuch vermittelt ein umfassendes Bild von einem Autor, der zu den wichtigsten Schriftstellern unserer Zeit gerechnet werden muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Ähnliche
Michael Ende
Zettelkasten
Skizzen & Notizen
Herausgegeben von Roman Hocke
Im Bergwerk der Bilder
In seinem Archiv hat Michael Ende über die vielen Jahrzehnte seiner schriftstellerischen Arbeit hinweg stapelweise beschriebene Zettel, Blätter, aber auch anderes, ausgefalleneres Schreibmaterial wie zum Beispiel Theaterkarten und Rechnungen angesammelt. Auf ihnen sind, teils handschriftlich, teils mit Schreibmaschine geschrieben, irgendwelche Romananfänge, Einfälle jeglicher Art, einzelne Szenen aus Theaterstücken wie auch zahlreiche Entwürfe zu neuen Geschichten notiert. Aber nicht allein auf Literarisches bin ich dabei gestoßen. In dem Archiv waren auf Notizblättern auch Gedanken und Überlegungen festgehalten, die ihn irgendwann einmal beschäftigt oder bewegt haben; selbst längere Abhandlungen über die unterschiedlichsten Themen fand ich vor.
Beim Durchblättern all dieser Aufzeichnungen wurde mir klar, dass die große Bandbreite an Möglichkeiten, die Vielgestaltigkeit seiner Texte, ein wesentliches Merkmal dieses Erzählers phantastischer Literatur ausmacht. Vor allem aber wirft das Nebeneinander von Bildern und Gedanken ein Licht auf ein spannungsreiches und vielleicht deswegen so ergiebiges Verhältnis: Michael Endes Bilderwelt, die mittlerweile durch sein Erzählwerk weltweit einem großen Publikum bekannt ist, scheint sich aus einer Gedankenwelt zu speisen, die zwar unbekannter, aber ebenso interessant und originell sein dürfte.
Das vorliegende Lesebuch will das Nebeneinander der beiden Welten aufzeigen, in denen Michael Ende literarisch zu Hause ist. Selbstverständlich konnte dabei nur ein wirklich winziger Teil des Archivs berücksichtigt werden. Gerade deswegen haben wir uns aber besonders bemüht, darin von allen verschiedenen Arten zumindest ein Beispiel zu vertreten, um die faszinierende Vielgestaltigkeit erleben zu lassen. So finden sich in dem Lesebuch phantastische Geschichten und Gedichte, Balladen und Lieder voller Poesie und Witz, Heiter-Humorvolles und Nonsenshaftes, aber auch Traumgesichte, die oft paradoxe Züge tragen oder ins Grotesk-Dämonische umschlagen. Um aber auch einen Eindruck zu verschaffen von der Gedankenwelt, aus der Michael Endes Phantasie sich entwickelt, haben wir zwischendurch Texte ganz anderer Art eingestreut: Beobachtungen und Überlegungen, Aphorismen und Nachdenkenswertes, die um Themen kreisen, die Michael Endes gedanklichen Kosmos bestimmen. Wie seine erzählerischen Texte auch, vermitteln sie eine überraschende Sichtweise auf die Welt und zeigen vermeintlich Selbstverständliches in einem neuen Licht.
Nur in Kenntnis der Wechselseitigkeit von Gedanken- und Bilderwelt gilt jener Satz, der da heißt, Michael Ende sei in den beiden so gegensätzlichen Welten zu Hause: In der realen Welt und in der Welt der Vorstellungen, die er selbst in einem seiner schönsten Bücher Phantásien genannt hat.
Roman Hocke
Eine ganz normale Geistergeschichte
Wir trafen uns damals meistens im Leopold, einem jener Schwabinger Lokale, die an Gemütlichkeit einem Bahnhofswartesaal 3. Klasse gleichkamen, aber den Vorteil hatten, um 12 Uhr nachts zu schließen. Man wurde einfach hinausgeworfen und das ersparte einem den eigenen Entschluss, nach Hause und ins Bett zu gehen, anstatt bis in die Morgenstunden herumzuhocken und immer noch ein Bier oder einen Wein zu trinken – weiß der Teufel warum und das war nicht nur eine Frage des zu erwartenden Katzenjammers am nächsten Tag, sondern vor allem des Geldes. Wir hatten alle keins. Aber ins Leopold konnte man gehen; es wurde geduldet, dass man stundenlang bei einem einzigen Glas Wein saß. So was gibt’s heute vermutlich nicht mehr. Jedenfalls traf man dort immer irgendeinen Bekannten, mit dem man ein bisschen diskutieren konnte (wir waren alle mehr oder weniger Existenzialisten zu jener Zeit, und wer sich’s leisten konnte, trug einen schwarzen Rollkragenpulli), und wenn wirklich einmal keiner der Freunde da war, musste man nur ein bisschen warten. Früher oder später kam schon einer.
An dem Abend, von dem ich erzählen will, war an unserem Stammtisch bereits eine ganze Gesellschaft versammelt. Da war der baumlange Maler Oskar P., der aus irgendeinem Grund Oki genannt wurde, mit seiner winzigen baltischen Frau, die für ihn das Geld verdiente, meistens etwas indigniert dreinblickte und Ökchen hieß. Eigentlich hieß sie Inge, aber da es zu viele Inges in unserem Kreis gab, kannte man sie nur unter diesem Namen. Dann war da der kleine Heinz H., ebenfalls Maler und Autodidakt, der Einzige unter uns, dem es gelungen war, mit zwei Frauen in relativer Harmonie zusammenzuleben, seiner norddeutschen rechtmäßigen Ehegattin und seiner österreichischen Zweitfrau. Die beiden waren auch da, die Ehefrau strickte, die Zweitfrau weinte gerade mal wieder ein bisschen (sie tat das oft und gern), weil er sie mit sonorer Stimme, die auch an den Nebentischen gut zu verstehen war, wegen irgendeines Bildungsmangels tadelte. Daneben saß Eberhard S., ein trotz seiner jungen Jahre bereits weitgehend glatzköpfiger Physiker von freundlicher Gemütsart, der bei Siemens angestellt war. Außerdem sah ich am Tisch noch zwei ungewöhnliche Gäste: Inge S., eine Schönheit um die vierzig, von Beruf Bardame in irgendeinem der noblen Münchner Hotels, eine Frau, die einen eigentümlich trägen, pantherhaften Sex-Appeal hatte. Mehr als die Hälfte der männlichen Jugend in Schwabing war durch ihre erotische Lehre gegangen, weshalb sie den Spitznamen Schulschiff trug. An diesem Abend hatte sie einen jungen Kerl dabei, einen Medizinstudenten – sie nannte ihn Butzi –, der uns allen schon nach kurzer Zeit ziemlich auf die Nerven ging, weil er auf reichlich penetrante Art pausenlos den Naturburschen mimte. Angeblich kam er vom Land, aus einer Bauernfamilie, und benahm sich, als müsse er uns gegenüber bayerische Urwüchsigkeit repräsentieren.
Ökchen versuchte ihn mit einigen spitzen Bemerkungen zu bremsen, aber Butzi überhörte sie oder wollte sie überhören. Nach und nach verstummten alle und ließen den Naturburschen ins Leere laufen, bis auch ihm die dummen Witze ausgingen. Das Schulschiff blickte auf die Uhr und meinte, dass es nun bald Zeit sei zu gehen. Ihre Arbeit begann um halb eins im Regina-Palast-Hotel. Der Abend schien endgültig verloren.
Es gibt eine probate Methode, wie man allzu heterogene oder langweilige Gesellschaften mit beinahe unfehlbarer Sicherheit in eine angeregte Gesprächsrunde verwandeln kann. Man sollte sie nicht allzu oft bei den gleichen Leuten anwenden, aber beim ersten Mal funktioniert sie so gut wie immer. Jeder, der will, kann sich selbst davon überzeugen. Ich stelle sie hiermit der Allgemeinheit zur Verfügung: Man braucht nur die Frage aufzuwerfen, ob es Spukphänomene, Gespenster und dergleichen wirklich gibt oder nicht. Innerhalb weniger Minuten hat sich die Gesellschaft zu einer Art Gerichtshof formiert, mit Staatsanwaltschaft, die den Standpunkt des aufgeklärten Rationalismus vertritt, Verteidigern, die meist Argumente aus irgendwelchen parapsychologischen Veröffentlichungen ins Feld führen, und Zeugen, die eigene, mehr oder weniger merkwürdige Erlebnisse zum Thema beisteuern. Die Unentschlossenen übernehmen sozusagen die Position der Geschworenen, auf sie wird von den verschiedenen Parteien eingeredet, um sie auf die jeweilige Seite zu ziehen.
Ich warf also meine Frage in die inzwischen lastende Stille, und der Versuch gelang wie erwartet. Es dauerte nicht lang, und die Tafelrunde befand sich mitten in einer hitzigen Diskussion.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass der urwüchsige Butzi mit Hohngelächter und angeberischen Reden auf das Thema reagieren würde, stattdessen bemerkte ich, dass er zusehends stiller wurde und irgendwie bedrückt wirkte. Schließlich beteiligte er sich überhaupt nicht mehr am Gespräch, saß nur da und starrte in sein Bierglas, das er mit beiden Händen festhielt.
Ich forderte ihn auf, uns doch seine Meinung zum Thema mitzuteilen, aber er schüttelte nur den Kopf. Jetzt wurden auch die anderen auf sein sonderbares Verhalten aufmerksam und drangen in ihn.
„Ich hab’s erlebt“, sagte er leise. „Ich lach nie wieder über so was. Früher hab ich drüber gelacht, aber das tu ich nie wieder. Ich hab’s erlebt.“
Jetzt war unsere Neugier natürlich erst recht angestachelt, und wir ließen nicht locker. Er versuchte abzulenken, aber wir gaben nicht nach. Als er schließlich einsehen musste, dass alle Gegenwehr vergebens war, begann er, anfangs stockend, dann immer hastiger zu erzählen, so als wolle er die Sache rasch hinter sich bringen.
„Das Ganze war ungefähr vor einem Jahr. Ja, ziemlich genau sogar vor einem Jahr, in den Semesterferien. Ich war mit einem Kommilitonen unterwegs, auch Medizinstudent, ein Kerl aus nobler Familie, Freiherr Lazarus von Altenberg, irgendwo aus dem Schwäbischen. Unter den Adeligen gibt’s ja heutzutage viele Habenichtse und ein paar Stinkreiche, die untereinander nicht verkehren. Er gehörte zu den Habenichtsen. Vielleicht war das der Grund, warum er vor nichts Respekt hatte. Er war der frechste Hund, den ich je gekannt habe. Wir waren Freunde. Ja, doch, ich glaube, das kann man behaupten. Wir waren dicke Freunde.
Also, wir hatten uns in den Semesterferien vor einem Jahr verabredet, gemeinsam eine vierzehntägige Wandertour durch die Schwäbische Alb zu unternehmen. Fragt mich aber jetzt nicht nach irgendwelchen geografischen Einzelheiten. Für so was habe ich mich nie interessiert, schon in der Schule nicht. Ich weiß also keinen einzigen Ortsnamen mehr, hab mir nichts gemerkt. Die Reiseroute hatte Lazi – so nannte ich ihn – sich vorher zurechtgelegt. Er wollte dabei irgendwelche Gegenden und Burgruinen aufsuchen, die vor, ich weiß nicht wie viel, Generationen einmal seinen Ahnen gehört hatten. Mich interessierte das eigentlich weniger, ich lief einfach so mit und überließ ihm die Entscheidung. Bei mir zu Hause gibt’s höhere Berge, und die Schwäbische Alb beeindruckte mich nicht besonders.
Die ersten paar Tage hatten wir mit dem Wetter ausgesprochenes Glück, es war warm und sonnig, und man konnte sogar baden. Dabei machte ich allerdings eine Entdeckung, die mich einigermaßen überraschte. Wir hatten unser Lager am Rand eines kleinen Waldsees aufgeschlagen, und ich stürzte mich sofort ins Wasser. Aber mein Freund weigerte sich stur, mir zu folgen. Ich kam wieder ans Ufer, um ihn zu holen, und wir rauften. Ich war der Stärkere und warf ihn von einem Bootssteg aus einfach hinein. Erst danach merkte ich, dass ich das nicht hätte tun sollen. Obwohl das Wasser ihm nur bis zum Bauch ging, bekam er einen regelrechten hysterischen Anfall. Ich musste ihn tatsächlich mit Gewalt herausziehen. Nicht nur, dass er nicht schwimmen konnte, das Wasser versetzte ihn in eine Art besinnungslose Panik, so wie andere Leute Klaustrophobie oder Höhenangst haben. Warum das so war, wusste er selbst nicht oder wollte es mir nicht sagen. Na gut, von da an badete ich eben allein, wenn sich die Möglichkeit ergab, und ließ ihn in Ruhe.
Ungefähr nach einer Woche verschlechterte sich das Wetter. Es fing an zu regnen und hörte überhaupt nicht wieder auf. Wir liefen nur noch möglichst geradewegs von einer Unterkunft zur nächsten und kamen dort meistens völlig durchweicht und frierend an. Die Sache war nicht mehr sehr lustig, aber mein Freund bestand darauf, weiterzumachen. Vielleicht würde das Wetter bald wieder aufklaren. Das tat es aber keineswegs, es wurde eher noch schlechter.
Einmal kamen wir unterwegs an einen Waldsteg, der über einen Bach führen sollte. Aber der Bach war inzwischen zu einem reißenden Wildwasser angeschwollen, und der Holzsteg war weggerissen worden. Ich schlug vor, an einer schmalen Stelle zu versuchen, durch das Wasser auf die andere Seite zu kommen, aber mein Freund war dazu nicht bereit. Er zog seine Karte heraus, die schon ziemlich aufgeweicht war, und meinte dann, stromabwärts in ein paar Kilometern Entfernung gäbe es eine größere Brücke. Wir machten uns also auf den Weg.
Um es kurz zu machen: Wir fanden die Brücke nicht. Wahrscheinlich hatte Lazi den Bach auf der Karte mit einem anderen verwechselt. Es wurde schon dunkel und wir irrten noch immer im Wald herum. Schließlich mussten wir uns eingestehen, dass wir uns total verirrt hatten. Wir wussten nicht mehr, wo wir waren.
Wäre das Wetter danach gewesen, dann hätten wir uns einfach ein Feuer gemacht und im Freien übernachtet, aber es regnete weiter in Strömen. Es gab auch keine Höhle oder irgendeinen anderen Unterschlupf; die Sache fing an, ziemlich ungemütlich zu werden. Wir stolperten weiter durch die Dunkelheit in der Hoffnung, eine Ortschaft oder wenigstens eine Straße zu finden, denn schließlich ist die Schwäbische Alb ja nicht der brasilianische Urwald.
Gegen zehn Uhr nachts stießen wir tatsächlich auf eine kleine Ortschaft, die wie ausgestorben wirkte. In keinem der Häuser sahen wir Licht, einen Gasthof, wo wir ein Zimmer hätten nehmen können, schien es nicht zu geben. Mein Freund verfluchte laut alle schwäbischen Tugenden, vor allem die Sparsamkeit, die die Landeskinder dazu brachte, mit den Hühnern ins Bett zu gehen.
Schließlich entdeckten wir doch einen schwachen Lichtschein, der durch die Ritzen geschlossener Fensterläden drang. Sie gehörten zu einem großen, altertümlichen Haus direkt neben der kleinen Kirche im Zentrum des Ortes. Offensichtlich handelte es sich um das Pfarrhaus. Wir klingelten, und da das nichts nützte, hämmerten wir gegen die Tür.
Es dauerte eine Weile, bis sie geöffnet wurde.
Vor uns stand ein kleiner, dicklicher Mann in einem vielfach geflickten Schlafrock. Er hatte eine Stirnglatze, der Rest seiner weißen Haare hing ihm bis auf die Schultern herab. Sein Gesicht wirkte irgendwie teigig, aber er blickte uns freundlich an, und während wir unsere Situation erklärten und unsere Bitte um Unterkunft vorbrachten, hielt er den Kopf schräg und die Hand ans rechte Ohr. Es war klar, dass er ziemlich schwerhörig war. Als er uns endlich verstanden hatte, bat er uns ins Haus.
Er schlurfte vor uns her durch einen ungeheuer weitläufigen dunklen Flur, dessen Boden gefliest war, in sein Arbeitszimmer, in dem es pestilenzialisch nach schlechtem Pfeifentabak stank. Dort brannte auf dem Schreibtisch eine einzige Lampe mit grünem Schirm. Er setzte sich dahinter und forderte uns auf, auf dem Sofa Platz zu nehmen.
Es stellte sich heraus, dass wir richtig vermutet hatten. Er war tatsächlich der Pfarrer des Ortes und hieß Magerle – was meinem Freund ein glucksendes Kichern entlockte, das der Mann aber nicht hörte. Wir stellten uns ebenfalls vor, und er fragte uns ein bisschen aus, nach unserer Herkunft und unserem Studium und so weiter. Wir gaben ihm bereitwillig Auskunft und schließlich schien er zufrieden. Er entschuldigte sich, dass er uns nichts anbieten könne, da seine Hausbesorgerin schon um sieben Uhr gegangen sei, wie immer, und wir beeilten uns, ihm zu versichern, dass wir genügend eigenen Proviant dabeihätten und ihn überhaupt nicht weiter stören wollten, wenn er uns nur freundlicherweise eine Möglichkeit der Übernachtung bieten könne. Wir seien mit allem einverstanden und stellten überhaupt keine Ansprüche.
Er versank in Schweigen und schaute uns nur eine ganze Weile lang nachdenklich an. Ich nahm an, er habe unsere Bitte vielleicht nicht verstanden, und wiederholte sie noch einmal lauter. Er nickte lächelnd, zündete sich seine Pfeife an und paffte vor sich hin. Dann räusperte er sich und sagte: ‚Ich habe im ersten Stockwerk, gerade hier über uns, ein Gästezimmer mit zwei Betten und einem Waschbecken. Ich stelle es Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie es wollen, meine Herren. Ich muss Sie aber vorher darauf aufmerksam machen, dass es in diesem Hause spukt.‘
Wir schauten uns an, mein Freund grinste und fragte: ‚Was tut es?‘
‚Es spukt‘, antwortete Herr Magerle freundlich. ‚Sie wissen doch, was das heißt, nicht wahr? Ein Gespenst geht um in diesem Haus. Es ist übrigens harmlos und tut niemandem etwas zuleide. Es macht sich eben nur zu schaffen, niemand weiß, was und warum – vor allem dort oben. Deshalb wohne und schlafe ich hier unten. Das hat schon mein Vorgänger so gehalten und dessen Vorgänger. Es kommt jede Nacht zwischen zwölf und eins.‘
‚Na klar‘, rutschte es mir heraus. ‚Wann denn sonst!‘
Der Pfarrer schaute mich lächelnd an. ‚Ich scherze keineswegs, mein lieber junger Herr. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie vorbereitet sind, denn es ist nicht jedermanns Sache, solche Dinge zu erleben. Es ist wirklich etwas ganz anderes, als wenn man nur darüber liest. Jetzt steht das Zimmer ja schon seit Langem leer, aber früher ist es ein paarmal vorgekommen, dass Gäste Nervenzusammenbrüche oder Herzanfälle erlitten, nur aus Angst, denn, wie gesagt, der Spuk tut keinem etwas zuleide. Wenn diese Tatsache Sie beide also nicht weiter stört, meine Herren, dann können Sie meinetwegen gern die Betten benützen.‘
‚Nein, wirklich‘, sagten wir beide, fast wie aus einem Mund. ‚So was stört uns bestimmt nicht.‘
Wieder betrachtete uns Pfarrer Magerle ein Weilchen und sog an seiner Pfeife. Schließlich nickt er.
‚Sie sind Mediziner, Naturwissenschaftler, und vielleicht werden Sie die Frage eines alten Geistlichen vom Lande ein wenig lächerlich finden, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Können Sie beten?‘
‚Wie meinen Sie das?‘, fragte ich.
‚Nun ja, zum Beispiel das Vaterunser.‘
‚Ehrlich gesagt‘, antwortete mein Freund lachend, ‚ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenkriege. Der Religionsunterricht ist leider schon ein Weilchen her.‘
‚Versuchen Sie’s‘, erwiderte Herr Magerle ernst. ‚Es hilft manchmal.‘
Dann forderte er uns auf, ihm zu folgen.
Wir gingen auf den Flur hinaus. Dort führte eine breite Treppe aus altersschwarzem Eichenholz ins erste Stockwerk hinauf. Der Flur dort oben war etwas schmaler, und sein Dielenboden knarrte, als wir an einer Reihe von Türen entlanggingen. Unser Gastgeber öffnete die letzte und knipste das Licht an.
‚Das hier ist Ihr Zimmer, bitte sehr, meine Herren.‘
Wir traten in einen ziemlich großen, aber niedrigen Raum mit Balkendecke. Es roch muffig und nach Staub. In der Wand, die der Tür gegenüberlag, gab es ein Fenster, die schweren Vorhänge waren zugezogen. An der linken Wand, nur durch ein Nachttischchen getrennt, standen zwei mächtige Holzbetten, die gewaltigen Plumeaus und die Kissen waren nicht überzogen. Daneben gab es ein Waschbecken an der Wand mit nur einem Wasserhahn. Gegenüber, in der rechten Wand, befand sich ein großer offener Kamin, in dem Holz aufgeschichtet war. An den freien Stellen standen Regale voller alter, verstaubter Bücher und in der Ecke zwischen dem Fenster und dem Kamin befand sich eine Art Stehpult, auf dem eine große, ledergebundene Bibel lag.
‚Tut mir leid‘, sagte Herr Magerle, ‚dass die Betten nicht überzogen sind, aber, wie gesagt, meine Hausbesorgerin ist schon gegangen, und ich weiß nicht, wo sie die Bezüge aufbewahrt. Wir haben eben nicht damit gerechnet …‘
‚Oh, machen Sie sich keine Sorge‘, unterbrach ich ihn. ‚Wir kommen sehr gut so zurecht. Wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar.‘
Ich war inzwischen hundemüde und wollte endlich schlafen.
Der Pfarrer ging zur Tür und steckte den Schlüssel in das große, altertümliche Eisenschloss. ‚Ich lasse ihn hier innen stecken‘, erklärte er, ‚falls Sie lieber abschließen wollen. Obwohl …‘
‚Danke sehr‘, sagte mein Freund laut. ‚Das wird nicht nötig sein.‘
‚Also dann, ich wünsche eine gute Nacht‘, murmelte der Alte und öffnete die Tür. Aber er drehte sich noch einmal um und fügte hinzu: ‚Es ist ein wenig kalt hier, und wenn Sie wollen, können Sie gern den Kamin anzünden. Es ist genügend Holz da.‘
‚Sehr freundlich, Herr Pfarrer‘, rief ich, ‚und ebenfalls recht gute Nacht.‘
Die Tür schloss sich und wir schauten uns an und brachen in ein ziemlich albernes Gelächter aus. Wir hatten es bisher nur mit Mühe unterdrückt.
‚Das gibt’s nicht!‘, rief mein Freund und warf sich auf eines der Betten, ‚also das gibt’s doch einfach nicht! Oh, ich liebe meine Schwaben und ihre dichterische Phantasie! Glaubst du, man würde einen solchen Typ noch irgendwo sonst auf der Welt finden?‘
‚Weißt du was‘, sagte ich und setzte mich zu ihm. ‚Ich hab den Eindruck, der verrückte Kerl glaubt selber daran.‘
‚Ach was!‘, antwortete Lazi. ‚Da kennst du diese Art von Schlitzohr schlecht. Er lacht sich ins Fäustchen, weil er meint, dass er uns Angst gemacht hat.‘
‚Nein, im Ernst‘, beharrte ich, ‚der hat nicht gelogen. Der spinnt einfach.‘
Mein Freund richtete sich auf.
‚Du glaubst, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat?‘
‚Ja, genau.‘
Lazi hockte sich vor den Kamin und zündete die vorbereiteten Holzspäne an. Die Flämmchen leckten an den Buchenscheiten empor, und das Feuer begann zu prasseln.
‚Irgendwie kommt mir das komisch vor‘, sagte mein Freund. ‚Das sieht doch fast aus, als ob er Gäste erwartet hätte.‘
Ich musste gähnen. ‚Nicht unbedingt. Die Betten sind nicht überzogen und nicht mal ein Butterbrot oder ein Glas Bier.‘
Wir zogen unsere nassen Sachen aus und hängten sie über zwei Stühle, die wir in die Nähe des Feuers stellten. Es wurde schon langsam angenehm warm im Zimmer. Wir holten unsere Trainingsanzüge aus unseren Rucksäcken, auch trockene Wollsocken und schlüpften hinein. Dann packten wir unseren Proviant und unsere Thermosflaschen aus und aßen und tranken. Irgendwo im Haus schlug eine Standuhr elf Mal.
Lazi kicherte plötzlich. ‚Weißt du was‘, sagte er kauend, ‚ganz gleich, ob der alte Kauz verrückt ist oder nur so tut, ich bin fast sicher, dass er irgendeine Schau veranstalten wird, so mit Bettlaken und Huhu! und Bubu! Wir sollten ihm eine kleine Lehre erteilen, damit er sich’s in Zukunft überlegt, ob sich das Spuken für ihn lohnt. Was hältst du davon?‘
‚Meinetwegen‘, antwortete ich, schon halb schlafend.
Jeder von uns hatte eine große Stablampe dabei, die legten wir uns auf dem Nachttischchen zurecht. Lazi löschte das elektrische Licht und wir krochen beide unter unsere Plumeaus. Das Zimmer war nur noch vom Schein der zuckenden Flammen erleuchtet und draußen rauschte noch immer der Regen.
Ich musste wohl eingeschlafen sein, denn plötzlich fühlte ich, wie Lazi mich schüttelte und dicht an meinem Ohr flüsterte: ‚He, wach auf! Ich glaub, es geht los.‘
Ich konnte nur schwer zu mir kommen und wusste im ersten Moment nicht mehr, wo ich war.
‚Was ist denn?‘, murmelte ich. ‚Lass mich doch in Ruhe.‘
‚Hör doch mal!‘, raunte mein Freund.
Das Geräusch kam offenbar unten aus dem Flur mit den Steinfliesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich’s beschreiben soll. Es klang so ähnlich wie kleine, nachhallende Explosionen, in unregelmäßigen Abständen – oder als schlage jemand mit einer Eisenstange auf den Boden –, oder, nun ja, wie schwere, langsame, irgendwie taumelnde Schritte von metallenen Schuhen.
‚Das ist er‘, zischelte mein Freund. ‚Wenn er die Treppe heraufkommt, werfen wir ihn runter. Los!‘
Ich hielt ihn zurück. ‚Nein, du, runterwerfen nicht! Das könnte böse ausgehen.‘
‚Na, dann jagen wir ihm einfach einen Schreck ein. Nun komm schon!‘
Wir schnappten uns unsere Stablampen, öffneten leise die Tür und schlichen auf den stockfinsteren Flur hinaus. Dort tasteten wir uns an der Wand entlang bis zur breiten Eichenholztreppe und stellten uns am obersten Absatz nebeneinander auf.
‚Auf eins, zwei, drei – Licht anknipsen!‘, wisperte mir Lazi ins Ohr.
Wir hielten unsere Lampen bereit.
Die schweren Schritte, oder wie immer man es eben nennen will, kamen langsam auf die Treppe zu. Dazwischen hörte man jetzt noch ein eigentümliches, schleifendes oder auch klirrendes Geräusch und eine Art Keuchen, ein lang gezogenes, rasselndes Atmen wie bei einem schweren Fall von Asthma, und trotzdem war es – ich weiß nicht, wie ich sagen soll – nicht richtig räumlich, ich meine, es hatte so etwas wie einen Nachhall, ein Echo von anderswoher.
Jetzt kam das Geräusch mit zermürbender Langsamkeit die Stufen der Treppe herauf, die knarrten, als ob sie sich unter einer ungeheuer schweren Last durchbögen, Schritt für Schritt.
Als es etwa die Mitte der Treppe erreicht hatte, flüsterte Lazi mir ins Ohr: ‚Achtung! Eins – zwei – drei!‘
Gleichzeitig knipsten wir unsere Stablampen an. Die blendenden Lichtkegel erleuchteten die Treppe taghell – aber da war nichts. Da war absolut nichts, nur das Geräusch kam weiter auf uns zu, Stufe um Stufe.
Völlig kopflos von der augenblicklichen Panik, die uns beide gepackt hatte, rasten wir in unser Zimmer zurück, schlugen die schwere Tür hinter uns zu, und mein Freund drehte den großen Schlüssel mehrmals um. Dann sprangen wir in unsere Betten, zogen uns mit der einen Hand die Plumeaus bis zum Kinn und hielten mit der anderen den Scheinwerferkegel unserer Lampen auf die Tür gerichtet.
Die Schritte, oder was es eben war, kamen heran und hielten dann plötzlich inne. Es wurde ganz still, selbst das Feuer im Kamin hörte auf zu knistern, nur das gleichmäßige Rauschen des Regens draußen war noch zu hören. Ich weiß nicht, wie lang diese Stille anhielt, aber ich glaube, es waren mindestens zehn Minuten. Ich hoffte schon, dass die ganze Sache vielleicht vorbei sei, da hörte ich, dass meinem Freund die Zähne klapperten. Ich brachte es aber nicht fertig, zu ihm hinzuschauen, sondern starrte wie hypnotisiert auf die Tür. Und dann bemerkte ich es ebenfalls, was er offenbar schon vor mir gesehen hatte: Die schweren geschnitzten Bretter begannen sich durchzubiegen, die ganze Tür wölbte sich nach innen, als wäre sie aus Gummi, aber ohne jedes Geräusch, immer wieder und wieder, und der furchtbare Druck von außen schien jedes Mal stärker zu werden. Ich fühlte, wie mir der kalte Schweiß von der Nase tropfte.
Dann hörte es plötzlich auf, als sei die Kraft erschöpft, einen Augenblick geschah gar nichts mehr, aber dann ging ein Hagel von Schlägen gegen die Tür los, als ob zehn riesige Kerle in rasender Wut mit schweren Hämmern und Eisenstangen auf das Holz eindreschen würden. Ich dachte, der ganze Türrahmen müsse aus der Wand brechen, aber diesmal bewegte sich nichts, der Türflügel zitterte nicht einmal.
Wieder blieb es längere Zeit still, dann sah ich, wie der Eisenschlüssel, der noch immer im Schloss steckte, sich langsam und ruckweise drehte. Meine Kopfhaut prickelte, weil sich mir buchstäblich die Haare sträubten. Der Riegel des Schlosses sprang zurück, die Klinke wurde niedergedrückt, und Zentimeter für Zentimeter öffnete sich die Tür, bis sie ganz offen stand.
Im gleichen Moment wurde es eiskalt im Zimmer. Ich meine, nicht mir wurde kalt, sondern tatsächlich wurde die Luft im Raum so frostig, dass ich meinen eigenen Atem, der nur noch stoßweise ging, vor meinem Gesicht sah. Dann erloschen die Flammen im Kamin, nur noch eine schwelende Glut blieb zurück. Die Lichtkegel unserer Stablampen zitterten, wir konnten sie kaum noch halten.
Das seltsame, rasselnde Keuchen mit dem unirdischen Nachhall setzte wieder ein und die schweren, schleifenden Schritte kamen ins Zimmer. Sie näherten sich dem Fußende meines Bettes und hielten dort inne. Ich weiß nicht, wie lang das dauerte, mir kam es vor, als seien es Stunden. Dann wandten sich die Schritte zu Lazis Bett und blieben dort stehen. Jetzt konnte ich zum ersten Mal einen Blick auf sein Gesicht werfen, und ich erkannte ihn kaum wieder, so verzerrt war es. Die Augen traten ihm aus dem Kopf und der Mund war aufgerissen, als sei er am Ersticken. Ich wollte ihn anrufen, brachte aber selbst keinen Laut heraus.
Schließlich drehten sich die Schritte von ihm weg und gingen schleppend zu dem Stehpult in der Ecke hinüber. Ich sah, wie sich die große Bibel wie von selbst aufschlug, dann wurden die Seiten hin und her gewendet, als ob ein heftiger Wind sie bewege. Die ganze Zeit über war das rasselnde Keuchen zu hören. Nach einer Weile hörte das gespenstische Blättern auf und aus dem Kamin erhob sich ein Stück glimmender Holzkohle, schwebte durch den Raum und senkte sich auf eine Seite des Buches, wo es hin und her rutschte und sich dann mit einem kleinen Knall in Funken auflöste.
Die schweren Schritte gingen durch das Zimmer, blieben noch einmal vor Lazis Bett stehen, hinkten dann zur Tür hinaus, die krachend zuschlug, und verhallten nach und nach irgendwo im Haus. Das Feuer im Kamin brannte wieder hell, als wäre es nie ausgegangen, und im Raum war es angenehm warm.
Der Spuk war vorbei.
Als Erstes kümmerte ich mich um Lazi, um den es ziemlich schlecht stand. Er war in seine Kissen zurückgefallen, sein Gesicht war grünlich, seine Augen verdreht, sodass man nur noch das Weiße sah, und sein Puls war praktisch nicht mehr vorhanden. Ich rieb seine Hände, klopfte seine Backen und rief ihn an, aber es dauerte ein Weilchen, ehe er halbwegs wieder zu Bewusstsein kam. Zum Glück hatte ich im Rucksack noch eine kleine Taschenflasche mit ein bisschen Enzian-Schnaps, davon flößte ich ihm ein paar Schlucke ein.
Als es ihm schließlich etwas besser ging und er aufstehen konnte, untersuchten wir als Erstes die Tür. Sie war abgeschlossen. Wir schauten uns nur stumm an und Lazi schüttelte immerzu den Kopf. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber wir unterhielten uns nur flüsternd.
Dann gingen wir zu der Bibel, die noch immer aufgeschlagen auf dem Stehpult lag. Am Rand befand sich auf der einen Seite ein Brandfleck und eine Textstelle war mit Holzkohle unterstrichen. Sie lautete: Vater Abraham, sende doch Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers in Wasser tauche und netze meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme.
Ich musste meinen Freund festhalten, denn die Beine knickten plötzlich unter ihm ein. Ich schleppte ihn in sein Bett zurück und gab ihm noch etwas Enzian, den letzten Rest gönnte ich mir selber.
‚Ich will hier weg‘, wisperte Lazi immerzu. ‚Nur raus hier! Bitte, lass uns abhauen, sofort …‘
Draußen rauschte noch immer der Regen, es war stockfinstere Nacht, wir hätten sowieso nicht gewusst wohin, also versuchte ich meinen Freund zu beruhigen, so gut es ging. Ich zog mir einen Stuhl an sein Bett und hielt seine Hand, bis er schließlich in einen erschöpfenden Dämmerschlaf fiel. So verbrachten wir den Rest der Nacht.
Am nächsten Morgen empfing uns Pfarrer Magerle mit einem reichlichen Frühstück. Die Hausbesorgerin war inzwischen da und hatte alles vorbereitet. Eine ältere, hagere Frau mit Schnurrbartanflug und auffallend großen Schuhen, die uns grußlos den Kaffee auf den Tisch stellte und wieder verschwand.
Der alte Kauz sah uns prüfend an, während wir ohne großen Appetit die Mahlzeit einnahmen. Auf seinem teigigen Gesicht lag das gleiche Lächeln wie am Abend zuvor.
‚Haben die jungen Herren gut geschlafen?‘, erkundigte er sich.
Lazi verhielt sich schweigsam, also antwortete ich: ‚Das kann man nicht gerade behaupten.‘
Der Pfarrer nickte. ‚Das dachte ich mir.‘
‚Haben Sie denn nichts gehört von dem – Heidenkrach?‘, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. ‚Nein, man hört nie etwas davon im übrigen Haus. Nicht mal im Nebenzimmer.‘
Er schien darauf zu warten, dass wir etwas erzählten, aber keiner von uns beiden hatte Lust dazu. Erst als wir fertig waren, sagte ich: ‚Übrigens, das Brandloch in der alten Bibel – also, das ist nicht unsere Schuld.‘
‚Schuld?‘, fragte er. ‚Was meinen Sie damit?‘
‚Na ja, ich wollte nur sagen – wir haben es nicht verursacht.‘
Magerle heftete seine Augen auf Lazi und sagte leise: ‚Das ist etwas anderes.‘
Da mein Freund immer noch nichts sagte, bedankte ich mich für die erwiesene Gastfreundschaft und wir brachen auf.
Der Morgen war windig und ziemlich kühl, aber es hatte aufgehört zu regnen.
Nach einem Weg von etwa einer Stunde kamen wir zu einer Bahnstation und stiegen in den nächsten Zug. Stillschweigend waren wir uns einig, unsere Wandertour abzubrechen. Wir fuhren nach München zurück. Lazi sagte während der ganzen Fahrt kein Wort.“
Der Erzähler trank sein Bierglas auf einen Zug leer und lehnte sich zurück.
Unter seinen Zuhörern fing ein geraunter Meinungsaustausch an. Die Erstfrau nahm ihre Strickarbeit wieder auf, die sie zuletzt hatte sinken lassen.
„Also, ich weiß nicht recht“, sagte Oki zu seiner Frau, die ihn mit geflüsterten Fragen bedrängte.
Eberhard S., der Physiker, lächelte sardonisch.
Das Schulschiff betrachtete Butzi mit einem gewissen überraschten Besitzerstolz, als habe sie jetzt erst bemerkt, was für ein rares Exemplar sie da aufgegabelt hatte, und fragte: „Ist deine Geschichte zu Ende?“
„Ja“, antwortete er. „Meine ist zu Ende, aber die eigentliche Geschichte fängt jetzt erst an. Nur kann ich sie nicht erzählen, weil ich sie nicht weiß. Sie betrifft Lazarus.“
„Wieso?“, fragte Heinz H. „Was war denn mit ihm?“
„Ich habe kaum etwas aus ihm herauskriegen können“, antwortete Butzi, der plötzlich müde wirkte und keine Lust mehr zu haben schien, weiterzureden. „Nach unserem gemeinsamen Erlebnis habe ich ihn kaum noch gesehen. Er ging mir aus dem Weg, ich weiß nicht, warum. Das Einzige, was ich erfahren habe, ist, dass es da vor mehreren Generationen irgendeinen Vorfahren von ihm in der Gegend gab, der seinen eigenen Bruder ersäuft hat, um in den Alleinbesitz des Familienvermögens zu kommen. Die Sache ist aber nie geklärt worden, weil man die Leiche nicht gefunden hat. Die Witwe des Ermordeten zwang er, ihn zu heiraten. Aus dieser fluchbeladenen Verbindung entstammte ein einziger Sohn, der dann der Ururahn meines Freundes wurde. Was die ganze Angelegenheit mit dem alten Pfarrhaus zu tun hat – ich habe keine Ahnung.“
„Aber das wär doch grad interessant!“, rief die österreichische Nebenfrau. „Fragen S’ ihn doch unbedingt.“
Butzi verzog sein Gesicht zu einem freudlosen Grinsen. „Das würde ich schon tun, wenn ich könnte. Aber leider kann ich’s nicht mehr. Mein Freund ist tot.“
Einen Moment lang herrschte betroffenes Schweigen.
„Wie ist er denn gestorben?“, fragte Ökchen.
Butzi zögerte, offenbar mochte er nicht antworten.
„Eine Krankheit?“, drang Ökchen in ihn. „Ein Unfall? Oder Selbstmord?“
Butzi drehte das leere Bierglas zwischen seinen Händen und sagte leise: „Er ist ertrunken – in einer Waschschüssel.“
Die Zuhörer wechselten Blicke und schienen bereit, in schallendes Gelächter auszubrechen, aber Butzis Gesichtsausdruck hielt alle zurück. Er schien ganz und gar keinen Spaß gemacht zu haben, er war sogar etwas blass geworden und hatte rote Flecken auf den Backen.
„Was soll das heißen?“, fragte der kleine Heinz H. ein wenig zu laut.
Butzi atmete tief durch und sagte, ohne einen von uns anzusehen: „Ich war ja nicht dabei, also weiß ich nicht, wie es passiert ist. Das war vor zwei Monaten. Er wohnte in der Amalienstraße, in der Nähe der Universität. Seine Studentenbude hatte ein Fenster, das nach hinten hinausging, zum Hof. Kostete nicht viel, weil er ja kein Geld hatte. Ein winziges Zimmer ohne Heizung und eigenes Wasser. Offenbar hatte er seine Waschschüssel aufs Fensterbrett gestellt und sich da bei offenem Fenster gewaschen. Das Rollo konnte man mit einem Riemen an der Wand rauf und runter lassen. Es war alt und verrostet und aus irgendeinem Grund muss der Riemen gerissen sein. Das Rollo hat ihn wahrscheinlich wie ein Fallbeil ins Genick getroffen und seinen Kopf in die Waschschüssel gedrückt. Als man ihn einen Tag später fand, konnte man es kaum hochkriegen.“
Butzi blickte auf und schaute uns der Reihe nach an. „Tja“, sagte er mit einem angestrengten Lächeln, „das ist alles. Mehr weiß ich nicht.“
Unsere Kellnerin, die dicke Zenzi, kam an unseren Tisch und forderte uns barsch auf, auszutrinken und zu zahlen. „Feierabend, meine Herrschaften! Unsereins will auch endlich heim und ins Bett, und morgen früh ist die Nacht rum. Ihr seid’s eh immer die Letzten.“
Tatsächlich war das Leopold inzwischen leer. Wir zahlten und gingen. Butzi wurde vom Schulschiff im Auto mitgenommen. Eberhard S. und ich gingen noch ein Stück gemeinsam, weil wir den gleichen Weg hatten. Wir schwiegen beide, bis wir vor seiner Haustür angelangt waren.
„Wie fandest du denn die Geschichte?“, fragte ich.
„Na ja“, sagte er. „Eine ganz normale Geistergeschichte. Die Schritte, der rasselnde Atem, die plötzliche Kälte – lauter Klischees, die man aus hundert anderen Storys kennt. Nicht besonders originell, außer der Sache mit der Waschschüssel vielleicht.“
„So sind die Phänomene eben“, wandte ich ein. „In allen Berichten sind es immer die gleichen. Das spricht eigentlich für ihre Authentizität.“
„Willst du damit etwa sagen, dass du ihm die Geschichte glaubst?“
Ich nickte. „Und du?“
Er lachte und klopfte mir auf die Schulter. „Nein, mein Lieber, und an den Weihnachtsmann glaube ich auch nicht, wenn du mir’s nicht übel nimmst. Aber ich muss zugeben, dass er’s spannend gemacht hat. Immerhin, das hätte ich ihm vorher nicht zugetraut. Schlaf gut! Servus – bis bald.“
„Servus“, sagte ich. „Schlaf auch gut.“
Und ich überlegte mir, wo ich noch hingehen könnte, um unter Leuten zu sein.
Nieselpriem und Naselküss
Auf seiner Suche nach dem sagenumwobenen Lande Unsinnsibar entdeckte der weltberühmte Juxologe und Quatschonom Stanislaus Stups eines Tages mitten im Ozean eine Insel, die auf keiner Karte verzeichnet stand. Er befahl dem Kapitän seines Schiffes, vor der Küste Anker zu werfen, und ruderte mit einem Boot allein an Land.
Die ganze Insel hatte die Gestalt eines spitzen, ultramarinblauen Hutes. Der Strand war sozusagen die Krempe und nur zwanzig oder dreißig Meter breit, dahinter erhob sich ein kegelförmiger Berg aus rissigem Gestein. Irgendwelche Pflanzen schien es nicht zu geben, weder Bäume oder Büsche, noch Gras oder Moos.
Als Stups um den Berg herumging und abzuschätzen versuchte, wie hoch er wohl sein mochte, stand er plötzlich vor einem Wegweiser, der nach zwei Richtungen wies. Auf dem Arm, der nach rechts zeigte, stand „Zum Nieselpriem“, der andere trug die Aufschrift „Zum Naselküss“.
Stups konnte sich zunächst nicht entscheiden, in welche Richtung er gehen sollte, denn er vermochte sich weder unter dem einen noch unter dem anderen Namen etwas vorzustellen. Doch dann entdeckte er etwas, das ihm die Wahl leicht machte: Es gab überhaupt nur einen Weg, nämlich den nach rechts. Auf der linken Seite, also dort, wo es zum Naselküss ging, lag nur unwegsames, schwer zu erkletterndes Felsgelände.
Stups entschied sich also für die bequeme, gut ausgebaute Straße zum Nieselpriem, die immer rechts herum in einer großen Spirale um den Bergkegel aufwärts führte. Offenbar wohnte dieser Nieselpriem oben auf dem Gipfel.
Nachdem er etwa in halber Höhe angelangt war, blieb der Forschungsreisende stehen, um zu verschnaufen und zurückzublicken. Er blickte hinunter auf das Schiff, das draußen im Meer vor Anker lag, er sah auch das kleine Boot am Strand – aber wo war die Straße, auf der er gekommen war? Es gab keine Straße mehr, sie war spurlos verschwunden. Das heißt, hinter ihm gab es keine Straße mehr, denn das Stück, das noch vor ihm lag und sich bis zum Gipfel hinaufwand, war zweifellos vorhanden. Diese Entdeckung befremdete den Forscher, er hatte das ungute Gefühl, in eine Falle zu gehen.
Vorsichtig und Schritt für Schritt stieg er weiter bergan, wobei er immer wieder über die Schulter hinter sich blickte, und tatsächlich, er konnte beobachten, wie unmittelbar hinter seinen Fersen der Weg undeutlich wurde und verschwand, so spurlos verschwand, als sei er nie vorhanden gewesen. Stups hielt inne und überlegte. Sollte er überhaupt weitergehen, oder war es nicht ratsamer, umzukehren? Aber umkehren, das hieß, über den rissigen, blauen Fels hinunterzuklettern. Wenn er dabei den Halt verlor, würde er abstürzen und sich Hals und Bein brechen. Außerdem, so sagte sich Stups, war dieser eine sonderbare Umstand mit dem verschwindenden Weg noch kein ausreichender Grund aufzugeben. Die Entdeckung des sagenumwobenen Landes Unsinnsibar würde ihn sicherlich noch vor weitaus schwierigere Aufgaben stellen. Es war ja auch durchaus nicht gesagt, dass die Sache wirklich bedrohlich war, bisher jedenfalls war ihm schließlich noch nichts Schlimmes dabei zugestoßen.
Er fasste sich also ein Herz und stieg weiter aufwärts. Die Wegspirale wurde immer enger, je näher er dem Gipfel kam, und als er die letzte Biegung hinter sich hatte, stand er unversehens vor einer kleinen, kreisrunden Holzhütte von ziemlich ärmlichem Aussehen. Der Weg endete vor der Tür dieser Hütte.
Stups trat näher und fand auf der Tür ein Schild mit der Aufschrift:
Nieselpriem
Besuche herzlich erwünscht, aber sinnlos
Bitte mindestens siebenmal klopfen!
Stups pochte also siebenmal, und dann, wegen des Wörtchens „mindestens“, noch weitere dreimal. Danach lauschte er und hörte aus dem Inneren der Hütte ein Geräusch näher kommen, das wie das Bimmeln zahlloser Glöckchen klang. Die Tür öffnete sich und in ihr stand eine höchst seltsame Gestalt. Es war ein kleiner Mann, kaum größer als Stups selbst, in einem knallroten Anzug, mit einem ebenso knallroten Zylinderhut auf dem Kopf und einem gewaltigen schwarzen Schnurrbart unter der dicken Nase, dessen Spitzen einen halben Meter nach links und nach rechts wegstanden wie zwei Türkensäbel. An Armen und Beinen, an der Krempe seines Hutes, an beiden Ohren, ja selbst an den Spitzen seines Schnurrbartes hingen silberne Schellen, die bei jeder Bewegung klingelten. Und an Bewegung ließ es der sonderbare Kerl nicht fehlen. Er hüpfte und zappelte fast ohne Unterbrechung. Dabei blickte er allerdings so jämmerlich und todtraurig drein, als sei ihm ganz und gar nicht nach Hüpfen zumute.
„Aha!“, rief er, als er des Forschungsreisenden ansichtig wurde. „Da steht zweifellos ein Besucher. Das hilft mir zwar nichts, aber ich möchte doch zumindest wissen, mit wem ich die Ehre habe.“
„Stups“, sagte Stups mit einer kleinen Verbeugung. „Stanislaus Stups, Juxonom und Quatschologe auf einer wichtigen Entdeckungsreise.“
„Jammerschade!“, antwortete der seltsame Bursche und machte einen Sprung, der alle Schellen bimmeln ließ. „Ich bin der Nieselpriem, aber es ist nicht der Mühe wert, verehrter Herr, dass Sie sich das zu merken versuchen. Lassen Sie’s sein!“
„Was ist jammerschade“, fragte Stups, „und warum ist es nicht der Mühe wert?“
„Ach, es ist sinnlos, dass ich Ihnen das erkläre, mein Bester, denn Sie werden es auf keinen Fall behalten.“
„Ich versichere Ihnen“, widersprach Stups, „dass ich für gewöhnlich ein ziemlich gutes Gedächtnis habe.“
„Für gewöhnlich, für gewöhnlich!“, rief der Nieselpriem und winkte mutlos ab. „Das wird Ihnen bei mir absolut nichts nützen. Es dreht sich nicht um Ihr Gedächtnis, es liegt an mir.“
Stups hatte den Eindruck, vielleicht nicht ganz erwünscht zu sein, und sagte deshalb höflich, wie er nun einmal war: „Ich bitte sehr um Entschuldigung, falls ich Sie gestört haben sollte, Herr Nieselpriem. Vielleicht komme ich besser ein andermal, wenn es Ihre Zeit erlaubt.“
„Aber um Himmels willen, nein!“, erwiderte der Nieselpriem bestürzt. „Bitte, treten Sie doch ein – auch wenn es ganz und gar zwecklos ist.“
Stups folgte dem Hausherrn ins Innere der armseligen Hütte. Es bestand aus einem einzigen Raum, die wenigen Möbel waren aus morschen Holzbrettern zusammengenagelt – offenbar handelte es sich um angeschwemmtes Treibholz – und das Geschirr bestand aus verrosteten Blechbüchsen und Ähnlichem. Merkwürdigerweise war für zwei Personen gedeckt.
Der Nieselpriem forderte Stups auf, am Tisch Platz zu nehmen. Unter ständigem Seufzen goss er aus einem kleinen Fass zwei Büchsen voll.
„Es ist Rum aus einem Schiffbruch“, erklärte er. „Bitte trinken Sie nur, er wird sowieso nicht lange vorhalten.“
„Haben Sie mich denn erwartet?“, fragte Stups. Die offensichtliche Verzweiflung seines Gastgebers erregte sein Mitgefühl.
„Nicht die Bohne“, antwortete der klagend. „Die zweite Büchse war eigentlich für meinen Bruder Naselküss bestimmt. Aber sie ist natürlich ganz überflüssig, denn er weiß ja überhaupt nichts von mir. Er hat mich vergessen, wie jeder andere mich vergisst. Das ist nun einmal mein Schicksal, lieber Herr.“
Der Nieselpriem schien am Rande der Tränen zu sein.