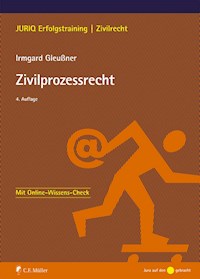
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Inhalt: Dargestellt werden die für das erste Staatsexamen in der Pflichtfachprüfung relevanten Bereiche des Zivilprozessrechts (Verfahrensgrundsätze, Prozessvoraussetzungen, Arten und Wirkungen von Klagen und gerichtlichen Entscheidungen, Prozessvergleich, vorläufiger Rechtsschutz; Arten und Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung). Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Zivilprozessrecht
von
Dr. Irmgard Gleußner
Professorin an der Technischen Hochschule NürnbergGeorg Simon Ohm
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-7521-2
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2018 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilprozessualen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript behandelt die Grundzüge des Zivilprozessrechts. Die grundlegenden Strukturen des Erkenntnisverfahrens sowie des Vollstreckungsverfahrens werden angesprochen und „nutzerfreundlich“ (anhand zahlreicher Beispielsfälle) aufbereitet. Die Neuerungen durch die Rechtsprechung und Gesetzgebung sind eingefügt. Das Skript versetzt Sie in die Lage, die prozessualen Zusatzfragen im ersten Staatsexamen professionell zu lösen. Kein Buch ohne tatkräftige Unterstützung! Dank schulde ich an dieser Stelle meinen Kindern, die mich immer wieder inspirieren, sowie meinen engagierten Leserinnen und Lesern für die wertvollen Tipps. Genießen Sie Ihr Studium!
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an die Verfasserin unter [email protected].
Nürnberg, im Januar 2018
Irmgard Gleußner
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 61, 144, 166, 263, 329, 395, 435, 583
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilEinführung in das Zivilprozessrecht
A.Grundlagen
B.Ausgangsfall
I.Sachverhalt
II.Materielle Rechtslage – Erfolgsaussichten einer Klage?
1.Mögliche Anspruchsgrundlagen
2.Chancenabwägung
C.Internetrecherche
D.Aktuelle Reformen
E.Herausforderungen einer ZPO-Prüfung
2. TeilErkenntnisverfahren
A.Konzepte gütlicher Streitbeilegung
I.Gründe für eine außergerichtliche Konfliktlösung
II.Alternativen zum Prozess
1.Obligatorische Streitschlichtung nach § 15a EGZPO
2.Mediation
3.Weitere Streitschlichtungsangebote (für Verbraucher)
4.Schiedsgerichtliches Verfahren
III.Vorgeschaltete Güteverhandlung; gerichtliche Güteversuche
IV.Zusammenfassung
B.Verfahrensgrundsätze
I.Die Verfahrensgrundsätze im Überblick
II.Dispositionsgrundsatz
1.Bedeutung im Einzelnen
2.Durchbrechung des Dispositionsgrundsatzes
III.Verhandlungsgrundsatz
1.Einführung und Inhalt
2.Konsequenzen für das Gericht
3.Abgrenzung
4.Modifikationen
IV.Anspruch auf rechtliches Gehör
1.Rechtsgrundlage und Inhalt
2.Ausnahmen
3.Rechtsbehelfe
V.Grundsatz der Mündlichkeit
1.Inhalt und Bedeutung
2.Ausnahmen
VI.Grundsatz der Unmittelbarkeit
VII.Grundsatz der Öffentlichkeit
VIII.Beschleunigungsgrundsatz
IX.Anspruch auf ein faires Verfahren
C.Die Zulässigkeit der Klage
I.Überblick
II.Ordnungsgemäße Klageerhebung
1.Parteien
2.Gericht
3.Angabe des Klagegegenstandes und des Klagegrundes
4.Bestimmter Antrag
5.Unterschrift
6.Postulationsfähigkeit
7.Weiterer (Soll-)Inhalt
8.Beispiel für eine Klageschrift
III.Gerichtsbezogene Prozessvoraussetzungen
1.Deutsche Gerichtsbarkeit
2.Internationale Zuständigkeit
3.Zulässigkeit des Zivilrechtswegs
4.Sachliche Zuständigkeit
5.Örtliche Zuständigkeit
6.Zuständigkeitsvereinbarungen
7.Rügelose Einlassung (§ 39 ZPO)
8.Fehlen der sachlichen oder örtlichen Zuständigkeit
IV.Parteibezogene Prozessvoraussetzungen
1.Parteibegriff
2.Parteifähigkeit
3.Prozessfähigkeit
4.Postulationsfähigkeit
5.Prozessführungsbefugnis
V.Streitgegenstandsbezogene Prozessvoraussetzungen
1.Schlichtungsversuch vor Klageerhebung
2.Klagbarkeit des Anspruchs
3.Rechtsschutzbedürfnis
4.Keine anderweitige Rechtshängigkeit
5.Keine entgegenstehende Rechtskraft
6.Exkurs: Der Streitgegenstand
VI.Zusammenfassung zur Zulässigkeit der Klage
D.Ablauf eines Zivilprozesses
I.Überblick
II.Außergerichtliche Streitschlichtung
III.Klageerhebung
1.Voraussetzungen
2.Beteiligter Personenkreis
3.Wirkungen der Klageerhebung
IV.Entscheidung über den weiteren Prozessablauf
1.Entscheidungsmöglichkeiten
2.Früher erster Termin
3.Schriftliches Vorverfahren
V.Die Güteverhandlung
VI.Die mündliche Verhandlung (der Haupttermin)
VII.Beweisaufnahme
VIII.Fortsetzung der mündlichen Verhandlung
IX.Urteil
E.Prozessverhalten des Beklagten zur Klage
I.Prozesshandlungen und ihre Auslegung
1.Bewirkungs- und Erwirkungshandlungen
2.Wirksamkeit von Prozesshandlungen
3.Rechtzeitigkeit von Prozesshandlungen
II.Prozessverhalten des Beklagten im Überblick
III.Der Klageabweisungsantrag
IV.Die Aufrechnung im Prozess
1.Doppelnatur der Prozessaufrechnung
2.Besonderheiten der Eventualaufrechnung
3.Rechtswegfremde Gegenforderung
4.Rechtshängigkeit der Gegenforderung
5.Rechtskraft
6.Schema Prozessaufrechnung
V.Die Widerklage
1.Privilegiertes Angriffsmittel
2.Zulässigkeitsvoraussetzungen
3.Drittwiderklage
4.Schema Widerklage
VI.Anerkenntnis
1.Voraussetzungen
2.Verfahren und (Kosten-)Entscheidung
F.Prozessverhalten des Klägers
I.Klagerücknahme
1.Vorteile aus Klägersicht
2.Voraussetzungen
3.Rechtliche Folgen
4.Verpflichtung zur Klagerücknahme
II.Klageverzicht
1.Voraussetzungen
2.Entscheidung des Gerichts
III.Einseitige Erledigungserklärung
1.Ausgangslage
2.Begriff der einseitigen Erledigungserklärung
3.Rechtliche Einordnung
4.Prüfungsreihenfolge
IV.Klageänderung
1.Interessenlage
2.Vorliegen einer Klageänderung
3.Zulässigkeit der Klageänderung
4.Entscheidung des Gerichts
G.Übereinstimmendes Prozessverhalten von Kläger und Beklagtem
I.Übereinstimmende Erledigungserklärung
1.Voraussetzungen
2.Wirkungen
3.Kostenentscheidung nach § 91a ZPO
II.Prozessvergleich
1.Vorteile
2.Rechtsnatur
3.Voraussetzungen
4.Wirkungen und Inhalt
5.Unwirksamkeit und Fortsetzung des Prozesses
6.Außergerichtlicher Vergleich, Anwaltsvergleich
H.Das Versäumnisverfahren
I.Begriff der Säumnis
1.Mündliche Verhandlung
2.Schriftliches Vorverfahren
II.Versäumnisurteil gegen den Beklagten
1.Antrag des Klägers
2.Säumnis des Beklagten
3.Kein Hindernis nach § 335 ZPO
4.Kein Hindernis nach § 337 ZPO
5.Zulässigkeit der Klage
6.Schlüssigkeit der Klage
III.Versäumnisurteil gegen den Kläger
1.Voraussetzungen
2.Umfang der Rechtskraft
IV.Einspruch gegen das (erste) Versäumnisurteil
1.Voraussetzungen
2.Entscheidung des Gerichts
V.Zweites Versäumnisurteil
I.Besondere Prozesssituationen
I.Objektive Klagehäufung
1.Ausgangssituation
2.Voraussetzungen
3.Erscheinungsformen der objektiven Klagehäufung
4.Folgen
II.Subjektive Klagehäufung (Streitgenossenschaft)
1.Grundlagen und Entstehung
2.Einfache Streitgenossenschaft
3.Notwendige Streitgenossenschaft
III.Beteiligung Dritter am Rechtsstreit
1.Nebenintervention
2.Streitverkündung
IV.Parteiänderung
1.Gesetzliche Parteiänderung
2.Gewillkürte Parteiänderung
J.Das Beweisrecht
I.Bedeutung
II.Darlegungslast
III.Beweisbedürftigkeit
1.Entscheidungserhebliche Tatsachen
2.Bestreiten des Gegners
3.Offenkundige und vermutete Tatsachen
IV.Beweislast und Beweislastumkehr
V.Strengbeweis, Freibeweis, Glaubhaftmachung
VI.Beweismittel
1.Zeugenbeweis
2.Sachverständigenbeweis
3.Urkundenbeweis
4.Augenschein
5.Parteivernehmung
VII.Beweisverfahren
1.Beweisantrag und Beweisanordnung
2.Beweisaufnahme
3.Beweiswürdigung
K.Gerichtliche Entscheidungen
I.Arten gerichtlicher Entscheidungen
1.Urteile
2.Beschlüsse
3.Verfügungen
II.Einteilung der Urteile
1.Begrifflichkeiten
2.Urteilstenor
3.Urteilsarten
III.Erlass des Urteils
1.Form und Inhalt
2.Bindung an den Antrag
3.Urteilsverkündung und Zustellung
IV.Wirkungen des Urteils
1.Innerprozessuale Bindung
2.Formelle Rechtskraft
3.Materielle Rechtskraft
L.Rechtsbehelfe und Rechtsmittel
I.Allgemeine Grundsätze
1.Unterscheidung zwischen Rechtsbehelf und Rechtsmittel
2.Beschwer
3.Rechtsmittelverzicht, Rechtsmittelrücknahme
4.Verbot der reformatio in peius
5.Meistbegünstigungsgrundsatz
II.Berufung
1.Zulässigkeit der Berufung
2.Begründetheit der Berufung
3.Entscheidung des Berufungsgerichts
III.Revision
1.Zulässigkeit
2.Begründetheit der Revision
3.Entscheidung des BGH
4.Sonderfall Sprungrevision
IV.Sofortige Beschwerde
1.Zulässigkeit
2.Beschwerdeverfahren
3.Begründetheit und Entscheidung
V.Rechtsbeschwerde
1.Zulässigkeit
2.Entscheidung
M. Besondere Verfahrensarten
I.Verfahren vor den Amtsgerichten
II.Mahnverfahren
1.Mahnantrag
2.Mahnbescheid
3.Widerspruch des Antragsgegners
4.Vollstreckungsbescheid
III.Urkundenprozess
3. TeilDie Zwangsvollstreckung
A.Einführung
I.Erkenntnisverfahren, Vollstreckungsverfahren
II.Aufbau des 8. Buches
III.Vollstreckungsorgane
IV.Einzelvollstreckung, Gesamtvollstreckung
B.Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
I.Allgemeine (Verfahrens-)Voraussetzungen
1.Antrag
2.Zuständiges Vollstreckungsorgan
II.Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
1.Vollstreckungstitel
2.Vollstreckungsklausel
3.Zustellung
III.Besondere Vollstreckungsvoraussetzungen
IV.Keine Vollstreckungshindernisse
C.Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen
I.Reform: Informationsbeschaffung vor der Pfändung
1.Allgemeines
2.Verfahrensablauf der Informationsgewinnung
II.In bewegliche (= körperliche) Sachen
1.Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen
2.Ablauf und Rechtmäßigkeit der Vollstreckung
3.Rechtliche Wirkungen der Pfändung
4.Verwertung
III.In Forderungen
1.Ablauf der Vollstreckung
2.Rechtliche Wirkungen der Vollstreckung
3.Verwertung
4.Vollstreckung in andere Vermögensrechte
IV.In das unbewegliche Vermögen
1.Sicherungshypothek
2.Zwangsversteigerung
3.Zwangsverwaltung
D.Zwangsvollstreckung wegen anderer Ansprüche als Geldforderungen
I.Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen
1.Allgemeine Voraussetzungen
2.Bewegliche Sachen
3.Unbewegliche Sachen
4.Übereignung von Sachen
II.Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung einer vertretbaren Handlung
III.Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung einer unvertretbaren Handlung
IV.Die Zwangsvollstreckung zur Erzwingung von Duldungen und Unterlassungen
V.Die Zwangsvollstreckung zur Abgabe einer Willenserklärung
E.Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung
I.Vollstreckungserinnerung
1.Zweck und Abgrenzung
2.Zulässigkeit der Erinnerung
3.Begründetheit der Erinnerung
4.Entscheidung
II.Sofortige Beschwerde
1.Zulässigkeit
2.Begründetheit, Verfahren
III.Vollstreckungsgegenklage
1.Grundlagen
2.Zulässigkeit der Vollstreckungsgegenklage
3.Begründetheit
4.Entscheidung
IV.Drittwiderspruchsklage
1.Grundlagen
2.Zulässigkeit der Drittwiderspruchsklage
3.Begründetheit
4.Entscheidung
5.Lösung Abschlussfall
V.Klage auf vorzugsweise Befriedigung
1.Grundlagen
2.Zulässigkeit
3.Begründetheit
F.Einstweiliger Rechtsschutz
I.Überblick
II.Arrest
1.Grundlagen
2.Zulässigkeit des Antrags
3.Begründetheit, Entscheidung
4.Vollziehung
III.Einstweilige Verfügung
1.Grundlagen
2.Auswahlentscheidung, Vollziehung
3.Abschließende Beispiele
G.Grenzüberschreitende vorläufige Kontenpfändung
I.Grundlagen
II.Voraussetzungen und Verfahren der vorläufigen Kontenpfändung
1.Antrag
2.Zuständiges Gericht
3.Verfahren und Entscheidung
4.Vollziehung
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Adolphsen
Zivilprozessrecht, 5. Aufl. 2016
Assmann
Fälle zum Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann
Zivilprozessordnung (Kommentar), 76. Aufl. 2018
Brox/Walker
Zwangsvollstreckungsrecht, 11. Aufl. 2018
Greger/Gleußner/Heinemann
Festgabe für Max Vollkommer 2006(zitiert: Bearbeiter in FS Vollkommer)
Greger/Unberath/Steffek
Recht der Alternativen Konfliktlösung, 2. Aufl. 2016
Grunsky/Jacoby
Zivilprozessrecht, 15. Aufl. 2016
Heiderhoff/Skamel
Zwangsvollstreckungsrecht, 3. Aufl. 2017
Jauernig/Hess
Zivilprozessrecht, 30. Aufl. 2011
Kornol/Wahlmann
Zwangsvollstreckungsrecht, 2. Aufl. 2017
Lackmann
Zwangsvollstreckungsrecht, 11. Aufl. 2017
Lüke
Zivilprozessrecht I, 2013
Münchener Kommentar
Zivilprozessordnung (Kommentar), 5. Aufl. 2016 f.(zitiert: MüKo-Bearbeiter)
Musielak/Voit
Zivilprozessordnung (Kommentar), 14. Aufl. 2017(zitiert: Musielak/Bearbeiter)
Musielak/Voit
Grundkurs ZPO, 13. Aufl. 2016
Pohlmann
Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2014
Rosenberg/Schwab/Gottwald
Zivilprozessrecht, 17. Aufl. 2010
Saenger
Zivilprozessordnung (Kommentar), 7. Aufl. 2017
Schilken
Zivilprozessrecht, 7. Aufl. 2014
Schwab
Zivilprozessrecht, 5. Aufl. 2016
Sendmeyer
Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2016
Stein/Jonas
Zivilprozessordnung (Kommentar), 23. Aufl. ab 2014 ff.(zitiert: Stein/Jonas/Bearbeiter)
Thomas/Putzo
Zivilprozessordnung (Kommentar), 38. Aufl. 2017(zitiert: Thomas/Putzo/Bearbeiter)
Zeiss/Schreiber
Zivilprozessrecht, 12. Aufl. 2014
Zimmermann
Zivilprozessordnung (Kommentar), 10. Aufl. 2015
Zimmermann
ZPO-Fallrepetitorium, 10. Aufl. 2015
Zöller
Zivilprozessordnung (Kommentar), 32. Aufl. 2018(zitiert: Zöller/Bearbeiter)
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 4Grundlagen: Lernen, Behalten und Erinnern
Die Lern- und Gedächtnispsychologie hat einige praktische Ideen, die Ihr Lernen erleichtern werden. Sie können damit effektiver lernen, mehr behalten und später den Lernstoff wieder gut abrufen. Sie können diese Methoden und Techniken sofort in die Praxis umsetzen und deren Erfolg unmittelbar feststellen. Lerntipps gibt es zu den Themen Arbeitsplanung, Techniken zum Warmlaufen, Einteilung des Lernpensums, Pausenmanagement und positive Abschlussgestaltung. Übrigens: Sie brauchen nicht alle Tipps auf einmal anzuwenden. Testen Sie ruhig einen nach dem anderen!
Lerntipps
Fangen Sie nicht einfach an!
Viele wollen das große Arbeitspaket möglichst schnell hinter sich bringen und fangen einfach an. Verschaffen Sie sich besser zu Beginn eine Übersicht über folgende Punkte:
•
Inhalte, die erarbeitet werden müssen
•
Tätigkeiten, die erbracht werden müssen (Lesen, Schreiben, Sammeln, Gliedern, Auswendiglernen)
•
Benötigte Arbeitszeiten
•
Dringlichkeit und Priorisierung einzelner Inhalte und Tätigkeiten
Schreiben Sie auf Arbeitskarten (Karteikartengröße), welche Arbeiten im folgenden Zeitabschnitt von ca. 2 bis 4 Stunden zu erledigen sind. Sie können das Ganze in eine optimale Reihenfolge bringen und an eine Pin-Wand heften. Damit bekommen Sie eine sinnvolle Ordnung, die Ihr Lernleben erleichtert. Und immer, wenn eine Tätigkeit beendet ist, vernichten Sie die Zettel als positiven Abschluss. Die Planungstechnik eignet sich auch für langwierige schriftliche Ausarbeitungen sehr gut.
Machen Sie Ihren Denkapparat warm!
Ein Sportler macht sich vor Beginn des Wettkampfes warm, um körperlich, aber auch mental auf „Betriebstemperatur“ zu kommen. Ein Musiker spielt sich vor seinem Konzert ein. Auch der Denkapparat braucht eine Warmlaufphase, da zu Beginn einer Lerneinheit die Aufnahmefähigkeit noch relativ gering ist. Starten Sie also mit möglichst einfachen Tätigkeiten, Dingen, die Ihnen persönlich eher leicht von der Hand gehen.
Startarbeiten können sein:
•
Definitionen erst einmal nur durchlesen
•
Begriffe aus einem Buch zu einem Thema heraussuchen, kennzeichnen, mit Seitenzahlen versehen
•
Einfache Texte lesen
•
Karteikarten schreiben und ordnen
•
Material abheften
Bei umfassenderen Arbeiten das wiederholte Warmlaufen nicht vergessen!
Wenn Sie an einer Hausarbeit oder an einem umfangreicheren Lernstoff sitzen, starten Sie nach Pausen immer wieder neu. Sie können sich das Denken für einen Neustart erleichtern, wenn Sie sich am Ende einer Arbeitsphase kurze Merksätze notieren, was Sie nach der Pause konkret lesen, erarbeiten, vergleichen oder welche Fragen Sie beantworten wollen. Mit diesen Notizen können Sie sehr schnell wieder Gedankengänge aktivieren und in Ihr Gesamtkonzept einsteigen. Sie können aber auch die Feingliederung für den geplanten Teil noch einmal durchgehen oder zwei Seiten zurückzublättern, um sich wieder einzulesen.
Den Lernstoff in 5 bis 7 Lernportionen einteilen!
Es gibt auch beim Lernen eine optimale Menge der „akuten Lernbelastbarkeit“. Ein Lernumfang von 5 bis 7 Elementen („Chunks“) kann leicht auf einmal gespeichert werden. Wird diese Menge überschritten, ist Ihr Arbeitsspeicher (Speicherdauer 15 bis 30 Sekunden) überfordert, und es wird weniger ins Langzeitgedächtnis („Festplatte“) befördert, also behalten. „Chunks“ sind sinnvolle Gruppierungen von Informationen, – z. B. 7 Aufbauschemata, 7 Definitionen etc. Der mögliche Umfang Ihrer „Chunks“ hängt von Ihrem Vorwissen zu einem Lerngebiet ab.
Fazit für die Praxis:
•
Bereiten Sie Ihr Lernmaterial so auf, dass die Zahl von 5 bis 7 Fachbegriffen, Definitionen, Merksätzen, Kategorien nicht überschritten wird.
•
Teilen Sie umfangreicheres Material in Einheiten mit Untereinheiten (ebenfalls max. 7), die sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
•
Denn: Sinnvoll gruppiertes Material wird besser behalten als beziehungslos nebeneinanderstehendes.
•
Stabilisieren Sie das Wissen durch regelmäßiges Wiederholen in kleineren Portionen.
Testen Sie den Positionseffekt beim Lernen!
Es gibt nicht nur bevorzugte Plätze im Stadion oder Konzertsaal, sondern auch in einer Reihe von Lernelementen. Der Anfang und das Ende werden besser behalten und erinnert (Erfahrung des Autors als Coach: auch die ersten und letzten Stellenbewerber werden besser erinnert als die in der Mitte eines Bewerbungsprozesses). Stellen Sie sich vor, Sie müssen 20 Aufbauschemata oder Definitionen lernen. Die erste und die letzte Definition machen 10% des Lernmaterials aus, das Sie sich ohne besonderes Zutun besser einprägen können. Bei 2 Lernpaketen wären das 20%, bei 4 Paketen à 5 Definitionen schon 40% erleichterte Aufnahme.
Fazit für die Praxis:
•
Nutzen Sie den Vorteil, dass Anfang und Ende einer Reihe leichter behalten werden!
•
Teilen Sie Ihre Gesamtmenge in Portionen von 5 bis 7 Elementen auf, dann haben Sie entsprechend mehr Randelemente!
•
Lernen Sie die Einheiten stets mehrfach in einer jeweils anderen Reihenfolge, dadurch wird der Positionseffekt mehrfach genutzt und sie werden damit flexibler bereitgestellt!
Beseitigen Sie die „Ähnlichkeitshemmung“!
Sind Lernelemente einander sehr ähnlich, so hemmen sie sich gegenseitig beim Lernen (= Ähnlichkeitshemmung). Man kann z. B. 5 unterschiedliche Begriffe besser abspeichern als 5 ähnliche. Lernen Sie ähnliche Inhalte stets zeitlich voneinander getrennt. Sie können diese dann „verwechslungssicherer“ abrufen. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie inhaltlich unterschiedliche Dinge lernen. Das ist sogar eher förderlich.
Mit verteiltem Lernen behalten Sie auf die Dauer mehr!
Unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Das haben Sie und ich schon mehrfach festgestellt. Selbst nach einem Warmstart dürfen wir nicht mit einer gleichmäßig ansteigenden Zunahme unseres Wissens rechnen. Es mag Sie zwar enttäuschen, aber wir behalten nach längerer Lernzeit immer weniger. Wir erreichen dann ein Lernplateau, wenn wir zu lange oder zu häufig denselben Stoff wiederholen. Es wird dann oft ohne Gewinn unnötiger Energieaufwand betrieben. Es kann sogar zu einer Abnahme schon erworbenen Wissens führen. Mehrarbeit kann also auch schaden. Das Gehirn braucht zum effektiven Lernen Zeit, um neue neuronale Verknüpfungen zu bilden, damit das Lernen auch „Spuren“ hinterlässt.
Die Konsequenz heißt „verteiltes statt massiertes Lernen“, den Lernstoff also mit Zwischenpausen bearbeiten.
•
Zuerst langsam und aufmerksam lesen und nicht direkt einprägen wollen.
•
Pause: Etwas ganz anderes tun.
•
Wesentliche einzelne Begriffe und Zusammenhänge aufschreiben.
•
Pause: Wieder ganz andere Dinge tun, auch Geistiges, jedoch möglichst unähnlich zu dem bisherigen Lernstoff.
•
Wieder Begriffe und Zusammenhänge einprägen.
•
usw.
Für Definitionen und Aufbauschemata zu einem Thema sind Abstände von 20 bis 40 Minuten zu empfehlen, bei größeren Textabschnitten wie Buchkapiteln können das auch mehrere Stunden sein.
Den Lernmotor und Ihre Motivation vor Überbelastung schützen!
Die maximale Leistungsfähigkeit kann nur in einem begrenzten Zeitraum erreicht werden. Bei Überschreitung passieren Fehler, die Leistung wird gemindert und die Motivation möglicherweise dauerhafter geschädigt. Vor Eintritt in eine solche Negativphase sollten Sie ein für Sie passendes Pausenmanagement einrichten.
Generell gilt:
•
Häufige Pausen von weniger als 20 Minuten sind besonders effektiv und besser als wenige lange Pausen.
•
Pausen sollten nicht mit lernnahen Tätigkeiten oder speicherbelastenden Aktivitäten (PC-Spiele) ausgefüllt werden.
Beispiele für unterschiedliche Pausenarten, die in den Tages- und Lernablauf integriert werden sollten:
•
Abspeicherpausen (Augen zu): 10 bis 20 Sekunden nach Definitionen, Begriffen und komplexen Lerninhalten zum sicheren Abspeichern und zur Konzentration.
•
Umschaltpausen: 3 bis 5 Minuten nach ca. 20 bis 40 Minuten Arbeit, um Abstand zum vorher Gelernten zu bekommen und dadurch besser Neues aufzunehmen.
•
Zwischenpausen: 15 bis 20 Minuten nach 90 Minuten intensiver Arbeit, also nach zwei Arbeitsphasen, dient dem Erholen und Abschalten.
Und nicht vergessen:
•
Die lange Erholungspause von 1 bis 3 Stunden, z. B. mittags oder zum Feierabend nach 3 Stunden Arbeit sollten Sie ebenfalls zum richtigen Abschalten, Regenerieren, Sich-Belohnen nutzen!
Die Lernarbeit positiv abschließen!
Unsere Erinnerung behält vor allem die letzten Erlebnisse. Endet ein an und für sich schöner Abend mit einem Streit, so wird der Abend rückwirkend als unangenehm empfunden. Ein Kellner bietet uns nach dem Essen auf Rechnung des Hauses einen Espresso oder Schnaps an. Wenn wir uns erinnern, werden wir geneigt sein, das gute Essen noch besser zu erinnern. D. h. wenn eine Tätigkeit positiv beendet wird, wird sie insgesamt als positiver erlebt.
Nach einer längeren Arbeitsphase von 1 bis 3 Stunden können Sie Folgendes tun:
•
Bewusst feststellen, was Sie alles geschafft haben, beachten Sie dabei weniger die unbearbeitete Menge.
•
Vergleichen Sie, was Sie zu Beginn einer Lernphase konnten oder wussten – und was Sie nun beherrschen.
•
Legen Sie eventuell ein Karteikartensystem an, mit dem Sie sehr leicht feststellen können, was Sie können (z. B. eine Kartei mit Aufbauschemata, Definitionskartei; siehe dazu auch die Arbeitskarten aus dem ersten Lerntipp)
Jeden Tag das gleiche Ritual!
Der Abschluss eines Lerntages sollte auch symbolisch eine Zäsur setzen, analog dem Wechsel von Arbeit zu Freizeit mit der Schulklingel oder dem Kleidungswechsel nach der Arbeit.
Abschlussrituale am Ende eines Tages können sein:
•
Denken Sie bereits 10 Minuten vor dem Arbeitsende eines Tages an das Ende der Arbeit.
•
Denken Sie kurz aber bewusst darüber nach, an welcher Stelle Sie die Arbeit für heute beenden.
•
Sagen Sie sich bewusst: Für heute ist die Arbeit für mich beendet.
•
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geleistete.
•
Machen Sie sich kurze Notizen, welche Aspekte in der nächsten Arbeitsphase zu berücksichtigen sind. Das erleichtert den Einstieg am Folgetag.
•
Klappen Sie den Ordner bewusst zu, fahren Sie den PC bewusst herunter und sagen Sie sich „Ich habe jetzt Freizeit!“
•
Verlassen Sie den Arbeitsplatz und den Arbeitsbereich. Wenn möglich, ziehen Sie sich um.
•
Gestalten Sie dieses Abschlussritual jeden Tag!
1. TeilEinführung in das Zivilprozessrecht
A.Grundlagen
B.Ausgangsfall
C.Internetrecherche
D.Aktuelle Reformen
E.Herausforderungen einer ZPO-Prüfung
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › A. Grundlagen
Anmerkungen
Näher Zöller/Vollkommer ZPO Einl. Rn. 48.
Eine Übersicht gibt Adolphsen Zivilprozessrecht § 2 Rn. 33 ff.
Grunsky/Jacoby Zivilprozessrecht Rn. 858.
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › B. Ausgangsfall
B.Ausgangsfall[1]
5
Zivilprozessrecht ist alles andere als „graue Theorie“. Denn jeder Zivilprozess setzt einen „echten Streit“ zwischen zwei Personen, also einen Fall aus dem Zivilrecht, voraus. Dementsprechend wird in diesem Lehrbuch ein Ausgangsfall aus dem Kaufrecht zugrunde gelegt. Anhand dieses realen Ausgangsfalls werden die Schritte und Abfolgen eines Zivilprozesses erläutert und mögliche Varianten und Fallstricke für die beteiligten Personen aufgezeigt. Soweit es zum besseren Verständnis für einzelne Themenbereiche erforderlich ist, wird der Ausgangsfall in den jeweiligen Kapiteln in kleinere Varianten zerlegt.
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › B. Ausgangsfall › I. Sachverhalt
I.Sachverhalt
6
Mona (M) studiert im fünften Semester Rechtswissenschaft in Köln. Seit Bestehen der Zwischenprüfung ist sie – aufgrund einer großzügigen Schenkung ihrer Eltern – Eigentümerin einer 2-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Sürth, die sie zusammen mit ihrem Freund Thomas, einem Betriebswirtschaftsstudenten, bewohnt. Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Pisa als Erasmusstudentin beschließt Mona, ihr altes Bad zu renovieren. Bei der „VORORT Fliesen GmbH“ (V-GmbH) im Kölner Süden findet sie italienische Markenfliesen zu günstigen Preisen. Am 2.1.2017 kauft Mona 30 polierte Bodenfliesen zum Gesamtpreis von 600 €, die ihr Fliesenleger Felix Fromm (F) nach mehrfacher Erinnerung für 400 € fachgerecht verlegt. Kurze Zeit später zeigen sich auf den Fliesen hässliche Verfärbungen. Der Geschäftsführer der V-GmbH, Gerald Grün (G), streitet nach Rücksprache mit dem Hersteller jegliche Verantwortung ab. Mona beauftragt daraufhin den Sachverständigen Simon Sand (S). Dieser stellt fest, dass die Fliesen falsch poliert wurden und Abhilfe nur durch einen kompletten Austausch möglich sei. Die Kosten hierfür beziffert der Sachverständige auf insgesamt 2400 € (= 2000 € Ausbau- und Entsorgungskosten der alten Fliesen, 400 € Einbaukosten für die neuen Fliesen). Für seine Expertise stellt der Sachverständige Mona zudem 200 € in Rechnung. Auch nach Vorlage des Sachverständigengutachtens verweigert die V-GmbH mit Schreiben vom 14.2.2017 die Lieferung 30 neuer Bodenfliesen und die Übernahme der Kosten des Austausches von 2400 €. Die Firma argumentiert, dass sie lediglich Händlerin sei und für das Verschulden des italienischen Herstellers nicht einstehen müsse. Schließlich seien die Nacherfüllungskosten in Höhe von insgesamt 3000 € (Austauschkosten 2400 € einschließlich neuer Fliesen für 600 €) angesichts des vereinnahmten Kaufpreises von 600 € absolut unverhältnismäßig.
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › B. Ausgangsfall › II. Materielle Rechtslage – Erfolgsaussichten einer Klage?
II.Materielle Rechtslage – Erfolgsaussichten einer Klage?
7
Versuchen Sie zunächst selbst, diesen Gewährleistungsfall zu lösen. Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich mit den neuen Vorschriften im kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht vertraut, die ab 1.1.2018 gelten.
Als Studierende der Rechtswissenschaft wird Mona zunächst die materielle Rechtslage prüfen, wie sie dies in zahlreichen Klausuren gelernt hat. Die Urteile des EuGH (NJW 2011, 2269) sowie des BGH (NJW 2012, 1073, NJW 2013, 220 und NJW 2014, 2183) sind Mona bedauerlicherweise nicht bekannt, da sie für ihre Recherche ausschließlich einen veralteten BGB-Kommentar verwendet. Die Neuregelungen der §§ 439 Abs. 3, 475 Abs. 4, 6 BGB,[2] die eine Reaktion des Gesetzgebers auf die Vorgaben des EuGH darstellen, gelten erst ab 1.1.2018 und sind daher im Februar 2017 noch nicht relevant. Mona stellt folgende Überlegungen an:
1.Mögliche Anspruchsgrundlagen
8
Ein Anspruch auf Nacherfüllung könnte sich aus §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 BGB ergeben. Dies setzt einen Kaufvertrag (§ 433 Abs. 1 BGB), eine mangelhafte Sache (§ 434 BGB) sowie das Vorliegen eines Sachmangels bei Gefahrübergang (§ 446 BGB) voraus. Hier geht es um einen Verbrauchsgüterkauf, da Mona als Privatkäuferin Verbraucherin (§ 13 BGB) und die V-GmbH gewerblich handelnde Unternehmerin (§ 14 BGB) ist und die Fliesen bewegliche Sachen sind (§ 474 BGB). In diesem Fall muss Mona das Vorhandensein der Verfärbungen bei Gefahrübergang nicht beweisen (§ 477 BGB n.F.), da sich der Mangel innerhalb von sechs Monaten gezeigt hat.[3] Nach § 439 Abs. 1 BGB steht ihr als Käuferin ein Wahlrecht zwischen Reparatur und Ersatzlieferung zu. Da die Reparatur der Fliesen technisch unmöglich ist (§ 275 Abs. 1 BGB), bleibt Mona nur das Recht auf Ersatzlieferung. Problematisch ist die Frage, ob die Nacherfüllung aus § 439 Abs. 1 BGB nur die Neulieferung von 30 Fliesen beinhaltet oder auch die Ausbaukosten der alten Fliesen und die Einbaukosten der neuen Fliesen umfasst. Hierzu ist der Meinungsstand ziemlich breit gefächert. So hatte der BGH im Jahr 2008 entschieden, dass die Kosten der Neuverlegung (= Einbaukosten) nicht unter den Nacherfüllungsanspruch des § 439 BGB fallen.[4] Mona überlegt daher, ob ein Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281 BGB möglich wäre. Voraussetzung des Schadensersatzanspruches ist ein Vertretenmüssen des Verkäufers (§§ 280 Abs. 1 S. 2, 276 BGB). Da die V-GmbH die Fliesen nicht selbst hergestellt hat und der Verkäufer als reiner Händler nicht zur Prüfung der Fliesen auf Fehlerfreiheit verpflichtet ist, wäre Mona kaum in der Lage, ein schuldhaftes Handeln der V-GmbH nachzuweisen, zumal der Hersteller auch nicht Erfüllungsgehilfe (§ 278 BGB) des Händlers ist.[5] Immerhin stellt Mona fest, dass einige Gerichte und Autoren die Meinung vertreten, der Verkäufer einer mangelhaften Sache müsse zumindest die Kosten für den Ausbau tragen, da er nach § 439 BGB zur Rücknahme der mangelhaften Sache verpflichtet sei.[6] Der Käufer brauche keine mangelhafte Sache behalten. Als Anspruchsgrundlage hierfür wird auf die Vorschriften der §§ 437 Nr. 1, 439, 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1, 2 BGB verwiesen. Zu unverhältnismäßigem Kostenersatz dürfe der Verkäufer aber nicht gezwungen werden; insofern könne er sich auf § 439 Abs. 3 BGB (Unverhältnismäßigkeit) berufen. Als Zwischenergebnis ihrer Recherche stellt Mona fest, dass der Wortlaut der Gewährleistungsnormen wenig zur Lösung ihres Problems hergibt.
Würde Mona 2018 die Fliesen kaufen, könnte sie seit 1.1.2018 eindeutige Aussagen zu den Ein- und Ausbaukosten im BGB finden.[7] Der Gesetzgeber hat diese „Fliesenfälle“ gesetzlich normiert. In § 439 Abs. 3 BGB ist nun die Ersatzpflicht des Verkäufers für Ein- und Ausbaukosten näher geregelt. Danach muss der Verkäufer die erforderlichen Aufwendungen für Ein- und Ausbau tragen. Sind die erforderlichen Ein- und Ausbaukosten unverhältnismäßig hoch, ist beim Verbrauchsgüterkauf der Anspruch auf Nacherfüllung in Form der Mängelbeseitigung aber nicht gänzlich ausgeschlossen, wenn die andere Art der Nacherfüllung (Reparatur) unmöglich ist (§ 475 Abs. 4 S. 1 BGB). Stattdessen darf der Unternehmer den Aufwendungsersatz auf einen „angemessenen Betrag“ beschränken (§ 475 Abs. 4 S. 2, 3 BGB). Der Käufer kann einen Vorschuss verlangen (§ 475 Abs. 6 BGB). Die Beweislastumkehr ist nun in § 477 BGB geregelt, die Regressansprüche in §§ 445a, 445b BGB.
2.Chancenabwägung
9
Die Prüfung der materiellen Rechtslage ist stets die erste Maßnahme, die Mona (bzw. ein Anwalt, wenn es sich bei dem Rechtssuchenden um einen juristischen Laien handelt) ergreifen wird, um die Erfolgsaussichten einer Klage und das Kostenrisiko abzuschätzen. Das Kostenrisiko ist deshalb so bedeutsam, da der Verlierer eines zivilgerichtlichen Rechtsstreits nach § 91 ZPO grundsätzlich sämtliche angefallenen Kosten (eigener Anwalt, gegnerischer Anwalt, Gerichtskosten) tragen muss. Ein Prozess kann somit teuer werden. Sollte Mona den Prozess in erster Instanz verlieren, kämen insgesamt Kosten von ca. 1400 € auf sie zu.[8] Mona diskutiert daher die gefundenen Ergebnisse mit ihrem Freund Thomas, der ihr wegen der „etwas wackeligen“ Rechtslage von einem gerichtlichen Streit abrät. Er schlägt stattdessen vor, die Verfärbungen der Fliesen zu akzeptieren oder zumindest nochmals einen Güteversuch mit der V-GmbH zu starten. Als angehende Juristin will sich Mona allerdings nicht damit zufrieden geben, die nächsten Jahre auf schlecht polierte Fliesen blicken zu müssen. Insofern ist es ihr auch egal, dass der Ersatz von Aus- und Einbaukosten durch den Verkäufer einer mangelhaften Sache in der juristischen Fachliteratur umstritten ist. Vor allem findet sie das in der Literatur geäußerte Argument, § 439 BGB müsse europarechtskonform – also verbraucherfreundlich – interpretiert werden, da diese Vorschrift auf einer EU-Richtlinie beruhe, besonders überzeugend. Daher beschließt Mona, die V-GmbH auf Neulieferung und Kostenersatz zu verklagen. Allerdings fehlen ihr jegliche Kenntnisse über das Zivilprozessrecht, da sie noch keine Vorlesung zu diesem Rechtsgebiet besucht hat. Unklar ist ihr, ob sie Kosten vorstrecken muss, welches Gericht für ihren Fall zuständig ist und ob sie einen Anwalt benötigt. Ihr Studienkollege Kai rät ihr, erst dann einen Prozess zu führen, wenn sie folgende Themengebiete des Zivilprozessrechts beherrscht:
Rechtswegzuständigkeit, Verfahrensgrundsätze, Klagearten, allgemeine Verfahrensvorschriften und Verfahren im ersten Rechtszug, Wirkungen gerichtlicher Entscheidungen, gütliche Streitbeilegung, Arten und Voraussetzungen der Rechtsbehelfe, Beweisgrundsätze, Zwangsvollstreckung (allgemeine Voraussetzungen, Arten, Rechtsbehelfe), vorläufiger Rechtsschutz.
Anmerkungen
Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung, zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes etc. vom 28.4.2017 (BGBl I 2017, 969).
Eingehend zur Beweislast BGH NJW 2017, 1093.
BGH NJW 2008, 2837, 2838 f.
BGH NJW 2008, 2837, 2839 m.w.N. (= Parkett-Fall).
OLG Frankfurt OLGR 2008, 325.
Näher Höpfner/Fallmann NJW 2017, 3745.
Unterstellt wird ein Streitwert von 3000 € (600 € für Neulieferung und 2400 € für die Austauschkosten).
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › C. Internetrecherche
C.Internetrecherche
10
In diesem Skript wird sich Mona Schritt für Schritt Grundkenntnisse im Zivilprozessrecht aneignen. Zum Nachschlagen wichtiger Gesetze am Computer verwendet Mona die offizielle Homepage des Bundesministeriums der Justiz „www.gesetze-im-internet.de“ bzw. die Website der EU für europäische Rechtsakte „eur-lex.europa.eu“, zum Recherchieren der BGH-Rechtsprechung „www.bundesgerichtshof.de“. Informationen über Internet-Versteigerungen durch die Gerichtsvollzieher findet sie unter „www.justiz-auktion.de“. Testfragen zum Zivilprozessrecht bekommt Mona unter „www.juriq.de“ beantwortet.
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › D. Aktuelle Reformen
D.Aktuelle Reformen
11
Das Verfahren in Familiensachen (Ehe, Unterhalt, Kindesumgang etc.) war bis 2009 in der ZPO geregelt. Mit dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) hat der Gesetzgeber ein eigenes „Prozessgesetz“ für Familiensachen geschaffen und weitere Themen (Betreuungssachen, Grundbucheinträge, Nachlasssachen) aufgenommen. Das FamFG ist am 1.9.2009 in Kraft getreten. Auch wenn oft auf die ZPO verwiesen wird, gibt es eigene Begrifflichkeiten. Statt einer „Klage“ gibt es „Anträge“, die Parteien sind die „Beteiligten“ und heißen Antragsteller/in bzw. Antragsgegner/in, die ein „Verfahren“ und keinen „Prozess“ führen. Das Gericht entscheidet stets durch Beschluss, nicht durch Urteil (§ 38 FamFG). Installiert wurde das „Große Familiengericht“ (kein gesetzlicher Begriff) mit einer umfassenden Zuständigkeitskonzentration (z.B. Scheidung, Zugewinn, elterliche Sorge, Unterhalt, Gewaltschutzsachen). Im erstinstanzlichen Verfahren herrscht grundsätzlich Anwaltszwang (§ 114 FamFG). Ein weiteres Ziel des FamFG ist, die außergerichtliche Streitbeilegung zu fördern. Das Gericht kann in sog. Folgesachen anordnen, dass beide Ehepartner an einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder andere Formen der außergerichtlichen Konfliktbeilegung teilnehmen (§ 135 FamFG).
12
Im Jahr 2012 hat der Gesetzgeber die Mediation gesetzlich verankert, um in Deutschland auf breiter Ebene eine Kultur der Streitvermeidung zu etablieren. Am 26.7.2012 ist das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsG)[1] in Kraft getreten, das gesetzliche Regelungen zur außergerichtlichen und gerichtlichen Mediation in allen Verfahrensordnungen (ZPO, ArbGG, FamFG, VwGO, FGO, SGG) enthält. Erklärtes Ziel ist eine rasche und kostengünstige außergerichtliche Streitbeilegung. Einen Schwerpunkt des Gesetzes bilden die berufsrechtlichen Vorgaben für Mediatoren und Mediatorinnen (Aufgaben, Befugnisse, Ausbildung, Verjährung). Zusätzlich wurden die gerichtlichen Güteversuche (§§ 278 Abs. 5, 278a ZPO) neu konzipiert.
13
Das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung aus dem Jahr 2009 hat zahlreiche Neuerungen im Vollstreckungsrecht gebracht.[2] Die meisten Änderungen sind 2013 in Kraft getreten. Ganz im Sinne des Gläubigerschutzes steht nun die frühzeitige Informationsbeschaffung über (pfändbare) Vermögenswerte des Schuldners an erster Stelle. Zudem wurde die elektronische Datenverarbeitung im Vollstreckungsrecht fortentwickelt. Das Vermögensverzeichnis (§ 802f Abs. 5 ZPO) und das Schuldnerverzeichnis (§ 882h Abs. 1 ZPO) werden elektronisch geführt. Die EuKoPfVO (Nr. 655/2014) erlaubt seit 2017 eine (einfache) grenzüberschreitende vorläufige Kontenpfändung in der EU; die (deutschen) Ausführungsvorschriften sind neu in die ZPO eingefügt worden (§§ 946–959 ZPO).
14
Die fortschreitende Digitalisierung stellt auch die Justiz vor neue Herausforderungen. Zahlreiche Neuregelungen in der ZPO greifen diesen technischen Fortschritt auf (Videokonferenz § 128a ZPO, Internetversteigerungen § 814 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, Fotos in elektronischer Form §§ 885a Abs. 2, 760 S. 2 ZPO etc.). Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (ERV-Gesetz) vom 10.10.2013[3] wird der Versuch gestartet, auch für Gerichtsverfahren endgültig in das Zeitalter papierloser (elektronischer) Kommunikation vorzustoßen. Die wichtigsten Änderungen sind 2016 bzw. 2018 in Kraft getreten. Zum 1.1.2018 kommt das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) gem. § 31a BRAO. Es leidet allerdings unter Startschwierigkeiten. Nach dem neuen § 130a ZPO können Anträge nun elektronisch über das beA bei Gericht eingereicht werden. Es besteht für Anwälte eine sog. passive Nutzungspflicht (= ins beA sehen; § 31a Abs. 6 BRAO).[4] Die Pflicht zur elektronischen Einreichung von Schriftsätzen (§ 130d ZPO n.F.) wird für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen erst 2022 verbindlich. Mit dem Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs (E-Akte-Gesetz) vom 5.7.2017[5] wird es auch für die (Zivil-)Gerichte ernst. Auch sie müssen ihre Papier-Aktenführung allmählich aufgeben. Die Gerichte dürfen sich allerdings mit der E-Akte bis 2026 Zeit lassen (§ 298a Abs. 1a ZPO). Für sehbehinderte Personen gilt es, einen barrierefreien Zugang zu allen Dokumenten zu schaffen (§ 191a GVG).
Anmerkungen
BGBl. I 2012, 1577; hierzu Ahrens NJW 2012, 2465.
BGBl. I 2009, 2258.
BGBl. I 2013, 3786.
Zur E-Justiz Jost/Kempe NJW 2017, 2705; Kasper/Ory NJW 2017, 2709; Siegmund NJW 2017, 3134.
BGBl I 2017, 2208.
1. Teil Einführung in das Zivilprozessrecht › E. Herausforderungen einer ZPO-Prüfung
E.Herausforderungen einer ZPO-Prüfung
15
Juristen und Juristinnen stehen bei jeder Prüfung vor der Herausforderung, für die Fallfragen eine sachgerechte (vertretbare) Lösung zu finden. Die Art und Weise, eine Lösung zu finden, ist in sämtlichen juristischen Fragestellungen durch die Methodenlehre vorgegeben. Die Kenntnis der Methodenlehre ist für eine überzeugende Argumentation unverzichtbar. Die Rechtswissenschaft lebt von der Sprache, der Diskussion und dem Gerechtigkeitsgedanken. Jeder Studierende ist daher gut beraten, seine Gedanken in ausführlicher Weise auf Papier zu bringen. In Deutschland, wie auch in vielen anderen europäischen Kontinentalländern, existiert der Vorteil, dass Rechtsuchende in nahezu allen Rechtsgebieten auf ein Gesetz zurückgreifen können. Englische Juristen dagegen stehen regelmäßig vor der Herausforderung, zur Falllösung Gerichtsurteile (auswendig) abrufen zu müssen (= case law). In Deutschland werden Prozesse unter den Rahmenbedingungen der ZPO geführt. Für eine Falllösung ist somit primär der Wortlaut einer Vorschrift aus der ZPO zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass die Studierenden zunächst dadurch „punkten“ können, dass sie die richtige Vorschrift finden und deren Wortlaut richtig wiedergeben. Ist der Wortlaut mehrdeutig, kommt die systematische Auslegung zum Tragen. Damit ist es von Vorteil, zu wissen, in welchem Kontext die Vorschrift steht (Nachbarvorschriften, Abschnitt). Helfen Wortlaut und systematische Auslegung nicht weiter, wird die teleologische Auslegung relevant, die nach dem Zweck der Vorschrift fragt. Das Positive für Studierende ist, dass sie den Zweck des Gesetzes nicht selbst erfinden müssen, sondern – das mag langweilig anmuten – die bereits geäußerten Vorstellungen von Rechtsprechung und Literatur übernehmen können und müssen. Der Knackpunkt ist also oft, den Meinungsstreit zu kennen und korrekt wiederzugeben. Dieses Buch will hierzu Hilfestellung bieten.
Viele Themenbereiche der ZPO sind nicht zentral und zusammenhängend an einer Stelle behandelt, sondern auf eine Vielzahl von Vorschriften verteilt. Diese im Kontext stehenden Vorschriften sollten daher am Rand der „Hauptnorm“ kommentiert werden (soweit es die jeweilige Prüfungsordnung erlaubt). Hier ist aktives Handeln beim Lesen gefordert. Die ZPO (Schönfelder) und ein Bleistift sind unverzichtbare Arbeitsmittel für dieses Buch.
2. TeilErkenntnisverfahren
A.Konzepte gütlicher Streitbeilegung
B.Verfahrensgrundsätze
C.Die Zulässigkeit der Klage
D.Ablauf eines Zivilprozesses
E.Prozessverhalten des Beklagten zur Klage
F.Prozessverhalten des Klägers
G.Übereinstimmendes Prozessverhalten von Kläger und Beklagtem
H.Das Versäumnisverfahren
I.Besondere Prozesssituationen
J.Das Beweisrecht
K.Gerichtliche Entscheidungen
L.Rechtsbehelfe und Rechtsmittel
M. Besondere Verfahrensarten
2. Teil Erkenntnisverfahren › A. Konzepte gütlicher Streitbeilegung
A.Konzepte gütlicher Streitbeilegung
2. Teil Erkenntnisverfahren › A. Konzepte gütlicher Streitbeilegung › I. Gründe für eine außergerichtliche Konfliktlösung
I.Gründe für eine außergerichtliche Konfliktlösung
16
Für Mona ist die Vorstellung, einen Prozess führen zu müssen, eher unangenehm. Dieses Problem haben nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmer/innen und Industriekonzerne. Im Vordergrund steht die Sorge, dass der Prozess verloren gehen könnte. Der Spruch „Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand“ symbolisiert dieses Risiko besonders plastisch. Bei Prozessverlust droht eine „Kostenexplosion“. Die Klagepartei muss nicht nur die eigenen Anwaltskosten und die Gerichtskosten tragen, sondern auch noch die Kosten der Gegenseite (Anwaltskosten). Geregelt ist die Kostentragungspflicht des Verlierers in § 91 ZPO. Auswege aus dieser Kostenfalle gibt es kaum.
17
Falls der Kläger/die Klägerin über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, kann dieser Umstand Abhilfe schaffen. Im Rahmen des abgeschlossenen Vertrags werden sämtliche Prozesskosten von der Versicherung übernommen. Voraussetzung ist aber ein bereits vor dem Prozess bestehender Vertrag. Außerdem kann eine Rechtsschutzversicherung nicht für alle zivilrechtlichen Streitigkeiten abgeschlossen werden. Dies gilt etwa für bau- oder erbrechtliche Streitigkeiten. Für einkommensschwache Kläger gibt es die staatliche Prozesskostenhilfe (§§ 114 ff. ZPO). Sie dient der Rechtsschutzgleichheit (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG), ermöglicht aber kein „kostenloses Prozessieren“.[1] Bei Prozessverlust müssen stets die gegnerischen Kosten (§ 123 ZPO) getragen werden. Ähnliches gilt bei Vereinbarung von Erfolgshonoraren mit dem eigenen Anwalt (vgl. § 49b BRAO mit § 4a RVG). Im Fall des Verlierens müssen lediglich der gegnerische Anwalt und die Gerichtskosten, nicht aber der eigene Anwalt gezahlt werden. Allerdings können Erfolgshonorare nur unter besonderen – erschwerten – Voraussetzungen vereinbart werden (vgl. § 4a RVG). So müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mandanten derart schlecht sein, dass er ohne Erfolgshonorar von der Rechtsverfolgung absehen würde.[2]
18
Ein weiterer Weg zur Kostenvermeidung ist die Prozessfinanzierung. Hier lassen sich auf Prozessfinanzierung spezialisierte Unternehmen gegen Vorfinanzierung der Verfahrenskosten sowie Übernahme des Prozesskostenrisikos im Unterliegensfall im Gegenzug für den Erfolgsfall einen Teil des erstrittenen Erlöses abtreten.[3] Die geforderte Quote für den Erfolgsfall ist bei den einzelnen Anbietern unterschiedlich. Ungeklärt ist auch die rechtliche Qualifikation des Prozessfinanzierungsvertrags. Des Weiteren ist umstritten, ob Anwälte eigene Prozessfinanzierungsunternehmen (GmbH, AG) gründen dürfen. Für „kleinere Verfahren“ wird die Prozessfinanzierung mangels Rentabilität nicht eingesetzt. Anders ist die Situation bei „Sammelschäden“ (z.B. VW-Abgasskandal). Das Geschäftsmodell wird hier eingesetzt, um die Ansprüche der Betroffenen zu bündeln und außergerichtlich bzw. gerichtlich durchzusetzen.
19
Sieht man einmal von der Kostenfrage ab, ist auch der Zeitaufwand (Besprechungen mit dem Anwalt, Gerichtstermine) und die Dauer eines Zivilverfahrens (eventuell mehrere Jahre bei Ausschöpfung aller Rechtsmittel) zu berücksichtigen. Außerdem kann gegen die Inanspruchnahme einer richterlichen Entscheidung eingewendet werden, dass es an einer echten „Konfliktlösung“ fehlt, weil es nur Sieger oder Verlierer gibt.
Mona hat keine Rechtsschutzversicherung. Als Studentin kann sie gegebenenfalls Prozesskostenhilfe beantragen. Eventuell wird sie zur Ratenzahlung verpflichtet. Ihre Wohnung muss sie jedenfalls nicht einsetzen (vgl. § 115 Abs. 3 ZPO mit § 90 Abs. 2 SGB XII). Für ein Prozessfinanzierungsunternehmen ist ihr Fall „zu mager“, da die meisten Prozessfinanzierer einen Mindeststreitwert von 50 000 € verlangen.





























