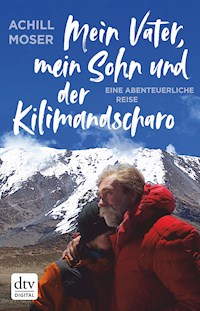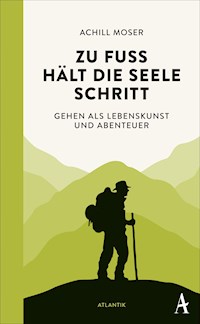
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
UNTERWEGS IN DER WELT, UNTERWEGS ZU SICH SELBST --- Das Gehen und Wandern, die ursprünglichste Bewegungsform des Menschen, ist eine Form der Glückssuche. Denn wer geht, kommt ins Sinnieren und läuft auch durch seine eigene Denklandschaft. Ob in den Wüsten der Welt, auf Chinas Seidenstraße, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze oder auf Don Quijotes Spuren in der spanischen La Mancha - überall erlief sich Achill Moser ungeahnte Einsichten. Er berichtet von echten Abenteuern, den unter¬schiedlichsten Formen des Gehens - vom Nomadentum bis zum Pilgern - und vor allem davon, wie das Gehen den Blick auf die Welt und sich selbst verwandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Ähnliche
Achill Moser
Zu Fuß hält die Seele Schritt
Gehen als Lebenskunst und Abenteuer
Atlantik
Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen,
und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre,
dass man ihn nicht beim Gehen loswürde.
Sören Kierkegaard
Vorwort
Nur zu Fuß hält die Seele Schritt
Wege entstehen dadurch,
dass man sie geht.
Franz Kafka
Im Laufe meines Lebens habe ich schon so manches erlebt: dramatische Situationen, unliebsame Missgeschicke, wunderbare Begegnungen, beeindruckende Naturphänomene, leidenschaftliche Momente. Und doch gibt es für mich ein paar ganz simple Augenblicke, bei denen mir – im wahrsten Sinne des Wortes – immer wieder die Luft wegbleibt. Und obschon ich das, was mich sprachlos macht, bereits unzählige Male erlebt habe, bin ich dennoch jedes Mal wieder ergriffen und spüre eine prickelnde Erregung, die mich überkommt, wenn ich zu meinem gepackten Rucksack greife, ihn auf die Schultern nehme und zu einer neuen Reise aufbreche – und zwar zu Fuß.
Ich liebe das »Zu-Fuß-Reisen«. Es ist für mich eine Art Rückkehr zur Langsamkeit, ein Allheilmittel gegen die Stressfaktoren der Zivilisation, egal, ob ich auf dem Kolonnenweg der NVA an der ehemaligen innerdeutschen Grenze oder über die Alpen nach Italien unterwegs bin. Ich wanderte in China, Ägypten, Australien, Alaska, Kenia und durch die Prärie in Nordamerika, reiste auf vergessenen Karawanenwegen und alten Entdeckerrouten durch die Wüsten der Welt und folgte den historischen Reiserouten von Heinrich Heine, Gustave Flaubert, Sven Hedin oder Gerhard Rohlfs, dem großen Afrikaforscher. In Eis und Schnee war ich in Alaska und auf Island unterwegs, lief ›auf Schusters Rappen‹ durch Kastilien-La Mancha und begab mich auf die Spuren von Miguel de Cervantes und seinen unsterblichen Phantasiefiguren Don Quijote und Sancho Panza.
Straßen, Wege und Pfade führten mich auf allen fünf Kontinenten zu geschichtsträchtigen Orten und wundervollen Naturschönheiten. Entlang großer Flüsse ging ich durch Wälder, über endlose Ebenen oder Berge, hinauf und hinunter. Nicht zu vergessen: die vielen Städte – Florenz, Kairo, Marrakesch, Peking, London, Nairobi, Reykjavík –, durch die ich von einem Ende zum anderen spazierte, um im Gehen all die unspektakulären Kleinigkeiten zu erobern, die Geschichte und Geschichten erzählen.
Nichts bildet unser Leben besser ab als das Gehen. Es ist Sinnbild unseres Daseins, jeder Weg oder Pfad mit all seinen Höhen und Tiefen erscheint mir als Symbol des Lebens selbst.
In der Rückschau fällt mir vor allem ein Erlebnis ein, das meine Leidenschaft zum Gehen und Wandern weckte und das mich tief prägte, weil mein Leben von da an ganz anders verlief: Es war gegen Ende der siebziger Jahre. Damals war ich in den unwirtlichen, weitgehend wilden Norden Kenias gereist. Eine kaum bekannte Gegend im Osten Afrikas, fernab der Zivilisation. Dort lebten die Turkana auf einem Gebiet von der Größe Hollands. Ein Volk, das in jenen Tagen als kriegerisch und unregierbar galt. Alle Versuche der kenianischen Regierung, dem Nomadenstamm einen Übergang zur modernen Zivilisation zu ermöglichen, waren gescheitert, weil die Turkana ihre kulturelle Eigenständigkeit nicht aufgeben wollten. Ohne Sondergenehmigung war das Betreten dieser Region verboten.
Mit gleichförmigen Schritten wandern die Turkana durch Kenias Norden.
Als Student der Afrikanistik faszinierte mich dieses Naturvolk, dessen Kultur grundlegend anders war als das, was ich kannte. Ich interessierte mich für diesen anarchistischen Stamm so sehr, dass ich schließlich den brennenden Wunsch verspürte, in den Norden Kenias zu reisen, um eine Zeit lang bei den Turkana zu leben. Natürlich war mir damals absolut klar, dass das Mitleben bei einem fremden Volk die sicherlich schwierigste Art ist, eine andere Kultur kennenzulernen. Doch was mich antrieb, war der Wunsch, eine Lebensform zu erleben, wie sie mir unsere westliche Zivilisation niemals bieten konnte. Ich wollte das Wesen eines Nomadenstammes erkunden, dessen Männer noch im 20. Jahrhundert kleine Holzpflöcke oder Patronenhülsen in ihren durchbohrten Ohrläppchen und Unterlippen trugen. Bunte Lederbänder und Eisenringe zierten ihre Ohren und Gliedmaßen, während sich die Frauen mit glattrasierten Schädeln, wulstigen Schönheitsnarben und bunten Perlenketten schmückten. Wie ein enger Kragen umschnürten Hunderte von Ketten ihren Hals. Niemals durfte eine Turkana-Frau aus traditionellen Gründen ihren schweren Perlenkranz ablegen, der zur Reinigung mit ranzigem Fett und Urin eingeschmiert wurde. Lebenslänglich ging eine Frau der Turkana in Ketten.
Das Unterwegssein mit ihren Tieren – Kamelen, Ziegen und Schafen – bestimmte größtenteils den Lebensrhythmus der Turkana, die zudem im Lake Rudolf (heute Turkana-See) mit kleinen Flößen aus Palmenstämmen Fischfang betrieben. Ein gefahrvolles Unterfangen, weil heftige Stürme, Flusspferde und eine große Krokodilpopulation den Männern die Fangarbeit erschwerten, sodass sie in erster Linie von der Viehwirtschaft lebten. Gleichwohl machten die vorherrschenden klimatischen Bedingungen die lebensnotwendige Nahrungs- und Wasserversorgung der Viehherden äußerst schwierig, sodass die Turkana mit den Gabbra im Norden und den Rendille im Süden ständig in kriegerischen Auseinandersetzungen standen. Nicht selten überfielen Krieger nachts ein Dorf der Nachbarstämme, um das Vieh der überrumpelten Gegner in die eigenen Pferche zu treiben. Dabei wurden oft Männer, Frauen und auch Kinder getötet. Selbst Polizei- und Militärpatrouillen gelang es seinerzeit nicht, trotz Einsatz modernster Ausstattung, die brutal durchgeführten Viehdiebstähle der nordkenianischen Stämme zu verhindern.
Ich lebte damals viele Monate bei den Turkana. Eine aufregende Zeit, in der ich ständig auf etwas Unvorhergesehenes vorbereitet war, und ich wusste es zu schätzen, als ich sie schließlich auf einigen ihrer Viehwanderungen durch Kenias Wüste begleiten durfte. Wanderungen, die selbst für die an extremste Entbehrungen gewöhnten Turkana als harte Prüfung galten. Hitze, Durst, Sandstürme und Raubtiere erwarteten mich, doch ich war begeistert, als ich mit den Turkana in das karge Wüstenland aufbrach.
Fast nackt – nur mit ein paar Tüchern um die Hüften oder Schultern und bewaffnet mit Speer, Schwert und Holzkeule – wanderten die hoch gewachsenen, sehr dunkelhäutigen Nomaden durch das dornige, rotbraune Land. Sie hielten ständig Ausschau nach Wasserstellen und Nahrung für ihre Herden. Hatten sie ein Dorf vor Augen, das ihr Ziel war, blieben die Männer stehen und warteten eine Weile. Anfangs verstand ich es nicht. Warum taten sie das? Schließlich erklärten mir die Turkana – für die das Gehen nicht nur Lebensinhalt, sondern existenzielle Daseinsform ist – ihre Maxime: Nach einem langen Marsch warteten sie eine gewisse Zeit vor ihrem Zielort, damit ihre Seele sie einholt. Denn: Nur zu Fuß hält die Seele Schritt.
Seit jenen Tagen bei den Turkana ist das Gehen für mich zu einem Abenteuer geworden. Der Virus des Zu-Fuß-Reisens hatte mich gepackt. Ein Zugewinn an Lebensfreude, eine Form der Glückssuche. Und überall auf der Welt, wo ich mittlerweile zu Fuß unterwegs war, um durch die Magie des Gehens das Leben in seiner intensivsten Form zu empfinden, begleiteten mich die Worte der Turkana-Nomaden. Worte, die für mich eine Art Initialzündung waren, durch die ich phantastische Entdeckungen machte und mir ungeahnte Erfahrungen, Einsichten und Erkenntnisse erlief.
Meine eigene Weltanschauung kommt also vor allem durch die tatsächliche Anschauung der Welt zustande – und das geht natürlich am besten zu Fuß.
Im Norden Kenias wanderte ich mit Samburu-Nomaden durch einsame Landstriche. Für die Samburu und Turkana ist das Gehen existenzielle Daseinsform.
1Wenn die Seele Freiraum braucht
Vom Loslassen und Aufbrechen
Wenn ich loslasse, was ich bin,
werde ich, was ich sein könnte.
Wenn ich loslasse, was ich habe,
bekomme ich, was ich brauche.
Lao Tse
Der Traum vom Ausbruch aus dem Alltag, vom freien und unbekümmerten Leben – wer hätte ihn nicht schon mal geträumt? Alles hinter sich lassen, den gepackten Rucksack schultern und einfach loswandern, zwecks Selbstfindung. Doch wer sich zu einem Auf- und Ausbruch entschließt, merkt zuweilen, dass das Entkommen aus den eigenen vier Wänden gar nicht so einfach ist.
Schon im Alter von 17 Jahren habe ich erfahren, wie schwer es ist, den ersten Schritt zu tun, wenn man eine Idee zur Veränderung seines Lebens hat. Damals, es waren die siebziger Jahre, ging ich noch zur Schule und nahm nebenbei alle möglichen Gelegenheitsjobs an, um mir das Geld für eine Reise ins exotische Marokko zu verdienen. Meine Eltern reagierten mit Bestürzung. »So was Verrücktes macht man nicht! Wer hat dir bloß solche Flausen in den Kopf gesetzt?« In endlosen Diskussionen musste ich mich erklären und rechtfertigen, weil scheinbar jeder Ausbruch aus dem gewohnten Alltag eine logische Begründung braucht. Gründe gab es, und sie gibt es auch heute noch zur Genüge.
Vor allem im Lauf der letzten Jahre wird der Wunsch nach Entschleunigung bei vielen Menschen immer größer. Irrsinnig schnell ist unsere Welt geworden, und die Auswirkungen auf unsere Psyche sind enorm. Viele Menschen fühlen sich gestresst, überfordert oder ausgebrannt, klagen über Hektik, Schlafstörungen und Depressionen, suchen nach Überschaubarkeit und einer neuen Balance, um dem unkontrollierbaren Hamsterradrennen zu entkommen. Gründe für kleine und große Fluchten sind also deutlich erkennbar, und wohl jeder kann sie für sich benennen, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und sich eingesteht: Ich brauche mal eine Auszeit, muss einfach mal weg, weil mich der stetige Trott langweilt, weil mich Sehnsucht und Neugier treiben, weil ich durch das unablässige Funktionieren meine Begeisterungsfähigkeit verliere, weil ich mehr Zeit für mich selbst brauche, weil mir die ganze Geschäftigkeit über den Kopf wächst, weil ich ein Verlangen nach Veränderung spüre – und weil eine wachsende Unruhe schließlich zur zwingenden Kraft wird, die mich fortzieht.
Wenn sich bei mir derartige Signale einstellen, wehre ich mich anfänglich noch dagegen und gebe mir Mühe, relativ »normal« zu funktionieren. »Das gelingt dir aber nur selten«, meint meine Frau Rita – und sie hat Recht. Meine Stimmungskurve hängt in solchen Lebensphasen durch wie eine Trauerweide und dämpft die Lebenslust. Weltschmerztage. Manchmal wochenlang. Was mir hilft, ist Potentialentfaltung: Die Aussicht auf baldige Veränderung, denn das Leben ist ein Erkenntnisprozess. Und mit dem »Blick nach vorn« plane ich ein nächstes Unterwegssein, weil ich weiß, was mir fehlt – neue Begegnungen, neue Erfahrungen und die kontinuierliche Bewegung.
»Einfach loslassen – und alle Einengungen und Unsicherheiten beiseiteschieben«, das sagte ich mir damals, als ich im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal nach Nordafrika reiste, und das sage ich mir noch heute, wenn ich zu einer neuen Wanderung aufbreche. Ohne Loslassen gibt es keinen Neuanfang. Und wer in seinem Leben wirklich etwas verändern will, muss das Loslassen lernen. Man muss sich lösen vom gewohnten Alltag; lösen von allem Materiellen; lösen von dem Gefühl, stets für alles verantwortlich zu sein; lösen auch von den Gedanken an die Zukunft. Denn wer Außergewöhnliches wagen will, muss auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Dazu gehören die Trennung von alten Gewohnheiten, das Lösen von persönlichen Bindungen und der Abschied von Liebgewordenem.
Eine Wanderung durch Thüringen führte mich zum langgestreckten Gipfelplateau des Gebaberges, der 751 Meter aus der Rhön aufragt.
Die Entscheidung zum Loslassen war und ist für mich ein befreiender Ritus und eine wesentliche Voraussetzung, um sich auf den Weg zu machen. Natürlich wägt man vor einem Aufbruch alle Eventualitäten ab, durchdenkt das Geplante, prüft seine Beweggründe – und wenn man sich sicher ist, schiebt man mutig alle Warnungen beiseite, macht sich frei, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und die eigenen Träume in Bewegung zu setzen. In solchen Entscheidungsphasen steckt sich mein Ego zumeist Watte in die Ohren, und voller Hoffnung sage ich mir: »Wenn nicht jetzt, wann dann?« Worte, die für mich seit vielen Jahren motivierender Antrieb sind. Denn der Mensch ist ein Nomade, und die Natur hat uns seit Jahrtausenden das Unterwegssein vorgegeben. Eine Tatsache, die wir in unserem übertechnisierten Alltag verdrängt und fast vergessen haben. Der Mensch ist sesshaft geworden, und der enorme Zuwachs der Weltbevölkerung lässt einen natürlichen Wandertrieb nicht mehr ohne weiteres zu. Das wissen mittlerweile auch die Betreiber zahlloser Fitnessstudios, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, um Menschen unterschiedlichen Alters in Bewegung zu bringen. Für mich ist das nichts. Meinen nomadischen Bewegungstrieb kann ich unmöglich auf einem elektronisch betriebenen Laufband ausleben. Was ich brauche, um meine körperlichen und sinnlichen Anlagen auszuschöpfen, ist ein Weg, ein Pfad, ein Stück freie Natur – und darüber ein grenzenloser Himmel.
In meinem »inneren Rucksack« habe ich dann immer eine Vision, nämlich die Vision eines einfachen und bewussten Lebens, gepaart mit einem respektvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur. Das humane Tempo ist das Maß.
Im Gehen, Schritt für Schritt, erlebe ich dann hautnah meine Umwelt, kann wieder staunen, mich wundern, mich freuen – und innehalten, wenn ich die ungeheure Vielfalt der kleinen Dinge am Wegesrand wahrnehme, die die Evolution hervorgebracht hat. Wir dürfen nicht aufhören, Suchende zu sein, wie es unsere nomadisierenden Vorfahren waren, sonst verlieren wir eines der größten Wunder des Lebens: die Entdeckerfreude.
2Die Magie der Prärie
Unterwegs im Mittleren Westen der USA
Ich ging von der Vernunft in das Gefühl,
von der Sicherheit in das Abenteuer,
vom Rationalen in den Traum.
Erich Maria Remarque
Eine sanfte Brise wehte über das ausgedörrte Präriegras. Es roch nach feuchtem Staub und Salbei. Irgendwo musste ein Regenschauer niedergehen, denn in der Ferne schwebte ein Regenbogen in den prächtigsten Farben. Es war noch früh am Morgen. »Das ist unsere heilige Zeit«, sagte mir ein Medizinmann der Sioux. »Da begegnest du dem Heiligsten, das durch die Farben des Himmels zu dir spricht.« Tatsächlich waren die Morgenstunden immer etwas Besonderes, wenn sich Lichtstreifen in rot, gelb und orange am östlichen Horizont zeigten, ineinanderflossen und sich durch eine aufreißende Wolkenlandschaft fächerartig in die Weite verbreiteten. Das waren magische Momente, in denen sich Vater Himmel und Mutter Erde im Einklang befanden. So hatten mir einige Sioux und auch Angehörige anderer Stämme vom Sonnenaufgang erzählt. Und so erlebte ich es nun selbst: Das aufziehende Tageslicht vertrieb die Nacht. Leuchtendes Goldgelb und die damit einhergehende Wärme berührten fühlbar die Erde. Durch die weiche Einstrahlung von außen öffnete sich irgendetwas, nahm mich auf. Ich spürte Kraft und Geborgenheit. Ein Gefühl so nahe an den Träumen, dass es süchtig machen konnte.
Seit zwei Monaten war ich zu Fuß im Mittleren Westen der USA unterwegs. In einer Region, wo die Mythen der Ureinwohner Amerikas allgegenwärtig sind. Unterwegs durch South Dakota, Wyoming und Montana, wollte ich einen Landstrich aus der Sicht des Zu-Fuß-Reisenden erleben, so wie einst die Paläoindianer diese Region erkundeten und zu ihrem Lebensraum machten, nachdem sie vor mehr als 10000 Jahren aus dem Inneren Asiens über die längst im Meer versunkene Bering-Landbrücke nach Alaska kamen und Amerika erschlossen – lange vor Kolumbus.
Was mich trieb, war die Liebe zur Natur und das Interesse für die Geschichte der Besiedelung des amerikanischen Westens. Seltsamerweise schenke ich der Vergangenheit immer mehr Beachtung, je weiter unser übertechnisierter Fortschrittswahn in eine schwer überschaubare Zukunft führt, in der die Menschen vor allem ihre Effizienz unter Beweis stellen müssen. Schon seit langem habe ich den Eindruck, dass durch das permanente Vorwärtsdrängen in unserer zivilisierten Welt irgendetwas verlorengegangen zu sein scheint. Etwas Bedeutsames und Lebenswichtiges. Etwas, das mit unserem Daseinsgefühl, mit dem vielbeschworenen Sinn des Lebens zu tun hat. Etwas, das der moderne Mensch mittlerweile in der Natur sucht, bei uralten Völkern, deren Wissen und Weisheit im Laufe der letzten hundert Jahre in Vergessenheit geraten ist und zu entschwinden droht. Zum Beispiel jene Weisheit, die Grundsatz indianischer Philosophie ist und die mir Joe Curtis, ein 57-jähriger Cheyenne mit langem grauem Haar, tiefliegenden Augen und einem rotkarierten Holzfällerhemd auf einem Parkplatz von Pine Ridge erzählte: »Nimm dich selbst nicht so wichtig; lausche und schaue in die Welt hinaus und nicht so viel in dich hinein; werde heimisch in der Welt deiner Mutter und deines Vaters und fühle dich in die Rhythmen der Natur ein.«
Um eine ganz unmittelbare Verbindung mit der Natur zu spüren, war ich nach South Dakota gereist, dem »Sunshine State«. Dort schulterte ich meinen Rucksack und machte mich auf den Weg in Richtung Nordwesten. Denn die Möglichkeit, das Aktive mit dem Kontemplativen zu verbinden, ist wohl nirgends so stark wie beim einsamen Gehen durch die Weiten grandioser Landschaften.
Grandios und einsam waren auch die Badlands zu Beginn meiner Wanderung. Ein über hundert Kilometer langes Sandsteingebirge mit zerfurchten Zinnen und Zacken, das sich inmitten der Prärie erstreckt. In Jahrtausenden haben Wind und Wasser selbst die härtesten Gesteinsschichten zu bizarren Formen geschliffen. Die Sioux nannten diese Region »Makoshika«, schlechtes Land. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen, als ich in dieses Gebirge eintauchte. Vor allem in der Mittagshitze erschien mir das Berglabyrinth mit seinen Schluchten und Felstürmen aus hellem Gestein wie ein überdimensionaler Sonnenofen. Glutheißer Wind pfiff durch das Felsgewirr, das jährlich Hunderttausende von Besuchern durchqueren. Das unwirklich-gespenstische Felsgebirge, steinerne Attraktion und Ursprungsland zahlloser indianischer Legenden, wurde zum beliebten Nationalpark, nachdem die Sioux in Reservate verbannt worden waren.
Wenn am Abend die Sonne hinter den sich übergipfelnden Bergriesen verschwand und die wind- und wettergeschliffene Landschaft sich im Wechsel von Licht und Schatten verwandelte, kamen mir die Badlands vor wie ein magisch-mystisches Reich, so wie es auch die amerikanischen Ureinwohner gesehen haben müssen. Dabei dachte ich an Pine Ridge, die Stadt im Süden von South Dakota, die ich vor meiner Wanderung besucht hatte.
Ich war mit dem Bus gekommen, und mit dem Bus hatte ich Pine Ridge wieder verlassen. Es war kein Ort zum angenehmen Verweilen. Denn hier sah ich den jämmerlichen Alltag der Sioux: zerfallene Behausungen, ungepflasterte Straßen, ausgeweidete Autos und fliegenumschwirrte Hundekadaver. Dazwischen zerlumpte Kinder, gebeugte Frauen und betrunkene Männer, obwohl der Verkauf von Alkohol im Reservat verboten war. Doch jenseits der drei Kilometer entfernten Grenze zum Bundesstaat Nebraska war Schnaps und Bier zu haben. Nirgendwo in den USA war die Arbeitslosenquote höher als rund um Pine Ridge. Und keine Gemeinde hatte ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen.
Das, was aus dem stolzen Volk der Sioux geworden ist, steht nicht in den Geschichtsbüchern; ich konnte es in Pine Ridge erfahren. Die jahrzehntelange Kolonialpolitik der weißen Amerikaner hatte das indianische Volk zerbrochen – sie mussten dramatische Ausrottungsschlachten, die Vertreibung aus ihren Jagdgründen und die Verpflanzung in Reservate erleiden. Alle späteren Versuche, die Ureinwohner zu »rothäutigen Weißen« zu machen, raubten den Stämmen ihre Identität, und alle zweifelhaften Bemühungen, die Native Americans durch Subventionen auf den Standard des »American way of live« zu bringen, waren gescheitert.
Es versteht sich von selbst, dass mich die Elendsbilder von Pine Ridge auf meinem Weg entlang der Badlands im Kopf begleiteten, während ich weiter nach Nordwesten zog – dorthin, wo die Landschaftskulissen noch heute jede Sehnsucht nach Ursprünglichkeit erfüllen. Vollkommen unabhängig – mit Zelt, Proviant und Wasser – rastete ich immer dort, wo es mir gefiel: auf einem freien Hügel, an einem Flusslauf, in der Nähe einer Bergkulisse oder inmitten der Prärie. Hinsetzen, schauen, staunen. Und nachts, wenn die silberne Mondscheibe einen milchigen Schimmer auf das Land streute, lag ich unter dem Sternengefunkel und kroch erst dann in mein Zelt, das ich an einer geschützten Stelle aufgebaut hatte, wenn ich mich am glitzernden Himmel sattgesehen hatte. Keine Sternschnuppe wollte ich verpassen.
Tagsüber, beim stetigen Gehen auf schnurgeradem Asphalt oder sandigen Pfaden, stellte sich alsbald auch das passende Gefühl ein, das mir die Prärie vermittelte. Ich spürte Ungebundenheit und Bewegungsfreiheit, während ich mit großen, raumgreifenden Schritten voranlief. Der stahlblaue Himmel, das endlos ausrollende Land und mein gleichmäßiges Schritttempo gaben den Tagen einen betörenden Gleichklang. Vor allem durch die Ruhe des Gehens konnte ich mich allmählich an die ungewohnte Landschaft anpassen, in der ein anderer Puls schlug, die Sonne ein anderes Licht vom Himmel warf und die indianischen Mythen – trotz aller Veränderungsprozesse – erfahrbar schienen. Schließlich war es hier, wo die Ureinwohner einst die weiten Ebenen durchstreiften auf der Jagd nach Bisons, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch millionenfach über die Great Plains zogen.
Mittlerweile leben in der Südwestecke South Dakotas nur noch rund zweitausend Bisons, dennoch ist es die größte Herde der USA. Auf sie traf ich im Grasland des Custer State Parks. Im ersten Moment mochte ich meinen Augen kaum trauen, als ich in der Ferne Hunderte dunkelbrauner Pelzrücken sah, die über das hügelige Land wanderten. Wie Fabelwesen aus einer anderen Welt erschienen mir die zotteligen Riesen, die immer wieder äsend stehen blieben, um Gras, Kräuter, Moose und Flechten zu fressen. Was für ein Anblick! Über drei Meter sind die ausgewachsenen Bisons lang, sollen bis zu 900 Kilo wiegen, so hatte ich gehört. Und dennoch seien die Tiere unglaublich schnell, erreichten eine Geschwindigkeit von fünfzig Stundenkilometern.
All das schreckte mich nicht, als ich den Bisons näher kam, während der sanfte Wind die hohen Gräser wiegte. Ganz nahe wollte ich den Tieren sein. Warum? Ich weiß es nicht. Etwas Unerklärliches trieb mich zu ihnen.
In South Dakota traf ich auf eine der letzten großen Bisonherden.
Mein bester Schutz war der Wind, als ich mich auf eine Bison-Gruppe zu bewegte, die in einem Meer aus Gras, Salbei und Dachtrespe standen. Sorgsam achtete ich darauf, dass ich gegen den Wind oder mit dem Seitenwind ging. Und als mich nur noch wenige Meter von zwei äsenden Bisons trennten, hoben die beiden Tiere plötzlich ihre Köpfe und blickten in meine Richtung. Wie festgenagelt blieb ich stehen, verhielt mich ganz ruhig, auch die schussbereite Kamera benutzte ich nicht. Angespannt beobachtete ich die beiden mächtigen Tiere, sah die hohen Buckel der Vorderkörper, die ein Dreieck formenden Köpfe, die kräftigen Bärte und die kurzen, gebogenen Hörner. Und ich sah die braun-metallisch glänzenden Augen, in denen sich mir die ganze Wildheit der Bisons offenbarte. Doch Angst spürte ich nicht, es war eher Faszination. Trotz dieses penetranten Geruchs, der von den staubverklebten Tieren ausging. Ein Geruch, so beißend-streng, der mir fast den Atem nahm.
Auge in Auge stand ich den Bisons eine ganze Weile gegenüber, die sich irgendwann abwandten und gemächlich davonwanderten. Ich war erstaunt über ihre Gleichgültigkeit, die sie mir gegenüber zeigten, und – auch wenn es sich verrückt oder leichtsinnig anhört – ich beschloss spontan, den Tieren zu folgen.
Einen Tag lang wanderte ich mit größter Vorsicht in unmittelbarer Nähe der Bisons, wobei sich der Abstand immer dann vergrößerte, wenn die Herde – ohne für mich ersichtlichen Grund – plötzlich zu galoppieren begann, mit wild wirbelnden Hufen, die ein dumpfes Grollen verursachten. In das staubige Trampeln mischte sich dann dröhnendes Blöken, das wie fernes Gewittergrummeln klang.
Zu Fuß brauchte ich natürlich eine gewisse Zeit, um die Bisons in der Prärie wieder einzuholen. Dabei drifteten meine Gedanken beim Gehen in den fast kniehohen Grasflächen in jene Zeit, als die spanischen Konquistadoren unter Francisco Vásquez de Coronado Mitte des 16. Jahrhunderts die nordamerikanischen Grasländer erreichten. Damals erstreckten sich die großen Grasebenen, nur von einigen Flussläufen und Baumstreifen unterbrochen, über eine Fläche von 3,6 Millionen Quadratkilometern. Ein schier grenzenloses Grasland, das die französischen Entdecker ein Jahrhundert später »prairie«, Wiese, nannten. Es war die Heimat von Millionen Bisons, die, wie einst die Paläoindianer, über die vereiste Bering-Landbrücke von Asien nach Amerika gekommen waren, ehe sie sich über den ganzen Kontinent ausbreiteten.
Mittlerweile hat sich die Prärie gewaltig verändert. Nur vereinzelte Flecken der einstmals unermesslichen Grasweiten sind heute noch in unverändertem Zustand. Der Veränderungsprozess in diesem komplexen Ökosystem begann mit den ersten Siedlern im 17. Jahrhundert, die in dem schier grenzenlosen Grasland einen idealen Boden für ihre Pflanzungen fanden. Kultivierte Sorten der Graminaceen (Süßgräser) wurden angebaut und verdrängten die widerstandsfähigen Präriepflanzen. Vor allem seit der Erfindung der Pflugschar aus gehärtetem Stahl zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Prärieland mehr und mehr bewirtschaftet. Farmer und Rancher verwandelten große Teile der wildwuchernden Ebenen in ertragreiches Acker- und Weideland, zerstörten die jahrtausendealte Grasdecke, bestehend aus Blaustengelgras, Fuchsschwanzgerste und Büffelgras. Hinzu kamen ein sinkender Grundwasserspiegel und eine immer stärkere Erosion, was dazu führte, dass aus vielen fruchtbaren Gebieten wüste Landstriche wurden.
Ganz anders war es, als die ersten Siedler mit ihren Planwagen über die »Great Plains«, die großen Ebenen, rollten. Beim Anblick des im Wind wogenden Graslandes, das sich wie eine Dünung zum Horizont ersteckte, drängte sich ihnen der Vergleich mit dem Meer auf. Und auch mir kamen ähnliche Vergleiche in den Sinn, obwohl sich heute auf dem einstigen Prärieland nicht nur wilde Gräser im Wind wiegen, sondern auch viele Getreidearten.
Gleichwohl empfand ich die weiten Ebenen beim stetigen Gehen nie als eintönig. Vor allem die sich überbuckelnden Hügelketten ließen die herrliche Ausdehnung des Landes noch gewaltiger erscheinen. Zudem setzten busch- und baumgesäumte Flussläufe, kleinere Monolithe und bizarre Felsformationen viele landschaftliche Akzente. So auch die Black Hills, ein Gebirgszug mit dichten Wäldern, wilden Flüssen, schroffen Felsformationen, weiten Grasebenen und schimmernden Seen. Vom Westen South Dakotas erstreckt sich dieses spektakuläre Waldgebirge bis ins nordöstliche Wyoming, umfasst eine Fläche von etwa einhundert mal zweihundert Kilometer. Seinen Namen erhielt dieser Landstrich aufgrund der dunklen Ponderosa-Kiefern. Schon von weitem wirkte der dichte Nadelwaldbewuchs wie eine fast schwarze Wand.
Als ich mich anderntags den Black Hills näherte, traf ich – völlig überraschend – auf eine Ansammlung von Werbeschildern. Auf riesigen Billboards las ich Freizeitangebote für Biker und Hiker, Kanuten und Wild-West-Fans. Reklametafeln warben für Wasserparks, Krokodilfarmen und Wachsmuseen. Für South Dakota ist dieses Feriengebiet zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Mehr als 600 Millionen Dollar an Einnahmen aus dem Tourismus werden jährlich in die Staatskasse gespült, obgleich die Black Hills eigentlich den Lakota-Sioux gehören. Es ist ihr Geburtsort: »Wamaka Og’naka l’Cante«.
Die Schönheit von Bergwelt und Prärie erschloss sich mir dagegen im Westen der Black Hills, wo sich der Wind Cave National Park erstreckte – mit ausgedehnten Grasflächen und offenem Land, das an der Nahtstelle zu den Gelbkiefernwäldern der Black Hills lag. Ein großartiger Naturgroßraum, in dem sich Bisons, Wapiti-Hirsche, Gabelhorn-Antilopen, Präriehunde und Kojoten frei bewegten. Alles war hier so wahnsinnig nahe und unfassbar groß. Und während ich von einer Weg- oder Pistenwindung zur nächsten lief, von einer baumbewachsenen Hügelkette zur anderen wanderte, konnte ich mich nicht sattsehen an den vielfältigen Farben der Landschaft: So grün, so braun, so orange. Und darüber eine riesige Fläche von Blau. Ein erhebender Anblick.
Es ist vor allem die Zweiteilung dieser Region, die den Wind-Cave-Nationalpark so einzigartig macht. Während die Hochebene der südlichen Black Hills von endlosen Mischgrasebenen, ausgedehnten Wäldern, tiefen Flusstälern und zerklüfteten Bergketten geprägt ist, befindet sich unter der Erde ein riesiges Höhlensystem, das sich über mehr als 220 Kilometer erstreckt.
Um das geheimnisvolle Geflecht von Gängen, Tunneln und Kammern zu erleben, kehrte ich der Sonne den Rücken und schloss mich einer Höhlenführung an. Über zahllose Stufen ging es in die Tiefe, wo die Durchschnittstemperatur neun Grad Celsius betrug. Alle Besucher waren mit Jacke, langer Hose und festen Schuhen ausgerüstet. Manch einem wurde in der Dunkelheit ein bisschen mulmig. Doch die Faszination überwog, als ein Ranger wissenswerte Informationen zur Entstehung des unterirdischen Wegesystems gab: Vor 60 Millionen Jahren hatten tektonische Bewegungen die Black Hills angehoben und in den tiefer gelegenen Kalksteinschichten hatten sich zahllose Spalten gebildet, in die Wasser eindrang und das Gestein in Jahrmillionen aushöhlte. Erst 1881 wurde die Höhle entdeckt. Siedler hatten in unmittelbarer Nähe einen stetigen Pfeifton bemerkt und fanden ein kleines Loch, durch das der Wind blies. Dieses Loch wurde vergrößert und bildet heute den Eingang zur »Wind Cave«, in deren Labyrinth nach wie vor ein deutlicher Luftzug spürbar war.
Höhepunkte des Höhlenzaubers waren nicht Stalaktiten und Stalagmiten, von denen es aufgrund der großen Trockenheit nur wenige gab, sondern kunstvolle Gesteinsformationen, farbenprächtige Felswandschattierungen sowie mineralische Kalkspatgebilde (auch »Boxwork« genannt), die an den Decken und Wänden gewachsen waren. Diese Kalzium-Formationen, die an unregelmäßige Honigwaben erinnern, gelten als schönste Steinwaben der Welt.
Überdies ist die Wind Cave eng verbunden mit der Herkunftsgeschichte der Lakota-Sioux. In einer Legende heißt es, dass sie vor 10000 Jahren durch das verzweigte Höhlensystem aus den Tiefen der Erde in das Licht dieser Welt geklettert seien.
Sobald ich aus der Höhle ans Tageslicht getreten war, schwelgte ich beim Sonnenuntergang im Farbenrausch. Ein großer, gelber Ball schwamm im rot-violetten Himmel, berührte irgendwann die Erde und sank als orangegoldener Punkt hinter den Horizont. Das waren Momente, die meine mystische Saite zum Klingen brachten. Momente, in denen ich die Farben des verlöschenden Lichtes in mir speichern wollte. Doch plötzlich merkte ich, dass mein innerer Bilderspeicher voll war. Nichts konnte ich mehr in mich aufnehmen, auch wenn Himmel oder Landschaft noch so schön waren. Meine Sinne waren übersättigt. Zu viel hatte ich in den vergangenen Wochen gesammelt und in mir eingelagert. Das Außergewöhnliche erschien mir auf einmal ganz normal. Visueller Overkill: Jede Bergkette war überwältigend, jeder Wald märchenhaft, jeder Flusslauf atemberaubend, jeder Wasserfall imposant. Und alles war intensiv, kaum zu verkraften. Kein Wunder, dass meine Wahrnehmungsfähigkeit abstumpfte.
Kopf und Augen brauchten Besinnung. Also gönnte ich mir auf einem Campingplatz des Wind-Cave-Nationalparks, nördlich des Visitor Center, ein paar Tage Gemütsruhe, schrieb Tagebuch und las in Dee Browns Buch Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses, in dem der amerikanische Autor die Eroberung des Westens durch den weißen Mann aus der Sicht der Indianer schildert. Hier traf ich anderntags auch Russell, einen vierzigjährigen Lakota-Sioux mit schulterlangem schwarzem Haar, Plastik-Schirmmütze und Jeanshemd. Eine Zigarette steckte lose in seinem Mundwinkel, als er sein knallgrünes Wohnmobil neben meinem Zelt parkte.
»Ich heiße Russell Tahomy«, stellte er sich vor, reichte mir zur Begrüßung die Hand, holte zwei Dosen Bier aus dem Fond seines Wagens und setzte sich ins Gras. Ich machte es ihm nach, als er mit der flachen Hand auf den Boden klopfte und sagte: »Das hier ist mein Land, meine Erde.« Ich nickte nur, als er dann fragte: »Was machst du hier? Bist du allein unterwegs?«
»Ja, ganz allein«, erwiderte ich und berichtete von meiner Wanderung.
»Das zeugt von Sinn und Verstand«, sagte er nachdenklich. »Einen Fuß vor den anderen setzen, das ist die beste Methode, um unser Land