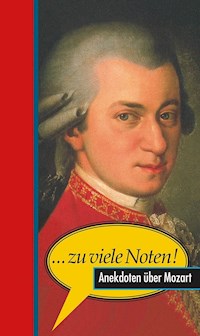
... zu viele Noten! E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Als in Anwesenheit von Kaiser Joseph II. die "Entführung aus dem Serail" uraufgeführt wurde, hatte der Monarch gewisse Vorbehalte und richtete sein kaiserliches Wort an Mozart: "Zu viele Noten, streich er einige weg, und es ist richtig." Diese Szene ist, wie andere auch, die in der Mozartliteratur kursieren, nicht verbürgt. Gesichert aber ist, daß die vielen Noten und also der "richtige" Mozart auf uns gekommen sind und eine nachhaltige Faszination ausüben, die sich auf Werk und Person erstreckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
eISBN 978-3-359-50024-7
© 2005 Eulenspiegel · Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Buchgestaltung: Matthias Gubig, unter Verwendung
eines Mozartporträts von Barbara Krafft, 1819
Die Bücher des Eulenspiegel Verlags
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
… zu viele Noten!
Anekdoten über Mozart
Gesucht, gesammelt und nacherzählt
von Margarete Drachenberg
EULENSPIEGEL VERLAG
Namensgebung
Am 9. Februar 1756 schrieb Leopold Mozart, der in der Bischofsstadt Salzburg als »Hof- und Kammerkomponist« in hochfürstlichen Diensten stand, an seinen Augsburger Freund Johann Jakob Lotter: »Übrigens benachrichte, daß den 27. Januari abends um 8 Uhr die Meinige mit einem Buben glücklich entbunden worden ... Gott sei Dank befinden sich Kind und Mutter gut. Sie empfehlen sich beiderseits. Der Bub heißt Joannes Chrysostomus, Wolfgang, Gottlieb.«
Wolfgang soll nach dem Großvater mütterlicherseits der Rufname sein. Im Geburtenregister des Salzburger Doms ist der Name Gottlieb in griechischer Version eingetragen: Theophilus. Auf seiner ersten Italienreise wandelt der junge Mann ihn in Amadeo um, benutzt später auch das französisierte Amadé, selbst aber nie das latinisierte Amadeus. Manchmal kürzt er den Namen ab mit Amad., und gelegentlich verballhornt er ihn zu »Adam« – der Bräutigam Wolfgang Amadeus Mozart trägt sich 1782 im Eheverzeichnis von St. Stephan eigenhändig als »Wolfgang Adam Mozart« ein.
Zur Nachahmung empfohlen
Wenn der Kleine in der Wiege schrie, nahm der Vater seine Geige und begann zu spielen. Oder er griff sich einen kupfernen Kerzenleuchter und schlug darauf mit einem Schlüssel, das hatte denselben Effekt: Das Kind hörte sofort auf zu schreien.
Kinderspiele
Kaum konnte Wolfgang laufen, gab es nur ein Ziel in der Wohnung: das Pianoforte. Wenn der Vater der fünf Jahre älteren Schwester Maria Anna, genannt Nannerl, Klavierunterricht gab, hockte sich Wolfgang neben oder unters Klavier. Oder er hangelte sich zur Tastatur hinauf und entlockte dem Instrument mit zwei Fingern Töne. Gelang ihm ein harmonischer Zusammenklang, jauchzte er vergnügt.
Bald nahm der Vater den Kleinen auf seine Knie und führte ihm die Finger auf dem Klavier. Das Kind lernte schnell kleine Stücke spielen. In Nannerls Notenbüchlein findet sich eine Eintragung von Leopolds Hand: »Diesen Menuett und Trio hat der Wolfgangerl den 26ten Januari 1761, einen Tag vor seinem 5ten Jahr, um halb 10 Uhr nachts in einer halben Stund gelernet.«
Ja, man staunt, zumal doch um diese Zeit »Wolfgangerl« längst ins Bett gehört hätte.
Ein Kind
Die Schwester Nannerl bezeugte: »Sein liebstes Spielzeug war das Klavier. Er mußte nie dazu genötigt werden. Außerdem machte ihm das Rechnen größten Spaß ... Erwischte er eine Kreide, so waren bald Tisch, Sessel, Wände und sogar der Fußboden mit Ziffern bedeckt. Damit konnte er sich stundenlang unterhalten. Außer der Musik war und blieb er fast immer ein Kind. Und dies ist ein Hauptzug seines Charakters auf der schattigen Seite.«
Tintenkleckse und Noten
Einmal fand der Vater den Vierjährigen am Schreibtisch, mit einer Feder in der Hand und die Finger voller Tinte. Auf die Frage, was er dort mache, sagte Wolfgang: »Ein Konzert für Klavier, der erste Teil ist bald fertig!« Der Vater nahm das Blatt, das voller Tintenkleckse war, die der Kleine mit der Hand auseinandergewischt hatte, betrachtete es erheitert, merkte aber zu seiner Überraschung, daß »alles richtig und regelmäßig gesetzt« war. »Nur ist’s nicht zu brauchen«, meinte er, »weil es so außerordentlich schwer ist, daß es kein Mensch spielen kann.«
»Drum ist es ein Konzert«, sagte Wolfgang, »man muß es eben so lange exerzieren, bis man es trifft. Sehen Sie, so muß es gehn ...!« – setzte sich ans Klavier und spielte, wohl kein vollendetes Stück, doch so, daß der Vater verstand, worauf er hinauswollte.
Die Nummer 1
Mit fünf Jahren komponierte Wolfgang erste Stücke und spielte sie dem Vater vor, der zwei davon in
Nannerls Notenbuch notierte. Die Stücke hat Ludwig Ritter von Köchel in sein »Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts« – kurz genannt »Köchel-Verzeichnis«, noch kürzer KV – als Nummer I aufgenommen. Insgesamt verzeichnet sind 626 Werke Mozarts.
Das absolute Gehör
Ein Freund der Familie, der Hoftrompeter und Geiger Johann Andreas Schachtner, kam oft ins Haus und spielte und musizierte mit den Kindern. Schachtners Geige hatte einen besonders weichen Ton, Wolfgang nannte sie die »Buttergeige«. Als Wolfgang einmal auf seiner eigenen Geige spielte und Schachtner hinzutrat, unterbrach er sein Spiel und sagte: »Herr Schachtner, Ihre Geige ist um einen halben Viertelton tiefer gestimmt als meine ...« Schachtner wehrte lächelnd ab, doch Wolfgang fuhr fort: »Wenn Sie sie doch so gestimmt ließen, wie sie war, als ich das letzte Mal darauf spielte.« Schachtner schüttelte nur den Kopf, aber der Vater ließ die Geige holen. Und tatsächlich: Die Buttergeige war präzise um einen Achtelton tiefer gestimmt.
Mißtöne
Den Ton der Geige liebte Wolfgang, den grellen Klang der Trompete fürchtete er. Vater Leopold konnte das nicht akzeptieren und unternahm immer wieder Versuche, den Sohn an den Klang zu gewöhnen.
Obwohl Wolfgang bereits weinte, verlangte Leopold einmal von Schachtner, dem Kind recht kräftig entgegenzublasen.
»Aber, mein Gott, hätte ich mich nur nicht dazu verleiten lassen! Wolfgang hörte kaum den schmetternden Ton, ward er bleich und begann zur Erde zu sinken ...«
Alles ist möglich
Andreas Schachtner äußerte über den kleinen Wolfgang: »Er war voll Feuer, seine Neigung hing jedem Gegenstand sehr leicht an; ich denke, daß er im Ermangelungsfalle einer so vorteilhaft guten Erziehung, wie er hatte, der ruchloseste Bösewicht hätte werden können, so empfänglich war er für jeden Reiz, dessen Güte oder Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht im Stande war.«
Erste Geige
Wieder einmal fand in der Mozart-Wohnung einer der zahlreichen Hausmusikabende statt.
Schachtner erschien mit einem Kollegen, der sollte die erste Geige, Schachtner die zweite Geige und Vater Leopold die Bratsche spielen. Wie stets hörte Wolfgang gespannt zu und bat den Vater schließlich, die zweite Violinstimme spielen zu dürfen. Aber der lehnte ab, denn der Sohn habe noch nicht »die geringste Anweisung in der Violin gehabt!« Darauf Wolfgang: »Um eine zweite Violin zu spielen, braucht man es doch nicht erst gelernt zu haben!« Der Vater blieb unerbittlich, doch Schachtner überredete ihn, den Jungen mit ihm zusammen spielen zu lassen. Leopold willigte ein: »Geig mit Herrn Schachtner, aber so still, daß man dich nicht hört.« Und so geschah es auch. »Wolfgang geigte mit mir«, so erzählt Schachtner. »Bald bemerkte ich mit Erstaunen, daß ich da ganz überflüssig war.« Durch den Beifall ermutigt, behauptete Wolfgang, er könne auch die erste Geige spielen. »Wir machten zum Spaß einen Versuch und mußten uns fast zu Tode lachen, als er auch dies, wiewohl mit lauter unregelmäßigen Applikaturen, doch so spielte, daß er nie ganz stecken blieb.«
Wie Wunder geschehn
Die »vorteilhaft gute Erziehung« nahm der Vater in die Hand. Er hatte die ungewöhnliche Begabung seiner Kinder erkannt; mit einem immensen täglichen Übungspensum und Unterricht in Klavier,
Violinspiel, Gesang, Orgelspiel, ergänzt durch Theoriestudien, Kopieren eigener und fremder Kompositionen und Lehrübungen im Dirigieren und Komponieren sorgte er dafür, daß das »Wunder« eintrat.
Eine Schule besuchten Nannerl und Wolfgang nie; der Vater war in allem der einzige Lehrer seiner Kinder. Vater Leopold war fleißig, ehrgeizig und ganz und gar der Musik ergeben. Für die Ausbildung seiner Kinder stellte er die eigene Karriere zurück, gab zeitweise das Komponieren auf. Zugleich wollte er aus ihrer Begabung Kapital schlagen; das sollte den Kindern zugute kommen, aber auch die eigene Finanzlage aufbessern.
Wollte er bösen Stimmen ob solcher »Vermarktung« zuvorkommen? Oder die Strapazen, die er den Kindern – und sich selbst – zumutete, entschuldigen? Oder brauchte er vor sich selber eine Rechtfertigung? Mit einem geradezu religiösen Sendungsbewußtsein begründete er seine Pläne: Er wolle »der Welt ein Wunder verkündigen, welches Gott in Salzburg hat lassen geboren werden. Ich bin diese Handlung dem allmächtigen Gott schuldig, sonst wäre ich die undankbarste Kreatur ...«
Reisevergnügungen
Für den noch nicht ganz sechsjährigen Wolfgang begann im Januar 1762 die Zeit des Reisens.
Nannerl erinnerte sich: »Wenn die Familie im Reisewagen durch die fremden Lande fuhr, behauptete Wolfgang, er sei ein König und besichtige sein Königreich. Der Diener mußte auf Wolfgangs Geheiß eine Landkarte skizzieren und drauf die Städte und Dörfer eintragen, durch die der kleine Herrscher kam. Zu jedem Ort diktierte er einen erfundenen phantastischen Namen.«
Wunderkinder auf Reisen
Bevor sie die Reise antreten konnten, mußte Vater Leopold ein Urlaubsgesuch bei seinem erzbischöflichen Dienstherren, Graf Schrattenbach, einreichen, der dieses – wie später weitere – bewilligte.
Auf der ersten Reise spielten die Kinder vor dem bayrischen Kurfürsten in München, auf der zweiten gab Wolfgang am 1. Oktober 1762 in Linz sein erstes öffentliches Konzert.
Von der zweiten Reise berichtet Leopold an die daheimgebliebene Mutter von einem Vorfall: Auf der Durchfahrt in einem kleinen Ort brach ein Rad. Während der Wagen repariert wurde, gingen Vater und Sohn in die Dorfkirche, und Leopold wies Wolfgang an der Orgel in den Gebrauch des Pedals ein. Es dauerte nicht lange, da spielte er das gewaltige Instrument und trat das Pedal ganz selbstverständlich. »Alles geriet in Erstaunen, und es ist eine neue Gnade Gottes, die manch anderer erst nach vielen Mühen erhält.«
Am kaiserlichen Hof
Mit dem Postschiff trafen Leopold und die Kinder am 6. Oktober 1762 in Wien ein. Am Tage zuvor hatte Glucks Oper »Orpheus und Eurydike« im Burgtheater ihre Uraufführung erlebt.
Gerade in Wien angekommen, wurde Leopold von einer Einladung in die Habsburger Sommerresidenz nach Schönbrunn überrascht.
Er berichtete an seinen Freund und Hauswirt, den Kaufmann Leopold Hagenauer, sie seien außerordentlich gnädig aufgenommen worden, und meinte, daß, »wenn ich es erzählen werde, man es für eine Fabel halten wird«. Das Vorspiel des Wunderkindes habe damit geendet, daß der kleine Künstler der huldvoll lächelnden Maria Theresia auf den Schoß gesprungen sei und sie umhalst und geküßt habe.
Unter Kunstkennern
Weniger fabelhaft erschien den Mozarts wohl das Kunstverständnis des Kaisers Franz Stephan, der das wahre Können des kleinen Pianisten testen wollte, indem er die Klaviatur mit einem Tuch abdecken ließ. Wolfgang absolvierte das Zirkuskunststück; der Vater sollte es später als Zugnummer in die Auftritte seiner Kinder einbauen.
Wolfgang hingegen fragte den Kaiser: »Ist der Herr Wagenseil hier? Der soll kommen, der versteht was.«
Der Musiklehrer der kaiserlichen Familie, der auch Komponist war, wurde hinzubeordert, und Wolfgang sagte: »Ich spiele ein Stück von Ihnen. Sie müssen mir umblättern.«
Second hand
Einige Tage nach der Audienz in Schönbrunn schickte der Hof 100 Dukaten an die Familie Mozart und außerdem zwei Hofkleider, »eins für den Buben und eins fürs Mädl«. Wolfgang bekam ein Galakleid »vom feinsten Tuch, lilafarb ... mit Goldborten breit und doppelt bordieret«. Zuvor hatte es Erzherzog Maximilian getragen: Maria Theresia hatte die Gabe aus den abgelegten Kleidern ihrer Kinder zusammengestellt.
Die gute Prinzessin
Bei einem zweiten Besuch in Schönbrunn spielten Wolfgang und Nannerl mit den Kindern des kaiserlichen Paares. Wolfgang glitt auf dem Parkett aus. Prinzessin Maria Antonia – die spätere französische Königin Marie Antoinette und berühmt geworden durch ihren Ratschlag, daß die Armen, wenn sie kein Brot hätten, doch Kuchen essen sollten – half ihm auf.
»Sie ist brav, ich will sie heiraten«, sagte Wolfgang.
Kein Wunder, daß der Vater aus Wien berichtete: »Alle Dames sind in meinen Buben verliebt.«
»Gott hat uns ein kleines Kreuz geschicket ...«





























