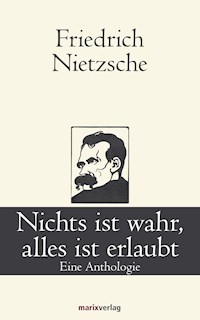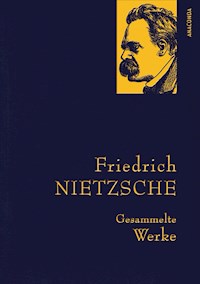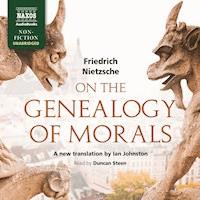Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Werk, das aus einer Vorrede und drei "Abhandlungen" besteht, gehört zu den einflussreichsten Schriften Nietzsches. Er legte hier keine Aphorismen vor wie in den meisten anderen seiner Werke, sondern längere, systematische Texte mit durchaus wissenschaftlichem Anspruch: Er stellt darin soziologische, historische und psychologische Thesen auf. Nietzsche wollte anders als klassische Moralphilosophen keine Moral herleiten oder begründen, sondern die geschichtliche Entwicklung und die psychischen Voraussetzungen bestimmter moralischer Wertvorstellungen nachvollziehen. Er fragt also nicht, wie die Menschen handeln sollten, sondern warum Menschen (Einzelne oder Gruppen) glauben, sie sollten auf bestimmte Weise handeln, oder andere dazu bringen wollen, so oder so zu handeln. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Genealogie der Moral
Eine Streitschrift.
Friedrich Nietzsche
Inhalt:
Friedrich Nietzsche – Biografie und Bibliografie
Zur Genealogie der Moral
Vorrede.
Erste Abhandlung: „Gut und Böse“, „Gut und Schlecht“.
Zweite Abhandlung: „Schuld“, „schlechtes Gewissen“ und Verwandtes.
Dritte Abhandlung: was bedeuten asketische Ideale?
Zur Genealogie der Moral, Friedrich Nietzsche
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616281
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Nietzsche – Biografie und Bibliografie
Namhafter philosophischer Schriftsteller, geb. 15. Okt. 1844 in Röcken bei Lützen, gest. 25. Aug. 1900 in Weimar, war der Sohn eines Pfarrers, der zeitig starb, wurde von seiner Mutter in Naumburg a. S. erzogen, besuchte die Landesschule Pforta und studierte von 1864–67 in Bonn und Leipzig klassische Philologie. Frühreif, ein bevorzugter Schüler Ritschls, erhielt er noch vor seiner Promotion (1869) einen Ruf als außerordentlicher Professor der klassischen Philologie an die Universität Basel, wurde 1870 schon ordentlicher Professor daselbst, welche Stellung er bis 1870 bekleidete. In diesem Jahre nötigte ihn ein schweres Augenleiden, verbunden mit Überreizung des Gehirns, sein Amt aufzugeben, nachdem er schon den Winter 1876/77 in Sorrent zugebracht hatte. Von da ab führte er, beständig schriftstellerisch äußerst tätig, ein Wanderleben, hielt sich mit Vorliebe in Venedig, in der Schweiz, in Turin, Genua, Nizza, bisweilen auch in Leipzig und Naumburg auf, bis er im Frühjahr 1889 in Turin nach übermäßiger geistiger Anstrengung und zu starkem Gebrauch von Schlafmitteln geisteskrank wurde. Kürzere Zeit brachte er in der Heilanstalt in Jena zu, wo ihm keine Genesung wurde; dann lebte er wieder bei seiner Mutter in Naumburg und nach deren Tode in treuester Pflege seiner Schwester zu Weimar in einer oberhalb der Stadt gelegenen Villa, wo sich jetzt das Nietzsche-Archiv befindet (vgl. Kühn, Das Nietzsche-Archiv zu Weimar, Darmst. 1904). Mit Rich. Wagner war er längere Jahre eng befreundet, brach aber den Verkehr später mit ihm hauptsächlich wegen dessen religiösen Ansichten ab. Im persönlichen Umgange sehr gewinnend, aber doch die Einsamkeit liebend, ging er in seinen Schriften schonungslos gegen alles ihm nicht Gefallende vor. Als Stilist ist er in der Gegenwart unübertroffen, seine Sprache hat oft einen geradezu bestrickenden Zauber, und ihr ist zum Teil die große Wirkung seiner Werke zuzuschreiben.
Seine schriftstellerische Laufbahn begann N. mit kürzern philologischen Arbeiten über Theognis und Diogenes Laertius, aber schon in seiner ersten größern Schrift: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« (Leipz. 1872), wandte er sich von der rein philologischen Methode ab, indem er sich von allgemeinen philosophischen und künstlerischen Anschauungen, namentlich solchen Schopenhauers u. Wagners, leiten ließ. Derselben Richtung folgt er auch, zugleich ein deutsches Kulturideal anstrebend'. in den »Unzeitgemäßen Betrachtungen« (4 Stücke, Leipz. 1873–76), verläßt sie aber in seinen weitern aphoristischen Werken: »Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister« (Chemn. 1878–80, 3 Tle.); »Morgenröte. Gedanken über moralische Vorurteile« (das. 1881); »Die fröhliche Wissenschaft« (das. 1882), wo der Glaube an Ideale preisgegeben, der Mensch als reines Naturprodukt betrachtet wird, auch die Sittlichkeit sich mit ihren Gesetzen nicht von höhern Mächten oder der allgemeinen Vernunft, sondern aus den natürlichen Trieben der Menschen herleiten soll. So hatte N. mit aller sittlichen und religiösen Tradition gebrochen, war nicht mehr an Vorurteile, nicht mehr an die sogen. ewigen Gesetze der Vernunft gebunden, namentlich nicht an die christliche Welt- und Lebensanschauung, von der diese unsre Welt im Gegensatz zu einer erdichteten jenseitigen mißachtet werde, bei der die natürlichen Triebe des Menschen nicht zu ihrem Rechte kämen, aber die Schwäche der Unterwerfung für das Höhere gelte. Der Mensch muß nach N. seine Instinkte möglichst befriedigen, sich selbst zum Zweck seines Daseins setzen, diesen nicht außer sich, nicht in selbstlosen Handlungen suchen, er muß sich selbst leben, den Willen zur Macht, den er hat, möglichst zur Erfüllung bringen, die Tugenden nicht über sich stellen, nicht ihnen dienen, sie vielmehr als sein Machwerk betrachten. So zeichnet N. die Gestalt des Übermenschen, der nur sich selbst will und sich seine Welt gewinnt, für den nur gut ist, was er will, der weltfreudig und stark ist in seinem Wollen und alles, was sich ihm entgegenstellt, niederwirft, nichts von Ergebung weiß, nichts von Mitleid, das nur die Tugend des Schwachen ist. Nicht alle können gleiche Macht und gleichen Genuß haben, nur gemäß ihrer verschiedenen Stärke können die einzelnen das Ziel des Menschen erreichen; deshalb gibt es auch nicht gleiche Rechte für alle Menschen: der Starke hat das Recht, der Schwache muß ihm zur Erreichung seiner Ziele dienen. Diese Gedanken sind ausgeführt in. »Also sprach Zarathustra« (1.–3. Teil, Chemn. 1883 bis 1884; 4. Teil, Leipz. 1891); »Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel zu einer Philosophie der Zukunft« (Leipz. 1886); »Zur Genealogie der Moral« (das. 1887); »Der Fall Wagner« (das. 1888); »Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert« (das. 1889). Alle diese Werke sind in einer Reihe von Auflagen erschienen. Von »Also sprach Zarathustra« sind schon 50,000 Exemplare gedruckt. Von der Gesamtausgabe der »Werke« Nietzsches enthält die erste Abteilung (Leipz. 1895, 8 Bde.) das von N. selbst Veröffentlichte und außerdem: »N. contra Wagner«, »Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums« und »Gedichte«. Eine 1893 schon begonnene (von Peter Gast) mußte nach Ausgabe von 5 Bänden abgebrochen werden. Der »Antichrist« ist das erste Buch des nicht vollendeten philosophischen Hauptwerkes Nietzsches: »Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte«, dessen unvollendete weitere drei Bücher den Titel haben: »Der freie Geist. Kritik der Philosophie als einer nihilistischen Bewegung«, »Der Immoralist. Kritik der verhängnisvollsten Art von Unwissenheit der Moral«, »Dionysos, Philosophie der ewigen Wiederkunft«. Von der ersten Abteilung der Werke ist 1899 auch eine Ausgabe in kleinerm Format erschienen. Die zweite Abteilung der Gesamtausgabe ist in 7 Bänden 1901–04 erschienen und enthält aus den ungedruckten Papieren Nietzsches die unvollendeten Schriften und Fragmente, Entwürfe, Nachträge und Aphorismen. Übersetzungen der ersten Abteilung der gesamten Schriften ins Englische und Französische erschienen in London 1897 ff. und Paris 1899 ff. Von Nietzsches gesammelten Briefen sind 3 Bände veröffentlicht worden (Berl. u. Leipz. 1900–05), besonders wichtig sind die an Erwin Rhode und Malvida v. Meysenbug. Das »Leben Fr. Nietzsches« ist von seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche (Leipz. 1895 bis 1904, 2 Bde.) geschrieben. Das Werk enthält auch viele Briefe und Aufzeichnungen Nietzsches. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Philosophen II«.
Die Nietzscheschen Ansichten haben viele Gegner gefunden, wie dies bei dem vielen Paradoxen und Umstürzenden in ihnen natürlich, anderseits auch viele Freunde besonders in der jüngern Generation, in dieser zum Teil wegen der Zersetzung des Traditionellen. Im ganzen hat die Verehrung Nietzsches nach seinem Tod eher noch zu-als abgenommen; namentlich hat sein »Zarathustra« große Verbreitung und Bewunderung erfahren. Man fängt an, das dauernd Wertvolle bei N., namentlich sein Streben nach einer höhern Kultur und seinen Individualismus anzuerkennen und betont, daß N. selbst eine vornehme reine Natur voller Ideale war, und daß niedriger Egoismus in seiner Lehre keine Stelle findet. Manche seiner Ansichten freilich, so die von ihm selbst hochbewertete von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, finden wenig Anerkennung. Infolge der verschiedenen Stellung zu N. ist eine große Reihe von Schriften und Abhandlungen über ihn, gegen ihn und für ihn erschienen, von denen hier nur die wichtigsten genannt sein mögen: O. Hansson, Friedrich N. (Leipz. 1890); Kaatz, Die Weltanschauung Fr. Nietzsches (Dresd. 1892–93, 2 Tle.; 2. Aufl. 1898); L. Stein, Fr. Nietzsches Weltanschauung und ihre Gefahren (Berl. 1893); Andreas-Salomé, Friedr. N. in seinen Werken (Wien 1894); Steiner, Friedr. N., ein Kämpfer gegen seine Zeit (Weim. 1895); Meta v. Salis-Marschlins, Philosoph und Edelmensch (Leipz. 1897); Th. Ziegler, Friedr. N. (Berl. 1900); Schellwien, Max Stirner und Friedr. N., Erscheinungen des modernen Geistes und das Wesen des Menschen (Leipz. 1892); Alex. Tille, Von Darwin bis N. Ein Buch Entwickelungsethik (das. 1895); Riehl, Fr. N. der Künstler und der Denker (Stuttg. 1897, 3. Aufl. 1901); Deussen, Erinnerungen an F. N. (Leipz. 1901); Vaihinger, N. als Philosoph (Berl. 1902, 3. Aufl. 1905); Richter, F. N. Sein Leben und sein Werk (Leipz. 1903); Ewald, Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen (Berl. 1903); Drews, Nietzsches Philosophie (Heidelb. 1904); Lichtenberger, La philosophie de Fr. N. (Par. 1898, 6. Aufl. 1901; deutsch, 2. Aufl., Dresd.1900); J. de Gaultier, De Kant à N. (2. Aufl., Par. 1900) und N. et la réforme philosophique (das. 1905); Seillière, Apollon ou Dionysos. Étude critique sur F. N. (das. 1905; deutsch, Berl. 1905); Zoccoli, Federico N. La filosofia religiosa, la morale, l'estetica (Modena 1898, 2.Aufl. 1901); Orestano, Le idee fondamentali di Fed. N. (Palermo 1903).
Zur Genealogie der Moral
Vorrede.
1.
Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst: das hat seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht, — wie sollte es geschehn, dass wir eines Tags uns fänden? Mit Recht hat man gesagt: „wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz“; unser Schatz ist, wo die Bienenkörbe unsrer Erkenntniss stehn. Wir sind immer dazu unterwegs, als geborne Flügelthiere und Honigsammler des Geistes, wir kümmern uns von Herzen eigentlich nur um Eins — Etwas „heimzubringen“. Was das Leben sonst, die sogenannten „Erlebnisse“ angeht, — wer von uns hat dafür auch nur Ernst genug? Oder Zeit genug? Bei solchen Sachen waren wir, fürchte ich, nie recht „bei der Sache“: wir haben eben unser Herz nicht dort — und nicht einmal unser Ohr! Vielmehr wie ein Göttlich-Zerstreuter und In-sich-Versenkter, dem die Glocke eben mit aller Macht ihre zwölf Schläge des Mittags in’s Ohr gedröhnt hat, mit einem Male aufwacht und sich fragt „was hat es da eigentlich geschlagen?“ so reiben auch wir uns mitunter hinterdrein die Ohren und fragen, ganz erstaunt, ganz betreten „was haben wir da eigentlich erlebt? mehr noch: wer sind wir eigentlich?“ und zählen nach, hinterdrein, wie gesagt, alle die zitternden zwölf Glockenschläge unsres Erlebnisses, unsres Lebens, unsres Seins — ach! und verzählen uns dabei… Wir bleiben uns eben nothwendig fremd, wir verstehn uns nicht, wir müssen uns verwechseln, für uns heisst der Satz in alle Ewigkeit „Jeder ist sich selbst der Fernste“, — für uns sind wir keine „Erkennenden“…
2.
— Meine Gedanken über die Herkunft unserer moralischen Vorurtheile — denn um sie handelt es sich in dieser Streitschrift — haben ihren ersten, sparsamen und vorläufigen Ausdruck in jener Aphorismen-Sammlung erhalten, die den Titel trägt „Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister“, und deren Niederschrift in Sorrent begonnen wurde, während eines Winters, welcher es mir erlaubte, Halt zu machen wie ein Wandrer Halt macht und das weite und gefährliche Land zu überschauen, durch das mein Geist bis dahin gewandert war. Dies geschah im Winter 1876-77; die Gedanken selbst sind älter. Es waren in der Hauptsache schon die gleichen Gedanken, die ich in den vorliegenden Abhandlungen wieder aufnehme: — hoffen wir, dass die lange Zwischenzeit ihnen gut gethan hat, dass sie reifer, heller, stärker, vollkommner geworden sind! Dass ich aber heute noch an ihnen festhalte, dass sie sich selber inzwischen immer fester an einander gehalten haben, ja in einander gewachsen und verwachsen sind, das stärkt in mir die frohe Zuversichtlichkeit, sie möchten von Anfang an in mir nicht einzeln, nicht beliebig, nicht sporadisch entstanden sein, sondern aus einer gemeinsamen Wurzel heraus, aus einem in der Tiefe gebietenden, immer bestimmter redenden, immer Bestimmteres verlangenden Grundwillen der Erkenntniss. So allein nämlich geziemt es sich bei einem Philosophen. Wir haben kein Recht darauf, irgend worin einzeln zu sein: wir dürfen weder einzeln irren, noch einzeln die Wahrheit treffen. Vielmehr mit der Nothwendigkeit, mit der ein Baum seine Früchte trägt, wachsen aus uns unsre Gedanken, unsre Werthe, unsre Ja’s und Nein’s und Wenn’s und Ob’s — verwandt und bezüglich allesamt unter einander und Zeugnisse Eines Willens, Einer Gesundheit, Eines Erdreichs, Einer Sonne. — Ob sie euch schmecken, diese unsre Früchte? — Aber was geht das die Bäume an! Was geht das uns an, uns Philosophen!…
3.
Bei einer mir eignen Bedenklichkeit, die ich ungern eingestehe — sie bezieht sich nämlich auf die Moral, auf Alles, was bisher auf Erden als Moral gefeiert worden ist —, einer Bedenklichkeit, welche in meinem Leben so früh, so unaufgefordert, so unaufhaltsam, so in Widerspruch gegen Umgebung, Alter, Beispiel, Herkunft auftrat, dass ich beinahe das Recht hätte, sie mein „A priori“ zu nennen, — musste meine Neugierde ebenso wie mein Verdacht bei Zeiten an der Frage Halt machen, welchen Ursprung eigentlich unser Gut und Böse habe. In der That gieng mir bereits als dreizehnjährigem Knaben das Problem vom Ursprung des Bösen nach: ihm widmete ich, in einem Alter, wo man „halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen“ hat, mein erstes litterarisches Kinderspiel, meine erste philosophische Schreibübung — und was meine damalige „Lösung“ des Problems anbetrifft, nun, so gab ich, wie es billig ist, Gott die Ehre und machte ihn zum Vater des Bösen. Wollte es gerade so mein „A priori“ von mir? jenes neue, unmoralische, mindestens immoralistische „A priori“ und der aus ihm redende ach! so anti-Kantische, so räthselhafte „kategorische Imperativ“, dem ich inzwischen immer mehr Gehör und nicht nur Gehör geschenkt habe?… Glücklicher Weise lernte ich bei Zeiten das theologische Vorurtheil von dem moralischen abscheiden und suchte nicht mehr den Ursprung des Bösen hinter der Welt. Etwas historische und philologische Schulung, eingerechnet ein angeborner wählerischer Sinn in Hinsicht auf psychologische Fragen überhaupt, verwandelte in Kürze mein Problem in das andre: unter welchen Bedingungen erfand sich der Mensch jene Werthurtheile gut und böse? und welchen Werth haben sie selbst? Hemmten oder förderten sie bisher das menschliche Gedeihen? Sind sie ein Zeichen von Nothstand, von Verarmung, von Entartung des Lebens? Oder umgekehrt, verräth sich in ihnen die Fülle, die Kraft, der Wille des Lebens, sein Muth, seine Zuversicht, seine Zukunft? — Darauf fand und wagte ich bei mir mancherlei Antworten, ich unterschied Zeiten, Völker, Ranggrade der Individuen, ich spezialisirte mein Problem, aus den Antworten wurden neue Fragen, Forschungen, Vermuthungen, Wahrscheinlichkeiten: bis ich endlich ein eignes Land, einen eignen Boden hatte, eine ganze verschwiegene wachsende blühende Welt, heimliche Gärten gleichsam, von denen Niemand Etwas ahnen durfte… Oh wie wir glücklich sind, wir Erkennenden, vorausgesetzt, dass wir nur lange genug zu schweigen wissen!…
4.
Den ersten Anstoss, von meinen Hypothesen über den Ursprung der Moral Etwas zu verlautbaren, gab mir ein klares, sauberes und kluges, auch altkluges Büchlein, in welchem mir eine umgekehrte und perverse Art von genealogischen Hypothesen, ihre eigentlich englische Art, zum ersten Male deutlich entgegentrat, und das mich anzog — mit jener Anziehungskraft, die alles Entgegengesetzte, alles Antipodische hat. Der Titel des Büchleins war „der Ursprung der moralischen Empfindungen“; sein Verfasser Dr. Paul Rée; das Jahr seines Erscheinens 1877. Vielleicht habe ich niemals Etwas gelesen, zu dem ich dermaassen, Satz für Satz, Schluss für Schluss, bei mir Nein gesagt hätte wie zu diesem Buche: doch ganz ohne Verdruss und Ungeduld. In dem vorher bezeichneten Werke, an dem ich damals arbeitete, nahm ich gelegentlich und ungelegentlich auf die Sätze jenes Buchs Bezug, nicht indem ich sie widerlegte — was habe ich mit Widerlegungen zu schaffen! — sondern, wie es einem positiven Geiste zukommt, an Stelle des Unwahrscheinlichen das Wahrscheinlichere setzend, unter Umständen an Stelle eines Irrthums einen andern. Damals brachte ich, wie gesagt, zum ersten Male jene Herkunfts-Hypothesen an’s Tageslicht, denen diese Abhandlungen gewidmet sind, mit Ungeschick, wie ich mir selbst am letzten verbergen möchte, noch unfrei, noch ohne eine eigne Sprache für diese eignen Dinge und mit mancherlei Rückfälligkeit und Schwankung. Im Einzelnen vergleiche man, was ich Menschl. Allzumenschl. S. 51 über die doppelte Vorgeschichte von Gut und Böse sage (nämlich aus der Sphäre der Vornehmen und der der Sklaven); insgleichen S. 119 ff. über Werth und Herkunft der asketischen Moral; insgleichen S. 78. 82. II, 35 über die „Sittlichkeit der Sitte“, jene viel ältere und ursprünglichere Art Moral, welche toto coelo von der altruistischen Werthungsweise abliegt (in der Dr. Rée, gleich allen englischen Moralgenealogen, die moralische Werthungsweise an sich sieht); insgleichen S. 74. Wanderer S. 29. Morgenr. S. 99 über die Herkunft der Gerechtigkeit als eines Ausgleichs zwischen ungefähr Gleich-Mächtigen (Gleichgewicht als Voraussetzung aller Verträge, folglich alles Rechts); insgleichen über die Herkunft der Strafe Wand. S. 25. 34., für die der terroristische Zweck weder essentiell, noch ursprünglich ist (wie Dr. Rée meint: — er ist ihr vielmehr erst eingelegt, unter bestimmten Umständen, und immer als ein Nebenbei, als etwas Hinzukommendes).
5.
Im Grunde lag mir gerade damals etwas viel Wichtigeres am Herzen als eignes oder fremdes Hypothesenwesen über den Ursprung der Moral (oder, genauer: letzteres allein um eines Zweckes willen, zu dem es eins unter vielen Mitteln ist). Es handelte sich für mich um den Werth der Moral, — und darüber hatte ich mich fast allein mit meinem grossen Lehrer Schopenhauer auseinanderzusetzen, an den wie an einen Gegenwärtigen jenes Buch, die Leidenschaft und der geheime Widerspruch jenes Buchs sich wendet (— denn auch jenes Buch war eine „Streitschrift“). Es handelte sich in Sonderheit um den Werth des „Unegoistischen“, der Mitleids-, Selbstverleugnungs-, Selbstopferungs-Instinkte, welche gerade Schopenhauer so lange vergoldet, vergöttlicht und verjenseitigt hatte, bis sie ihm schliesslich als die „Werthe an sich“ übrig blieben, auf Grund deren er zum Leben, auch zu sich selbst, Nein sagte. Aber gerade gegen diese Instinkte redete aus mir ein immer grundsätzlicherer Argwohn, eine immer tiefer grabende Skepsis! Gerade hier sah ich die grosse Gefahr der Menschheit, ihre sublimste Lockung und Verführung — wohin doch? in’s Nichts? — gerade hier sah ich den Anfang vom Ende, das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit, den Willen gegen das Leben sich wendend, die letzte Krankheit sich zärtlich und schwermüthig ankündigend: ich verstand die immer mehr um sich greifende Mitleids-Moral, welche selbst die Philosophen ergriff und krank machte, als das unheimlichste Symptom unsrer unheimlich gewordnen europäischen Cultur, als ihren Umweg zu einem neuen Buddhismus? zu einem Europäer-Buddhismus? zum — Nihilismus?… Diese moderne Philosophen-Bevorzugung und Überschätzung des Mitleidens ist nämlich etwas Neues: gerade über den Unwerth des Mitleidens waren bisher die Philosophen übereingekommen. Ich nenne nur Plato, Spinoza, La Rochefoucauld und Kant, vier Geister so verschieden von einander als möglich, aber in Einem Eins: in der Geringschätzung des Mitleidens. —
6.
Dies Problem vom Werthe des Mitleids und der Mitleids-Moral (— ich bin ein Gegner der schändlichen modernen Gefühlsverweichlichung —) scheint zunächst nur etwas Vereinzeltes, ein Fragezeichen für sich; wer aber einmal hier hängen bleibt, hier fragen lernt, dem wird es gehn, wie es mir ergangen ist: — eine ungeheure neue Aussicht thut sich ihm auf, eine Möglichkeit fasst ihn wie ein Schwindel, jede Art Misstrauen, Argwohn, Furcht springt hervor, der Glaube an die Moral, an alle Moral wankt, — endlich wird eine neue Forderung laut. Sprechen wir sie aus, diese neue Forderung: wir haben eine Kritik der moralischen Werthe nöthig, der Werth dieser Werthe ist selbst erst einmal in Frage zu stellen — und dazu thut eine Kenntniss der Bedingungen und Umstände noth, aus denen sie gewachsen, unter denen sie sich entwickelt und verschoben haben (Moral als Folge, als Symptom, als Maske, als Tartüfferie, als Krankheit, als Missverständniss; aber auch Moral als Ursache, als Heilmittel, als Stimulans, als Hemmung, als Gift), wie eine solche Kenntniss weder bis jetzt da war, noch auch nur begehrt worden ist. Man nahm den Werth dieser „Werthe“ als gegeben, als thatsächlich, als jenseits aller In-Frage-Stellung; man hat bisher auch nicht im Entferntesten daran gezweifelt und geschwankt, „den Guten“ für höherwerthig als „den Bösen“ anzusetzen, höherwerthig im Sinne der Förderung, Nützlichkeit, Gedeihlichkeit in Hinsicht auf den Menschen überhaupt (die Zukunft des Menschen eingerechnet). Wie? wenn das Umgekehrte die Wahrheit wäre? Wie? wenn im „Guten“ auch ein Rückgangssymptom läge, insgleichen eine Gefahr, eine Verführung, ein Gift, ein Narcoticum, durch das etwa die Gegenwart auf Kosten der Zukunft lebte? Vielleicht behaglicher, ungefährlicher, aber auch in kleinerem Stile, niedriger?… So dass gerade die Moral daran Schuld wäre, wenn eine an sich mögliche höchste Mächtigkeit und Pracht des Typus Mensch niemals erreicht würde? So dass gerade die Moral die Gefahr der Gefahren wäre?…
7.
Genug, dass ich selbst, seitdem mir dieser Ausblick sich öffnete, Gründe hatte, mich nach gelehrten, kühnen und arbeitsamen Genossen umzusehn (ich thue es heute noch). Es gilt, das ungeheure, ferne und so versteckte Land der Moral — der wirklich dagewesenen, wirklich gelebten Moral — mit lauter neuen Fragen und gleichsam mit neuen Augen zu bereisen: und heisst dies nicht beinahe so viel als dieses Land erst entdecken?… Wenn ich dabei, unter Anderen, auch an den genannten Dr. Rée dachte, so geschah es, weil ich gar nicht zweifelte, dass er von der Natur seiner Fragen selbst auf eine richtigere Methodik, um zu Antworten zu gelangen, gedrängt werden würde. Habe ich mich darin betrogen? Mein Wunsch war es jedenfalls, einem so scharfen und unbetheiligten Auge eine bessere Richtung, die Richtung zur wirklichen Historie der Moral zu geben und ihn vor solchem englischen Hypothesenwesen in’s Blaue noch zur rechten Zeit zu warnen. Es liegt ja auf der Hand, welche Farbe für einen Moral-Genealogen hundert Mal wichtiger sein muss als gerade das Blaue: nämlich das Graue, will sagen, das Urkundliche, das Wirklich-Feststellbare, das Wirklich-Dagewesene, kurz die ganze lange, schwer zu entziffernde Hieroglyphenschrift der menschlichen Moral-Vergangenheit! — Diese war dem Dr. Rée unbekannt; aber er hatte Darwin gelesen: — und so reichen sich in seinen Hypothesen auf eine Weise, die zum Mindesten unterhaltend ist, die Darwin’sche Bestie und der allermodernste bescheidene Moral-Zärtling, der „nicht mehr beisst“, artig die Hand, letzterer mit dem Ausdruck einer gewissen gutmüthigen und feinen Indolenz im Gesicht, in die selbst ein Gran von Pessimismus, von Ermüdung eingemischt ist: als ob es sich eigentlich gar nicht lohne, alle diese Dinge — die Probleme der Moral — so ernst zu nehmen. Mir nun scheint es umgekehrt gar keine Dinge zu geben, die es mehr lohnten, dass man sie ernst nimmt; zu welchem Lohne es zum Beispiel gehört, dass man eines Tags vielleicht die Erlaubniss erhält, sie heiter zu nehmen. Die Heiterkeit nämlich oder, um es in meiner Sprache zu sagen, die fröhliche Wissenschaft — ist ein Lohn: ein Lohn für einen langen, tapferen, arbeitsamen und unterirdischen Ernst, der freilich nicht Jedermanns Sache ist. An dem Tage aber, wo wir aus vollem Herzen sagen: „vorwärts! auch unsre alte Moral gehört in die Komödie!“ haben wir für das dionysische Drama vom „Schicksal der Seele“ eine neue Verwicklung und Möglichkeit entdeckt —: und er wird sie sich schon zu Nutze machen, darauf darf man wetten, er, der grosse alte ewige Komödiendichter unsres Daseins!…
8.
— Wenn diese Schrift irgend Jemandem unverständlich ist und schlecht zu Ohren geht, so liegt die Schuld, wie mich dünkt, nicht nothwendig an mir. Sie ist deutlich genug, vorausgesetzt, was ich voraussetze, dass man zuerst meine früheren Schriften gelesen und einige Mühe dabei nicht gespart hat: diese sind in der That nicht leicht zugänglich. Was zum Beispiel meinen „Zarathustra“ anbetrifft, so lasse ich Niemanden als dessen Kenner gelten, den nicht jedes seiner Worte irgendwann einmal tief verwundet und irgendwann einmal tief entzückt hat: erst dann nämlich darf er des Vorrechts geniessen, an dem halkyonischen Element, aus dem jenes Werk geboren ist, an seiner sonnigen Helle, Ferne, Weite und Gewissheit ehrfürchtig Antheil zu haben. In andern Fällen macht die aphoristische Form Schwierigkeit: sie liegt darin, dass man diese Form heute nicht schwer genug nimmt. Ein Aphorismus, rechtschaffen geprägt und ausgegossen, ist damit, dass er abgelesen ist, noch nicht „entziffert“; vielmehr hat nun erst dessen Auslegung zu beginnen, zu der es einer Kunst der Auslegung bedarf. Ich habe in der dritten Abhandlung dieses Buchs ein Muster von dem dargeboten, was ich in einem solchen Falle „Auslegung“ nenne: — dieser Abhandlung ist ein Aphorismus vorangestellt, sie selbst ist dessen Commentar. Freilich thut, um dergestalt das Lesen als Kunst zu üben, Eins vor Allem noth, was heutzutage gerade am Besten verlernt worden ist — und darum hat es noch Zeit bis zur „Lesbarkeit“ meiner Schriften —, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht „moderner Mensch“ sein muss: das Wiederkäuen…
Sils-Maria, Oberengadin, im Juli 1887.
Erste Abhandlung: „Gut und Böse“, „Gut und Schlecht“.
1.
— Diese englischen Psychologen, denen man bisher auch die einzigen Versuche zu danken hat, es zu einer Entstehungsgeschichte der Moral zu bringen, — sie geben uns mit sich selbst kein kleines Räthsel auf; sie haben sogar, dass ich es gestehe, eben damit, als leibhaftige Räthsel, etwas Wesentliches vor ihren Büchern voraus — sie selbst sind interessant! Diese englischen Psychologen — was wollen sie eigentlich? Man findet sie, sei es nun freiwillig oder unfreiwillig, immer am gleichen Werke, nämlich die partie honteuse unsrer inneren Welt in den Vordergrund zu drängen und gerade dort das eigentlich Wirksame, Leitende, für die Entwicklung Entscheidende zu suchen, wo der intellektuelle Stolz des Menschen es am letzten zu finden wünschte (zum Beispiel in der vis inertiae der Gewohnheit oder in der Vergesslichkeit oder in einer blinden und zufälligen Ideen-Verhäkelung und -Mechanik oder in irgend etwas Rein-Passivem, Automatischem, Reflexmässigem, Molekularem und Gründlich-Stupidem) — was treibt diese Psychologen eigentlich immer gerade in diese Richtung? Ist es ein heimlicher, hämischer, gemeiner, seiner selbst vielleicht uneingeständlicher Instinkt der Verkleinerung des Menschen? Oder etwa ein pessimistischer Argwohn, das Misstrauen von enttäuschten, verdüsterten, giftig und grün gewordenen Idealisten? Oder eine kleine unterirdische Feindschaft und Rancune gegen das Christenthum (und Plato), die vielleicht nicht einmal über die Schwelle des Bewusstseins gelangt ist? Oder gar ein lüsterner Geschmack am Befremdlichen, am Schmerzhaft-Paradoxen, am Fragwürdigen und Unsinnigen des Daseins? Oder endlich — von Allem Etwas, ein wenig Gemeinheit, ein wenig Verdüsterung, ein wenig Antichristlichkeit, ein wenig Kitzel und Bedürfniss nach Pfeffer?… Aber man sagt mir, dass es einfach alte, kalte, langweilige Frösche seien, die am Menschen herum, in den Menschen hinein kriechen und hüpfen, wie als ob sie da so recht in ihrem Elemente wären, nämlich in einem Sumpfe. Ich höre das mit Widerstand, mehr noch, ich glaube nicht daran; und wenn man wünschen darf, wo man nicht wissen kann, so wünsche ich von Herzen, dass es umgekehrt mit ihnen stehen möge, — dass diese Forscher und Mikroskopiker der Seele im Grunde tapfere, grossmüthige und stolze Thiere seien, welche ihr Herz wie ihren Schmerz im Zaum zu halten wissen und sich dazu erzogen haben, der Wahrheit alle Wünschbarkeit zu opfern, jeder Wahrheit, sogar der schlichten, herben, hässlichen, widrigen, unchristlichen, unmoralischen Wahrheit… Denn es giebt solche Wahrheiten. —
2.