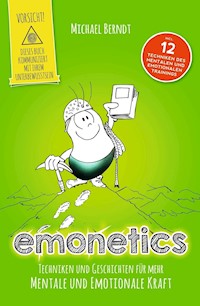Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michael Berndt führt ein beschauliches Leben im ländlichen Sachsen. Er absolviert eine Metzgerlehre, nach der Arbeit trifft er sich gerne mit Freunden und Bekannten in der Kneipe, wo die Stammtischgespräche nicht selten in Unmut über die unerwünschten Fremden umschlagen, die einem ja doch nur die Arbeit wegnähmen. Michael Berndt sieht das anders, die kleinbürgerliche Engstirnigkeit frustriert ihn. Er langweilt sich, will raus aus dem Alltagstrott, was erleben, die Welt sehen! So bricht er mit 23 Jahren eines Tages ohne Vorbereitung und mit nur 700 Euro im Gepäck nach Australien auf. Dort landet er erst mal auf dem Boden der Realität. Die australische Hitze erträgt er nach dem deutschen Winter kaum, er spricht kein Wort Englisch und fremdelt mit der ungewohnten Kultur. Gutmütig und ahnungslos tappt er in unzählige Fettnäpfchen: Er schwimmt in einem mit Krokodilen verseuchten Gewässer, wird später auch überfallen und ausgeraubt, einmal auch verhaftet, weil er am Strand Sex hatte. Doch er reist weiter und kostet das Leben bis zum Äußersten aus, lässt sich tätowieren, nimmt allerlei Drogen und beschließt, in jedem Land mit einer anderen Frau zu schlafen. Ursprünglich geplant war ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt – doch es werden 8 Jahre daraus, die ihn in 100 verschiedene Länder führen. Als er schließlich nach Deutschland zurückkommt, spricht er mehrere Sprachen fließend und ist ein weltoffener Mensch geworden, der weiß, dass Begegnungen mit anderen Menschen viel wertvoller sind als alles, was man mit Geld kaufen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe
4. Auflage 2019
© 2017 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Matthias Teiting
Umschlaggestaltung: Karen Schmidt
Umschlagabbildungen und Abbildungen im Innenteil: Michael Berndt
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-7423-0280-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95971-748-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95971-749-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Inhalt
Vorwort
Down Under
Planlos in Sydney
Der härteste Job der Welt: Banana Humping an der Ostküste
Heiße Nächte im Hilton
Winter in Darwin
Dem Tod von der Schippe gesprungen
Hochzeitsnacht ohne Braut
Auf dem Kiwi Trail
Ein Arsch reist um die Welt
Dauerbreit auf Kiwi Experience
Sex für einen Schlafplatz: Meine Tage mit Milf
Sega na lega: Gefangen in der Zeitkapsel
Japan, Korea, China: Kulturschock in Ostasien
Japan: Das lange Warten auf Sex
Korea: Im geteilten Land
China: Niubi und ein echtes Wunder
Südostasien: Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand
Vietnam: Die Schlangenblut-Erektion
Kambodscha: Land der krassen Gegensätze
Vollmondparty in Thailand
Ein Backpacker muss reisen
Mit Dreadlocks nach Sachsen
Wintersaison in Vorarlberg
Amerika: Von Kanada bis Jamaika
In Las Vegas verzockt
Nuttenärger in Tijuana, Mexiko
Im Knast von Cancún
Pyramiden-Sex vom Feinsten
In den Slums von Kingston, Jamaika
Südamerika I: Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien
Kolumbien: Salsa und Kokain
Ecuador: Den Äquator in der Arschritze
Peru: Sächsisches Frühstück für die Ladys
Mit Pferde-Tranquillo über die Anden
Bildteil
Südamerika II: Chile, Argentinien, Uruguay, Brasilien
Über Chile nach Argentinien
Buenos Aires, Argentinien
Rezeptionist mit kleinen Schwächen
Rio de Janeiro: Applaus für die Sonne und das Leben
Vorstellungsgespräch beim Paten
Das Roadmovie
Per Anhalter nach Afrika
Afrika: Der gemiedene Kontinent
Im Devil’s Pool
Südafrika: Begegnung mit dem weißen Hai
Adrenalin
Tattoos, die Bilder meiner Reisen
Dem Tod lässig zuzwinkern
Meine Top 10
Zugedröhnt
Opium und Black Moon
Indien: Tod und Verwesung am Ganges
Im Opiumrausch
Leben und Tod am Ganges
Meditieren sollen andere
Black-Moon-Party
Die Küchen dieser Welt
Von Genüssen und Mutproben
Vom Laien zum Promi-Koch
Vor dem Essen steht der Tod
Die letzte Reise: Aus 90 Ländern 100 machen
Mikey Stiff: Der Mann, der immer kann
Und dann kam Lisa
Mit Will durch Zentralamerika
Die Generation Selfie-Stick
Honduras: Im gefährlichsten Land der Welt
100 Länder, aber meine Welt ist Lisa
Vorwort
Zugetraut hat mir keiner etwas. Als ich beschloss, nach Australien wegzumachen, lachten mich alle aus und schlossen Wetten ab, wie weit ich wohl kommen würde. Bis Dresden, das eine Stunde entfernt lag? Oder eventuell sogar ein ganzes Stück aus Deutschland heraus?
Für die meisten war ich Micha, der spinnerte Metzger vom Bauernhof, der gern einen trank und dann den Mund zu voll nahm. Selbst mein Vater war sich sicher: »Stehst eh in drei Tagen wieder da.«
Cunnersdorf liegt in Sachsen im Landkreis Bautzen, ein Dorf mit wenig mehr als fünfhundert Einwohnern, einer Hauptstraße, um die sich die Bauernhöfe und Häuser gruppieren, mit einem Feuerwehrhaus und einem Kindergarten. Eingebettet wird Cunnersdorf von Wiesen, Feldern und Wäldern, die von Hochsitzen bewacht werden. Alleen führen durch die hügelige Landschaft, deren Stille nur selten gestört wird – etwa wenn im Steinbruch Grauwacke abgebaut wird und die Detonationen herüberschallen.
Die Höhepunkte im Dorfleben sind schnell aufgezählt: Immer an Karsamstag findet das Osterschießen statt, dabei werden mit einer explosiven Chemikalie die Deckel von massiven Milchkannen gesprengt, ein uralter Brauch, mit dem der Winter vertrieben werden soll. In unserem Jugendclub steigt jedes Jahr eine Russen-Party mit Pelmeni, aus Sibirien stammenden Teigtaschen, Wodka und sauren Gurken. Alle tragen dann die Armeeklamotten, die jeder von uns im Schrank liegen hat. Und am Vatertag ziehen alle Männer mit dem Fahrrad von Kneipe zu Kneipe und trinken sich Mut an für das Finale, bei dem sich eine Stripperin im Feuerwehrhaus unter lautem Gegröle auszieht.
In Cunnersdorf kennt jeder jeden, und wenn einer mal Hilfe braucht, springt man für den anderen ein. Am Stammtisch wird wie überall politisiert, es sind immer dieselben Argumente und Floskeln, die drehorgelhaft zu hören sind. Natürlich sind die Ausländer schuld, die anders sind und nicht nach Sachsen gehören, sie sind schuld an allem, was irgendwie schiefläuft. Meine Eltern hielten sich da zurück, die Politik war, wie sie war, und was sollten ausgerechnet sie daran ändern? Aber sie hatten genaue Vorstellungen, wie sich anständige Leute benehmen sollten. Man musste arbeiten und sich nichts zuschulden kommen lassen. Nur nicht auffallen, das war das oberste Gebot.
Einer der Bauernhöfe im Dorf gehört noch heute meinen Eltern, hier bin ich aufgewachsen mit zwei Dutzend Ochsen, Schafen, Gänsen, Enten, Karnickeln, Hühnern und Hunden. Es gab immer was zu tun, die Tiere mussten versorgt und irgendwann geschlachtet werden, das war auch der Grund, warum meine Eltern mich drängten, Fleischer zu lernen. Meine Eltern hatten alle Hände voll zu tun, um über die Runden zu kommen – der Bauernhof allein konnte uns nicht ernähren, das lohnte sich von Jahr zu Jahr weniger.
Deshalb ging mein Vater zusätzlich als Schlossermeister arbeiten für eine Tiefbaufirma. Morgens um vier stand er auf, schaute zuerst im Stall nach seinen Ochsen und ging dann zur Arbeit. Anschließend sah man ihn wieder bei den Rindern. In diesem Rhythmus hat er irgendwann aufgehört, viel mit uns zu reden. Er schuftete ohne große Worte und legte viel Wert darauf, möglichst unabhängig zu sein. Wir waren Selbstversorger, der Hof lieferte Fleisch und Kartoffeln, und wir waren auch stolz darauf, dass unsere Schnitzel in der Pfanne nicht um die Hälfte schrumpften wie die Fleischimitate aus dem Supermarkt. Wir saßen zusammen, die Füße unter Vaters Tisch, und meine Mutter trug auf, am liebsten das Fleisch aus dem eigenen Stall. Unter der Woche Schwein, Huhn und Rinderbraten mit Kartoffeln und Karotten. Und am Wochenende kochte sie nach altem Familienrezept ihre Rouladen.
Ich bin der mittlere von drei Söhnen, die 1983, 1984 und 1987 zur Welt kamen. Mein älterer Bruder ist Elektriker, der jüngere arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Die beiden waren zufrieden, wenn man sie in Ruhe ließ. Ich war derjenige, der am meisten aus der Reihe tanzte. Mit dreizehn fing ich an zu kiffen und zu trinken, mit vierzehn ließ ich mir das erste Zungen-Piercing stechen und die ersten Tattoos, die ich vor meinen Eltern verstecken musste. Meine kleine Rebellion gegen die gutbürgerlichen Verhältnisse musste sich im Verborgenen abspielen.
Mit siebzehn verließ ich die Mittelschule, und ich wusste nicht, was ich anfangen sollte. Meine Eltern sind einfach mit mir zum Schlachter gegangen im Nachbardorf Bernbruch. Der schaute mich nur kurz an und meinte: »Nehm ich, kann ich gebrauchen.«
Von allein wäre ich wohl kaum Schlachter geworden. Aber es war mir egal, ob ich schlachten ging oder nicht. Anfangs hatte ich ganz schön zu kämpfen. Ich war nicht sonderlich kräftig und sollte Schweinehälften tragen, sechzig Kilo schwer, und Rinderhälften, die noch mal zwanzig Kilo mehr auf die Waage brachten. Rückwärts knallte ich mit meiner ersten Schweinehälfte auf den weiß gekachelten Boden, die anderen standen in ihren blutverschmierten Schürzen um mich herum und feixten. Am nächsten Tag ging ich nach der Arbeit ins Fitnessstudio, um schnell Muskelmasse aufzubauen. Morgens um vier musste ich hoch, oft war ich bis abends um acht in der Metzgerei, danach stemmte ich Gewichte im Kraftraum. Und am Wochenende arbeitete ich auf unserem Bauernhof weiter. Das alles war eigentlich nur auszuhalten mit einem ordentlich gerollten Joint.
Irgendwann kam ich in der Metzgerei zurecht und wuchtete auch die schweren Rinderhälften durch die Gegend. Ich war zäh, konnte zupacken und entwickelte Ehrgeiz, wenn ich etwas erreichen wollte. Schlimm waren nur die Montage, wenn ich verkatert Därme reinigen musste, aus denen der Geruch von Scheiße drang – dann musste ich raus an die Luft und reiherte, bis mir die Galle hochstieg. Manchmal kam mir die Fleischerei wie ein Gefängnis vor. Wir hatten nur ein einziges Fenster, sechzig auf sechzig Zentimeter, das den Blick nach draußen auf den Garten und die Villa unseres Chefs freigab.
Wir waren im gefliesten Schlachtraum abgeschottet und sahen keinen Sonnenstrahl. Im Winter war es kalt, und im Sommer lief uns der Schweiß in die Gummistiefel. Schlachten ist ein Knochenjob, die Älteren bekamen Rheuma und Gicht wegen der Kälte, dazu kam noch die Sauferei. Wer in die Rente ging, hatte nicht mehr viel vom Leben.
Unter Metzgern gilt das Sprichwort: »Hängt das Schwein an der Leiter, geht es im Keller weiter.« Und zwar an der Flasche. Als Metzger habe ich richtig angefangen zu saufen. Da wurde ständig abgeschmeckt, Grützewurst, Leberwurst, alles ziemlich fetthaltig, es wurde immer ein Schnaps zur Verdauung eingeschenkt. Eine Ausrede ließ sich immer finden für das nächste Bier und den nächsten Korn. Das fing mit dem Elfer-Zug an, so nannten wir das erste Bierchen um elf, zum Mittagessen wurde eines aufgemacht, zum Feierabend kamen noch einmal ein paar dazu, dazwischen war immer Zeit für einen Schnaps. Meine Hände sind von Narben überzogen, einmal verlor ich beinahe einen Finger. Als ich nach einigen Bieren mit dem Schlachtermesser hantierte, hing er nur noch lose am Gelenk. Da bin ich kurz aufgewacht, aber bald war ich wieder drin in diesem elenden Trott.
Der Horizont über Cunnersdorf war eng geschnitten, hoch konnten meine Träume hier nicht steigen. Wenn ich mehr erleben wollte, musste ich nach Kamenz fahren, unsere Kreisstadt mit 15.000 Einwohnern, die keine zehn Kilometer entfernt liegt. Am Wochenende ließ ich immer die Sau raus – volle Druckbetankung in einer kleinen Disco. Dort konnten wir uns richtig abschießen, und wenn einer zu viel intus hatte und am Boden lag, interessierte das keinen. Ich fuhr einen VW Golf und baute immer wieder Unfälle. Einmal jagte ich ihn morgens um sieben mit 2,4 Promille gegen einen Baum, danach wurde mir der Führerschein für ein Jahr entzogen. Die Polizei tauchte öfter auf dem Hof auf, als meinen Eltern und Brüdern lieb war. Eine Zeit lang war ich zufrieden, wenn ich in Kamenz durch meine Stamm-disco stolzieren konnte, wo jeder mich kannte. Was bin ich doch für ein toller Hecht, dachte ich da, wenn ich meine Runde gedreht hatte. Heute weiß ich: Das war eine ganz schön armselige Szenerie. Wenn wir besoffen waren, kloppten wir uns auch gelegentlich und vertrugen uns wieder beim nächsten Bier. Wir wussten ohnehin nicht mehr, warum wir uns geprügelt hatten.
Nur mit den Mädchen tat ich mich schwer. Mit 167 Zentimetern bin ich ziemlich klein geraten, und man sah mir inzwischen auch an, dass ich gern Wurst und Hackepeter aß und literweise Bier trank. Wenn ich nüchtern war, traute ich mich nicht, ein Mädel anzusprechen. Wenn ich mich dann auf Betriebstemperatur getrunken hatte, winkten die meisten ab: Nüchtern schüchtern und voll toll, damit kam ich nicht weit. Manchmal fand ich eine, der alles einerlei war, dann steckte ich auf dem Parkplatz der Disco zwischen den Autos hastig einen weg. Manchmal nahm mich auch eine mit nach Hause, aber am nächsten Morgen wollte keine mehr etwas von mir wissen. Da fragte ich mich schon gelegentlich, ob was mit mir nicht stimmte. Spürten die, dass ich Schlachter war? Roch ich nach Tier und Blut und nach Tod?
Nach drei Jahren hatte ich die Lehre beendet, aber ich arbeitete als Geselle weiter, das war einfacher, als sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Einer der Metzger ging in Rente, und ich sollte seinen Posten übernehmen. Wahrscheinlich würde ich immer noch in der Metzgerei in Bernbruch stehen, wenn der angehende Rentner mich nicht zur Seite genommen hätte: »Willst du wirklich ein Leben lang aus dem kleinen Fenster gucken und den Garten vom Chef sehen?«
Da fing es an in mir zu arbeiten. Sollte meine Welt so klein bleiben? Ich war zwanzig und spürte: Jetzt musst du mal was anderes machen. An der Fachoberschule für Ernährung in Dresden holte ich das Abitur nach und brauchte dafür ein Jahr. Natürlich nervten mich vorher alle: »Was will ein Metzger denn mit Abitur? Schaffst du eh nicht.«
Das war für mich der Ansporn, es den anderen zu zeigen. Die Schlachterklamotten wollte ich nicht mehr anziehen, ich wollte zur Polizei. Aber dafür war ich zu klein, genau genommen fehlten mir drei lächerliche Zentimeter. Ich beschloss, Berufssoldat zu werden, und unterschrieb dann gleich für zwölf Jahre. Mir war nur wichtig, dass ich nicht mehr zurück in die Schlachtkammer musste.
Im Sommer 2009 sollte ich eingezogen werden, da hatte ich noch beinahe ein Jahr zu überbrücken. Ich fing an, bei einem Automobilhersteller zwei Dörfer weiter im Schichtdienst am Fließband zu arbeiten. Ich starrte die ganze Zeit nur auf die Maschinen, nach drei Monaten fühle ich mich nur noch leer. Am Wochenende gab es zu Hause Ärger, wenn ich einmal ausschlafen wollte, denn da sollte ich mich um die Viecher kümmern.
Für mich stand kurz vor Weihnachten 2008 fest: So kann ich nicht weitermachen, ich hau ab, ich geh nach Australien. Ich konnte nicht mehr, ich musste diese Endlosschleife aus Arbeit, kleinkarierter Muffigkeit und Suff durchbrechen. Ich wollte raus, und die anderen reagierten wie immer: »Der kleine Spinner hat wieder mal einen im Tee, das kriegt er doch im Leben nicht hin.«
Tatsächlich glaubte ich selbst nicht daran, dass ich nach Australien losziehen würde. Ich war ein ausgewiesener Tollpatsch, wenn es ein Fettnäpfchen gab, dann ließ ich es nicht aus. Es kam nicht nur einmal vor, dass ich mit dem Handy in den Badeshorts in das Schwimmbecken sprang. Und wenn ich mal mit Freunden im Stripclub in Dresden war und meine Zeche mit der Kreditkarte bezahlte, dann war ich natürlich der Einzige, der um ein paar Hundert Euro geprellt wurde. Aus Sachsen herausgekommen war ich bisher nur selten. Ich kannte Dresden und Berlin, fuhr manchmal kurz über die Grenze nach Polen und Tschechien, um zu tanken und Zigaretten zu holen.
Aber es gab keinen Weg mehr zurück. Ich hatte schon überall herumgetönt, dass ich nach Australien fliegen würde. Ich konnte nicht einmal Englisch, den Unterricht hatte ich konsequent geschwänzt, weil ich ohnehin davon ausgegangen war, dass ich niemals wegkommen würde. Freunde mussten mir helfen, das Visum zu beantragen. Das war typisch für mich: Ich wollte in die Welt hinaus und sprach nur Sächsisch. Ich verkaufte mein Auto, hatte kurz zuvor allerdings auf Glatteis einen Unfall gebaut, und statt der eingeplanten 2500 bekam ich nur noch 700 Euro. Das war mein Reisebudget.
An Neujahr betrank ich mich noch einmal anständig, und am 2. Januar 2009 zog ich dann verkatert los. Erst als ich das erste Foto aus Sydney postete, glaubten sie zu Hause, dass ich es dieses Mal ernst meinte.
Sechs Monate wollte ich als Backpacker durch Australien ziehen, es sind acht Jahre geworden, in denen ich hundert Länder bereist habe. In jedem dieser Länder wollte ich mindestens eine Einheimische flachlegen, und so viel kann ich verraten: Ich hatte deutlich mehr als hundert Frauen.
Zudem habe ich überall, wo ich war, die Drogen der Einheimischen ausprobiert. Ich wollte wissen, wie sich die Leute auf den Fidschis oder am Amazonas berauschten, wie sich die Pakistani abschossen oder die Menschen in Afrika. Ich saß in Mexiko mit Schwerverbrechern in einer Zelle und wusste nicht, ob ich den nächsten Morgen noch erleben würde. Ich bin einige Male dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Ich habe das Leben ausgereizt und auf die Spitze getrieben – eigentlich dürfte ich gar nicht mehr hier sein.
Als ich nach Sachsen zurückkam, war ich ein anderer. Mir kann keiner mehr was erzählen oder vormachen. Manchmal treffe ich die Maulhelden, die mich früher ausgelacht haben und zu denen ich aufgeschaut habe. Sie wollen dann mit ihren tollen Bräuten prahlen, und ich sage ihnen: Wer nicht mit mindestens zehn Brasilianerinnen Samba im Bett getanzt hat, kann nicht mitreden.
Meine Eltern wissen bis heute nicht, was ich alles erlebt habe. Sie wissen nicht einmal, dass ich zweimal geheiratet habe auf meiner Reise. Es ist Zeit, dass auch sie es erfahren.
Down Under
Planlos in Sydney
Als wir in Sydney landeten, hatte ich nicht den Hauch einer Ahnung, was mich dort erwartet. Im Flieger saßen vor allem frischgebackene Abiturienten, siebzehn oder achtzehn Jahre alt, die genau wussten, wie und wohin sie reisen wollten. Manche hatten das kommende Jahr vollständig durchgeplant, Woche für Woche. Alle wussten, wo sie in Sydney übernachten würden.
»Und wo pennst du?«, wurde ich immer wieder gefragt.
»Keine Ahnung«, sagte ich und fühlte mich bei jeder Frage schlechter.
Alle hatten einen Plan, nur ich nicht. Ich wusste nur eines – günstig musste es sein. Mancher hatte im Flugzeug damit geprahlt, dass er fünftausend Euro auf den Kopf hauen könne. Ich wollte in den ersten zwei bis drei Monaten mit lächerlichen siebenhundert Euro auskommen.
»Was, so wenig?«, fragten diese umsorgten Muttersöhnchen und setzten eine sorgenvolle Miene auf. »Damit kommst du nicht weit.«
Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Die hatten gerade die Schule verlassen und schon die Taschen voller Geld – ich hingegen war inzwischen vierundzwanzig Jahre alt und musste sparen. Aber immerhin war ich in Sydney angekommen, das hatten mir zu Hause in Sachsen nur die wenigsten zugetraut.
Ich selbst begriff es auch erst so richtig, als ich mit meinem Backpack auf dem Rücken in der Ankunftshalle des Sydney Airports stand. Am Flughafen ließ ich mich vom Tross der Backpacker mitreißen, der sich im Shuttlebus Richtung Innenstadt bewegte. Ich trottete einfach hinterher zu einem Hostel, das die Übernachtung für zwanzig Dollar anbot und in Kings Cross lag, dem bekannten Party- und Rotlichtviertel Sydneys.
Nach sechzehn Stunden Flug war ich vollkommen erledigt. Von minus 10 Grad aus dem sächsischen Winter in der australischen Sommerhitze zu landen, wo die Temperaturen bis auf 35 Grad kletterten – damit musste ich erst einmal klarkommen. Und ich hatte noch ein paar Probleme mehr. Weil ich kein Englisch konnte, war ich die ganze Zeit auf die Hilfe anderer angewiesen und musste mir die einfachsten Sachen übersetzen lassen. Micha, der Hinterwäldler aus Sachsen, brauchte Hilfe. Ich musste mir einen Adapter leihen, um mein Handy aufzuladen, da ich davon ausgegangen war, dass alle Steckdosen auf der Welt gleich aussähen.
Ich benötigte eine Tax Number, damit ich arbeiten und mein knappes Budget auffüllen konnte, und auch davon erfuhr ich erst im Hostel.
»Kümmere dich besser gleich darum«, sagten die Backpacker, »bevor du anfängst herumzureisen.«
In Kings Cross reihte sich Disco an Disco und Nachtklub an Nachtklub, ein denkbar ungünstiger Ort, wenn man einen so schmalen Geldbeutel besaß wie ich. Natürlich gönnte ich mir zur Ankunft ein kaltes Bier. Aber ich würde nicht wie viele andere jeden Abend Party machen können.
Um Geld zu sparen, entschloss ich mich, alle Strecken zu Fuß zu gehen, und das in Sydney, dieser Riesenstadt mit über vier Millionen Einwohnern. Ich schlenderte in Badelatschen los, wie ein Pauschaltourist auf Sightseeing, hielt eine Weile durch, bis ich mir am dritten Tag schließlich einen derben Sonnenbrand einfing. Zunächst schaute ich mir die Harbour Bridge an, die von den Einheimischen nur Coat Hanger genannt wird, Kleiderbügel, außerdem sah ich das weltberühmte Opera House, das Wahrzeichen Sydneys. Sonnencreme war teuer, und das Geld hatte ich mir sparen wollen. Ich war total verbrannt, von oben bis unten, meine Haut schälte sich, jede Bewegung schmerzte. Zudem hatte ich zu humpeln begonnen, die Sehnen an beiden Schienbeinen hatten sich beim stundenlangen Herumlaufen in den Badelatschen entzündet.
»Du musst Flipflops tragen«, empfahl einer der Backpacker.
Wie sich herausstellte, war das ein guter und folgenschwerer Rat. Die nächsten paar Jahre war ich nur noch in Flipflops unterwegs.
Sydney brach wie eine Welle über mich herein. Ich war noch nie gereist, von Kamenz aus war ich höchstens einmal über die Grenze nach Polen oder Tschechien gefahren, um zu tanken oder Zigaretten zu holen. Ich musste zur Ruhe kommen und beschloss, mich ins Hostel zurückzuziehen und mich auszukurieren. Die anderen gingen am Abend aus, aber als sie mich zum Mitkommen aufforderten, winkte ich ab: »Nee, lasst mal.«
Das Bier in Sydney war so teuer, dass es mir ohnehin nicht schmeckte.
Im Rückblick muss ich sagen: Typisch deutsch, so habe ich mich aufgeführt. Während dieser Tage im Hostel schaute ich insgeheim schon wieder nach einem Rückflug. Kings Cross war in Feierlaune, aber ich verspürte Heimweh nach Sachsen. Für mich stand fest, schlechter ist es zu Hause auch nicht. Vor allem die Nächte waren hart, wir lagen zu zehnt in einem Schlafsaal in Etagenbetten, das war es, was einem in der billigsten Kategorie geboten wurde. Nachts war nie Ruhe, ständig rumpelte irgendjemand besoffen durch den Raum, die Metallbetten quietschten und ächzten, wenn irgendwo gepimpert wurde. Das lernte ich erst später – als echter Backpacker ging man nicht nüchtern ins Bett. Du musst bedröhnt sein, um schlafen zu können.
Ich wollte also aufgeben und die Reise abbrechen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Ich legte mir schon die Argumente zurecht, warum ich zu Hause wieder auf der Matte stehen würde. Aber dann wendete sich völlig unerwartet das Blatt.
Im Hostel gab es einen Gemeinschaftsraum, in dem auch ein Fernseher stand. Ich saß da abends allein herum und schlug die Zeit tot, als eine Brasilianerin hereinkam, knapp über zwanzig, dunkle Locken, makellose Figur. Die Bonita fing an, mich vollzulabern, ich verstand kaum ein Wort. Ich nickte und schaute ihr scheu in die braunen Augen. Die Unterhaltung fiel ziemlich sparsam aus, aber sie wollte ohnehin etwas anderes. Wir fingen zu knutschen an, sie übernahm dabei das Kommando. Und ich dachte: Mein Gott, was passiert denn hier? Sie sah verdammt gut aus, ich war völlig verschüchtert und hätte mich nie getraut, sie anzurühren. Wir waren auf der Couch zugange, immer wieder kamen andere Backpacker vorbei.
»Hey, da vögeln welche«, sagte einer.
Am Anfang war es mir unangenehm, dass mir jemand dabei zuschaute. Aber diesen Coup konnte ich mir von ein paar neugierigen Blicken unmöglich verderben lassen. Es war die Nacht, in der mich eine brasilianische Göttin rettete. Ohne sie wäre ich zurückgeflogen und hätte nie erfahren, wie großartig das Leben sein kann.
Nach dieser Nacht sah jedenfalls alles anders aus. Sydney zeigte sein freundliches Gesicht, meine düstere Stimmung war nach der Nacht mit der Brasilianerin wie weggewischt. Ich verliebte mich nun schnell in Australien. Neben den Wolkenkratzern von Kings Cross gab es den Botanischen Garten, wo ich mich gern aufhielt und wo sich die Einheimischen zum Picknick trafen.
Ich staunte über die Schilder: Walk on gras, stand darauf. Gehen Sie bitte auf dem Rasen, dafür ist der da. Wäre das in Deutschland denkbar?
Auf der Queen Street entdeckte ich den Fleischtempel Victor Churchill, die coolste Metzgerei in ganz Sydney. In Reifekammern hingen, von Scheinwerfern ausgeleuchtet, riesige Teile von Wagyu- und Black-Angus-Rindern. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich ging immer wieder hin, um die gigantischen Rinderhälften zu bestaunen. Das war vielleicht mal eine Fleischkultur! Die Australier legten viel Wert auf Barbecues, in jedem Park gab es Grillplätze. Würste dagegen vernachlässigten sie, das musste ich als Mann vom Fach natürlich bemängeln. Trotzdem war Fleisch so ziemlich das Wichtigste in diesem Land, und auch das war einer der Gründe, warum ich blieb. Es war der verbindende Link von meiner alten Heimat zu dieser neuen Welt.
Victor Churchills Fleischtempel
Nach anderthalb Wochen in Sydney schloss ich mich Eddy und zwei anderen deutschen Backpackern an, die ein paar Städte abklappern wollten. Über Canberra, der Hauptstadt Australiens, fuhren wir im Greyhound Bus nach Melbourne. Eddy war lässig, konnte Englisch und fand sich leichter zurecht als ich. Melbourne war für seinen hohen Lebensstandard bekannt, ich war schnell beeindruckt von dieser Stadt. Oft waren wir mit der Straßenbahn unterwegs, die man kostenlos benutzen konnte. Wir besuchten den Queen-Victoria-Market, mit sieben Hektar einer der größten Freiluftmärkte, und Chinatown, wo wir uns für kleines Geld die Bäuche vollstopften. Abends amüsierten wir uns auf einer der vielen Partys, die meist auf dem Dach eines Hochhauses stiegen.
Nach einer Woche in Melbourne reisten wir gemeinsam auf der Great Ocean Road bis Adelaide weiter. Eddy wollte Spaß und war nicht besonders scharf darauf zu arbeiten. Aber ich wollte nach einem Job suchen. Ich hatte keinen Überblick über meine Finanzen und überschlug lediglich im Kopf, wie viel Geld ich noch haben müsste. Wenn ich Geld abheben wollte, waren Gebühren fällig, deshalb hob ich meist gleich dreihundert Dollar ab und versteckte die großen Scheine zwischen den Unterhosen und Socken. Nicht zu wissen, wie lange mein Geld noch reichen würde, beunruhigte mich. Nach außen versuchte ich cool zu wirken. Aber mir war klar, dass ich allmählich arbeiten musste.
Der härteste Job der Welt: Banana Humping an der Ostküste
In Innisfail, eine Stunde von Cairns entfernt, checkte ich in einem der Working-Hostels an der Ostküste ein, die Arbeit an Backpacker vermittelten. Am nächsten Morgen holte mich ein LKW ab, der mich ins Outback brachte.
Die Anweisungen waren knapp gehalten – ich musste mit einem Riesenmesser einen Berg abgefahrener Autoreifen zerkleinern und in eine Grube beim Fluss werfen. Der Fahrer setzte sich neben den Lastwagen und sah mir gelangweilt beim Arbeiten zu. Die Sonne brannte auf die ausgetrocknete Steppenlandschaft, immer wieder musste ich das Messer an einem Schleifstein schärfen. Nach zehn Stunden setzte der LKW mich wieder am Hostel ab. Das war mein erster Job Down Under: Für zehn Dollar die Stunde illegal Reifen zu entsorgen. Es gab Bargeld auf die Hand, der Rest hatte mich nicht zu interessieren. Die hatten mich sicher auch deshalb ausgewählt, weil ich kein Englisch sprach und keine unangenehmen Fragen stellen konnte.
Ich blieb einige Tage im Working-Hostel, es war ein gutes Gefühl, das erste Geld verdient zu haben. Wir Backpacker saßen abends beim Bier zusammen. Da waren alle Nationalitäten versammelt, unter anderem auch ein Russe, der illegal in Australien lebte und sich auf einer Farm durchschlug. Wir grillten öfter zusammen, auch um in kein Restaurant gehen zu müssen und Geld zu sparen.
Es dauerte nicht lange, bis ich meinen zweiten Job bekam, Banana humping. Es hieß, das sei der härteste Job in Australien. So ähnlich müsse es in der Hölle zugehen, behaupteten sie im Hostel.
Das war zwar übertrieben, aber tatsächlich eine Maloche, die mir einiges abverlangte. Um die grünen Bananenstauden wurde ein Sack gewickelt, man packte die Staude am Ende, und der Farmer schlug mit der Machete den Stiel weg. Die Bananen trug man auf den Schultern einige Hundert Meter zu einem Truck. Einige Stauden wogen siebzig Kilos. Wenn man das ein paar Stunden unter der sengenden Sonne gemacht hatte, spürte man Muskeln im eigenen Körper, die man vorher gar nicht kannte.
Was den Job noch härter machte: In den Säcken befanden sich oft giftige Schlangen und Spinnen. Australien ist ohnehin ein Freiluftparadies für giftige Reptilien und Kriechtiere. Aber auf der Bananenfarm verdichtete sich dieser Zustand noch einmal auf kleiner Fläche, da wimmelte es nur so von hoch toxischen Kreaturen. Mir krabbelten einige Spinnen den Rücken herunter, ich wollte gar nicht wissen, wie gefährlich die waren. Gebissen wurde ich nicht, zumindest bemerkte ich nichts davon.
Die australischen Arbeiter waren hart im Nehmen, die packten die Schlangen und Spinnen einfach und schleuderten sie weg. Da hieß es dann: »Scheiß dich doch nicht gleich ein, du deutsche Pussy.«
Zwei Wochen lang schleppte ich Bananen, das gab gutes Geld, zwölf Dollar die Stunde. Ein anderes Problem blieb jedoch bestehen – nach drei Monaten in Australien konnte ich immer noch nicht richtig Englisch reden. Wenn eine Runde im Hostel zusammensaß, hockte ich schweigend daneben, selbst der Russe musste für mich übersetzen.
Das war eine echte Schmach für mich, so konnte es nicht weitergehen. Ich beschloss, dass ich endlich Englisch lernen musste.
Heiße Nächte im Hilton
In Surfers Paradise nahm ich mir ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Surfers ist ein beliebter Ort an der Gold Coast, mit über dreihundert Meter hohen Wolkenkratzern und kilometerlangen Sandstränden. Irgendwo war da immer eine Party am Laufen. Die ganze Ostküste Australiens ähnelte einem Backpacker-Highway, auf dem die Busse hoch und runter fuhren und die Hostels ansteuerten. Allein war man nie, man traf unterwegs immer wieder auf bekannte Gesichter.
Jetzt lebte ich in der WG zusammen mit Brandon, einem Engländer, außerdem mit Eugen, einem Iren, und Scott, einem Schotten. Scott konnte ich kaum verstehen, er mochte aber mein Sächsisch, das ihn an das Angelsächsische erinnerte. Das waren kuriose Dialoge: Ich sächselte, er antwortete in seinem harten schottischen Dialekt.
Eugen brachte mir das Grundvokabular in seinem gälischen Dialekt bei, das man seiner Meinung nach im Alltag gebrauchen konnte: Póg mo thóin, küss meinen Arsch, das war seine liebste Redewendung.
Gehobenes Englisch konnte ich bei den Jungs also nicht lernen, aber ich gewöhnte mir wenigstens an, mich auf Englisch zu verständigen. Als wir abends einmal gemeinsam trinken waren, stieß auch der Chef des Iren noch dazu. Der bekam mit, dass ich dringend Arbeit suchte. Wieder einmal waren meine Geldreserven beinahe aufgebraucht. Er fragte, ob ich schon mal als Bricklayer gearbeitet hätte. Klar, lautete meine Antwort, schon öfter. Dabei wusste ich gar nicht, was für einen Job er mir anbot.
Und so war ich dann also als Maurer eingestellt, für stolze zwanzig Dollar die Stunde. Pünktlich stand ich am nächsten Morgen um sieben mit dickem Kopf an der Straße. Wie es in Australien üblich ist, kamen meine neuen Kollegen erst um acht vorbei. Ganz nüchtern war noch keiner der Bricklayer. Meine Maurer-brigade nahm das Leben nicht zu ernst, Probleme gab es selten, ständig bekam ich zu hören: »No worries, Michael, no worries.«
Meinen Vornamen sprachen sie natürlich Englisch aus, wie in Michael Jackson.
Als Maurer konnte ich gut mithalten in der Gang, die wussten nicht einmal, wie man einen Bauplan las. Das Ausbildungsniveau in Australien war nicht besonders hoch, ich konnte beinahe jeden Job übernehmen. Nur einmal gab es Ärger, aber das ist eine Geschichte, die ich später erzähle. Auf der Baustelle dauerte alles viel länger, als ich es aus Deutschland gewohnt war. Ich war derjenige, der Tempo machte. Der Chef der Baufirma nahm mich nach ein paar Tagen zur Seite und meinte: »Hör doch mal auf, so deutsch zu sein, Michael.«
Das wollte ich mir nicht anhören müssen. Ich konnte auch anders, wenn ich wollte.
Es traf sich gut, dass ich von einem Backpacker, der nach Hause fliegen wollte, ein Zelt und einen Schlafsack geschenkt bekommen hatte. Ich fuhr allein die Ostküste hinauf nach Byron Bay, einem der Backpacker-Hotspots und Partyplätze, wo viele Mädels in den Bars ihre Titten zeigen, um Freidrinks zu bekommen. Am Great Barrier Reef in Cairns wollte ich Tauchen lernen, aber mir fehlte natürlich das nötige Geld. Mit der Tauchschule einigte ich mich darauf, dass ich die vierhundert Dollar Gebühr abarbeiten konnte. Ich füllte die Sauerstoffflaschen auf und kümmerte mich um die Verpflegung.
Bei einem der Tauchgänge sah ich beim Auftauchen einen Wal, der direkt hinter uns schwamm. Ich war fasziniert und wäre gern näher herangeschwommen, am liebsten hätte ich den Wal gestreichelt. Aber unser Tauchlehrer gab uns zu verstehen, dass wir uns schnellstmöglich entfernen sollen. Später erklärte er uns, dass man hinter einem Wal schwimmen dürfe, aber nie vor ihm: Wenn das riesige Tier anfange, Wasser einzusaugen, dann habe man keine Chance mehr wegzukommen.
Das Great Barrier Reef war 2009 schon überfüllt, da waren mehr Touristen als Fische im Wasser unterwegs. Beim Auftauchen ankerte Boot an Boot, und am Meeresboden starben die Korallen ab. Aber ich war nicht der Typ, der sich zu lange an Problemen festbiss. Ich wollte etwas erleben, und dafür brauchte ich Hilton – so taufte ich den weißen Camper, den ich mir ausgeliehen hatte. Hinten lag eine Matratze drin, neben der Tür stand ein Gaskocher.
Mit Hilton fuhr ich in Richtung Norden nach Cape Tribulation, das für seine von Palmen gesäumten Sandstrände bekannt ist. Ich besuchte Hostel-Partys und parkte Hilton vorher auf dem nächsten Campingplatz. Das war ein paradiesisches Leben, hier hatte ich viel mehr Privatsphäre als in den Hostels, wo der ganze Schlafsaal einem beim Sex zuschauen konnte.
Mit Hilton schnellte meine persönliche Frauenquote sprunghaft nach oben. Auf den vielen Backpacker-Partys quatschte ich die Mädels an: »Ich schlafe heute Nacht im Hilton, willst du mit?«
Keine Backpackerin schlief freiwillig in den überfüllten, miefigen Schlafsälen, in denen sich oft bed bugs, also Bettwanzen eingenistet hatten, die einen bissen und sich in den Klamotten festsetzten.
Die meisten Damen stutzten kurz, als sie mein Hilton sahen. Aber zurück zum Hostel laufen, das wollte dann auch wieder keine.
»Jetzt bist du schon mal da«, schwadronierte ich, »leg dich schon mal hinten rein.«