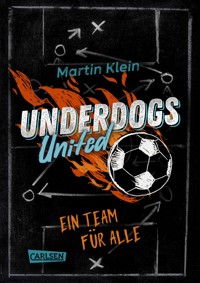111 Gründe, ihr Kind auf den Mond zu schießen (und noch mehr, es nicht zu tun) E-Book
Martin Klein
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Sind sie nicht süß, die lieben Kleinen? Glucksend liegen sie in ihren Bettchen, quietschen vor Vergnügen und schauen Mami und Papi aus kugelrunden Monchichi-Augen voller Liebe an. Okay, gelbe Sabberfäden hängen ihnen aus den Mundwinkeln und tropfen auf das frisch bezogene Laken, und die Windel, gerade erst angelegt, stinkt auch schon wieder bestialisch. Ja, sie sind entzückend. Auch wenn sie dann später die neue Tapete mit Nuss-Nougat-Creme dekorieren, mit viel Gebrüll die Nacht zum Tag machen und aus dem Kindergarten die lustigsten Kinderkrankheiten heimbringen. Kinder sorgen immer wieder für Momente, in denen sich Eltern fragen, warum sie sich das eigentlich angetan haben – vom Zeugungsakt einmal abgesehen. Vorher war das Leben doch auch schön. Aber dann fällt es einem rechtzeitig wieder ein: Kinder sind etwas Großartiges und bereichern das Leben ungemein. Ehrlich! Letzten Endes sind sie den ganzen Stress doch wert. Die in diesem Buch versammelten 111 Gründe, sein Kind auf den Mond zu schießen, sind eine sehr persönliche Auswahl aus den etwa 111.111 Gründen, die der Autor Martin Klein auf Anhieb aufzählen könnte. Ergänzt werden seine eigenen Erfahrungen durch die Fronterlebnisse befreundeter Eltern. Es geht um Haustiere als Weihnachtsgeschenk, den Kampf um die Fernbedienung, um Babysitter, Arztbesuche, schulische Debakel und Pubertätsparanoia, um Taschengeld und verschluckbare Kleinteile. Mütter und Väter werden sich in den Texten wiederfinden und erleichtert feststellen, dass sie nicht die Einzigen sind, die ihre Scharmützel im Kinderzimmer haben. Witzige Anekdoten und praktische Tipps helfen auch werdenden Eltern, sich darauf einzustellen: Nicht alles wird besser mit Kindern, aber alles wird anders! Wer bei der Lektüre ein paar Mal hysterisch lacht oder weinend ins Kopfkissen beißt, hat schon gewonnen. Denn ohne Galgenhumor übersteht keiner die Kindheit – zumindest nicht die Eltern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Ähnliche
Martin Klein
111 GRÜNDE, IHR KIND AUF DEN MOND ZU SCHIESSEN
(und noch mehr, es nicht zu tun)
Wie Sie entspannt bleiben und die ersten Jahre mit den kleinen Nervensägen mehr oder weniger gut gelaunt überstehen
1
EINE SCHWANGERSCHAFT IST KEIN RUBBELLOS
VORWORT ODER: 1.GRUND
Weil man nie aufhört, Vater zu werden
Was Sie hier in den Händen halten, sind 111 Notizen eines werdenden Vaters. Werdenden Vaters? Ist etwa schon wieder was unterwegs?! Haha, nix da, niemals, never ever. Siehe Kapitel 111. Ich bin werdender Vater, weil es nie aufhört, so lange die Kinder Kinder sind. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht, das mit der idealen Erziehung. Manchmal klappt alles, manchmal nichts. Die meiste Zeit liege ich dazwischen. Ein weiser Vater und Erziehungswissenschaftler hat mal gesagt: »Bis man wirklich gut ist im Erziehen, muss man mindestens vier Kinder haben.«1 So weit, siehe Kapitel 111, wird es bei mir nicht kommen.
Ich habe zwei Töchter. Jeden Tag. Ich bin verliebt in sie wie damals in der dritten Klasse in Stefanie oder Gabi und in meine Grundschullehrerin. Alles kribbelt und ist schön. Ich komme nach Hause und noch bevor ich durch die Tür trete, habe ich das Gefühl, mir wird eine unsichtbare Heizdecke umgelegt. Doch kaum habe ich die Tür hinter mir geschlossen, könnte ich die Kinder auf den Mond schießen. Weil sie gar nicht lieb auf der Küchenbank sitzen, mich anhimmeln und applaudieren, nur weil ich da bin, meine Schuhe ausziehe und mein Handytelefonat fast beendet habe. Sie sprechen auch nicht meine sehnlichsten Wünsche aus und sagen Sachen wie: »Bestimmt möchtest du jetzt erst einmal deine Ruhe haben, hier ist deine Zeitung und im Kühlschrank wartet ein gekühltes Bier auf dich, Vater.« Nein, sie sind fordernd, sie sind laut. Sie schimpfen mit mir, obwohl sie eigentlich gerade Krach mit ihrer Mutter haben, die zufällig auch meine Frau ist und die ich jetzt gerne erst mal küssen würde. Doch dazu komme ich gar nicht, weil mir meine Jüngste von hinten einen Puppenwagen in die Hacken rammt und die Größere wissen will, ob ich wenigstens an die gewünschte DVD gedacht hätte, an die ich blöderweise nicht gedacht habe. Die Vorfreude auf einen entspannten Feierabend, an dem jeder ruhig und mit gerecht verteilten Redeanteilen von seinem Tag erzählt, während wir gepflegt Abendbrot essen wie einst die Buddenbrocks, bricht in wenigen Sekunden im größten anzunehmenden Chaos zusammen.
Vor 30 Jahren hat der Monty-Python-Komiker John Cleese zusammen mit dem Psychotherapeuten Robin Skynner ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel Families and How to Survive Them. Ins Deutsche wurde es leider etwas doof übersetzt mit Familie sein dagegen sehr2statt Familien und wie man sie überlebt. Darin steht ein kluger Satz über das Kinder-Eltern-Ding: »Eltern sollten verstehen, dass ihre Kinder überwiegend anderer Meinung sind und ihre Eltern als Tyrannen, als diktatorische Geistesgestörte ansehen.« Aber wenn schon nicht unsere Kinder, dann sollten wenigstens wir vollstes Verständnis für uns haben, und es wie die Moderatorin und Autorin Amelie Fried halten, die einmal ganz richtig sagte: »Es ist normal, wenn Sie gelegentlich Lust haben, Ihre Kinder aus dem Fenster zu werfen. Es ist nicht normal, wenn Sie es tun!«3 Denn, das wurde mir immer klarer beim Aufschreiben dieser 111 Gründe, wir haben es immer in der Hand, das Fenster geschlossen zu lassen oder den Countdown für die Mondrakete rechtzeitig abzubrechen. Na ja, nicht immer. Aber manchmal bis meistens. Ich hätte beim Nachhausekommen mein Handytelefonat ja beenden können, bevor ich in der Tür stehe. Ich hätte auch erst mal auf die Kinder eingehen und dann meine Frau küssen können. Ich hätte also nicht sofort Teil der großen Chaos-Party werden müssen.
Es gibt also nicht nur 111 und mehr Gründe, Kinder auf den Mond zu schießen. Es gibt noch sehr viel mehr, es nicht zu tun. Was kann ein Kind dafür, (m)ein Kind zu sein? Vor allem, wenn ich selbst in vielen Situationen nicht erwachsen reagiere. Also nehme ich mir vor, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das klappt nicht immer …
2. GRUND
Weil sie es nicht leicht machen, eine Familie zu gründen
Zwischen Geld und Geschlechtsverkehr besteht zwar im Bordell ein Zusammenhang, aber nicht, wenn’s ums Kinderkriegen geht. Da ist Geld eher selten ein Anreiz für die Beteiligten, wie zuletzt das Elterngeld gezeigt hat. 2007 ging’s damit los in Deutschland, doch der politische Wunsch, junge Eltern ohne Verhüterei ins Bett zu schicken, erfüllte sich nicht. Die Geburtenrate der Republik verharrt bei 1,4 Stück. (Man darf doch bei so einer krummen Statistik-Zahl von Stück sprechen?) Es wären aber 2,1 Stück (oder Kinder) pro Frau nötig, um die Bevölkerung stabil zu halten. Doch dieser statistische Druck scheint ebenso wenig stimulierend zu sein wie das Scheckbuch des Familienministeriums. Wenn also schon nicht für Kohle, wofür machen Menschen dann Kinder? Immerhin sagten 85 Prozent in einer Umfrage des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, dass es wichtig sei, eigene Kinder zu haben.4 Auf die einfache Frage »Warum?« antworteten die meisten mit dem Satz: »Weil durch sie das Leben bunter und vielfältiger wird.« Sehr populär war auch eine Antwort der Sorte Basta: »Das war immer schon so und wird auch immer so bleiben!« Wörtlich lautete die Antwort, dass Kinder einfach zum Leben dazugehören. Angst vor Einsamkeit im Alter ist auch eine Motivation, die Pille mal wegzulassen. Viele gehen auch über das Alter hinaus bis zum Friedhof: Die Hälfte der Befragten freut sich jetzt schon, in ihren Kindern über den eigenen Tod hinaus weiterzuleben. Noch ein Grund, wahrscheinlich der heikelste, weil nicht unbedingt richtigste: weil Kinder eine Beziehung stabiler machen. Ich jedenfalls habe im erweiterten Bekanntenkreis oft das Gegenteil erleben können. Sobald es hieß, in dieser kritischen Situation kann uns nur noch ein Kind wieder vereinen, war die Trennung besiegelt, und das Neugeborene wunderte sich, dass man es offenbar mit Zement verwechselt hatte.
Geld kommt dann doch noch am Rande ins Spiel. Aber nicht in dem Sinn, dass irgendwer der Meinung ist, dass Kinder reich machen (in finanzieller Hinsicht), auch nicht in dem Sinne, dass sie mal die Altersversorgung sichern. So wie früher, als die Söhne und Töchter schön Geld abdrücken mussten, solange sie ihre Füße unter »seinen« Tisch stellten, und auch später die Versorgung der alten Eltern gewährleisteten. Nein, bei der Umfrage war’s umgekehrt: Eben weil von eigenen Kindern kein Geld erwartet wurde, große Kosten aber allemal, waren um die 80 Prozent der Befragten der Meinung, es müsse genügend Geld da sein, bevor man das Kondom in der Packung lässt und sich auf das unbekannte Abenteuer Familie einlässt. Da genügend Geld aber eigentlich nie da ist, es könnten ja immer gerne ein paar Cent mehr sein, und da kein König und keine Kanzlerin sich auf ein bedingungsloses Grundeinkommen einlassen wollen (sagen wir je 1.000 Kröten für die Eltern und 500 für jedes Kind), bleibt’s in der eigenen Verantwortung. Bleibt es ein Abenteuer, auch finanziell.
3. GRUND
Weil der Stress ultrafrüh beginnt
Wer mich richtig in die Bredouille bringen will, zeigt mir eine Ultraschallaufnahme und fragt: »Süß, oder?« Für mich sieht jede Ultraschallaufnahme aus wie die Satellitenaufnahme eines tropischen Wirbelsturms. Ich erkenne leider gar nichts, geschweige denn etwas Süßes. »Ja, aber …«, heißt es dann vom fassungslosen Gegenüber, meistens die werdende Mutter – manchmal haben auch stolze Väter in spe ein zerknittertes Ultraschallbild von ihrem Erben zwischen Dauerkarte und Fahrzeugschein im Portemonnaie stecken –, »ja, aber hier sieht man doch ganz deutlich die Nase! Und das hier ist das Füßchen, allerdings ein klein wenig verdeckt hinterm Popo.« Man ist ja nicht so und weiß um den Stolz und die Glückshormone werdender Eltern, also wird pflichtschuldig geantwortet: »Ach, jetzt sehe ich’s auch! Donnerwetter, dann muss das hier der Pipimann sein!« – »Nein, es wird ein Mädchen, das ist ein Finger.«
Ich gehöre leider nicht zu den Profi-Eltern, die diese verwaschenen Schwarz-Weiß-Bilder lesen können wie Kunststudenten Rembrandts Nachtwache. Mir ist es nicht vergönnt, behaupten zu können, dass ja klar und deutlich die Müller- oder Schmitz-Linie zu erkennen ist, dass die Kopfform ja »eindeutig« nach dem Vater komme, dass man »jetzt schon« einen lebhaften Charakter ganz klar sehen könne. Ich kann immer nur versuchen, die Situation irgendwie zu retten: »Auf alle Fälle ist es ein richtig schöner Embryo!« – »Es ist kein Embryo«, lautet resigniert die Antwort, »es ist ein Fötus, ich bin bereits in der elften SSW.«
Richtig, wir sagen ja SSW und nicht Schwangerschaftswoche, wir sagen ja auch PND und niemals Pränataldiagnostik. Denn wir sind jetzt hauptberuflich schwanger, und neun Monate lang kann uns kein Gynäkologe etwas vormachen, so gut, wie wir uns informiert haben. Wenn der Frauenarzt eine Fachfrage hat, wir helfen ihm jederzeit gern!
Seit Ende der 1970er ist die Sonografie mehr und mehr zum Standard bei den Schwangerschaftsuntersuchungen geworden. Hauptzweck ist, zu erkennen, ob alles tipptopp läuft im immer dicker werdenden Bauch. Das beinhaltet die Möglichkeit, dass festgestellt wird, dass es nicht gut läuft, sich eine Erkrankung oder Behinderung abzeichnet. Das bringt unweigerlich die Frage mit sich: Was tun, wenn …? Auch meine Frau hat sich und mir diese Frage im Wartezimmer vor den wichtigen Arztterminen gestellt. Ich habe sehr männlich reagiert – mit Verdrängen und Vertagen. Hätte eine Untersuchung vielleicht Hinweise aufs Downsyndrom ergeben, ich hätte erst dann entscheiden wollen, was wir tun würden. Vorher wollte ich mir nicht den Kopf zerbrechen über einen Plan B für den Fall X. Denn es ist eine prekäre Situation. Konfrontiert mit der Nachricht, ein behindertes Kind zu bekommen, kann man sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden – das kann die richtige Entscheidung sein, aber auch eine, die man später bitter bereuen wird. Und man kann sich entscheiden, das behinderte Kind zu bekommen, um später unter Umständen festzustellen, dass man den Konsequenzen nicht gewachsen ist und sich und dem Kind nicht gerecht wird.
Wir wurden glücklicherweise nur vor die Frage gestellt, ob wir wissen wollen, was es wird. Meine Antwort »Das wissen wir doch, ein Baby!« war zu vorschnell. Es ging natürlich um die Frage, ob’s ein Mädchen wird oder was Vernünftiges.
4. GRUND
Weil Namen Körperverletzung sein können
Erika-Cheyenne, Elvis-Jesus-Lutz, Jihad-Pumuckl. Petra-Penelope, Chin-Chin Champain … es gibt Kindernamen, die gehören verboten. Und den Behörden und den Gerichten sei gedankt, sie sind es auch! In meiner Grundschule hießen alle Jungs Christian, Andreas, Michael und Martin, die Mädchen wurden auf Stefanie, Claudia, Kerstin und Andrea getauft. Für Doppelnamen hatten die Eltern schon mal überhaupt keine Zeit, sie sparten fürs Eigenheim oder einen neuen Opel Kadett. Gefragt, warum sie mir diesen Vornamen gegeben haben, wo ich doch schon mit meinem Nachnamen gestraft genug bin, lautete die Antwort meiner Mutter: »Ich fand den Namen schön!« Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wer im früheren Leben meiner Mutter so hieß, mein Vater jedenfalls nicht. Den ich komischerweise nie gefragt habe, ob er den Namen auch schön fand. Ihm reichte bestimmt, dass er sich den Namen gut merken konnte. Mit der Namensgebung für den Nachwuchs hatte diese Vätergeneration weitgehend wenig zu tun. So wenig wie mit der Geburt, von der sie häufig im Stadion vom Stadionsprecher erfuhr: »Lieber Fußballfreund Karl-Günther, du bist soeben Vater eines prächtigen Knaben geworden! So, und jetzt wechseln wir den Spieler mit der Rückennummer sechs aus …«
Namen waren Schall und Rauch, bei mehr als sechs Kindern war man froh, wenn sie einem nicht ausgingen. Heute sind Namen Ausdruck größter Individualität, ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist zwar eine Generation nach Kevin und Chantalle noch nicht überall geglückt, aber heute wissen junge Neu-Eltern, wie’s geht und werden nur noch vom Frankfurter Oberlandesgericht gebremst, das den Vornamen »Schröder« partout nicht durchgehen ließ. Dieser Name sei nicht eintragungsfähig, wie es auf Juristisch heißt, weil ihn die Allgemeinheit als Familienname auffassen könnte.5
Humorlos sind die Gerichte auch, wenn spätere Hänseleien in den Namen eingebaut sind oder das Geschlecht nicht zu identifizieren ist. Das Amtsgericht Krefeld lehnte den Namen »Verleihnix« ab, und das Amtsgericht Kassel ließ »Borussia« nicht durchgehen – nicht wegen der Steilvorlage für späteren Spott im Klassenzimmer, sondern weil ein Mädchen mit dem Namen versehen werden sollte. Das Amtsgericht Nürnberg stoppte den Mädchennamen »Rosenherz«, das Landgericht Berlin die Eintragung des Namens »Venus« für einen Jungen, und das Amtsgericht München trat bei »Puschkin« als Mädchennamen auf die Bremse.6 Manchmal sind die Gerichte und Ämter aber auch ohne Sinn für Poesie. Dass der Wunschname »Mika«, den offenbar rennsportbegeisterte Eltern und Fans des finnischen Formel-1-Piloten Mika Häkkinen für ihren Buben erwählt hatten, vor Gericht landete, ist genauso wenig nachzuvollziehen wie der Umgang mit dem Namen »Juli«. So heißt die Tochter meines Freundes, der Geld zahlen musste, um die Zulässigkeit dieses Namens prüfen zu lassen. Kein Schmiergeld, ich schwöre, echte Gebühren nach der entsprechenden Gebührenverordnung.
Mein Tipp: Wenn Sie den Drang verspüren, Ihrem Nachwuchs einen ungeheuer originellen, nie dagewesenen Namen zu verpassen, denken Sie zweimal darüber nach, ob Sie Ihren Einfallsreichtum nicht lieber in einem kreativen Töpferkurs ausleben wollen, statt eine lange und schmerzhafte Schul- und Hänselzeit in die Wege zu leiten. Ihr Kind wird es Ihnen danken, sobald es Danke sagen kann!
5. GRUND
Weil jede Geburt den Wert eines Autos halbiert
Es gibt einen besonders schönen Moment in Nick Hornbys wunderbarem Roman About a Boy7. Held ist ein notorischer Single und Schürzenjäger, der die Erfahrung macht, dass schöne alleinstehende Mütter prima Beute sind, denn sie haben wenig Gelegenheiten, neue Männer kennenzulernen, wegen all der Verpflichtungen rund um ihre Kinder. Also geht Will Freeman zielstrebig da hin, wo er schöne alleinstehende Mütter wähnt: zur Selbsthilfegruppe SPAT (Single Parents Alone Together). Tatsächlich landet er im Paradies: Außer ihm erscheinen nur Frauen! Zum Einstand macht er sich allerdings gleich verdächtig, gar kein Kind zu haben, weil er pünktlich erscheint. Welcher Alleinerziehende schafft das schon, entweder ist der Babysitter noch nicht da, oder die Kinder wollen einen nicht ziehen lassen. Dabei ist Freeman gut vorbereitet, er hat sich eine Geschichte zurechtgelegt von seiner Ex, die ihn verlassen und den zweijährigen Sohn gleich mitgenommen habe, und sich zum Beleg seiner Lüge sogar einen Kindersitz zulegt. Doch schon macht er den nächsten Fehler: Der Kindersitz ist in jungfräulichem Zustand. Das aber ist jeder Kindersitz in jedem Auto auf jeder Straße dieses Universums nur bis zur ersten Sitzprobe durch den Nachwuchs. Der angehende Retter der alleinstehenden Mütter bemerkt und korrigiert seinen Fehler umgehend, indem er Chips und Schokolade in den Kindersitz bröselt und schmiert. Endlich sieht sein Wagen aus wie eine richtige Familienkutsche. Dabei geht das Drama im echten Leben und in echten Autos ja noch weiter als in Hornbys Roman. So wie der Kindersitz sieht nach kurzer Zeit die ganze Karre aus: Schuhabdrücke auf der Rückbank, Schokoladenspuren an den Kopfstützen, Kaugummi in den Fußmatten, Saftränder auf der Mittelkonsole, vergammelte Waffelreste unterm Beifahrersitz, Puderzucker in der Klimaanlage, Fingerabdrücke an den Heckscheiben.
Ich behaupte an dieser Stelle, mit der Geburt eines Kindes halbiert sich der Wiederverkaufswert eines Fahrzeugs mit sofortiger Wirkung. Mit jedem weiteren Kind nimmt der dramatische Werteverfall exponentiell zu. Die Schwacke-Liste müsste dringend um die Zahl der ständig mitreisenden Kinder ergänzt werden. Bei Inseraten sollte neben dem Hinweis »Nichtraucherfahrzeug« auch der Hinweis »Nichtkinderfahrzeug« stehen. Oder – im Interesse der den Gebrauchtwagen verkaufenden Eltern – besser nicht. Ist ja nicht schön, wenn es heißt: »5.000 Euro würde ich Ihnen für den Wagen noch geben.« – »Toll, da werden sich auch die Kinder freuen!« – »Kinder?! Ich gebe Ihnen 500.«
Selbst 500 werde ich für meinen Wagen wohl kaum noch bekommen. Nicht nur, weil es drinnen haargenau so aussieht, wie oben beschrieben. Auf der linken hinteren Tür prangt zudem ein großes Quadrat, darin eine Art Pluszeichen. Allerfeinstes Scratching, gekonnt ausgeführt von meiner Jüngsten. Auf meine Frage, was sie denn mit dem Stein an der Autotür mache, antwortete sie, zu diesem Zeitpunkt noch sehr klein von Wuchs, laut und logisch: »Ein Fenster, ich kann doch sonst nichts sehen!«
6. GRUND
Weil Schnuller mehr Fluch als Segen sind
»Haben Sie denn keinen Schnuller?!«, blaffte uns der Sitznachbar auf der anderen Seite des Ganges kurz nach Start des Flugzeugs in den Urlaub an. – »Nein, wir haben keinen Schnuller«. Und so plärrte meine Jüngste munter weiter. Sie hatte Druck auf den Ohren und war wohl außerdem nicht ganz ausgeschlafen. Der Sitznachbar hatte auch keinen Schnuller, er hätte ihn gut gebrauchen können, um sich für die Zeit des Fluges zu beruhigen.
Ein bisschen angeschwindelt hatte ich den etwas gereizten Mitreisenden ja schon. Wir hatten zwar keinen Schnuller dabei, doch wir besaßen schon welche. Die aber lagen unausgepackt in irgendeiner Schublade oder waren als Kinderspielzeug in der Puppenecke im Einsatz. Es waren Präsente von Bekannten oder Verwandten, die offensichtlich der Überzeugung waren, dass ein Schnuller zur Grundausstattung eines jeden Kindes gehört. Oder es waren Geschenke zum puren Selbstschutz, überreicht mit den Worten: »Damit die Großen auch mal Ruhe haben.« Dahinter unausgesprochen der Gedanke: »Hier, schluck das, du kleiner Schreihals, und dann schön Schnauze halten!«
Die Schnullerfrage wird entweder heiß und kontrovers diskutiert oder gar nicht. Für viele Eltern nämlich ist der Schnuller so selbstverständlich wie vollgekackte Windeln. Meine beiden Mädels hatten nie Schnuller, weil wir nie den Eindruck hatten, dass sie danach geschrien haben. Die Große hatte keinen erhöhten oralen Beruhigungsbedarf, und die Kleine entschied sich schnell für die Alternative: Daumen rein und gut. Das wiederum brachte uns regelmäßig Rügen ein. Als die Kleine einmal zufrieden nuckelnd im Einkaufswagen saß, reagierte die junge Kassiererin entsetzt: »Die nuckelt ja am Daumen, Sie müssen der Schnuller geben!« Und ein befreundeter Fünffachvater warnte mich bereits vor den Spätfolgen: »Der Daumen wird schrumpelig und schief werden, außerdem kann man einen Schnuller später wegnehmen, beim Daumen aber brauchst du dann einen Seitenschneider.«
So standen wir also vor der Wahl, unsere Kinder mit Waffengewalt zum Schnullern zu zwingen, als gescheiterte Eltern Hand in Hand in den Starnberger See zu gehen oder mal nachzugucken, was die Nuckelforschung zu dem Thema sagt. Was wir da fanden, hat uns so beruhigt wie der Daumen meine Tochter, denn der Schnulli ist nicht unumstritten: Er zögert das Hungergefühl hinaus, sodass Säuglinge oft zu spät angelegt werden. Wenn sie dann angelegt werden, ist das Saugbedürfnis bereits befriedigt und die Brust wird nicht ausreichend stimuliert – es fließt zu wenig Milch. Doch es kommt noch härter, jetzt wird richtig scharf geschossen: Pilzbefall im Mund, Zahnfehlstellungen und eine mangelhafte Ausprägung der Muskulatur im Mundraum können Schnullerfolgen sein. Viele Kinder, so steht’s geschrieben, die später eine Behandlung bei einem Logopäden brauchen, bekamen als Baby einen Schnuller. Gibt’s überhaupt Argumente pro Schnulli? Logo! Ein krankes Kind, das von der Mutter getrennt ein paar Tage im Krankenhaus liegt, lässt sich mit einem Schnuller schonender beruhigen als mit Medikamenten. Genau so, also wie ein Medikament, sollten die Plastikdinger eingesetzt werden: bei Bedarf und temporär, nicht als Standardartikel im Dauersedierungseinsatz.
Ein paar der oben genannten Anti-Schnulli-Argumente lassen sich natürlich auch bestens gegen den Daumen verwenden. Die Sache mit der Hygiene ganz besonders. Ich möchte gar nicht wissen, welche Keime direkt und ohne Umwege vom Sandkasten via Daumen in den Mund wandern, wo sie sich wohlig vermehren. Und auch die Schneidezähne werden die Nuckelphase nicht ganz unbeschädigt überstehen, fürchte ich. Manchmal gelingt es, den Daumen rauszuziehen, wenn die Kleine bei der Gutenachtgeschichte weggeschlummert ist, aber kaum ziehe ich die Kinderzimmertür etwas zu laut ins Schloss, wandert der Daumen wieder zielsicher zu seinem Hauptwohnsitz. Ich könnte zwar im Internet aus alten Psychiatriebeständen Fixiergurte erwerben, aber dann steigt mir mein Freund Tom vom Jugendamt aufs Dach, mit dem ich doch viel lieber FC-Spiele gucken gehe.
Tom kann übrigens in einer 15-minütigen Halbzeitpause locker 111 Gründe aufzählen, Eltern das Sorgerecht wegzunehmen, aber das ist ein ganz anderes Kapitel als dieses hier, in dem es ja nur um die Schnullifrage geht.
7. GRUND
Weil Mutti die Bestie ist
Mama ist die Beste, während Mutti eine Bestie ist. So krass unterscheidet der Psychoanalytiker und Autor Torsten Milsch Mama von Mutti. Auch Vatis können ein Mutti-Typ sein, doch in der Regel sei es Mutti, die für Milsch trotz bester Absichten alles falsch mache am Kind. Eine Mutti ist für Milsch ein Mensch, der seine Egozentrik auf Kosten seines Umfelds auslebe, selbst wenn es die eigene Familie, die eigenen Kinder trifft. Muttis seien Machtmenschen, die unter dem Deckmäntelchen der Fürsorge und Liebe ihre Kinder dominieren und so eine eigenständige und gesunde Entwicklung verhindern. Der Mutti-Typ, so Milsch, entscheide ständig, was richtig sei fürs Kind, und was falsch. Kontrolliere die Hausaufgaben und Jackentaschen, bestimme, mit wem gespielt werden darf und mit wem nicht, greife massiv in die Freizeitgestaltung ein. Das Ergebnis seien Kinder, die zu unglücklichen und unselbstständigen Erwachsenen würden. Die sich nicht in andere Menschen einfühlen könnten, nicht einmal in sich selbst. »Sie haben keine emotionale Grundlage für ein zufriedenes und erfolgreiches Leben in Familie, Beruf und Gesellschaft«, so der Autor des Buchs Mutti ist die Best(i)e – Die heimliche Diktatur vieler Mütter in seinem Vorwort.8 Woher der Doktor das weiß? Aus 30 Jahren Praxis als Arzt und Psychoanalytiker und aus persönlicher Erfahrung, die sich liest wie ein böses Märchen der Gebrüder Grimm: Er selbst habe als kleines Kind eine liebevolle Mama gehabt, doch nach deren frühem Tod kam eine Stiefmutter ins Haus, die sich als absolutistische Herrscherin entpuppt habe. »Durch ihre Terrorherrschaft weiß ich heute, wie sich viele Kinder fühlen«, sagt Milsch. Er kenne sowohl die liebevoll zugewandte Mama als auch die oberflächlich lächelnde, aber innerlich kalte und gefühllose Mutti.
Woran aber erkennt man den Unterschied zwischen Mama und Mutti im Detail? Auch da gibt der Fachmann für Bestien Auskunft: Muttis würden gerne laut über ihr Schicksal klagen, sich zu Opfern stilisieren. Lieblingssatz: »Ich mach das doch alles nur für euch!« Muttis würden vor Publikum mit ihren Kindern in einer niedlichen Pseudo-Kindersprache reden, den Tonfall aber auf der Stelle ändern, wenn das Publikum weg sei. Muttis würden für ihre Kinder antworten, selbst wenn die das ohne Weiteres selbst könnten. Hardcore-Muttis antworten sogar für ihre Männer. Weitere Mutti-Merkmale laut Milsch: Ständig würden sie Essbares bereitstellen, um Fürsorge vorzutäuschen und gleichzeitig Dankbarkeit zu sichern. Ob das Kind überhaupt Hunger habe, spiele dabei gar keine Rolle. Muttis lauern auf Fehler, um sagen zu dürfen: »Dann muss ich das wohl wieder machen, wenn ihr das nicht könnt.« Nicht zuletzt kutschieren Muttis ihre Kinder überallhin. Der Aufkleber »Muttis Taxi« hinten am Auto zeigt allen, wie sehr man sich sorge und mühe, doch tatsächlich gehe es darum, das Kind zu kontrollieren und abhängig zu machen. »Wir haben zu wenig Mamas, die ihre Kinder lieben, fördern und sich über ihre Entwicklung freuen«, lautet das Fazit von Torsten Milsch, »und zu viele Muttis, die vor allem sich selbst lieben und ihre Kinder benutzen, um sozial mächtig zu bleiben.« Wer Milschs Meinung teilt, kann ja schon mal anfangen, den »Taxi«-Aufkleber von Muttis Auto zu kratzen. Oder überkleben mit: »111 Gründe, Mutti in den Orkus zu jagen!«
8. GRUND
Weil Schuhe drücken
Was ist anfangs süß und später stinkt’s? Richtig, Füße. Könnten Babyfüße noch glatt mit Marzipanschweinchen verwechselt werden, rosa, wohlriechend und lecker, so weiß man spätestens nach der ersten Turnstunde, dass sich mit Füßen auch vortrefflich Fliegen anlocken lassen. Und früher oder später ist auch nur noch ein Bruchteil der Füße der Welt ansehnlich, die meisten sind verformt, von Hühneraugen und Überbeinen grotesk entstellt, von jahrelangem Rumstehen plattgetreten und vom vielen Laufen in falschen Schuhen für alle Zeiten deformiert. Das mit den falschen Schuhen – jeder Mann, der einmal High Heels angelegt hat, weiß, was falsche Schuhe sind, und jede Frau, die bei der Arbeit Gummistiefel tragen muss, auch – ist bereits für die Eltern von frisch entschlüpften Kindchen ein ganz großes Thema. Welche Schuhe sind für Kleinkinder richtig? Und ab wann? In der Hoffnung, dass Lauflernschuhe nicht nur so heißen, sondern das Laufenlernen massiv beschleunigen, bekommen bisweilen Kinder ihr erstes Paar, die noch nicht einmal formvollendet krabbeln können. Dabei warnt die Fußforschung bereits seit Jahren: Der beste Schuh für die ersten Schritte ist der eigene, also der blanke Fuß, nackt wie der Herr ihn schuf. Zwei Argumente: Zahllose Nerven im Fuß ertasten den Untergrund, erlernen im unmittelbaren Bodenkontakt den besten Halt. Noch überzeugender für mich: Keine Schuhe kosten nix! Eltern, die bereits frösteln, sobald die Abendsonne hinter der Hecke verschwindet, werden auf schlimme Erkältungsrisiken der Kleinen hinweisen, auf drohende Triefnasen und rasselnde Lungen. Doch dafür gibt’s ja Rutschsocken, diese fetten Wollteile mit Gummibremsen auf der Unterseite. Damit sind immer noch Bodenkontakt und Bewegungsfreiheit gegeben, wenn auch nicht ganz so intensiv wie bei unten ohne. Rutschsocken sind natürlich auch teurer als nackte Füße!
Ich höre bereits die Schuhfetischisten drängeln: Wann ist es denn endlich an der Zeit für das erste richtige Paar Schuhe? Die Fußforschung sagt: sobald das Kind das Haus verlassen möchte. Draußen auf Straßen und Wegen, auf Weiden und im Wald sind Schühchen eine feine Sache. Wenn sie passen. Blöd am Kleinkind im Schuhgeschäft: Es rollt gerne die Zehen ein, und mit eingerollten Zehen passt der Fuß auch in viel zu kleine Schuhe. Mit verkrüppelten Füßen kann man zwar immer noch Geisha werden, aber Spaß macht’s nicht. Wieder kennt die Fußforschung einen duften Kniff: Stellen Sie Ihr Kind am Nachmittag auf ein Stück Pappe, achten Sie darauf, dass die Zehen ausgestreckt sind, zeichnen Sie die Umrisse ab, Schere, fertig ist eine astreine Schablone für den optimalen Schuh. Warum nachmittags? Weil dann der Fuß gemeinhin am breitesten ist. Kinderfüße sehen wie gesagt nicht allzu lange aus wie Marzipanschweinchen, sie wachsen zügig. Deshalb sollte die Fußschablone auch alle drei Monate an den Fuß gehalten und gegebenenfalls ersetzt werden – durch eine neue und hoffentlich nicht quadratische.
Anders als Schuhhändler, die natürlich ordentlich Neuware an den kleinen Mann bringen wollen, haben Orthopäden nichts gegen gebrauchte Schuhe. Es sei denn, vorne grüßen schon die Zehen oder die Sohle weist walnussgroße Löcher auf. Wenn sie aber in Ordnung sind, dann ist ein bereits eingelaufener Schuh oft angenehmer als ein fabrikneuer. Das weiß jeder, der einmal heulend in seinen brandneuen Bergsteigerstiefeln auf einem Felsen in 1.300 Metern Höhe saß – und diese 1.300 Meter auch wieder runter musste.
9. GRUND
Weil sie kosten, bevor sie da sind
Sie ziehen einem bereits die Kohle aus der Tasche, da sind sie noch gar nicht da! Kaum zeigt das erste unscharfe Ultraschallbild ein heranziehendes Azorentief, da wird im Schweinsgalopp für ein Vermögen die Erstausstattung zusammengekauft. Hieß es nicht immer, dass wir die Erstausstattung aus dem Freundeskreis bekommen? Von den vielen Freundinnen und Bekannten, deren Brut bereits aus der kleinsten Strampler-Generation (XXXXXXS) rausgewachsen ist? Gebraucht, getragen, mit hellbraunen Schattierungen im Windelbereich, aber umsonst? Es wurde doch immer auch schwer ökologisch für eine gebrauchte Erstausstattung argumentiert: »Wenn wir gebrauchte Sachen nehmen, sind die Giftstoffe bereits komplett aus der Kleidung rausgewaschen, ist doch super, oder?!« Armer Vorbesitzer, der muss ja völlig vergiftet sein, wenn die Neuware so hochgradig toxisch war, vergiftet durch die Farben und Weißmacher der Bekleidungsindustrie, die ja nichts lieber macht, als ihre Neukunden mittelfristig umzubringen. Macht ja wirtschaftlich Sinn! Aber woher dieser plötzliche Sinneswandel bei uns? Eben noch waren gebrauchte Klamotten das Nonplusultra, jetzt werden überteuerte Boutiquen mit Namen wie »Pusteblume«, »Maja’s Lädchen«, »Das blaue Kind« oder »Design for Däumling« leer geshoppt und die Kreditkarte gleich mit.
Pränatal erworbene Neuware, heißt es plötzlich, sei etwas Besonderes, Einzigartiges. Soll ja keiner sagen: »Die Mütze hab ich doch schon mal gesehen, genau so eine, nur nicht so hässlich ausgebleicht …« Jaja, müsste man dann antworten, die haben wir günstig von Laras Mutter bekommen, davor trug sie Peter. Deshalb also wird nun doch gegen alle Abmachungen Neuware gekauft. Um die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes zu unterstreichen. »Dieser irre schicke Body ist ein absolutes Unikat, den gibt es in der ganzen Stadt nur viertausendmal!«
Wer in solchen Momenten jämmerlich einknickt (so wie ich), der muss sich nicht wundern, wenn im zweiten Monat der Schwangerschaft bereits hochglänzende Kataloge auf dem Küchentisch liegen, aufgeschlagen die Seiten mit Kinder- und Jugendzimmern, mit Kindersitzen fürs Auto und fürs Fahrrad, Wickelkommoden, einem Babyfon in NASA-Qualität. »Wir haben doch das alte Teil von deinem Bruder bekommen, warum denn jetzt ein neues?!« – »Ich trau dem alten Ding nicht, wenn es nicht funktioniert, stranguliert sich das Baby, ich vertrau lieber dem Testsieger, der ist auch gerade auf 400 Euro runtergesetzt worden …« Und das ist noch günstig im Vergleich zu den Pflegeprodukten, die bereits auf der Wickelkommode auf ihren Einsatz am wunden Hintern warten. Feuchttücher mit Melonenduft, mit Aloe Vera, mit und ohne Alkohol, mit dem Besten aus 200 Millilitern handgeschöpfter Bergziegenmilch, mit Anti-Aging-Emulsionen …
Kindergeld gibt’s erst ab Geburt, bis dahin steht der Embryo aber schon so was von in der Kreide bei mir! »Na gut, vielleicht erscheint dir das jetzt alles etwas teuer«, werde ich beschwichtigt, als ich im fünften Kinderladen dicke Tränen in meine leere Geldbörse weine, »aber dafür bekommst du doch auch so viel zurück!« Das stimmt, nur leider keine Kohle.
10. GRUND
Weil man(n) zur falschen Zeit am falschen Ort ist
Zu den Orten, die man als Mann als geprügelter Hund verlässt, gehören Damentoiletten, Lesbenbars und der Kreißsaal. Den versehentlichen Eintritt in ein gut besuchtes Frauenklo bemerkt Mann recht schnell, und noch bevor sich Lidstrich nachziehende Damen vom Spiegel abwenden und mit Lippenstiften werfen, ist man auch schon wieder draußen. Die verschämt ausgesprochene Entschuldigung dringt kaum durch die wieder geschlossene Klotür. Bis zur Korrektur des Besuchs einer Lesbenbar kann es länger dauern. Während einer Frauenfußballweltmeisterschaft unterlief mir einst dieser Fauxpas – als ich während einer Radtour in eine mir unbekannte Bar einkehrte, um ein Spiel zu sehen. Erster Gedanke nach Eintritt: »Toll! Nur Frauen hier!« Meine Gesichtsbegeisterung blieb leider komplett unerwidert. Stattdessen Blicke, die mir signalisierten, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Als ich realisierte, was genau mit mir nicht stimmt, trank ich schnell, aber nicht zu schnell aus – um noch einen Hauch von Restwürde zu bewahren. Dann saß ich auch schon wieder auf dem Rad und radelte Richtung Horizont. Bis heute weiß ich nicht, wie das Spiel endete.
Doch auf keiner Damentoilette und in keiner Lesbenbar dieser Welt fühlt man sich als Mann so deplatziert wie im Kreißsaal. Da kann man vorher noch so viele Geburtsvorbereitungskurse besucht haben. Egal wie solidarisch und synchron in den Kursen mit der schwangeren Partnerin gehechelt wurde, wenn es dann endlich ernst wird, dann vergiss alles, was du in den Kursen gelernt hast! Vergiss auch deine Opferbereitschaft, mit der du auf Skatabende mit deinen besten Freunden in den schönsten Kneipen verzichtet hast, um mit maximal einem weiteren werdenden Vater auf dem Boden im Kursraum zu hocken und Beckenbodenübungen zu praktizieren. Es wird dir nicht helfen! Und auch wenn (fast) jede Mutter später betont, wie wahnsinnig wichtig ihr die Kreißsaalpräsenz des Kinderzeugers war, in den entscheidenden Stunden bist du neben Mutter, Arzt, Hebamme und dem sich ans Licht wühlenden Zwerg das fünfte Rad am Wagen. Deine Frau wird »Nimm meine Hand!« rufen, um sie gleich wieder wegzustoßen und sofort wieder anzufordern. Du spielst Arzt und Hebamme für Arme und flüsterst zaghaft »Pressen, Schatz«, und erntest ein wütendes »Mach doch selbst!«.
Ein Segen des neuzeitlichen Geburtsprozesses ist die PDA. Die sogenannte Periduralanästhesie wirkt für die Gebärende schmerzlindernd und für alle anderen Beteiligten im Kreißsaal deeskalierend. Kaum war meine Frau nach der Rückenmarkspritze und dem Einsetzen der Wirkung ein wenig sediert, schlief ich auch schon auf meinem Stuhl ein. Das war auch gut so, denn wenig später ging es wieder ans Werk. Halbwegs ausgeruht und wieder bei Kräften, ging ich auf ein Neues meiner sinnlosen Assistententätigkeit nach. Erst als dann der letzte Schrei der Mutter ver- und der erste meines Kindes erklang, war ich so weit durch diese Eindrücke verwirrt, dass ich sagen konnte: »Schön war’s doch!« Das behaupte ich natürlich heute noch.
11. GRUND
Weil früher alles besser war
Was früher besser war als heute? Es gab keine Kinder! Kinder, wie wir sie kennen, gibt es erst seit 200 Jahren. Das wussten Sie nicht? Ich auch nicht, doch dann musste ich lesen, dass Kinder im 19. Jahrhundert erfunden wurden. Gab’s vorher etwa keine? Wurden Menschen als Erwachsene geboren? Arme Gebärende, möchte man seufzen, keine schöne Vorstellung, selbst wenn die Menschen früher kleiner waren, wovon sich jeder überzeugen konnte, der je in einem mittelalterlichen Wohnhaus mit der Stirn am Querbalken des Türrahmens hängen blieb.
Im Grunde war es aber tatsächlich so; bis weit ins 19. Jahrhundert waren Kinder keine Individuen, sondern schlichtweg zu kleine Erwachsene. Sie hatten die ersten acht oder zehn Jahre keinen Wert an sich. Allemal als Arbeitstiere der Zukunft, und arbeiten durften Kinder früh.
Auf ganz alten Gemälden finden Kinder gar nicht erst statt, wenn überhaupt, dann als Jesuskind oder Engelsgestalten. Kaum auf der Welt, wurden die Säuglinge von oben bis unten bandagiert; wenn sie brüllten, gab’s keinen Schnuller oder eine Runde mit dem Kinderwagen über die Felder, sondern Schnaps und Mohn. Dann waren die Kindchen schön ruhig und schauten mehr oder weniger selig in die Welt. Heute weiß man, dass weder Hafer noch Kinder schneller wachsen, wenn man dran zieht, im Mittelalter hatten die Menschen diesen Glauben. Ihre Kinder konnten noch nicht stehen, da wurden sie in Laufgitter geschnallt. Bewegen konnten sie sich darin nicht, sie sollten aber gefälligst auf eigenen Beinen stehen. Das ruinierte früh die Knochen und Gelenke, aber gegen den Schmerz halfen ja wiederum Schnaps und Mohn.
Weil wegen der katastrophalen hygienischen Bedingungen und des Fehlens einer medizinischen Versorgung im heutigen Sinne die Kinder wie die Fliegen starben, bekamen oft mehrere Geschwisterkinder denselben Namen, in der Regel den Namen der Eltern. Wenn dann ein Hans starb, waren vielleicht noch ein paar Hans in Reserve. Auch weil diese Zeiten so hart und brutal waren, waren innige Liebesbeziehungen zu Kindern die Ausnahme. Lieber gingen die Eltern auf Distanz, das machte den Verlust eines Kindes erträglicher.
Unterrichtet wurden nur die Kinder des Adels, die einfache Landbevölkerung zeigte bereits ihrem achtjährigen Nachwuchs, wie auf den Feldern geerntet wird. Im 18. Jahrhundert gab es zwar erste Volksschulen, auch für die Landbevölkerung. Doch nicht alle Eltern sahen den Nutzen von Lesen, Schreiben und Rechnen, solange die Heuernte wartete. Auf die Mädchen wartete zudem die Ehe; Kinderehen waren nicht selten, und verheiratete Mädchen mussten nicht mehr in die Schule, durften sogar nicht mehr: Eine verheiratete Frau braucht schließlich nicht mehr zu wissen, als dass sie ihrem Mann zu dienen hat. Mit der Industrialisierung wurde es für Kinder erst einmal noch schlechter. Weil jetzt auch die Mütter in den Fabriken arbeiten mussten, damit die Familie halbwegs über die Runden kam, gab’s überhaupt keine Betreuung mehr – die Kinder wurden daheim eingeschlossen oder angebunden. »Erfunden« wurde die Kindheit, wie wir sie erlebt haben und unser Nachwuchs sie erleben darf, in der Aufklärung. Als Erfinder gilt der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der als Erster die revolutionäre Idee hatte, dass Kinder nicht nur dem Erhalt der Familie zu dienen und nützlich zu sein haben, sondern das Recht auf ein eigenes Leben in der Kindheit. Émile heißt die Titelfigur seines großen Romans,9 Émile darf Dinge tun, die ein Junge nie zuvor tun durfte: toben, spielen, Kind sein. »Die Natur will, dass die Kinder Kinder sein sollen«, ist Rousseaus Überzeugung, von der seine eigenen fünf Kinder leider nicht profitieren: Gleich nach Geburt gab er sie jeweils ins Findelhaus. Vielleicht hatte er Sorge, dass der Lärm der Kindheit – seiner Erfindung – ihn beim Dichten stören könnte. Kann ja auch jeder nachvollziehen, dem bei einem wichtigen Telefonat mit dem Chef mal die Kinder mit Indianergeheul durchs Arbeitszimmer gesprungen sind.
2
DIE WEHEN MACHEN JA NOCH SPASS
12. GRUND
Weil Kinderkrankheiten die Pest sind
Lieben Sie diese Ranking-Shows? »Die 100 nervigsten Promis« oder »Die 1.000 überflüssigsten Schlager« oder »Die 111 besten Gründe, Kinder auf den Mond zu schießen«. Fast jedes Feld ist inzwischen in so einer Show beackert worden. Die witzigsten Versprecher, die blödesten Behörden, die ulkigsten Todesursachen. Was ich aber noch nicht im Fernsehen gesehen habe, obwohl sie eine eigene Show verdient hätten, sind Kinderkrankheiten. Schließlich gehen Kinderkrankheiten jeden etwas an, vor allem Eltern. Die ja besonders viel fernsehen, weil sie abends nur in Ausnahmefällen ausgehen können, somit eine hervorragende Einschaltquote garantieren, wenn es um ihre Themen geht. Super Idee also in jeder Hinsicht, ich hätte gerne jetzt schon einen Bambi.