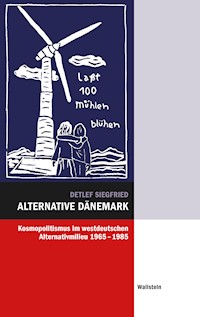8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Hinter der Zeitenwende von 1968 steckt mehr als nur eine politische Revolte: Männer ließen sich die Haare lang wachsen, Frauen wollten endlich die Pille nehmen dürfen, Drogen wurden konsumiert, Musikfestivals, Kommunen und neue Zeitschriften stellten das vorhandene Weltbild auf den Kopf. So unterschiedliche Heldenfiguren wie Twiggy, Rudi Dutschke, Che Guevara, Jimi Hendrix und Mao Tse-Tung traten auf den Plan, während die deutsche Politik noch mit dem Vermächtnis der NS-Zeit zu kämpfen hatte. Es wäre jedoch ein Irrtum zu glauben, alles habe erst 1968 begonnen. Detlef Siegfried zeigt, welche gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Ereignisse schon im Vorfeld nötig waren, damit die Revolte der Schüler, Studenten und Lehrlinge Fahrt aufnehmen konnte. Dabei lässt er nicht nur die Gegenkultur in Großstädten wie Berlin oder Frankfurt am Main wieder aufleben, sondern rückt auch Schauplätze aus der bundesrepublikanischen Provinz ins Rampenlicht. Doch wie viel revolutionäre Dynamik ließ sich in die "roten" Siebzigerjahre hinüberretten? Und was wurde eigentlich aus all den Linken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Detlef Siegfried
1968 in der Bundesrepublik
Protest, Revolte, Gegenkultur
Mit 60 Abbildungen
Reclam
2018 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Coverabbildung: picture alliance / dpa Bild Nr. 66934986
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961307-9
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011149-9
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Blickt man auf die Geschichte der Bundesrepublik, dann fallen bestimmte Grundmuster in der Interpretation von »1968« auf. 1. Es wird als Endpunkt und gleichzeitig als Neubeginn betrachtet – als ultimativer Schlussstrich unter die vermeintlich konservativ-traditionalistisch geprägten Jahre zuvor und als Beginn einer »Fundamentalliberalisierung« der westdeutschen Gesellschaft. Als tiefste Zäsur in der Geschichte der ›alten‹ Bundesrepublik dient »1968« zur Positionierung; es bezeichnet politische Grundhaltungen bis in die Gegenwart hinein.
2. »1968« wird hierzulande oftmals als spezifisch deutsche Geschichte beschrieben, die vor allem durch das »Dritte Reich« und einen von dort her bestimmten Generationskonflikt geradezu determiniert gewesen sei. Es wird als Befreiungsgeschichte der Jüngeren gegenüber den NS-infizierten Älteren erzählt, oder man vermutet eine heimliche NS-Kontinuität, die sich hinter der lautstarken Distanzierung der »68er-Generation« von ihren Eltern verbarg: Bücher wie Hitler’s Children (1977) und Unser Kampf (2008) haben diese These immer wieder reproduziert. Verstärkt wurde der nationale Fokus nach der deutschen Wiedervereinigung, als man sich für Einflussnahmen durch die DDR zu interessieren begann und aus den Jahren der Revolte »unsere unterwanderten Jahre« hat werden lassen.1
3. Vor diesen Hintergründen ist die Geschichte von »1968« in erster Linie als politische Geschichte verstanden worden, als Geschichte eines Wandels in der politischen Kultur und als Beginn der Radikalisierung in den 1970er Jahren. Extensive Terrorismusdebatten und Selbstkasteiungen früherer Akteure haben die Wahrnehmung der deutschen Öffentlichkeit verengt, die sich auf die radikalsten Zerfallsprodukte von 1968 konzentriert hat und in einem auffälligen Missverhältnis zum mittlerweile differenzierten Forschungsstand steht.
In den vergangenen Jahren hat sich die Geschichtswissenschaft stärker als zuvor mit kulturellen Aspekten beschäftigt und damit vorherrschende politik- und sozialgeschichtliche Perspektiven auf die Geschichte der Bundesrepublik neu gewichtet. Gerade unter Einbeziehung ›weicher‹ Faktoren der Kultur ist der übergeordnete Befund einer »Liberalisierung« der Bundesrepublik in den 1960er Jahren kaum überraschend.2 Dabei erfolgten die Demokratisierungs- und Liberalisierungsschübe der 1960er Jahre in den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren keineswegs simultan oder in gleichmäßiger Intensität. Vor manchen Institutionen, nicht zuletzt vor der »hohen Beamten- und Richterschaft«, machten sie »zunächst Halt«.3 Auch wurden sie in späteren Phasen teilweise wieder zurückgenommen. Gerade die jüngsten Forschungen zum westdeutschen Staatsschutz oder zur NS-Vergangenheit von Ministerien, Politik und Wirtschaft machen deutlich: Es mangelt nicht an dunklen, genauer: braunen Aspekten dieser Geschichte. Eine abgewogene Darstellung von »1968« kann die Vergangenheitsbindungen kaum umgehen, denn vor ihrem Hintergrund wird die spezifische Gestalt der Revolte in der Bundesrepublik teilweise erst verständlich.4
In der Wahrnehmung konservativer Gegner wie ehemaliger 68er schnurren die vielfältigen Wandlungsprozesse, die sich in den langen 1960er Jahren vollzogen haben, oftmals auf den Begriff »1968« zusammen. Er eignet sich als rechtes Feindbild, etwa für den AfD-Mann Jörg Meuthen, der jüngst bekundete, er wolle »weg vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll haben«.5 Aber auch aus entgegengesetzter Perspektive werden die Umbrüche der 1960er Jahre in dieser einen Zahl zusammengezogen. Barbara Sichtermann etwa assoziierte mit ihr: »Schluss mit dem Vietnamkrieg; besser spät als nie vor Gericht mit Altnazis und Kollaborateuren; im sozialen Leben Mitsprache und Kritik statt autoritärer Anordnungen; Transparenz, Durchlässigkeit und Umsturz von Hierarchien – Bosse sollten gewählt und absetzbar sein –; Radikalisierung der Demokratie« – und vieles mehr.6 Inzwischen wissen wir, dass nicht die 68er die ersten Altnazis vor Gericht brachten, sondern ältere Reformer aus der sogenannten 45er-Generation, dass Unterordnung schon einige Jahre zuvor in weiten Teilen der Gesellschaft in Misskredit gekommen war und dass eine sexuelle Liberalisierung bereits seit längerem in der Luft lag. Insofern waren die 68er weniger die Auslöser der von Sichtermann genannten Tendenzen, vielmehr bauten sie auf ihnen auf, politisierten und radikalisierten sie. Gleichwohl ist symptomatisch, dass erst die radikale Überspitzung derartiger Wandlungstendenzen durch »1968« den hohen Symbolgehalt dieses Datums erzeugt hat. Natürlich sind seine Bewertungen immer auch von Gegenwartsinteressen und Zukunftserwartungen bestimmt, geht es doch um die Legitimität bzw. Delegitimierung radikaler Neuordnungsvorstellungen.
Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über »1968« in der Bundesrepublik aus drei Perspektiven. Erstens werden gegenüber dem meist im Vordergrund stehenden politischen Aspekt die kulturellen Seiten von »1968« stärker gewichtet. Zweitens wird »1968« in einem weiteren zeitlichen Kontext verortet, der von etwa 1958 bis 1973 reicht. Und drittens wird die Geschichte der Jugendrevolte der BRD in ihren internationalen Bezugsrahmen eingebettet, also als Teil der europäischen und der Globalgeschichte von »1968« erzählt.
Seit der vor etwa zwanzig Jahren begonnenen Historisierung der langen 1960er Jahre wissen wir sehr viel mehr sowohl über die westdeutsche Gesellschaft als auch über »1968«, sodass eine Zwischenbilanz sinnvoll erscheint, um das Verhältnis von gesellschaftlichem Wandel und Revolte genauer zu bestimmen: Wie verhielt sich die Jugendrevolte zu der schon im Umbruch befindlichen Gesellschaft? Wo initiierte sie Neues, und inwiefern setzten ihre Neuerungen bei schon in Gang befindlichen Transformationen an? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, weil Ursache und Wirkung einander im Einzelnen schwer zuzuordnen sind, zumal »1968« sich kaum von den langen 1960er Jahren lösen und isoliert betrachten lässt. Schnell zeigt sich, dass es unmöglich ist, »1968« auf ein einziges Jahr zu begrenzen, das angeblich »alles verändert hat«.7 Dass es nicht aus dem Nichts kam, sondern eine längere Vorgeschichte hatte, versteht sich eigentlich von selbst. Wollte man einen zeitlichen Kern von »1968« ausmachen, dann müssten es, fließende Übergänge vorausgesetzt, die Jahre 1967 bis 1969 sein. Diese Hochzeit des Zusammenfalls von politischem Protest und lebensweltlichem Umbruch umfasst drei bis fünf Jahre, weshalb eigentlich ein Begriff passender wäre, der »1968« in den Plural setzt, so wie es im Französischen mit der Bezeichnung les années 68 der Fall ist.
Kritische Ereignisse trieben die innere Dynamik der Revolte voran. Der Tod Benno Ohnesorgs durch eine Polizeikugel am 2. Juni 1967 führte erst dazu, dass sich die Studentenbewegung von wenigen zentralen Orten – allen voran Westberlin – auf nahezu alle Hochschulen des Landes ausweitete. Gleichzeitig bildeten politische Reformideen zusammen mit Lebensstilexperimenten ein großes gegenkulturelles Gemisch, das nicht nur Studierende interessierte. Ihren bündigen Ausdruck fand diese Fusion in den Internationalen Essener Songtagen vom 25. bis 29. September 1968. Und schließlich leiteten die Radikalisierung nach dem Attentat auf Rudi Dutschke vom Gründonnerstag 1968 und die Verabschiedung der Notstandsgesetze im Deutschen Bundestag am 30. Mai 1968 eine Phase der Neuformierung ein, in der die politische Bewegung in eine Vielzahl kleiner, sich bekämpfender Gruppen zerfiel, wohingegen das kulturell und politisch geprägte linke Milieu sich verbreiterte. Aber die Hoffnung auf einen großen gesellschaftlichen Umschlag, die Wahrnehmung der Akteure, dass eine Richtungsentscheidung bevorstehe, deren Ausgang nur vom Willen des Einzelnen abhänge, ist nicht zu erklären ohne den Kontext – den schnellen Wandel der Gesellschaft auf vielen Gebieten.
»1968« – in dieser Chiffre verdichten sich also Entwicklungen, die bereits lange zuvor begannen, weit darüber hinaus ausstrahlten und mehrdeutiger waren, als das Label vermuten lässt. »1968« ist daher keine klar definierbare Kategorie, sondern eher eine Unschärfeformel zur Vereinheitlichung eines schwer fassbaren Ganzen. Das macht es schwer, die Grenzen genau zu bestimmen: Was war allgemeiner Umbruch, was bereits »1968«? Doch gerade von dieser Unbestimmtheit her rührt die suggestive Kraft der Chiffre, denn so lässt sich je nach Bedarf alles Mögliche hineinprojizieren, was irgendwie mit grundlegendem kulturellem und politischem Wandel assoziiert wird und bestätigend oder ablehnend aufgerufen werden soll. Gerade wegen seiner unscharfen Ränder und seiner Deutungsoffenheit bleibt »1968« ein Gegenstand, der sich so schnell nicht erschöpfen wird – je nach den Zeitumständen lässt er sich immer neu interpretieren. Längst beschränken sich daher Untersuchungen zu »1968« nicht mehr nur auf das Geschehene, sondern beziehen die Wandlungen ein, die seine Deutung in den vergangenen fünfzig Jahren durchlaufen hat.8 Da sie sich in keiner Weise auf dieses eine Jahr eingrenzen lässt und mehr meint als nur eine Zeiteinheit, müsste die Jahreszahl eigentlich immer in Anführungszeichen geschrieben werden – wie ich es bisher getan habe. Aber meine Position dazu dürfte inzwischen klar geworden sein, sodass ich von nun an darauf verzichte.
Die Vieldeutigkeit des Gegenstands hat auch zur Folge, dass er auf sehr unterschiedliche Weise beschrieben werden kann. Oftmals beschränkt sich die Darstellung auf die politischen Aktivitäten der Außerparlamentarischen Opposition, Ideologie und Strategie des SDS, hinzu kommen vielleicht noch die Reaktionen des »Establishments«. Das kann damit zu tun haben, dass 1968 in der Bundesrepublik tatsächlich politischer war als in den USA, Großbritannien oder Dänemark, weshalb selbst in der radikalen Negation ein Abglanz nationaler Besonderheit sichtbar bleibt. Andererseits fragt der Literaturwissenschaftler und damalige Aktivist Helmut Lethen: »Bildeten die politischen Theorien des Umsturzes nicht nur das Treibholz auf einer Strömung, die von der Musik und den Lebensstilexperimenten ausging, die die Straßen zu Räumen machte, die sich zur Republik öffneten?«9 Zu Recht wird die lange vorherrschende politische Lesart von 1968 inzwischen immer mehr in Frage gestellt. Stattdessen werden jene Faktoren einbezogen, die jenseits der vordergründig politischen Sphäre seine Tiefenwirkung bestimmten. Durch Popmusik zum Beispiel konnten sich Individuen mit dem Fortschritt assoziieren, ohne das geringste Interesse an Politik zu haben – was auf einen komplexeren Zusammenhang von Kultur und Politik verweist. Lebensstil und kulturelle Präferenzen, nicht zuletzt die Konsumkultur, spielen in meinem Blick auf 1968 eine wichtige Rolle. Indem ich sie zu den politischen Protesten in Beziehung setze, entsteht ein vielschichtiges Bild, das die zeittypische Verschmelzung von Kultur und Politik hervorhebt.
Oft hat man versucht, das Phänomen 1968 mit handfesteren Kategorien zu beschreiben. Dabei scheint mir die Rede von der »Revolte« am treffendsten zu sein, weil sie die wichtigste Intention der Akteure aufgreift, nämlich gegen das Bestehende aufzubegehren und Raum für die eigenen Präferenzen zu schaffen, gleichzeitig das Impulsive betonend. Der Begriff »antiautoritäre Revolte« fügt dem eine inhaltliche Einstellung gegen Staat und Macht hinzu, die in weiten Teilen zutrifft, aber unterschlägt, dass an die Stelle alter oftmals neue Autoritäten gesetzt wurden.10 Außerdem hat er einen euphorischen Beiklang, den ich gern vermeiden möchte. Sehr viel besser geeignet scheint mir der deskriptive, nicht wertende und schon zeitgenössisch verwendete Begriff der »Jugendrevolte«, der die hauptsächlichen Akteure ins Zentrum stellt.11 Mit diesem Ausdruck wird die Betrachtung nicht auf die Studentenbewegung begrenzt, sondern der Blick über die im Kern politische Dimension eines Elitenphänomens hinaus geweitet und das kulturelle Element verstärkt.
Zeitgenössisch ebenfalls viel gebraucht waren Bezeichnungen, die den von oppositionellen Jugendlichen gebildeten politisch-kulturellen Raum als »Untergrund« (bzw. in der Adaption aus den USA »Underground«) oder »Gegenkultur« (»Counterculture«) beschrieben. Zwar sind diese Bezeichnungen an die These gebunden, dass es sich dabei um eine Absonderung von einer »kompakten Majorität« handelte, wie Rolf Schwendter es nannte (ich würde beides als fließende Größen betrachten und die Verbindungen zwischen ihnen hervorheben), aber die Begriffe sind insofern treffend, als sie immer Politik und Kultur gleichzeitig meinen und damit die Fusion der beiden Sphären hervorheben, die für 1968 so kennzeichnend war. Nicht zeitgenössisch, sondern erst im Nachhinein wurden Kategorien wie »68er-Bewegung« oder »68er-Generation« gebildet, wobei letztere ursprünglich eine Selbstbezeichnung der Aktivisten war, die der eigenen Altersgruppe eine Sonderstellung für die Geschichte der Bundesrepublik zuschreibt und seit langem populär ist, aber problematisch bleibt.
Der Begriff der »68er-Bewegung« kommt aus der Forschung zu sozialen Bewegungen und geht davon aus, dass die Ideen einiger Vordenker der Neuen Linken über Avantgardegruppierungen verbreitet und von einer größeren Masse zumindest teilweise umgesetzt worden seien.12 Diese Sichtweise blendet allerdings Faktoren aus, die für meine Fragestellung wesentlich sind, insbesondere die sozialen Differenzierungsprozesse, die überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schufen, dass eventuell eine Idee zur materiellen Gewalt werden konnte, aber auch den kulturellen Aspekt des Milieus, die Entstehung und Ausformung konsumistischer Massenkulturen und der »Counterculture«. Hier stößt das theoretische Konzept der »Bewegung« an seine Grenzen, denn noch viel schwieriger als bei unmittelbar politischen Fragen ist zu bestimmen, inwieweit die vielfältigen Alltagspraktiken hunderttausender Akteure überhaupt auf die Ideen einzelner Vordenker oder Avantgardegruppen zurückgeführt werden können. Die hier kurz diskutierten Begriffe werde ich im Folgenden nicht dogmatisch benutzen bzw. ausgrenzen, sondern jene wählen, die mir jeweils am passendsten erscheinen.
In gewisser Weise ist dieses Buch ein Kondensat meiner bisherigen Forschungen zu diesem Thema, aber mehr noch Teil einer unabgeschlossenen Arbeit, die frühere Erkenntnisse aufgreift, weiterführt, teilweise modifiziert und ergänzt um Tiefenlotungen in Feldern, die ich noch nicht intensiver bearbeitet hatte.13 Ich danke den Mitarbeitern der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, die mir Gelegenheit gaben, Teile des Textes in ihrem Kolloquium zu diskutieren, sowie Knud Andresen, Kirsten Heinsohn, Sebastian Justke und Lu Seegers für die kritische Durchsicht einzelner Kapitel. Ohne den Anstoß von Jan Dressler wäre es nicht zu diesem Buch gekommen. Ihm bin ich ebenso verbunden wie Christina Müller, von deren gewissenhaftem Lektorat das Manuskript enorm profitiert hat.
Die langen 1960er Jahre. Eine Gesellschaft im Umbruch
1968 ist nicht denkbar ohne den Kontext der langen 1960er Jahre zwischen etwa 1958 und 1973, jener »fetten Jahre« zwischen Wirtschaftswunder und Ölkrise, in denen sich eine moderne Lebensweise durchsetzte.1 Die Jugendrevolte war selbst Ergebnis und Zuspitzung eines länger andauernden Wandels, der seit den späten 1950er Jahren immer sichtbarer geworden war und sich seit der Mitte der 1960er Jahre mit schubartiger Dynamik vollzog.2 Dass er mit heftigen Konfrontationen einherging, zeigt, wie umstritten manches daran war. Nicht nur in der Bundesrepublik ist dieser Wandel beobachtet worden. Mit Begriffen wie »Postmoderne«, »reflexive Moderne« oder »Erlebnisgesellschaft« versuchen Soziologen ein ganzes Bündel von Erscheinungen zu fassen: die Ausdehnung des Konsums und die Medialisierung, die die sozialen Unterschiede verfeinerten; die Erosion der traditionellen Sozialmilieus, der eine Lockerung kultureller Bindungen entsprach; die damit eng zusammenhängende Individualisierung. Ganz wesentlich ging der Eindruck eines tiefgreifenden Wandels auf die Tatsache zurück, dass sich die wirtschaftliche Basis der Gesellschaft veränderte. Immer mehr Menschen arbeiteten im Dienstleistungssektor – Mitte der 1970er Jahre übertraf ihre Zahl die der in der Industrie Beschäftigten –, deren Alltag weniger von harter körperlicher Arbeit geprägt war. Qualifikation und Wissen wurden wichtiger, weshalb sich auch ihr kultureller Horizont erweiterte.
Bildungsreform
Heranwachsenden aus unterprivilegierten Schichten versprach die Bildungsreform verbesserte Möglichkeiten, sich »kulturelles Kapital« anzueignen, und damit den sozialen Aufstieg. Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre erfasste diese Expansion auch das Gymnasium, dem der Deutsche Bildungsrat 1975 attestierte, es habe sich »von einer Standesschule für das Bürgertum zu einer Aufstiegsschule auch für bisher bildungsferne Schichten« entwickelt.1 Davon profitierten vor allem der Nachwuchs sozial schwächerer und ländlicher Bevölkerungsgruppen sowie junge Frauen. Durch die Ausdehnung des Bildungswesens lösten Schüler und Studierende die Arbeiterjugendlichen als bestimmende Sozialfiguren der jungen Altersgruppen ab. Auf diese Weise wurden diejenigen immer zahlreicher, die intensiver über Zeitprobleme nachdachten und die »strukturleitende Schicht« (Viggo Graf Blücher) der Gesellschaft bildeten.
Hinzu kam: Die Zeit etwa zwischen dem fünfzehnten und dreißigsten Lebensjahr bot einer immer größeren Gruppe Freiräume, um kulturelle und politische Stile zu erproben. In dieser Lebensphase, die als Postadoleszenz bezeichnet wird, konnten sich »Selbständigkeit und freier Wille« am ehesten entfalten, die auf der Werteskala der Bundesbürger einen immer prominenteren Platz einnahmen. Insofern wurde die Freizeit – mehr verfügbare Zeit im Alltag, aber auch im Lebensverlauf – zu einem »Motor des Wertewandels« (Horst Opaschowski). Sie wurde gefüllt von Jugendkulturen, die Raum für Muße und Lebensgenuss, aber auch für aktive Weltaneignung durch Reisen, Musikmachen, Wohnexperimente oder politische Aktivitäten boten.
Auch wenn erst die 1970er Jahre den Durchbruch der feministischen Bewegung brachten, entstand deren soziale Basis im vorangegangenen Jahrzehnt. Bereits damals nahm die Erwerbstätigkeit von Frauen erheblich zu, wenn auch oftmals zunächst nur in Teilzeit.2 Die Aufnahme einer Berufsausbildung wurde zu einer neuen Selbstverständlichkeit auch für junge Frauen, die zuvor oftmals ungelernt gearbeitet hatten, weil ihre wahre Erfüllung in der bald zu erwartenden Ehe liegen sollte, in der Berufstätigkeit nicht vorgesehen war. Dass Frauenarbeit gesellschaftsfähig wurde, war ein sehr weitgehender Bruch mit der Konvention. Schließlich herrschte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts allgemeiner Konsens darüber, dass außerhäusliche Erwerbsarbeit für verheiratete Frauen kein erstrebenswerter Zustand, sondern lediglich aus Gründen materieller Not akzeptabel sei. Die Veränderung weiblicher Arbeitsverhältnisse ›ohne Not‹ in den 1960er Jahren verweist darauf, dass sich die feministische Bewegung nicht vor dem Hintergrund fest zementierter Geschlechterverhältnisse herausbildete. Vielmehr gewann sie ihre Durchschlagskraft, weil ein Emanzipationsprozess von Frauen bereits in vollem Gang war, wobei er allerdings auch an Grenzen stieß.3 Auf vielen Gebieten findet sich dieses Muster, das für die Einordnung von 1968 wichtig ist: Die Jugendrevolte reagierte weniger auf eine in »bleierner Zeit« stillgestellte Gesellschaft, sondern auf bereits angestoßene Veränderungen, die sie vorantrieb, politisierte und in eine sozialistische Richtung lenkte. Nur weil es in der Gesellschaft schon gärte, konnte sie so große Resonanz hervorrufen.
Die Integrationsbemühungen der Westalliierten, die Abschottung nach Osten und die massenmediale Erfassung trugen dazu bei, dass sich die Aktionsräume und geistigen Horizonte der Bundesbürger hauptsächlich nach Westen hin erstreckten. Gleichzeitig erleichterten die zunehmenden Bemühungen um eine »Vergangenheitsbewältigung« in Kombination mit der Deeskalation des Kalten Krieges eine innere Liberalisierung der Gesellschaft. Doch je mehr Möglichkeiten sich boten, desto größer wurden die Erwartungen: Die Nutzung der neuen Spielräume weckte sogleich Zukunftshoffnungen und Reformerwartungen, die das von Skepsis durchsetzte Aufbruchklima der Zeit prägten. Der »kurze Traum immerwährender Prosperität« endete, als wirtschaftliche, ökologische und politische »Grenzen des Wachstums« erreicht schienen.4 Diversifizierung, Enttraditionalisierung und Individualisierung wiederum vollzogen sich nicht im leeren Raum, sondern innerhalb eines flexiblen Rahmens von Klassen- und Schichtenzugehörigkeit, Geschlecht, Milieubindungen, Kriegs- und Migrationserfahrungen etc.
Auch weil dieser Rahmen zwar in Grenzen variabel, aber keineswegs beliebig veränderbar war, kann die Sozial- und Kulturgeschichte der 1960er Jahre nicht als ungebrochene Modernisierungsgeschichte beschrieben werden. Noch in ihrer zweiten Hälfte waren traditionalistische Haltungen weit verbreitet – nicht zuletzt, weil größere Teile der Gesellschaft sich immer schneller von den althergebrachten Normen verabschiedeten. So signalisierte etwa der Aufstieg der NPD, dass sich ein Teil der Bevölkerung im Laufe des Jahrzehnts radikalisierte, um der politischen und kulturellen Verwestlichung und dem schnellen Wandel moralischer Normen etwas entgegenzusetzen. Die existenzielle Schärfe, die die Auseinandersetzungen der 1960er und frühen 1970er Jahre oftmals annahmen, erwuchs auch aus der Unsicherheit vieler Akteure über die Substanz der westdeutschen Demokratie und die demokratische Standfestigkeit der Bürger.
Demokratisierung und Politisierung
Demokratisierung war ein Schlagwort der Zeit, mit dem mehr gemeint war als die Ausweitung der repräsentativen Demokratie durch Engagement im Alltag. Vielen Akteuren ging es um soziale Demokratie, also um vermehrte Teilhabe auf allen Gebieten. Insbesondere forderten sie, die parlamentarische Demokratie in der Gesellschaft stärker zu verankern. Von den Kirchen und dem Städtebau über die Arbeitsplätze, Schulen und Hochschulen bis hin zu den Erziehungsheimen und der Bundeswehr sollten den Betroffenen mehr Rechte eingeräumt werden – das war der Sinn der Losung »Mehr Demokratie wagen« des sozialliberalen Regierungsprogramms von 1969. Wie weit die Demokratisierung der Gesellschaft gehen sollte, ob sie auf die soziale Teilhabe ausgedehnt werden oder sogar in sozialistische Verhältnisse münden sollte, war Gegenstand der politischen Auseinandersetzung.
Aber nicht nur im direkt politischen oder im vorpolitischen Raum wurde die vermehrte Teilhabe des Bürgers gefordert. Auch im Hinblick auf die wichtiger werdende Konsumsphäre wurde es in den 1960er und 1970er Jahren üblich, Konsum als aktiven Vorgang, als soziale Praxis der Aneignung und des Austauschs zu verstehen. Noch in den 1950er Jahren hatten staatliche und gesellschaftliche Akteure versucht, das Konsumverhalten der Bürger von oben zu beeinflussen. Im Laufe der 1960er Jahre wurde jedoch immer deutlicher, dass nicht nur in randständigen Subkulturen Konsumenten selbst bestimmten, was akzeptabel war und was nicht. Boykott, Diebstahl und sogar Warenhausbrandstiftung gehörten zu den aufsehenerregendsten Aktionen aus dem Umfeld der Jugendrevolte, die die »Konsumgesellschaft« attackierten.1
Doch Verbraucher erhoben ihre Stimme auch zu Gegenständen, die rebellischen Studenten sicherlich zu unpolitisch erschienen wären. Als die Industrie versuchte, mit dem Maxirock einen neuen Modetrend zu lancieren, gingen 1970 etwa in Dortmund 20 000 Personen auf die Straße. Die Losung der Demonstrantinnen: »Allein der Mini nur kommt schönen Beinen auf die Spur«.2 Diese von einer 25-jährigen Sekretärin initiierte Aktion war nicht nur ein Zeichen für die hohe Symbolwirkung, die einem Kleidungsstück beigemessen werden konnte, sie belegt auch das gewachsene Selbstbewusstsein insbesondere von Konsumentinnen, Stilfragen in eigener Regie zu entscheiden und dafür notfalls auch Produktstrategien der Unternehmen zu attackieren. Derartige Aktivitäten häuften sich, sodass die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung von einer »Verbraucher-APO« sprach und fragte: »Kommt es zum Aufstand der Konsumenten?«3
Demonstration für den Minirock in München, 1970
Ende der 1960er Jahre wurde immer offensichtlicher, dass junge Leute das Leben genießen wollten, aber sich gleichzeitig verstärkt für Politik interessierten. Im Mai 1967 machte das Allensbacher Institut für Demoskopie in einer Studie über die Leserinnen und Leser der Zeitschrift Twen einen »kulturhistorisch […] neuen Typus« aus. Die Probanden, junge Westdeutsche im Alter von vierzehn bis 29 Jahren, hätten viele Interessen, »die dem Bewusstsein des 19. Jahrhunderts und vielleicht auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts […] als einander ausschließend erscheinen müssen. So interessieren sich die Twen-Leser für Beat-Musik und Parties, aber zur gleichen Zeit in sehr betonter Weise für Politik.«4 Die Vermischung dieser beiden Komponenten – Lebensgenuss und Konsumkultur auf der einen, Interesse für gesellschaftliche Probleme und Politik auf der anderen Seite – war auch anderen Zeitgenossen aufgefallen. »Verwirrend« fand der Spiegel die Mixtur »Chelsea-girls und Rote Garden, Rudi Dutschke und Twiggy«.5 Dabei war es gerade diese Mischung, die die gesellschaftliche Tiefenwirkung von 1968 bewirkt hat: Politik und Kultur gingen eine Verbindung ein.
Für Twen verpasste der Grafiker Oliver Williams 1969 deutschen Politikern lange Haare, die sie ziviler erscheinen ließen. Hier Franz-Josef Strauß und Willi Brandt
Mit dem Reichtum der Gesellschaft, dem steigenden Bildungsgrad, der Medialisierung und den politischen Richtungskämpfen wuchs auch das Interesse an Politik. Bis 1960 betrachteten sich unter dreißig Prozent der Bundesbürger als politisch interessiert, doch 1973 lag ihr Anteil bei fast fünfzig Prozent und hatte damit den steilsten Anstieg in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt.6 Dabei war das politische Interesse der jüngeren Altersgruppen besonders stark ausgeprägt. Im Frühjahr 1968 konstatierten Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg, es hätten sich »während des letzten Jahres erhebliche Veränderungen in der Einstellung der Jugendlichen zur Politik« ergeben, insbesondere habe die Bereitschaft zum politischen Engagement zugenommen.7 Das war für die deutsche Soziologie auch insofern eine Überraschung, als bis dahin der Jugend nahezu unisono eine »unauffällige Integration in die Gesellschaft« attestiert worden war.8 Zwar hatte man seit den frühen 1960er Jahren ein wachsendes politisches Interesse beobachtet, aber gleichzeitig auch angesichts des im Kulturkonservatismus verbreiteten Schreckensszenarios von einer konsumistisch wie politisch verführbaren und damit für Radikalisierung offenen jungen Generation versucht, für Gelassenheit zu plädieren. Einschlägig war Viggo Graf Blüchers Studie über die Generation der Unbefangenen von 1966, in der er konstatierte: »Anpassung ist das dominante Verhaltensmuster.«9 Dieser Befund wurde angesichts der sich entfaltenden Jugend- und Studentenbewegung scheinbar in Gänze widerlegt und zum Musterbeispiel für das prognostische Versagen der Soziologie, sodass Blücher seine These schließlich zurückzog.10
Ein Vergleich zwischen Gesamtbevölkerung, der nicht studierenden und der studierenden Jugend von 1968 ergab, dass acht Prozent der nicht studierenden Jugendlichen sich als politisch sehr stark interessiert einstuften, während es bei den Studierenden 23 Prozent waren, in der Bevölkerung insgesamt nur fünf Prozent. Für stark interessiert hielten sich immerhin siebzehn Prozent der Jugendlichen (Studenten 33 Prozent, Bevölkerung neun Prozent).11 Bei alledem waren die Diskrepanzen nach sozialer Lage und Geschlecht erheblich: Generell war das politische Interesse stärker ausgepägt bei älteren, besser gebildeten und männlichen Jugendlichen, weniger interessiert waren jüngere Jugendliche mit niedrigen Bildungsabschlüssen und Mädchen. Besonders interessant ist, dass das Interesse für Politik am stärksten bei jüngeren Studierenden entwickelt war. Der höchste Wert, den die Emnid-Forscher 1968 bei ihrer Frage nach der Beschäftigung mit Politik unter der Antwort »öfter interessiert« verzeichneten, lag in der Altersgruppe der 21- bis 22-Jährigen, also bei den Geburtsjahrgängen 1946/47 (59 Prozent), den jüngeren unter den 68ern, die als Gesamtgruppe oftmals in den Jahrgängen 1938 bis 1948 verortet werden.12
Mit dem steigenden politischen Interesse – dies war das eigentlich Neue und seit dem 2. Juni 1967 Offensichtliche – wandelten sich auch die Bereitschaft zum Engagement und das Politikverständnis. Das repräsentative System wurde ergänzt und zum Teil gekontert, indem man einen Ausbau der partizipatorischen Elemente der Demokratie durch Demonstrationen und Techniken der begrenzten Regelverletzung praktizierte. Es handelte sich dabei nicht um Minderheitsmeinungen, sondern, so Emnid, »die Argumente und Aktionen der Radikalen finden in abgestuften Graden Sympathie über nahezu die gesamte soziale Schicht der jungen Intelligenz«.13
Wertewandel
Durch den zunehmenden Wohlstand, die kulturelle Öffnung der Gesellschaft und die Hebung des Bildungsniveaus gewannen »postmaterialistische« Werte bzw. »Selbstentfaltungswerte« an Bedeutung – grundlegend orientierte man sich weniger an materiellen Zielen, sondern konzentrierte sich auf die Verbesserung der Lebensqualität im Sinne von Selbstverwirklichung und Partizipation. Dieser zuerst von Ronald Inglehart beschriebene Befund ist nach wie vor stichhaltig, auch wenn die damit verbundene Forschrittseuphorie sich ebenso verflüchtigt hat wie die Vorstellung, »materialistische« und »postmaterialistische« Orientierungen schlössen einander aus.1 Seit den frühen 1960er Jahren nahm nicht nur die politische und kulturelle Liberalisierung zu, sondern auch die Aufmerksamkeit, mit der sich die Bundesbürger jenen Aspekten des Alltagslebens widmeten, die nicht unmittelbar existenzbezogen waren. Die »›Ausfaltung‹ oder ›Ausdifferenzierung‹ vorher weniger entwickelter Sinn-, Lebens- oder Optionsmuster«, wie Helmut Klages diesen »Pluralisierungsvorgang« beschrieben hat, bedeutete für den Einzelnen zunehmende Freiheit in der Lebensgestaltung, aber auch die Anforderung, sich selbständig in der Gesellschaft zu orientieren.2 Keineswegs wurden traditionalistische Sinnkonstruktionen generell ad acta gelegt, vielmehr brachten sich alternative Deutungsmuster stärker zur Geltung und wurden von größeren Teilen der Bevölkerung vertreten.
In den letzten Jahren ist die modellhafte Anlage der sozialwissenschaftlichen Wertewandelsforschung kritisiert worden, die historiografisch im Hinblick auf überschaubare Problemfelder zu konkretisieren sowie zu kontextualisieren sei.3 Natürlich müssen sozialwissenschaftliche Daten quellenkritisch betrachtet werden, gewiss auch sollten die von ihnen abgeleiteten Modelle nicht als Abbilder der Wirklichkeit gelten – ihr Sinn besteht gerade darin, von Einzelheiten zu abstrahieren, um größere Zusammenhänge hervortreten zu lassen. Und doch deuten die vorliegenden Zahlen der Demoskopie, die die Soziologie erst nachträglich in ein theoretisches Konzept überführt hat, darauf hin, dass sich in den 1960er und 1970er Jahren ein Wandel grundlegender Ordnungsvorstellungen vollzog. Sollte man sich dazu entschließen, die »Beschäftigung mit dem dekonstruierten Artefakt ›Wertewandel‹ einzustellen«, würden wichtige Informationen verlorengehen, nämlich empirische Befunde für den Umbruch normativer Orientierungsmuster in der Bevölkerung.4 Vor allem finden sich hier Anhaltspunkte zur quantitativen Gewichtung von Kulturerscheinungen.
Der als Wertewandel bezeichnete Prozess setzte Mitte der 1960er Jahre schubartig ein und kam Mitte der 1970er Jahre zu einem vorläufigen Abschluss – darüber herrscht »nach wie vor weitgehender Konsens«.5 Besonders sichtbar wurde er im Wandel der Erziehungsziele: »Gehorsam und Unterordnung« wurden von den Bundesbürgern als weniger wichtig erachtet, während »Selbständigkeit und freier Wille« als Erziehungsziele immer stärker an Rückhalt gewannen, die Alternative »Ordnungsliebe und Fleiß« blieb mit verhältnismäßig hohen Werten allerdings relativ konstant.6 Die anhaltende Beliebtheit dieser dritten Variable verweist auf eine Kontinuität, die auch in Gruppen zu beobachten ist, die zu den stärksten Befürwortern von »Selbstentfaltungswerten« gehörten. Linksradikale Aktivisten etwa konnten sich durch enorme Disziplin und Produktivität auszeichnen.
Die wichtigste soziale Trägergruppe dieses Wandels waren besser ausgebildete junge Leute. Fragt man nach dem Meinungsbild der jüngsten Altersgruppen, so bevorzugten sie »Selbständigkeit und freien Willen« sehr viel stärker – 1974 stimmten ihnen 71 Prozent der jungen Leute zu, achtzehn Prozent mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt.7 Unterscheidet man nun noch einmal nach dem Bildungsstand, so schält sich heraus, dass die Zustimmung nicht nur mit abnehmendem Alter wuchs, sondern auch mit zunehmender Bildung. 1974 stimmten den genannten Zielen 73 Prozent der 16- bis 24-jährigen Volksschulabsolventen zu, 82 Prozent der gleichaltrigen Realschulabsolventen und 91 Prozent der Abiturienten – damit lag die Avantgarde des Wertewandels zu fast vierzig Prozent über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Diese Zahlen spiegeln erhebliche Spannungen wider und machen deutlich, dass dieser Wandel sich weder in allen Segmenten der Bevölkerung gleichermaßen vollzog noch gleichsam automatisch vonstattenging. Im Gegenteil mussten ihn soziale Akteure gegen Widerstände durchsetzen, und das auch nur mit begrenztem Erfolg.
Das Alter spielt in der Theorie und in den empirischen Befunden zum Wertewandel eine zentrale Rolle. Für Inglehart verändern sich die politischen Kulturen vor allem im Generationenwechsel. Die Forschergruppe um Helmut Klages geht davon aus, dass junge Leute, insbesondere besser gebildete, den Wertewandel vorantrieben, der freilich auch ältere Kohorten erfasste.8 Peter Kmieciak, der 1976 für die Bundesregierung eine erste umfassende empirische Sekundäranalyse zum Wertewandel in der Bundesrepublik durchführte, hielt fest, »die jüngere Generation insgesamt« habe den Wertewandel »wesentlich initiiert und forciert« – speziell »die jungen Leute privilegierter Soziallagen«. Zudem machte er auf die in den jüngeren Altersgruppen entstandenen Sub- und Gegenkulturen aufmerksam, die »nach wie vor größeren Einfluss auf das Bewusstsein weiterer Bevölkerungskreise« hatten.9 Andererseits ist ganz zu Recht betont worden, dass viele überzogene Vorstellungen von der Wandlungsbereitschaft junger Leute hatten und allzu unvermittelt von nonkonformen Subkulturen auf die Einstellungen der Mehrheit dieser Altersgruppe schlossen.10 Tatsächlich entsteht erst dann ein realistisches Bild des Wertewandels und der Rolle, die Jugendliche dabei spielten, wenn Kontinuität und Wandel gleichermaßen betrachtet werden und Differenzierungen nach Geschlecht, Region, religiöser Orientierung, Bildungsstand und anderen Faktoren sozialer Strukturierung mit einfließen.
Generationen
Obschon das Alter der jeweiligen Akteure bei den Konflikten von 1968 eine wichtige Rolle spielte, lehnten sozialistische Gruppen die schon zeitgenössisch verbreitete Deutung als Generationskonflikt ab, weil sie den Protest entpolitisierte und als Ausdruck jugendlichen Überschwangs verniedlichte. Und tatsächlich war der immer wieder thematisierte Generationskonflikt zu einem erheblichen Teil eine Konstruktion der Medien, die die verbreitete Vorstellung, die Welt werde »jung«, mit allerlei Konfrontationsgeschichten anheizten.1 Die Rede vom Generationskonflikt fügte sich gut ein in die traditionelle deutsche Obsession für »Jugend« und »Jugendlichkeit«, beruhte aber zum Teil auch auf Tatsachen, wie die von der Sozialforschung immer wieder herausgearbeiteten Befunde zum cultural lag, einer Phasenverschiebung, zeigten: Jüngere Menschen stellten sich relativ schnell auf die neuen kulturellen Spielräume ein, während ältere Bürger längere Zeit benötigten und dazu auch weniger bereit waren. Dabei hat die häufige Verwendung des Generationsbegriffs zur Konstruktion und Legitimation historischer Kollektive seinen wissenschaftlichen Wert schon bald nach 1968 fragwürdig erscheinen lassen.2 Nicht zuletzt wurde damit häufig eine männlich geprägte »politische Generation« beschrieben, während die »stillen« Akteurinnen und Akteure – insbesondere auch die nicht vorrangig politisch Interessierten – ausgeblendet wurden.3 Andererseits kann die in »biographisches Kapital« (Jürgen Reulecke) umgemünzte Generationszugehörigkeit als schon zeitgenössisch relevante Sinnstiftungskategorie gerade in dieser Dekade nicht ausgeblendet werden; nicht nur das Alter, sondern auch generationelle Zuschreibungen sind in ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Dynamik der 1960er Jahre kaum zu überschätzen.
Das gilt beispielsweise für die Soziologie, die immer neue Etiketten erfand, um das Charakteristikum der jeweiligen jungen Altersgruppen so treffend wie möglich zu fassen: Sie seien »skeptisch«, »unbefangen« oder »unruhig« – so einige der gängigsten Zuschreibungen. Aber noch prägender war und ist die Formel von der »68er-Generation«, die die Akteure sich etwa zehn Jahre nach den Ereignissen selbst ausdachten. Da sie deutungsoffener ist als die qualifizierenden Zuschreibungen, kann sie ebenso affirmativ wie kritisch gebraucht werden. 1978 postulierte Klaus Hartung nach einem Bob-Dylan-Konzert, die deutsche Linke müsse »als Generation« begriffen werden.4 Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, in denen sich die Linke aus Angehörigen mehrerer Altersgruppen zusammensetze, sei sie in der BRD auf jene Jahrgänge beschränkt, die um 1968 politisiert worden seien – und Letztere seien »jünger als unsere Altersgenossen«. Hartungs Worte machen deutlich, wie der Begriff der Generation der Selbstzuschreibung diente und als Waffe im Kampf um Machtpositionen gegenüber Älteren, Jüngeren und dem politischen Gegner eingesetzt wurde.
Brauchbarer, weil weniger interessengeladen, sind beschreibende Begriffe wie Altersgruppe oder Kohorte. Denn die Altersunterschiede waren markant. An der Schwelle zu den 1960er Jahren hatten die noch im Kaiserreich sozialisierten Jahrgänge, die die Gründerjahre der Bundesrepublik geprägt hatten, die Verantwortung an Jüngere abgegeben, sodass nun noch stärker als zuvor jene kurz nach der Jahrhundertwende Geborenen die Geschicke des Landes bestimmten, die im »Dritten Reich« ins Arbeitsleben getreten waren.5 Einflussreich waren auch schon diejenigen, die zum Kriegsende Jugendliche oder junge Erwachsene gewesen waren und mit der Gunst des demokratischen Neuanfangs und des wirtschaftlichen Aufschwungs ihr berufliches wie politisches Leben begonnen hatten. Viele von ihnen standen den noch Jüngeren, die als »68er-Generation« von sich reden machen sollten, anfangs mit Sympathie gegenüber, weil sie in ihnen Verbündete im Kampf für eine politische und kulturelle Erneuerung der Bundesrepublik sahen. Andere waren sogar Bundesgenossen oder Vorkämpfer der 68er, wie etwa Hans Magnus Enzensberger (geboren 1929), Klaus Rainer Röhl (1928) oder Helmut Salzinger (1937). Natürlich gab es zahlreiche Akteure, die weder klar der einen noch der anderen »Generation« zuzurechnen waren. Manche Aktivisten werden durch die übliche Altersbegrenzung ausgeschlossen, weil sie als Schülerinnen und Schüler durch 1968 sozialisiert wurden – so etwa Thomas Ebermann (1951) oder Jürgen Trittin (1954). Alles in allem demonstriert dies einmal mehr, dass das Konzept der Generation nicht unbedingt erkenntnisfördernd ist.
Die altersbedingten Unterschiede in Stilpräferenzen, beim politischen Aktivismus, im Bildungsniveau, beim Konsumverhalten sind nicht zu übersehen. Um aus der Vielzahl der publizistischen und sozialwissenschaftlichen Befunde nur eine Stimme zu zitieren, die auf die Lebensweise abhebt: 1969 konstatierte das Meinungsforschunginstitut Emnid anhand seiner langjährigen Bestandsaufnahmen: »Seitdem wir das 2. Drittel des Jahrhunderts überschritten haben, werden die grundlegenden Wandlungen in unserer Gesellschaft immer deutlicher. Man orientiert sich auf Freizeit, Konsum und Wohlstand; den faktischen Veränderungen auf diesen Gebieten folgt die Bewusstseinsanpassung nur zögernd; die Jugend, die in die neue Zeit problemlos hineingewachsen ist, vollzieht diese Änderungen im Meinungsbild zuerst.«6 Inwieweit aus dem enormen Kontrast zwischen den Erfahrungswelten von Eltern, die in Kriegs- und Krisenzeiten aufgewachsen waren, und jenen ihrer im Wohlstand sozialisierten Kinder Konflikte zwischen Älteren und Jüngeren resultierten, ist eine weniger leicht zu beantwortende Frage. Es kommt darauf an – auf den Diskussionsgegenstand, das Milieu, das Geschlecht und auch alle anderen Faktoren sozialer Differenzierung.
So orientierten sich Eltern etwa beim Kauf von Unterhaltungselektronik, wie die Konsumforschung herausgefunden hat, oftmals am Urteil ihrer Kinder. Bekanntlich gab es zahlreiche Konflikte um Haarlänge und Kleidung der Jugend, aber auch in dieser Hinsicht ließ der Widerstand Älterer mit der Zeit nach. Die Sozialwissenschaftlerin Edith Göbel hatte schon 1964 konstatiert, dass sich »viele Erwachsene den Erscheinungsformen der Jugendlichen anpassen, da diesen eine besonders attraktive Form der Selbstdarstellung der Jugend gelungen sei«.7 Aber auch dazu ist ein Pauschalurteil schwer zu fällen, weil Unterschiede nach sozialer Lage und Geschlecht offensichtlich sind. Selbst die veröffentlichte Meinung lässt eine Vielzahl häufig gegensätzlicher Stimmen zu Wort kommen, wobei sich die Plädoyers für Vertrauen und Toleranz häuften. 1965 riet der katholische Journalist Walter Dirks Eltern, ihren Kindern nicht mit Misstrauen, sondern mit Offenheit zu begegnen und in ihren Verhaltensweisen die Veränderung der Gesellschaft aufzuspüren, »das Neue zu erkennen, das sich da anmeldet«. »Und dann«, so Dirks, »muss man sich mit diesem Neuen verbünden.«8 Mehr und mehr gingen Absetzbewegungen nicht in erster Linie von Erwachsenen aus, sondern von Jugendlichen, denn diesen waren distinktive Selbstzuschreibungen besonders wichtig, um die Legitimität ihrer gewandelten Stilpräferenzen durchzusetzen. Derartige Absetzbewegungen führten zu intergenerationellen Konflikten, erhöhten aber auch den Anpassungsdruck auf die Älteren. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Erwachsene trotz der demonstrierenden Studenten, mit denen die große Mehrzahl von ihnen keineswegs einverstanden war, bis zur Mitte der 1970er Jahre eine immer freundlichere Haltung zu ihren Sprösslingen einnahmen. Auf die Frage der Meinungsforschung, ob sie einen vorteilhaften oder einen eher unvorteilhaften Eindruck von der jungen Generation hätten, äußerten sich 1950 gerade einmal 24 Prozent der Befragten positiv, 1956 waren es bereits 38 Prozent, 196044 Prozent und 1975 nicht weniger als 62 Prozent.9
Umgekehrt legten Jugendliche nur selten jene Unversöhnlichkeit gegenüber Älteren an den Tag, die ihnen die Medien oftmals zuschrieben. Göbel konstatierte 1964 eine »erstaunlich tolerante und einsichtsvolle Haltung vieler Jugendlicher« gegenüber Erwachsenen. »Sie beurteilen die – ihrer Meinung nach – negativen Verhaltensweisen der Erwachsenen häufig mit einer gewissen Nachsicht.«10 Dabei blieb es im Kern auch zehn Jahre später. »Trau keinem über 30« – dieser Slogan, der als angebliche Parole der Jugend immer wieder kolportiert wurde, spiegelte bestenfalls die Einstellung einer Minderheit wider. Für überwiegend oder ganz falsch hielten diese Aussage 1975 70 Prozent der westdeutschen Jugendlichen, unter denen mit Hochschulbildung waren es sogar 89 Prozent.11 Allerdings bedeutete das nicht, dass unter ihnen unkritische Vorstellungen von einem harmonischen Verhältnis der Altersgruppen geherrscht hätten.
NS-Vergangenheit
Insbesondere der gebildetere Teil der Jugend wandte sich im Kampf um politischen Einfluss gegen eine Mehrheitsgesellschaft, die sich mitten in einem Prozess der Auflockerung und Diversifizierung befand und Jugendlichen auf der kulturellen Ebene bereits gewachsene Entfaltungsmöglichkeiten bot, aber die politische Ebene noch abschottete. In dieser Situation kam es insbesondere zwischen jungen Intellektuellen und den »Cold War Liberals« (Uta G. Poiger) zur Konfrontation. Viele Liberale aus der sogenannten 45er-Generation, wie etwa Günter Grass, Jürgen Habermas oder Uwe Johnson, rückten von den Jüngeren ab, als sich die Studentenbewegung radikalisierte. In der Selbstwahrnehmung vieler »45er« bestand der Kern ihres generationsspezifischen Habitus in einer nüchtern-pragmatischen und möglichst ideologiefernen Grundeinstellung, die sich mit den ideellen Bezugsgrößen der jungen Radikalen nicht mehr vertrug. In dem berühmten Fernsehinterview mit Rudi Dutschke vom 3. Dezember 1967 brachte der mit seinem Gesprächspartner durchaus sympathisierende Journalist Günter Gaus (Jahrgang 1929) diese Skepsis zum Ausdruck: »Der Unterschied […] zwischen Ihrer Generation und der Generation der heute Vierzig- bis Fünfzigjährigen scheint mir darin zu bestehen, dass Sie, die Jüngeren, die aus den vergangenen Jahrzehnten gewonnene Einsicht in die Verbrauchtheit der Ideologien nicht besitzen. Sie sind ideologiefähig.«1
Bei der Abgrenzung spielte die NS-Vergangenheit eine wichtige Rolle. Tatsächlich lehnten Jugendliche nahezu ausnahmslos den Nationalsozialismus ab, ohne sich allerdings besonders intensiv mit ihm auseinanderzusetzen oder sich ein sicheres Urteil zuzutrauen. Weit verbreitet war die Annahme, dass die Älteren wegen ihrer Prägung durch zwölf Jahre Nationalsozialismus keine Leitfunktion in der Gegenwart beanspruchen durften. Dies richtete sich gegen alle, die vor 1945 geboren, besonders aber gegen diejenigen, die im Nationalsozialismus groß geworden waren. Ein 19-jähriger Primaner hatte an der westdeutschen Demokratie vor allem auszusetzen, dass »die Leute, und zwar insbesondere die Generation unserer Eltern, einfach noch nicht reif ist dafür, dass in ihnen noch viel zuviel die autoritäre Erziehung, die sie selbst genossen haben, drinsteckt«.2 Erklärungen von studentischer Seite machten deutlich, dass es neben moralischer Empörung auch darum ging, Gegner zu diskreditieren und eigene Interessen durchzusetzen. So konnte es kommen, dass eine spektakuläre Aktion sozialdemokratischer Studenten, die bei der Rektoratsfeier der Hamburger Universität vom 9. November 1967 mit einem Transparent »Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren« gegen die Ordinarienuniversität protestieren wollten und eine Hochschulreform forderten, als antifaschistische Aktion wahrgenommen wurde.3 Es ging um etwas anderes, aber die NS-Verstrickung der westdeutschen Eliten – auch an den Hochschulen – war schon seit einigen Jahren skandalisiert worden, sodass das NS-Argument auch in Sachen Hochschulreform als triftig gelten konnte und als Provokation in jedem Falle Wirkung zeigte. Das NS-Argument war eine Waffe im politischen Kampf, die von allen Seiten eingesetzt wurde.
Insgesamt führten Aufklärungskampagnen nach der antisemitischen Schmierwelle von 1959/60, bei der Jugendliche Synagogen und jüdische Grabstätten mit Hakenkreuzen und rechtsradikalen Parolen geschändet hatten, bei jüngeren Altersgruppen zu einem allmählichen Rückgang antisemitischer Haltungen, während bei den älteren Jahrgängen eine größere Stabilität zu beobachten war.4 Oberschüler sowie Studierende wussten besonders viel über das »Dritte Reich«, seine Strukturen und Funktionsmechanismen, zudem verlangten sie mehr Aufklärung und politische Konsequenzen.5 Es scheint, als sei ein ›generationeller‹ Common Sense in der Ablehnung des Nationalsozialismus bereits in den frühen 1960er Jahren erreicht worden, wobei die Gegenwartsrelevanz des Problems – seine politische Dimension – am ehesten die besser Gebildeten erkannten. Als die NPD bei den Landtagswahlen seit 1966 zu reüssieren begann, stellte sich heraus, dass die 16- bis 29-Jährigen unter den NPD-Anhängern etwa zu einem Drittel unterrepräsentiert waren. Das galt auch für den Stimmenanteil der Partei unter den Jungwählern.6 Allerdings deutete sich im Zusammenhang mit der rasanten politischen und kulturellen Konfrontation seit 1967 eine leichte Verschiebung an. Während noch Mitte der 1960er Jahre besonders junge Leute einen »Schlussstrich« unter die NS-Aufarbeitung abgelehnt hatten, änderte sich dieses Bild seit etwa 1967, insbesondere bei nicht akademisch gebildeten Jugendlichen. Sie befürworteten nun ein Ende der Debatte um die NS-Vergangenheit zwar etwas weniger als die Westdeutschen insgesamt, aber doch deutlich stärker als ihre Altersgenossen mit Abitur.7
Derartige Tendenzen veranlassten Ende der 1960er Jahre manche Beobachter, in der jungen Generation insgesamt nicht nur ein Aufeinanderprallen der Extreme zu sehen, sondern sogar eine grundlegende Wendung von links nach rechts. So orakelte Die Welt Ende 1969 düster: »Jugend 1970 – restaurativ, faschistoid, rechtsextrem?«8 Allerdings erfüllte sich diese Erwartung nicht, insgesamt nahmen demokratische Haltungen in dieser Altersgruppe eindeutig zu.9 Doch lässt sich der Wandel in der Beurteilung des Nationalsozialismus nur an verhältnismäßig vagen Indizien festmachen, und dies verweist schon darauf, dass dem Thema im Laufe der 1960er Jahre weniger Bedeutung zugemessen wurde. Während noch am Anfang der Dekade der Umgang Jugendlicher mit der NS-Vergangenheit im Mittelpunkt des Interesses stand, war es an ihrem Ende ihre Haltung gegenüber aktuellen politischen Problemen.
Schon vor 1968 war das interpretative Grundmuster der die Jugendrevolte prägenden Position voll ausgebildet: 1. Der weit überwiegende Teil der älteren Generationen war durch aktive Mittäterschaft oder allzu passive Hinnahme mit dem Nationalsozialismus verstrickt und konnte deshalb keine Leitfunktion für die Gegenwart beanspruchen. 2. In einem versteckten Antisemitismus, in Antikommunismus und Autoritarismus existierten die Prägungen des Nationalsozialismus fort. 3. Ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft und der Politik öffnete einem Rollback zur Beseitigung der Demokratie Tür und Tor. 4. Die soziale Kraft, die diese Vergangenheitsbindungen lösen konnte, war die junge Generation, vor allem junge Intellektuelle. Diese gegenwartsbezogene Argumentation wurde im Kulturkampf von 1968 immer wieder repetiert, die Lösung von der NS-Bindung war ein nahezu unhinterfragtes Basisargument in Debatten um Sexualität, Wohnformen, politische Maßnahmen. Auch heizte es die Konfrontation beträchtlich an, aber in der Intensität der ersten Hälfte der 1960er Jahre beschäftigte man sich mit dem Nationalsozialismus nicht mehr.
»Die Phantasie an die Macht!« Anders leben
München 1966: Gammler und Passanten
Im Herbst 1966 interviewte der damals 29-jährige Regisseur Peter Fleischmann für den Bayerischen Rundfunk eine größere Gruppe sogenannter Gammler.1 Sie trafen sich in München, das sich als Sprungbrett in Richtung Mittelmeer zum bundesweiten Treffpunkt dieser vermeintlichen Taugenichtse entwickelt hatte. Bei Fleischmann kommen die jugendlichen Akteure selbst zu Wort, zumeist um die zwanzig Jahre alt, langhaarig, einige mit Bart, die meisten Männer, aber auch einige junge Frauen. Manche waren zum wiederholten Mal von zu Hause abgehauen und viele von ihnen bereits welterfahren. Immer wieder ist die Rede von den Zielen im Ausland, den Treffpunkten in den europäischen Großstädten, illegalen Grenzübergängen. Viele hatten eine Berufsausbildung absolviert, manche hatten sie abgebrochen. Andere waren noch Schüler, Studierende gaben sich nicht zu erkennen. Motive für den Ausstieg gab es viele: Ärger mit den Eltern, Gefangenschaft im Erziehungsheim, oftmals aber ausdrücklich das Bestreben, anders leben zu wollen, als es die Konventionen vorsahen, vor allem freier, auch von materiellen Gütern. »Ich hatte viel vom Beatnik-Leben gelesen«, schwärmt einer. Ein anderer liest aus seinem Einberufungsbescheid vor: »›Er hat sich am 3. Oktober 1966 in Münsingen, Herzog-Albrecht-Kaserne, zu stellen.‹ Und am 3. Oktober 1966 bin ich in Italien und grüße die Bundeswehr, indem ich eine Fünf-Liter-Flasche Wein ansetze.« Reflektiert wurde auch der Begriff, unter dem die Subkultur bundesweit bekannt geworden war: »Was ist überhaupt ein Gammler? Das ist doch ein Name, den die Gesellschaft uns gegeben hat. Da kann ich mich doch nicht selbst als Gammler bezeichnen, da wäre ich doch ein Idiot. Gammler ist für mich ein Schimpfwort. Ich bezeichne mich als Tramper, Reisender oder Globetrotter, aber doch niemals als Gammler.«
Fleischmann ermuntert seine Gesprächspartner auch, sich unter ältere Passanten zu mischen, etwa auf dem Oktoberfest, wo die Stimmung besonders aggressiv ist. Viele der Erwachsenen (keineswegs nur Alte) ereifern sich über die herumlungernden Jugendlichen und können nicht verstehen, warum sie nicht arbeiten gehen. Es mangelt nicht an traditionalistischen Rezepten (»Die Jugend muss in festen Händen sein.«) und Vernichtungsphantasien (»Solche Leute würde ich alle umbringen.«). Plädoyers für Toleranz hört man auch, doch sie sind in Fleischmanns Arrangements in der Minderheit. Die Jugendlichen sind sich ihrer Wirkung insbesondere auf ältere Bürger durchaus bewusst. Einer von ihnen scherzt gutgelaunt nach dem Aufwachen im Englischen Garten: »Jungs, es wird Zeit, dass Adolf wiederkommt, dass das Gesindel unter den Bäumen verschwindet.« Sehr schön bündeln sich in Fleischmanns Dokumentation die Eigenarten der Akteure in dieser Szene: Sehnsucht nach einem Alltag jenseits der Konventionen und des Konsums, Lust auf Horizonterweiterung durch Reisen, Bekenntnis zum Individualismus, eine gewisse politische Frustration, Konfrontation mit der NS-Vergangenheit, Spaß an der Provokation. Interessant sind diese Merkmale vor allem deshalb, weil sie in etwas weniger radikaler Form von einer wachsenden Masse Jugendlicher geteilt wurden. Insofern lässt sich in den Gammlern ein Idealtypus der Zeit mit größerer Ausstrahlung identifizieren.
1968 wurde nicht nur durch politische Forderungen geprägt, sondern viel grundsätzlicher noch durch das Ideal eines anderen Lebens. Es sollte offener und spielerischer sein, weniger ritualisiert, und dem Einzelnen Spielraum zur Entwicklung seiner Eigenarten verschaffen. Dass solche Ideen überhaupt entstehen konnten, beruhte auf den materiellen Verbesserungen, die das »Wirtschaftswunder« mit sich gebracht hatte. Aber diese hatten auch ihre Schattenseiten: der funktionalistische Massenwohnungsbau der 1950er und 1960er Jahre, die zunehmende Häuslichkeit durch das Fernsehen oder das »motorisierte Biedermeier« (Erich Kästner), dessen materieller Fetisch, das Auto, die Hartnäckigkeit des Traditionalismus nur unterstrich. Bommi Baumann, der sich 1966 zur Westberliner Gammlerszene gesellte, beschrieb einprägsam die Tristesse, die ihn umgab und seinen oppositionellen Geist anstachelte: »Der ganze Stumpfsinn, die Monotonie hat Ekel in uns erregt. Fahren Sie man frühmorgens durch Siemensstadt. Diese Anhäufung von Hässlichkeit und Sinnlosigkeit, die nur noch dazu dient, eine geistlose Maschine am Laufen zu halten, tagaus, tagein. Fernsehsüchtige Eltern, versoffene Arbeitskollegen. Als ich noch Lehrling war auf einem Bau, natürlich konnte ich es da nicht formulieren, da kann man es einfach nur dunkel empfinden. Aber da entstand ein unbestimmter Abscheu vor der Gesamtheit, die einen umgibt.«2
Erst vor dem Hintergrund der noch in der Modernisierung der Gesellschaft reproduzierten geistigen Enge wird die Faszination des in allen Farben leuchtenden Möglichkeitsraums verständlich, der jenseits der deutschen Grenzen aufschien – im französischen Existenzialismus, in der US-Beat-Literatur, in skandinavischer Liberalität und Popkultur aus Großbritannien. Aber auch im eigenen Land wurde die besonders starke Orientierung an der Tradition, die nach Nationalsozialismus und verlorenem Krieg den gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederherstellen sollte, seit den späten 1950er Jahren immer mehr in Frage gestellt. Anders leben, das bezog sich nicht nur auf das politische System, sondern fundamentaler auf die Lebensweise: Genuss statt Pflichtgefühl, Toleranz statt Normativität, weg mit dem nationalen Brett vorm Kopf – immer weniger wurde als gegeben hingenommen, weder die Familie als wichtigste Form der Gemeinschaft noch scheinbar objektive Gegebenheiten wie die sexuelle Orientierung, schon gar nicht die Konventionen von Bekleidung und Haartracht. Selbst der Rahmen dessen, was als Wirklichkeit verstanden wurde, konnte gesprengt werden, wie der Aufstieg illegaler Drogen verdeutlichte.
Die Kraft derartiger Ideen kann kaum überschätzt werden. Sie wurden keineswegs von allen geteilt, aber sie haben die späten 1960er Jahre zum Höhepunkt radikaler Neuordnungsbestrebungen werden lassen. Gerade die Tatsache, dass diese Ideen umstritten waren, hat deren Anziehungskraft noch verstärkt. Sie hat auch ihre Verfechter ermutigt in dem Bewusstsein, auf der Seite der Zukunft zu stehen und in ihren Gegnern die Vertreter einer überlebten Zeit zu bekämpfen. Die Zeit stand auf der Seite des Fortschritts, aber ihr musste im Kampf gegen das Alte zum Durchbruch verholfen werden.
Das undatierte Plakat des Künstlers Witt verbindet Furcht vor dem Atomkrieg mit Kritik an der Wehrpflicht und empfiehlt eine verträglichere Alternative.
Provokation ohne Grenzen. Handzettel aus dem Archiv der Amsterdamer Provos
Am 18. Dezember 1966 setzten sich Jugendliche aus der Frankfurter Gammlerszene an einige Tische im Lokal Aschinger nahe dem Hauptbahnhof und provozierten einen Lokalverweis. Denn sie hatten damit den Inhaber herausgefordert, der seit einigen Wochen keine Langhaarigen mehr bediente, weil sie seiner Meinung nach die allgemeinen Anstandsregeln nicht beachteten. Da die Jugendlichen das Lokal nicht verlassen wollten, rief er die Polizei, die 29 Personen vorläufig festnahm. Es handelte sich um eine Aktion der Frankfurter Provos, einer Gruppe politisierter Gammler, die sich wenige Wochen zuvor gegründet hatte und ihrem niederländischen Vorbild nacheiferte. In Amsterdam machten die Provos schon seit 1965 durch spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam. Besonderes Aufsehen erregten sie in der ersten Jahreshälfte 1966, als sie nicht nur mit Hilfe von Rauchbomben gegen die Hochzeit der niederländischen Thronfolgerin Beatrix mit einem deutschen Adeligen protestierten, sondern auch einer ihrer Vertreter in den Amsterdamer Stadtrat gewählt wurde und sich mehrere tausend Jugendliche gemeinsam mit streikenden Arbeitern Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Die Mischung aus Militanz und Ironie, die den Aktionen der Provos zum Erfolg verholfen hatte, machte die Sache auch für westdeutsche Jugendliche interessant. Deutsche Fanpost aus der tiefsten Provinz erreichte die Provos schon in diesem Jahr, und der Westberliner Untergrundverleger Hartmut Sander brachte sogleich ein Buchprojekt für den neuen Oberbaum-Verlag unter Dach und Fach, um noch 1966 seine Kunden mit Informationen zum provotarischen Denken zu versorgen.3 Auch bei der Frankfurter Gruppe handelte es sich um deutsche Provos, die es nicht beim Anderssein belassen, sondern politisch eingreifen wollten.
Auf Verständnis konnten kulturelle Abweichler und politische Provokateure in erster Linie bei Jüngeren und besser Gebildeten in den Großstädten hoffen, während unter älteren Menschen und auf dem Lande Ablehnung vorherrschte. Einen politischen Anstrich erhielten die Aversionen nicht zuletzt durch Politiker-Statements etwa aus dem Munde Bundeskanzler Erhards, der sich bei einer Wahlkundgebung im Juni 1966 echauffierte: »Solange ich regiere, werde ich alles tun, um dieses Unwesen zu zerstören.«4 Und Ende 1966 versuchte Freddy Quinn, mit einem Anti-Gammler-Schlager aus den in der Bevölkerung vorhandenen Ressentiments Kapital zu schlagen:
»Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir!
Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir!
Ihr lungert herum in Parks und in Gassen,
wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir! Wir! Wir!«
Ein »Spießerlied«, wie die Zeitschrift Twen es nannte, das als Wahlhilfe für die NPD zu beurteilen sei.5 Dass das Hochglanzmagazin für die ältere und gebildetere Jugend sich mit den Gammlern solidarisierte, zeigt schon, dass sie in dieser Schicht Verbündete hatten. Aber auch die etablierten Medien und der Staat reagierten nicht immer so ablehnend, wie Gammler und Provos es aus Gründen der Selbsterhöhung oftmals darstellten. So wurde zwar gegen vier der im Aschinger festgesetzten jungen Leute Anklage erhoben, doch bescheinigte das Gericht ihrer Aktion eine gewisse Berechtigung und stellte das Verfahren ein: Die Angeklagten hätten »aus verständlichen Motiven« gegen die willkürliche Selektion nach Geschmackskriterien protestiert.6
Pardon karikiert den Anti-Gammler-Kämpfer Ludwig Erhard, August 1966.
In ihren politischen Vorstellungen waren die Provos so radikal wie keine andere Gruppierung, denn sie leiteten ihre Forderungen aus dem Anspruch auf ein anderes Leben ab. Hans-Peter Ernst, ihr Frankfurter Anführer, der abgebrochene Berufsausbildungen als Koch und Bäcker hinter sich hatte, erklärte im Frühjahr 1968 die Umwälzung der Lebensweise zum einzig gültigen revolutionären Konzept überhaupt: Allein »die Bedürfnisse unserer Generation« seien der »Maßstab für unsere revolutionären Ziele«.7 Die Legitimität der Revolution lag weder in politischen Unzulänglichkeiten der Bundesrepublik – den Notstandsgesetzen oder einer unbearbeiteten NS-Vergangenheit – noch in der Ungerechtigkeit der Welt, sondern ganz allein in den unbefriedigten Bedürfnissen der jungen Nonkonformisten. Insofern war Ernst sehr bewusst ein »Revolutionär des modernen Daseins« – wie der Soziologe Walter Hollstein den Prototyp dieser Gruppe bezeichnete.8
War der Anspruch auf ein ganz anderes Leben schon Mitte der 1960er Jahre in manchen Praktiken der jugendlichen Akteure angelegt, so wurde er spätestens seit 1967 zu einer eigenständigen Triebkraft der Jugendrevolte, die sich nicht mehr in politischen Forderungen erschöpfte. Diese Utopie, wie sie Parolen wie »Die Phantasie an die Macht!« oder »Wir wollen alles!« widerspiegeln, macht das anhaltende Faszinosum von 1968 aus. Daher greifen alle Versuche zu kurz, dieses Datum auf politische Merkmale oder auf eine funktionale Rolle zur Liberalisierung der Bundesrepublik begrenzen zu wollen. Dass es um mehr ging – um eine neue Politik und um eine neue Lebensweise –, wurde besonders deutlich, als auf dem Höhepunkt der Revolte 1967/68 politische und kulturelle Erneuerungsimpulse miteinander verschmolzen. Aber der hohe Anspruch war auch in der anschließenden Spaltungsphase noch deutlich sichtbar: in der Jugendzentrumsbewegung etwa, die Anfang der 1970er Jahre entstand, aber auch unter Spontis und im Alternativmilieu, in den religiösen Erneuerungsbewegungen und selbst in den zahlreichen kommunistischen Gruppierungen, die ja von dem Ideal einer neuen Gesellschaft angetrieben wurden und die Befriedigung individueller Bedürfnisse im Hier und Jetzt zurückstellten, um dieses Ziel zu erreichen.
Unschwer lassen sich an den Frankfurter Provos Elemente erkennen, die in den Folgejahren auf massenhafte Akzeptanz stoßen sollten: lange Haare und legere Kleidung, der Anspruch auf Lebensgenuss jenseits der Arbeitssphäre, der internationale Horizont, grundsätzliche Gesellschaftskritik, das Insistieren auf Freiheitsrechten und der Legitimität eines individuell gewählten Lebensstils, die Provokation als Mittel der politischen Intervention. Gerade die Tatsache, dass diese Stilelemente nicht unbedingt mit radikalem Ausstieg verbunden sein mussten, sondern im Alltag übernommen werden konnten, machte sie so attraktiv. Dass alternative Vorstellungen von einem guten Leben überhaupt entstehen und um sich greifen konnten, war auch ein Effekt der verbesserten Rahmenbedingungen. Aber die Phantasie der Bevölkerungsmehrheit war noch stark in der Tradition verhaftet. Sie reichte selten aus, um daraus weite Horizonte für das eigene Leben oder neue gesellschaftliche Ideale abzuleiten, sondern viele klammerten sich an die materiellen Verbesserungen. So jedenfalls sah es Hans-Jürgen Krahl, der intellektuelle Wortführer des Frankfurter SDS, der im Hinblick auf die Wahrnehmung des wachsenden Wohlstands eine weit auseinanderklaffende Schere zwischen der Bevölkerung auf der einen, der Studentenbewegung auf der anderen Seite ausmachte. Dass aus der enormen Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen keine »Entfaltung der Menschen« resultierte, »die weit darüber hinausgehen könnte«, war für ihn »die eigentliche Knechtschaft im Kapitalismus«.9 »Das ist das Moment sozialer Unterdrückung, das wir als diejenigen, die privilegiert sind zu studieren, auch einsehen konnten. Und dieses Privileg wollen wir durchbrechen.« Darin, so Krahl, zeige sich der »Verfall des bürgerlichen Individuums« – und die eigentliche Ursache für die Entstehung der antiautoritären Bewegung. Dass der Wertewandel am Ende der 1960er Jahre bereits in vollem Gange war, konnten viele Zeitgenossen nicht überblicken. Für Krahl und Genossen stellte der cultural lag der Bevölkerungsmehrheit kein Übergangsphänomen dar, sondern ein Strukturmerkmal des »Spätkapitalismus«, der nur durch den revolutionären Sprung zu überwinden war.
Krahls Begründung deutet schon an, dass die Motive von Provos und Studentenbewegten nicht weit voneinander entfernt lagen. Denn im Kielwasser des cultural lag zwischen der rasanten Entwicklung der materiellen Kultur und dem vermeintlich zurückgebliebenen Bewusstsein der Mehrheit war aus der Sicht des SDS ein Potenzial herangereift, das eine weitere Radikalisierung zuließ. Die 1966 neu gewählten SDS-Vorsitzenden Reimut Reiche und Peter Gäng brachten dem Studentenverband die Idee einer Jugendrevolte nahe, die bei der Beobachtung ansetzte, dass nonkonformistische Jugendliche das rebellischste Element in der Gesellschaft darstellten: Gammler und Provos, Kriegsdienstverweigerer, Ostermarschierer, Folk- und Beat-Adepten. Jede oppositionelle Bewegung in den Metropolen habe sich primär auf »die Jungen« zu stützen, erklärten sie in einem Strategiepapier vom April 1967, und am aussichtsreichsten sei es, »die unpolitische Protesthaltung der Jugendlichen« zu politisieren und in einem organisatorischen Rahmen zur Entfaltung kommen zu lassen.10 Diese Neuorientierung hin zur Jugend als Subjekt der Revolte entsprach auch einer Annäherung der Szenen auf der Straße – Gammler und rebellische Studierende machten zunehmend gemeinsame Sache.
Natürlich waren Gammler als kleine radikale Subkultur alles andere als repräsentativ. Die Bezeichnung verschwand allmählich aus den Medien, als größere Gruppen von Jugendlichen sich ähnlich kleideten, ähnliche Freizeitinteressen hatten und ähnliche politische Ansichten äußerten. 1968 wurden sie unter Begriffen wie Studentenbewegung, Provos oder APO subsumiert, was zugleich die Verbreitung mancher ihrer Stilmerkmale illustriert. Und bis zu einem bestimmten Grad waren sie die Vorreiter eines Trends weg von der zentralen Stellung der Arbeit im Leben der Bürger, hin zu mehr Freizeit, Genuss und sogar Müßiggang. Das dokumentiert die euphorische Resonanz auf einen weiteren, zwei Jahre nach Fleischmanns Dokumentation ebenfalls in München gedrehten Film, der eine fiktive Geschichte erzählt: Zur Sache, Schätzchen von May Spils. Darin geht es nicht um gesellschaftliche Außenseiter, sondern um die Provokation des lakonischen Nichtstuns im Alltag des Schwabinger Bohemien Martin (gespielt von Werner Enke), dessen Desengagement seiner Zufallsbekanntschaft, der Bürgerstochter Barbara (Uschi Glas), gegen den Strich geht. In seinem Statement gegen die Sinnleere der »Leistungsgesellschaft« kommt Martins Lässigkeit so unpathetisch daher, dass sie sogar das Pathos der Verweigerung vermissen lässt, das bei Fleischmanns Dokumentation noch ungefiltert hervortritt.11 Sein Ort, um es bildlich zu fassen, ist nicht die Straße, sondern das Bett.
May Spils’ Komödie ist als Kultfilm von 1968 in die Geschichte eingegangen, ohne die mit dem Jahr gemeinhin verbundenen Assoziationen zu bedienen, wie es noch Fleischmanns Aussteiger-Helden taten. Es geht nicht um Anklage, Protest, Verweigerung oder auch nur Kulturkritik, noch erfüllt Spils die Erwartung des Publikums, mehr über die »Sache« zu erfahren, die der Titel des Films im Kontext der Sexwelle verspricht. Ihr »Film der entschlossenen Unentschiedenheit« huldigt aber auch nicht der Konsumkultur, sondern ironisiert etwa die Schlagertexte, mit denen Martin »Ideenkäufer« beliefert, um sich über Wasser zu halten.12 Die Presse erfreute sich an diesem »flinkfidele[n], unkomplizierte[n] Lotterspiel über Münchens Espresso-Jeunesse«.13 Martin, so urteilte Else Goelz in der Stuttgarter Zeitung, »ist ein Gammler, der dieser Spezies das eigentlich unvereinbare Attribut des Liebenswürdigen einverleibt«.14 Er ließ damit den Reiz eines »coolen und abgebrühten Hedonismus« mit Subversionspotenzial für eine größere Gruppe der Gesellschaft höchst attraktiv erscheinen.15
Aufbruch in andere Wirklichkeiten: Drogen
Dass das andere Leben sich nicht auf die bekannte Welt beschränken musste, sondern auf weitere Wirklichkeitsdimensionen erstrecken konnte, zeigt der Anstieg des Drogenkonsums. Im Milieu der Gegenkultur wurden Narkotika als Mittel der Bewusstseinserweiterung betrachtet, aber sie sollten in Verbindung mit anderen Stimulanzien, nicht zuletzt mit Popmusik und visuellen Eindrücken, auch eine neue Sensibilität, eine verfeinerte Wahrnehmung erzeugen. Sie konnten der Phantasie auf die Sprünge helfen. Der Sexualwissenschaftler und Drogenexperte Günter Amendt, der in den 1960er Jahren selbst einschlägige Erfahrungen gemacht hatte, u. a. mit LSD, sah darin auch rückblickend eine »Produktivkraft«: Drogen »haben meinen Blick geschärft und meine Wahrnehmung sensibilisiert, sie haben mir sinnlich erfahrbar gemacht, was mir analytisches Denken schon lange vorher bewusst gemacht hatte: Es gibt mehr als nur eine Realität und folglich auch mehr als nur eine Wahrheit.«1 In dieser euphorischen, durch keine spätere Erfahrung mit der dunklen Seite des Drogenkonsums oder durch taktische Vorbehalte verstellten Vision tritt noch im Nachhinein die Kraft der Idee einer Bewusstseinserweiterung hervor. Eine bodenständigere Wirkung war, dass der Drogengenuss gemeinschaftsbildend wirkte und zu einem Bindemittel innerhalb der Subkultur wurde – nicht zuletzt, weil er häufig in der Öffentlichkeit vonstattenging und daher Zusammenhalt nach innen und Abgrenzung nach außen signalisierte.