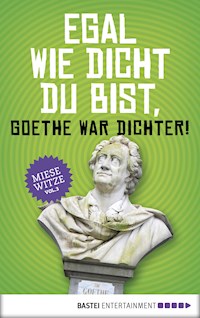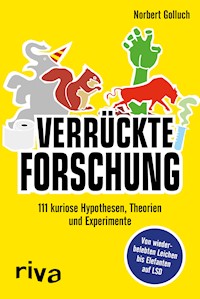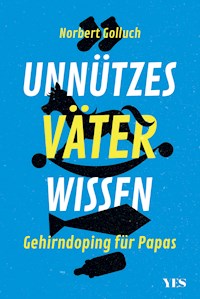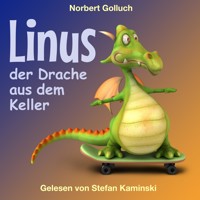Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine volle Festplatte macht den Computer noch lange nicht langsam. Körpersprache ist keineswegs international. Ammoniten sind keine versteinerten Schnecken und Erdnüsse auch keine Nüsse. Viele Gewissheiten, die einem so selbstverständlich erscheinen wie dem kleinen Kind der Weihnachtsmann, sind schlicht und ergreifend nicht wahr. In über 500 pointierten Texten räumt Norbert Golluch die am weitesten verbreiteten Irrtümer aus und überrascht auf diese Art und Weise jeden Leser immer wieder neu. Ob Pflanzen und Tiere, Medizin, Ernährung, Geografie und viele mehr – kein Interessensgebiet, das "555 populäre Irrtümer" nicht abgedeckt. Das Buch für alle, die es ganz genau wissen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
[email protected]
2. Auflage 2019
© 2015 by riva Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Stefanie Barthold
Umschlaggestaltung: Kristin Hoffmann, München
Abbildungen Umschlag und Innenteil: Kristin Hoffmann und Shutterstock
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print: 978-3-86883-551-0
ISBN E-Book (PDF): 978-3-86413-507-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86413-508-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Man erkennt den Irrtum daran, dass alle Welt ihn teilt.
(Jean Giraudoux, französischer Schriftsteller, 1882–1944)
Inhalt
Titel
Impressum
Zitat
Inhalt
Vorwort
Blinde Schlangen und Alter nach Punkten:Tiere
Seltsame Beeren und Regenwald eiskalt:Pflanzen
Großvater Affe und der Schlaf vor Mitternacht:Der menschliche Körper
Von der Höhle zur Autobahn:Geschichten und Geschichte
Legenden von der Frische und Glück aus der Banane:Essen und Trinken
Warum Kolumbus nicht von der Scheibe fiel:Geografie
Kometenschweife und Wasseradern:Naturwissenschaft
Wahre Erfinder und zu volle Festplatten:Technik und Technikgeschichte
Olle Kamellen unter aller Sau:Sprache
Die Schuld beim Auffahren ohne Personalausweis:Recht und Gesetz
Der Walzer, der keiner war:Musik
Die Putzfrau und die Avantgarde:Kunst
Old Shatterhand und Frankensteins Monster:Literatur
Miss Sophie und der blaue Engel:Film und Fernsehen
Aus diversen Schubladen:Alltagsirrtümer
… ein paar neue Irrtümer?
Über den Autor
Vorwort
Wasser ist nass. Gegenüber von Norden liegt Süden. Manche Dinge stellen wir nicht infrage – dass die Sonne morgens aufgeht und abends untergeht zum Beispiel, dass sich die Zeit vorwärts und niemals rückwärts bewegt und dass wir jeden Tag älter werden. Mit einer Änderung dieser Prämissen würden wir unser Weltbild ins Wanken bringen. Andere Gewissheiten gewinnen ihre Bedeutung einfach aus ihrer stereotypen Präsenz, man hält etwas einfach für wahr, weil es immer so war oder weil schon Mutter es so kannte – ohne es zu hinterfragen. Häufig ruht eine solche gewohnte Sicherheit aber auf tönernen Füßen. Das fällt im alltäglichen Leben nicht auf, weil diese Annahmen keine konkreten Folgen haben und weil unser Alltag eine erstaunliche Fehlertoleranz aufweist.
Auch wenn viele Menschen irrtümlich daran glauben: Freitag, der 13. bringt nicht wirklich Unglück und bei Vollmond schläft man höchstens schlecht, weil man es sich einredet. Wenn wir das Feld der traditionellen Irrungen hinter uns lassen, tun sich weitere Möglichkeiten für unterhaltsame Irrtümer auf: Neu erworbenes Wissen, die letzte Diät in der Frauenzeitschrift, fragwürdige Informationen aus Sensationsmedien, der letzte Hype aus dem Internet oder die Erkenntnisse einer spekulativen Wissenschaft stellen Behauptungen auf, die sich im Nachhinein als fehlerhaft, weil ungenügend recherchiert, manipuliert oder durch neuere Untersuchungen überholt, erweisen. Das Feld der Irrtümer ist also groß – beginnen wir, es zu beackern und uns über die Unwissenheit unserer Mitmenschen zu belustigen. Ein Gedanke sollte dabei allerdings nicht in Vergessenheit geraten: Die Gewissheit von heute ist der Irrtum von morgen. Es könnte schon bald sein, dass auch jemand über die Irrtümer in diesem Buch lacht.
Blinde Schlangen und Alter nach PunktenTiere
Was wissen wir nicht alles über Tiere? Mäuse fressen Käse, und Bären lieben Honig. Katzen sehen auch im Dunkeln. Ohrenkneifer kriechen mit Vorliebe in Ohren, Insekten mit gelb-schwarzem Hinterteil sind entweder fleißige Bienen oder bösartige Wespen. Der Stich von Libelle und Hornisse ist gefährlich, Blindschleichen sind blinde Schlangen und Glühwürmchen leuchtende Würmer. Die Anzahl der Irrtümer über Tiere ist beachtlich. Bekämpfen wir sie also, beginnend mit den Würmern, die keine sind.
Glühwürmchen sind glühende Würmer.
Nein, bei den Glühwürmchen handelt es sich um eine Käferart. Die Leuchtkäfer tragen den niedlichen lateinischen Namen Lampyridae, und ihr Verfahren, Licht zu erzeugen, nennt man Biolumineszenz. Die Substanz, die ihnen dieses ermöglicht, nennt sich Luciferin, und die Lichtausbeute dieser Tiere ist erstaunlich. Sie erzeugen kaltes Licht, das heißt, es gibt fast keine Wärmeverluste, sodass sie 95 Prozent der eingesetzten Energie in Licht umwandeln können. Von einem solchen Wirkungsgrad in der Beleuchtungstechnik träumen wir Menschen. Natürlich geht es bei den Lichteffekten der Käfer um die Liebe – Männchen und Weibchen sollen zueinanderfinden. Jede Käferart hat einen unterschiedlichen Leuchtcode. Bei einigen Arten leuchten nur die Weibchen, bei anderen auch die Männchen. Besonders effektvoll gestalten die Arten Pteroptyx gelasina und Pteroptyx similis ihre Lightshow – alle Käfer, die einander sehen können, synchronisieren ihre Blinksignale, was ganze Strauchgruppen oder sogar Baumreihen in eine blinkende Festbeleuchtung hüllt.
Chamäleons passen sich der Farbe ihrer Umgebung an.
Dieses Verhalten würde ihnen zwar einen enormen evolutionären Vorteil bringen, aber leider funktioniert es nicht immer so perfekt. Zwar nehmen Chamäleons die Farbe ihres Untergrunds an, wenn sie ruhen, sonst stellt ihre Hautoberfläche aber eher einen Monitor ihres Gefühlszustands dar als ein Tarnungsinstrument. Mit ihrer Farbe und Musterung signalisieren sie ihren Artgenossen zum Beispiel Paarungsbereitschaft oder auch aggressive Stimmungen. Wichtig ist die Farbe auch für die Regulation der Körpertemperatur – Chamäleons sind wechselwarme Reptilien. Brennt ihnen die Sonne auf den Pelz, sodass der Körper zu überhitzen droht, wählen sie eine helle Farbe, um das auffallende Sonnenlicht zu reflektieren. Wird es kühl, absorbiert eine dunkle Hautoberfläche die auftreffende Lichtenergie besser.
Fische sind kalt wie … Fische eben.
Ein kuschelig warmer Fisch ist eine merkwürdige Vorstellung. Fische sind wechselwarme Tiere, deren Körpertemperatur durch die Umgebung bestimmt wird – wenn das Wasser kalt ist, sind auch die Fische kalt. Falsch! Im Inneren von Tunfischen liegt die Körpertemperatur um mehr als zehn Grad über der des umgebenden Wassers. Das befähigt sie zu besseren Muskelleistungen und somit zu größerer Beweglichkeit. Ähnliches gilt für Haie – ihr Körper nutzt durch eine besondere Form des Blutkreislaufs (Gegenströmungsprinzip) die Wärme der Muskeln besser, ihre Kerntemperatur liegt um etwa 6 °C über der des Wassers. Eine sehr selektive Form von erhöhter Körpertemperatur begünstigt den Schwertfisch. Die Netzhaut seiner Augen ist um 15 bis 28 °C wärmer als die Umgebung. Dafür sorgt ein Muskel hinter dem Auge. Dadurch funktionieren die Sehnerven besser und schneller, der Raubfisch ist seiner Beute deutlich überlegen.
Vögel brüten ihre Eier aus.
Irrtum, manche lassen auch brüten. Der Kuckuck zum Beispiel, aber das ist ja sicher bekannt. Einen ganz besonderen Fall stellt die folgende Vogelart dar: Das Thermometerhuhn (Leipoa ocellata) im südlichen Australien nutzt die Wärme von verrottenden Pflanzenteilen, um seine Eier auszubrüten. Das Tier häuft Blätter und anderes kompostierbares Material an. Sein »Nest« erreicht eine Höhe von bis zu 1,50 Metern. Dann legt es seine Eier darin ab. Die Bruttemperatur sollte bei 33 °C liegen, und erstaunlicherweise benutzt der Vogel seinen langen Schnabel wie ein Thermometer, um das zu überprüfen. Wenn die Prüfung des Nests mit dem Schnabel eine zu geringe Temperatur ergibt, wird neues Laub aufgeschichtet. Ist es drinnen zu warm, entfernt der schlaue Vogel eine gewisse Menge kompostierender Masse.
Alle Fische atmen durch Kiemen.
Irrtum. Das stimmt für die meisten Fischarten, aber es sind eben nicht alle. Es gibt einige wenige Arten, die ihren Sauerstoff auf anderem Wege beziehen. Der Afrikanische Lungenfisch macht seinem Namen alle Ehre – er atmet durch Lungen und kann auch auf dem Land überleben. Allerdings atmet er nur durch seine Lungen, wenn er unbedingt muss. Solange es Wasser gibt und seine schleimige Haut feucht bleibt, bezieht er den Großteil seines Sauerstoffs über die Haut – aus der Luft oder aus dem Wasser. Er verfügt zwar noch über Kiemen, allerdings sind diese stark zurückgebildet und nicht mehr funktionsfähig. Die Hautatmung nutzen auch Flunder, Seezunge, Kabeljau und Aal. Andere Fischarten nehmen ihre Luft auf noch exotischere Weise zu sich: Die Atmung durch den Verdauungstrakt, die Schwimmblase oder besondere Schädelkammern wird unter den Flossenträgern ebenfalls praktiziert. Womit eine Eigenschaft angesprochen wird, die allen Fischen gemeinsam ist, gleichgültig, wie sie an ihren Sauerstoff kommen: Sie alle haben Flossen.
Bienen sind gelb-schwarz gestreift.
Nicht nur, dass ständig Bienen und Wespen verwechselt werden, das Gelb-Schwarz-Muster bringt uns Menschen gedanklich ziemlich durcheinander und produziert gleich eine ganze Reihe von Irrtümern. Nein, Bienen haben gar keinen schwarz-gelb gestreiften Hinterleib, sondern eine hell-dunkle Streifenfärbung. Biene Maja und ihr Freund Willi sind farblich zumindest überhöht dargestellt. Wenn tatsächlich gelbe und schwarze Streifen aufeinanderfolgen, haben wir meist eine Wespe vor uns – oder einen Spieler von Borussia Dortmund. Scherz beiseite – das von der Natur entwickelte, äußerst effektive Warnmuster erfüllt verschiedene Aufgaben. Gelb-Schwarz bedeutet an vielen Stellen in der Natur »Vorsicht, Gefahr!«. Gelb-Schwarz schützt die so gestreiften Insekten davor, vom Vogel gefressen zu werden, warnen doch die Streifen vor dem giftigen und schmerzhaften Stachel der wehrhaften Insekten. Davon profitieren aber nicht nur Hornissen (eine besonders große Wespenart) und andere Wespen, die tatsächlich bewaffnet sind, sondern auch eine ganze Reihe von völlig harmlosen, ja geradezu wehrlosen Insektenarten wie die Dickkopffliegen, bestimmte Schwebfliegen-Arten wie die Hainschwebfliege, die Späte-Gelbrand-Schwebfliege oder die Wespenschwebfliege. Ihr im Vergleich zu Wespen völlig anderes Flugverhalten fällt wohl nur uns Menschen auf den ersten Blick auf. Diese ziemlich geniale Anpassung nennt man Mimikry. Auch Käfer und Schmetterlinge machen in Gelb-Schwarz, so der Echte Widderbock und der Eichenwidderbock, zwei nahe verwandte Käferarten, oder der Hornissen-Glasflügler, ein kleiner Schmetterling. Sie alle profitieren in gewisser Weise von der Wehrhaftigkeit anderer. Auch die Wespenspinne – kein Insekt – nutzt die warnende Farbkombination, obwohl sie auch selbst immerhin über Giftklauen verfügt. Sicher ist sicher.
Apropos Sicherheit: Leider funktioniert dieser Schutz durch Anpassung nicht sofort, sondern oft erst dann, wenn der Fressfeind einmal versehentlich eine Wespe erwischt hat. Vor diesem unerfreulichen Ereignis schmecken ihm die wehrlosen Mimikry-Anwender eigentlich ganz gut, erst nach der schmerzhaften Erfahrung zögert der nun besser informierte Räuber, bevor er wieder zuschlägt. Schlimmer allerdings für die armen Opfer: Manche Vogelarten können die gefährlichen Originale perfekt von den schmackhaften Imitatoren unterscheiden.
Abschließend wäre vielleicht noch zu sagen, dass die stachelbewehrten Insekten die Warnfarbe nicht gepachtet haben. Kröten, Feuersalamander, Schlangen, Giftfrösche und Menschen verwenden die auffällige Farbkombination mit großem Erfolg. Die Grenzpfähle der österreichisch-ungarischen Monarchie sollen gelb-schwarz gewesen sein, und in unserem Lande finden wir die warnende Konstellation auf jedem Ortsschild, auch wenn es nur wenige Orte gibt, vor denen tatsächlich gewarnt werden müsste.
Bienen sterben, nachdem sie gestochen haben.
Die Waffe der Bienen, ihr Giftstachel, ist nicht nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn der Stachel einer Biene zum Nutzen des Bienenstaats gegen einen Angreifer aus dem Insektenreich eingesetzt wird, muss das noch lange nicht alles gewesen sein. Die tapfere Verteidigerin stirbt nicht, wenn sie ihren Stachel zum Beispiel in den Chitinpanzer eines feindlichen Insekts bohrt. Sie kann ihn mühelos wieder herausziehen und ein zweites Mal zustechen. Das Stechen in die Haut eines Menschen oder in ähnliche Materialien wie zum Beispiel Lederhandschuhe bringt für die Biene aber Probleme mit sich. Die elastische menschliche Haut hält den mit kleinen Widerhaken bewehrten Stachel gefangen, und wenn die Biene versucht, ihn herauszuziehen, reißt sie sich dabei den unteren Hinterleib oder Teile davon ab. Je nach der Schwere seiner Verletzung stirbt das Tier innerhalb kurzer Zeit, kann aber auch noch etliche Tage überleben. Interessant für uns Menschen und unangenehm zugleich ist die Tatsache, dass der abgerissene Stachel autonom funktionieren kann – er pumpt, auch ohne mit der Biene verbunden zu sein, für eine Weile weiter Gift in die Stichwunde.
Wespen, die ihren Stachel nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Erlegen von Beute benutzen, sind besser ausgestattet. Zwar kommt es in seltenen Fällen ebenfalls vor, dass ihr Stachel hängen bleibt, doch im Regelfall bleibt die Wespe unverletzt.
Ohrwürmer krabbeln Menschen in die Ohren.
Es ist so etwas wie eine Urangst, die diese Insekten auslösen: Was mache ich nur, wenn der Ohrwurm mir jetzt ins Ohr kriecht? Meist ist es auch noch der Gemeine Ohrwurm, vor dem sind mancher fürchtet. Allerdings steht das gemein in seinem Namen für gewöhnlich, und Ohrwürmer sehen es keinesfalls als ihren Lebenszweck an, jemandem ins Ohr zu kriechen. Auch wenn sie mit ihren Zangen am Hinterleib gefährlich aussehen – ihnen verdanken sie auch den zweiten Namen Ohrenkneifer –, sie sind für Menschen ungefährlich. Sie lieben aber dunkle Verstecke und kriechen deshalb in alle möglichen Öffnungen und Ritzen. Ein Ohr ist, wenn überhaupt, nur aus Versehen dabei.
Dieses Wissen jedoch dürfte bei den Betroffenen die Angst vor den Insekten der Ordnung Dermaptera kaum verringern, und wenn man weiß, dass die Biester auch noch fliegen können … und dass es einen bis zu fünf Zentimeter langen Riesenohrwurm gibt …
Der Stich einer Libelle ist gefährlich und schmerzhaft.
In manchen Gegenden hält sich ein Irrglaube: Bienenstiche sind schlimm, Wespenstiche schlimmer, der Stich einer Hornisse gilt sogar als lebensgefährlich für das arme Opfer. Der schlimmste Stich von allen soll aber der der Libelle sein. Ängstlich laufen Kinder davon, wenn eine der schönen Wasserjungfern geflogen kommt. Der Volksmund verleiht den zarten Flügelwesen Namen wie Pferdetod,Augenbohrer,Schlangenstecher oder Teufelsnadel. Alles Humbug! Libellen haben überhaupt keinen Stachel – weder an ihrem Hinterteil noch an ihrem Maul. Vielmehr besitzen sie eine Fangmaske, mit der sie im Flug kleinere Insekten schnappen können – für diese sind sie tatsächlich ein tödliche Gefahr. Das kräftige Mundorgan bekommt auch ein Mensch zu spüren, der eine große Libelle in der Hand hält – als sanftes Knabbern, bestenfalls als Zwicken. Verletzungen kann eine Libelle damit einem Menschen nicht zufügen. Umgekehrt schweben aber Libellen in der Hand eines Menschen in Lebensgefahr.
Auch immer wieder geschilderte »Angriffe im Flug« beruhen auf einem Irrtum. Libellen sind – selten für eine Insektenart – neugierig auf uns Menschen, nähern sich interessiert und betrachten uns im Schwebeflug. Ängstliche Charaktere halten das für die Vorbereitung eines Sturzangriffs – der aber niemals erfolgt – und fürchten sich, zumal manche Libellenarten zu der beeindruckenden Größe von bis zu 18 Zentimetern heranwachsen können.
Vielleicht hat das Gerücht von der stechenden und gefährlichen Libelle folgenden Ursprung: Manche Arten besitzen hinten eine Legeröhre, man könnte auch sagen einen Legestachel, der aber nur zur Ablage der Eier im Wasser dient.
Drei Hornissenstiche töten einen Menschen, sieben ein Pferd.
Für Pferde sind Hornissen relativ ungefährlich, und auch die Bedrohung für Menschen wird maßlos übertrieben. Die großen Insekten aus der Familie der sozialen Faltenwespen sind vergleichsweise friedliche Wesen und ähneln in ihrem Bedrohungspotenzial in etwa den Hummeln. Nur wenn ein Mensch Hornissen festhält, quetscht, ihr Nest bedrängt oder es in Gefahr bringt, wehren sich die Tiere – einfach so und aus Boshaftigkeit stechen sie nicht. Dabei ist ihr Stich durchaus nicht so giftig, wie es der eingangs angeführte Spruch behauptet. Hornissenstiche sind zwar sehr unangenehm, weil einer ihrer Inhaltsstoffe, ein reichlich vorhandener Neurotransmitter namens Acetylcholin, den Schmerzeffekt gegenüber einem Wespenstich deutlich erhöht. Aber erst 500 bis 1000 von ihnen würden einen erwachsenen Menschen in Lebensgefahr bringen. Nicht einmal ein ganzer Hornissenstaat enthält so viele stechende Tiere. Wer allerdings gegen das Gift von Bienen, Wespen oder Hornissen allergisch ist, für den kann schon ein einzelner Stich lebensbedrohlich werden. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind nötig.
Wichtig für die Gefahrenabwehr am Hornissennest sind folgende Informationen: Hornissen haben einen Verteidigungsradius von mehreren Metern rund um ihr Nest. Bei der einen Art ist er größer, bei der anderen etwas kleiner. Wer ihn respektiert, lebt sicher. Unruhe rund um ihr Nest regt Hornissen auf. Bauarbeiten mit Maschinen und Rasenmähen sollte man vermeiden. Auf Dauer macht das die Tiere aggressiver. Hornissen stehen unter Artenschutz. Man darf ihre Nester weder eigenhändig entfernen (viel Spaß!) noch vernichten. Wenn sie sich an einem sehr ungünstigen Ort befinden, kann ein geschulter Kammerjäger bei einer Umsiedlung helfen. Die örtlichen Behörden vermitteln kompetente Unterstützung.
Die Bisamratte ist eine Ratte.
Nein, das ist sie nicht, auch wenn sie wie eine etwas groß geratene Ratte aussieht und wie diese in der wissenschaftlichen Systematik zur Ordnung der Nagetiere gehört. Ganz präzise eingeordnet gehört sie zur Überfamilie Muroidea (Mäuseartige), zu der die Familie Cricetidae (Wühler) gerechnet wird; darin zur Unterfamilie Microtinae (Wühlmäuse) und hier zur Gattungsgruppe Microtini (Eigentliche Wühlmäuse) und in dieser zur Gattung Ondatra. Sie ist die größte aller Wühlmäuse und näher mit der Feldmaus, der Rötelmaus, den Schermäusen und den Lemmingen verwandt als mit den Ratten.
Die Ratten hingegen gehören zwar auch zur Überfamilie Muroidea (Mäuseartige), darin aber zur Familie Muridae (Mäuse) und in dieser zur Unterfamilie Murinae (Echte Mäuse), zu denen wiederum die Gattung Rattus (Eigentliche Ratten) mit den Arten Wanderratte und Hausratte zählt. Ganz schön kompliziert, oder? Einfacher gesagt: Löwe, Tiger, Leopard und Jaguar sind deutlich näher miteinander verwandt (die gehören zur selben Gattung) oder auch der Europäische Feldhase und das Zwergkaninchen (dieselbe Unterfamilie).
Bisamratten kommen ursprünglich aus Nordamerika und haben sich erst seit etwas mehr als 100 Jahren zunächst in Europa und später auch in asiatischen Lebensräumen verbreitet. Die ersten Exemplare brachte im Jahr 1905 ein böhmischer Fürst, vermutlich wegen des dichten Pelzes, von einer Reise mit und setzte sie in seinem Jagdrevier aus. Von dort aus verbreiteten sich die Tiere mit großer Geschwindigkeit bis in die Nachbarländer. Eine weitere Gruppe von 500 Exemplaren kam 1930 hinzu. Die Tiere waren aus einer Zuchtanlage in Frankreich ausgebrochen. Heute sind sie nahezu überall im nördlichen Europa und in Asien vertreten.
Nicht nur in ihrer wissenschaftlichen Einordnung, sondern auch in ihrer Lebensweise und Ernährung unterscheiden sich Bisamratten von den Haus- oder Wanderratten, die man als Allesfresser bezeichnen kann. Bisamratten sind auf Wasser angewiesen, Wasserpflanzen stellen den Großteil ihrer Nahrung dar, hinzu kommen Wasserinsekten, deren Larven, Schnecken und Muscheln und auch hin und wieder ein Krebs oder Fisch.
Kopfläuse verbreiten sich über Kleidungsstücke.
So glaubte man lange Zeit und traf Vorsorge. Garderobenhaken in Schule oder Kindergarten müssen einen Mindestabstand haben, damit sich die Kleidungsstücke nicht berühren und unliebsame Gäste vom einen auf das andere überspringen können – so dachte man. Und wenn es einmal zu einem Auftreten von Kopfläusen kam, musste alles gereinigt und desinfiziert werden – jedes Kleidungsstück, die Bettwäsche, viele Gebrauchsgegenstände und das Spielzeug der minderjährigen Betroffenen. Auch Teddy war dran. Läusekämme, Sprays und Spezialshampoos kamen zum Einsatz. Dabei ist alles halb so wild, was die Verbreitung der Parasiten über die Kleidung angeht. Unterschiedliche Studien in Polen und Australien sollen nämlich gezeigt haben, dass sich die Läuse fast nur über direkten Kontakt übertrugen, nämlich dann, wenn die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe zusammensteckten. Auf der Kleidung, auf Mützen oder Plüschtieren wurden so gut wie nie Exemplare der Kopflaus gefunden. Nicht einmal auf dem Kopfkissen befallener Kinder warteten sie auf ihre Opfer.
Lemminge begehen Massenselbstmord.
Sie denken gar nicht daran. Wenn man in Filmszenen eine riesige Anzahl von Lemmingen sieht, die sich über eine Klippe in einen Fluss oder einen Ozean stürzen, so sind diese Szenen von fragwürdigen »Naturfilmern« mit Unmengen von gefangenen Lemmingen gestellt worden. Für den Disney-Film »White Wilderness« (»Abenteuer in der weißen Wildnis«) aus dem Jahr 1957 sollen Unmengen von Lemmingen bei Eskimokindern in Manitoba gekauft worden sein. Diese wurden sodann in die kanadische Provinz Alberta gebracht, wo es von Natur aus überhaupt keine Lemminge gibt, und für die Filmaufnahmen auf eine große rotierende Scheibe gesetzt. Die einzelnen Takes aus verschiedenen Winkeln als Schleife mit immer denselben Tieren ergaben dann die massenhafte »Wanderung« der Lemminge im Film. Dieses Vorgehen könnte man noch als halbwegs legitimen Trick von Filmprofis durchgehen lassen, aber die Art, wie die dann folgenden Szenen entstanden sein sollen, kann man nur noch verwerflich nennen.
»Die Lemminge erreichen den tödlichen Abgrund. Dies ist ihre letzte Chance zur Umkehr. Aber sie laufen weiter, stürzen sich in die Tiefe.« So kommentiert die Offstimme das Geschehen. Die Nagetiere stürzen kopfüber in eine Schlucht, eine tragische Szene, welche die Kamera messerscharf festhält. Weil aber die Lemminge nicht springen wollten und auch sonst keinerlei Anzeichen von Lebensmüdigkeit zeigten, sollen die Tierfilmer nachgeholfen haben und die Tiere in den Abgrund geschubst oder geworfen haben. Anschließend sollen sie die Nager dem Tod durch Ertrinken »im Arktischen Ozean« überlassen haben. Genau das jedenfalls behauptete 1983 der Journalist Brian Vallée, der für das kanadische Fernsehen Recherchen über die Entstehung des Films angestellt hatte. Kollektiver Selbstmord ist die Sache dieser Nagetiere der arktischen Tundra nicht, zumal sie in einem Fluss nicht ertrinken würden, weil sie gute Schwimmer sind. Es kommt schlimmstenfalls vor, dass sich die Tiere in der Breite eines Gewässers oder in der Stärke einer Strömung verschätzen. In einem solchen Fall kann es sein, dass einige schwächere Individuen ertrinken.
Auf die Idee mit dem Massenselbstmord kamen ursprünglich Biologen, die die Population der Lemminge über die Jahre hinweg beobachteten. Auffällig war, dass es zunächst sehr viele Lemminge gab, sich ihre Anzahl aber in einem einzigen Jahr stark verringerte. Ursache war aber kein rätselhafter Todestrieb, der auch sonst in der Natur nicht vorkommt, sondern die natürlichen Feinde der kleinen Wühlmäuse mit dem Stummelschwanz. Der Marder, die Schnee-Eule und andere Raubvögel sowie der Polarfuchs stellen den Tieren nach und jagen sie auch den Winter über, denn Lemminge halten keinen Winterschlaf. Irgendwann dezimieren immer mehr Beutegreifer den Bestand sehr stark. Erst in den darauffolgenden Jahren sorgen die sehr fruchtbaren Lemminge – ein Weibchen hat bis zu 35 Junge pro Jahr – für sehr viel Nachwuchs. Dabei hat sich ein Vier-Jahres-Rhythmus herausgebildet. In jedem vierten Jahr schrumpft die Lemming-Bevölkerung, weil sehr viele Räuber sehr viele Lemminge fressen. Dann reguliert der Hunger den Bestand an Beutegreifern. Nun geht es ihnen an den Kragen. Eulen, Füchse und Marder sterben, weil es nicht mehr genug Nahrung für sie gibt. Die Lemminge können sich wieder relativ ungestört und kräftig vermehren. Dabei gehen sie mit großem Eifer zu Werke, während sie selbstmörderische Absichten in keiner Phase ihres Lebens entwickeln.
Die Blindschleiche ist blind.
Nein, das Tier sieht eigentlich recht gut, die Blindschleiche ist mit leistungsfähigen Augen ausgestattet. Dies ist nur einer von mehreren Irrtümern rund um diese Echse. Die Silbe Blind hängt mit dem Verb blenden zusammen, ihr althochdeutscher Name plintslîcho bedeutet so viel wie blendende oder blinkende Schleiche. Wer einmal eine Blindschleiche im Sonnenlicht betrachtet hat, weiß, dass dieser Name richtig ist. In Bezug auf die zu den nahe mit den Eidechsen verwandten Schleichen gehörende Art unterliegt man aber auch noch einem zweiten Irrtum: Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Blindschleiche eine Schlange ist. Wenn man ihr in der Natur plötzlich begegnet, greift zunächst einmal der Urinstinkt: Vorsicht, tödliche Gefahr! Das Erscheinungsbild der erwachsenen Blindschleiche gibt jeden Anlass zu diesem ersten Zurückschrecken. Die Verwechslung mit der Schlange unterlief wohl auch dem schwedischen Naturforscher Carl von Linné, als er die Blindschleiche mit dem lateinischen Namen Anguis fragilis, zu Deutsch etwa zerbrechliche Schlange, bedachte. Nein, Carl, eigentlich ist die Blindschleiche eher so etwas wie eine Eidechse ohne Beine, und sie ist auf gewisse Weise auch zerbrechlich wie diese. Gemeinsam mit den Echten Eidechsen hat sie nämlich eine Eigenschaft, die den Schlangen fehlt: die Sollbruchstelle am Schwanz. Es handelt sich um einen im Lauf der Evolution entwickelten Sicherheitsmechanismus. An bestimmten Stellen ist das Muskel- und Bindegewebe schwächer ausgeprägt, bei Belastung kann es zu einem Abriss kommen. Bei Blindschleichen gibt es sogar mehrere solcher Sollbruchstellen, aber im Unterschied zu den Eidechsen wächst bei ihnen nichts nach, wenn der Schwanz verloren geht. Wenn die Stelle abheilt, bildet sich nur eine Art halbrunder Stumpf. Wegen dieser Zerbrechlichkeit heißt die Blindschleiche im Volksmund auch Glasschlange.
Apropos Volksmund: Ein dritter Irrtum manifestiert sich in weiteren Bezeichnungen für diese Tierart. Mancherorts werden Blindschleichen auch Heuwurm, Hartwurm oder Haselwurm genannt und somit unter die sehr primitiven Wirbellosen eingeordnet – ein Irrtum, der verständlich ist, wenn man einmal eine junge Blindschleiche gesehen hat, die kaum größer als ein Regenwurm ist.
Das Faultier ist das faulste Tier.
Ja, es ist schon erstaunlich langsam, das Faultier, und so wenig aktiv, dass in seinem Fell Flechten, Algen und Moose wachsen und über 100 Insektenarten wohnen. Darunter befinden sich sogar drei Schmetterlingsarten, deren Raupen sich von den Algen im Fell ernähren und zum Teil ihren ganzen Lebenszyklus auf dem Faultier verbringen. Neue Bekanntschaften knüpfen die Bewohner aus dem Insektenreich, wenn sich zwei Faultiere treffen, zum Beispiel zur Paarung.
Die Grün- und Blaualgen im Fell erzielen auch noch einen anderen Effekt: Sie lassen das Tier in verschiedenen Schattierungen grünlich schimmern, was eine perfekte Tarnung in den Kronen der Urwaldriesen darstellt.
Ist das Faultier nun das faulste Tier? Man müsste Faulheit genau definieren, um eine Entscheidung über den Sieger in dieser Disziplin treffen zu können. Wenn das tägliche Schlafbedürfnis ein Kriterium für Faulheit ist, so sind Koalabären dem Faultier deutlich überlegen: Koalas schlafen nämlich 20 Stunden, in Extremfällen sogar bis zu 22 Stunden am Tag, während die vergleichsweise aufgeweckten Faultiere mit etwa 15 bis 18 Stunden auskommen. Man könnte aber auch Langsamkeit oder Trägheit zum Kriterium für Faulheit machen, und in einem solchen Wettbewerb läge das Faultier sicher auf den vordersten Plätzen.
Rot macht Stiere aggressiv.
Nein, es ist nicht die Farbe, sondern die Bewegung des roten Tuches, der Muleta, die den Stier zum Angriff reizt. Die Farbe Rot nimmt er überhaupt nicht wahr, sagen Zoologen, denn Stiere sind rotgrünblind. Dafür ist der Stierkampf selbst ein rotes Tuch, das etliche Tierschützer zum Angriff reizt, denn die halten besonders die spanische Form des Stierkampfs, die Corrida de Toros, für Tierquälerei. Befürworter hingegen argumentieren, die Abschaffung des Stierkampfs würde sowohl die Rasse der Kampfstiere als auch ihren Lebensraum – die Dehesas, ökologisch wertvolle beweidete Eichenhaine – in ihrer Existenz gefährden.
Katzen sehen auch im Dunkeln gut.
Irrtum oder Wahrheit? Katzen haben sehr gute Augen. Ihre Pupillen sind außerordentlich anpassungsfähig, sie sehen bei hellstem Sonnenschein und bei nahezu vollständiger Dunkelheit sehr gut, und ihr Gesichtsfeld umfasst 280 Winkelgrade. Bei wenig Licht kommt ihnen eine reflektierende Schicht im Auge zugute, sie erhöht in der Dämmerung und bei nächtlichen Beleuchtungsverhältnissen die Leistung im Vergleich zum menschlichen Auge um über 50 Prozent. Bei absoluter Dunkelheit können natürlich auch Katzen nichts sehen.
Die Lachmöwe hat etwas mit Gelächter zu tun.
Auch wenn sich ihr Geschrei für viele Ohren wie Gelächter anhört: Eigentlich müsste der Buchstaben a in ihrem Namen lang ausgesprochen werden, denn der Name dieser kleinen Möwenart mit der schwarzen Maske hängt mit dem Wort Lache zusammen. Weil Lachmöwen auch an kleinen Binnengewässern siedeln – eine Lache genügt schon –, werden sie so genannt.
Haie sind extrem gefährlich.
Nach seriösen Quellen gehen auf der ganzen Welt etwa 10 bis 15 Tote pro Jahr auf das Konto des Weißen Hais und anderer gefährlicher Haiarten. Mehr als die Hälfte der Opfer von Haiattacken sind Surfer bzw. Windsurfer, gefolgt von Schwimmern mit knapp 40 Prozent. Der Weiße Hai ist die gefährlichste Art, tödliche Angriffe kommen etwa so häufig vor wie bei Tigerhai, Bullenhai, Blauhai und Sandtigerhai zusammen. Von anderen Haiarten wie etwa Hammerhai, Schwarzspitzenhai und Grauem Riffhai sind zwar Angriffe bekannt, diese verlaufen aber nur selten tödlich.
Zum Vergleich: Etwa 150 Personen sollen jährlich durch herabfallende Kokosnüsse sterben – die genaue Zahl wurde nirgendwo erfasst, sie wird aber sicher die der Toten durch Haiattacken übertreffen. Weit über 1000 Menschen kommen durch wilde Rinder ums Leben. Sind also Rinder die größte Gefahr für Leib und Leben? Keineswegs. Giftschlangen haben 80 000 jährliche Todesopfer auf ihrer Strichliste, giftige Quallen töten jedes Jahr 5500 Menschen, Skorpione bringen es auf etwa 5000 Opfer. Es folgen Krokodile (1000) und Elefanten (500), Nilpferde (100), Giftspinnen (80), Löwen (60) und Tiger (50). Sicher werden auch Giftfrosch, Nashorn und Büffel nicht ganz ungefährlich sein, sie werden allerdings von den meisten Statistiken nicht berücksichtigt. Wie übrigens auch ein Haustier: Hunde beißen jedes Jahr Millionen von Menschen, Hunderte ihrer Opfer sterben an den Folgen des Bisses. Dennoch sind präzise Zahlen hierzu kaum zu erheben.
1,2 Millionen Menschen sterben weltweit jedes Jahr im Straßenverkehr, alleine in Deutschland kommen 30 000 Menschen pro Jahr durch Krankenhausinfektionen ums Leben, wie das »Ärzteblatt« berichtet – die weltweite Zahl dürfte dramatisch höher liegen.
Zu den größten Gefahren allerdings – und damit liegt sie auf jeden Fall auf Platz eins der gefährlichen Tierarten – gehört die Anopheles-Mücke. Bis zu 2,7 Millionen Tote sind jedes Jahr die Folge der Malaria-Infektionen durch Einzeller namens Plasmodium, die sie überträgt. Die Blutsauger infizieren Menschen darüber hinaus mit unterschiedlichen weiteren Krankheitserregern und Parasiten, oft mit tödlichen Folgen.
Übrigens: Viel gefährlicher als Haie für Menschen sind Menschen für Haie – zwischen 50 und 100 Millionen Haie – das sind Schätzungen aus unterschiedlichen Quellen, genauere Zahlen wurden bisher nicht ermittelt – Umgerechnet bedeutet das, dass pro Stunde etwa 5700 bis 11400 Haie getötet werden. Zum Verhängnis wird ihnen ein Kochrezept – Haifischflossensuppe – und der Glaube, dass ein Pulver aus Haiknorpel gut für die Gelenke sei. Viele Haie enden auch im Beifang der Fischereiflotten.
Zecken lassen sich von Bäumen fallen.
Wer im Frühling in sehr nahen Kontakt mit der Natur in Feld und Wald kommt, zum Beispiel durch eine Wiese läuft, sollte sich im Anschluss an seinen Spaziergang selbst auf Zecken kontrollieren oder von jemand anderem untersuchen lassen. Die Blutsauger mit den Beinen übertragen gleich mehrere Krankheiten, darunter FSME, eine gefährliche Hirnhautentzündung, oder die ausgesprochen tückische Borreliose. Zecken lauern allerdings nicht auf Bäumen auf ihre Opfer, wie man lange Zeit glaubte. Auslöser für einen Angriff von oben sollten dieser Theorie zufolge der Körpergeruch des Opfers oder die darin enthaltene Buttersäure sein. In Wirklichkeit lauert die achtbeinige Gefahr – Zecken sind Milben, eine Unterklasse der Spinnentiere – auf Grashalmen oder niedrigen Sträuchern. Wenn sie etwas berührt, klammern sie sich fest und machen sich daran, auf der Haut ihres Opfers eine Stelle für eine Blutmahlzeit zu finden. Lange Hosen und Gummistiefel bieten weitgehenden Schutz.
Aerodynamisch gesehen können Hummeln nicht fliegen.
Irren sich nun die Hummeln und fliegen trotzdem, oder irren sich die Menschen, die diese Behauptung aufgestellt haben? Die schöne Geschichte, dass Hummeln, diese sympathischen, brummelnden Pelzkugeln unter den Insekten, eigentlich zu plump und zu schwer sein sollen, um sich in die Luft zu erheben, ist ein modernes Märchen. Ihre Flügelfläche soll viel zu gering sein, um den vergleichsweise schweren Körper zu tragen. Diese Theorie hört sich tatsächlich so an, als ob sie wahr sein könnte. Erstmals setzten sie in den 1930er-Jahren Studierende der Universität Göttingen in die Welt. Nach dieser Version der Geschichte ist das Hummel-Paradoxon das Produkt eines Kneipengesprächs zwischen einem Biologen und einem Aerodynamiker. Es gipfelt in der Behauptung, Hummeln könnten nur fliegen, weil sie die Gesetze der Aerodynamik nicht kennen. Könnte man sie ihnen verdeutlichen, wäre es vorbei mit ihren Ausflügen in die Luft …
Irrtum, die Physik hebelt der Hummelflug nicht aus. Im Gegenteil, Hummeln arbeiten mit Hightech, mit der Hubschraubertechnik nämlich. Richtig ist, dass die kleinen Hummelflügel das Tier vermutlich nicht in der Luft halten könnten, wenn sie wie Flugzeugflügel funktionieren würden. Aber die Flügel der Hummeln bestehen aus einem extrem elastischen Material, dem Protein Resalin. Schlägt die Hummel mit den Flügeln, so verbiegen sich diese stark, und an den Flügelspitzen bilden sich große Luftwirbel, die einen enormen Auftrieb erzeugen – Wirbel, wie sie auch bei einem Hubschrauber auftreten. Die Hummel ist also kein Flugzeug, sondern eher der Helikopter im Insektenreich.
Spinnen zählen zu den Insekten.
Ginge es nach dem alltäglichen Empfinden, so würde man keinen großen Unterschied zwischen all dem kleinen, aber ekligen Viehzeug machen, das einem Menschen so über den Weg laufen kann. Ameisen, Asseln, Fliegen, Käfer, Kakerlaken, Mücken, Ohrenkneifer, Spinnen, Tausendfüßler, Wespen und Zecken – alles fiese Krabbeltiere von A bis Z. Und allzu leicht hält man sie alle für Insekten – wozu da Unterschiede machen? Einmal abgesehen davon, dass Asseln zu den Krebsen gehören und auch Tausendfüßler keine Insekten sein wollen: Spinnen unterscheiden sich in mehrfacher Weise von allen Insektenarten.
Zwar zählen sie wie auch die Insekten zum Stamm der Gliederfüßer, haben aber zwei Beine zu viel, nämlich acht. Spinnen besitzen zwei deutlich voneinander abgesetzte Körperabschnitte im Gegensatz zu den Insekten, die dreifach geteilt sind – in Kopf, Brust und Hinterleib. Während viele Insekten flugfähig sind und unterschiedlich ausgeprägte Flügelpaare besitzen, können Spinnen allenfalls mithilfe ihrer Fäden fliegen. Flügel hat keine Spinnenart.
Alle Insekten besitzen am Kopf Fühler, auf die Spinnen verzichten müssen. Am Kopf von Spinnen findet sich ein Paar Mundgliedmaßen, sogenannte Kiefernklauen, die recht beweglich sind und Gift in ein Beutetier injizieren können. Schmetterling, Käfer und alle übrigen Verwandten müssen auf eine solche Ausstattung verzichten. Insekten sehen durch Netz- oder Facettenaugen in die Welt, Spinnen verlassen sich auf acht einzelne Punktaugen, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Die Nebenaugen sind darauf spezialisiert, Bewegungen wahrzunehmen, die Hauptaugen erkennen Formen und vermutlich auch ein gewisses Farbspektrum.
Mit den Spinnwarzen am Hinterleib können Spinnen feine Fäden unterschiedlicher Qualität herstellen. Ganz nach Bedarf produzieren sie stabile Netzfäden, klebrige Fäden zum Beutefang, Fäden für haltbare Kokons oder dünne, empfindliche Signalfäden. Manche Insekten wie der Seidenspinner können zwar auch Spinnfäden produzieren, nutzen diese aber nur, um ihre Raupen während der Phase der Umwandlung zum Vollinsekt zu schützen, also während des sogenannten Puppenstadiums. Den meisterhaften Umgang vieler Spinnen mit Spinnenfäden erreichen sie nie.
Der Wolf ist ein für Menschen gefährliches Raubtier.
Der Wolf ist gefährlich für seine Beutetiere, zu denen Kaninchen, Hasen, Rehe und sogar Wildschweine und Elche zählen. Menschen passen nicht in sein Beuteschema. Weder holt der Wolf Rotkäppchens Großmutter noch hetzen Wolfsrudel im Winter Menschen, die mit dem Pferdeschlitten unterwegs sind. Auch wenn Horrorgeschichten gut ankommen: Angriffe von Wölfen auf Menschen sind extrem selten, und meist sind angreifende Tiere an Tollwut erkrankt. Ärgerlich ist jedoch, dass Wölfe Ziegen und Schafe reißen oder auch Haustiere wie Hund und Katze töten. Allerdings hat das Raubtier Mensch die Art Wolf in der Vergangenheit immer stärker gefährdet als umgekehrt – heute stehen Wölfe in Europa unter Artenschutz und dürfen nicht mehr geschossen werden.
Das Schwein ist ein schmutziges Tier.
Im Islam gilt das Schwein als unrein, und auch die Juden verschmähen Schweinefleisch. Das ganze Tier gilt als unrein. Auch die Bibel rät dazu, das Schwein von der Speisekarte zu streichen. Vor etlichen Hundert Jahren war es äußerst sinnvoll, sich an die Regeln der Religionsgelehrten zu halten, denn Schweine waren zu einem hohen Anteil von Trichinen befallen – parasitäre Fadenwürmer, die auch auf Menschen übergreifen und sie gesundheitlich schwer schädigen können. Schwächezustände, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sind die anfänglichen Folgen, im weiteren Verlauf treten Fieber, starke Muskelschmerzen und Ödeme im Augenbereich auf. Die Erkrankung Trichinellose kann in einzelnen Fällen sogar zum Tode führen. Die Fleischbeschau sorgt heute dafür, dass Schweinefleisch ohne Trichinen verzehrt werden kann.
Unrein – im Sinne von schmutzig – sind Schweine aber keineswegs, auch wenn sie oft so aussehen. Ihr schmuddeliges Äußeres hängt mit ihrer Reinigungsmethode zusammen. Sie ziehen die Suhle der Reinigung mit Wasser vor. Ein Schlammbad und die zurückbleibende Schlammschicht auf der Haut schützen sie vor Parasiten wie Stechmücken, Flöhen und Zecken. Die im Schlamm enthaltene Feuchtigkeit kühlt sie ab, denn Schweine haben keine Schweißdrüsen und können deshalb ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren. Draußen und unter freiem Himmel verbreiten Schweine nicht mehr Geruch als andere Tierarten – zu einem bestialischen Gestank kommt es im Schweinestall, wenn die Tiere nicht artgerecht gehalten werden.
Das Alter eines Marienkäfers erkennt man an den Punkten.
Wenn es so wäre, dann gäbe es nur Marienkäfer, die 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 oder 24 Jahre alt sind, was übrigens einem biblischen Alter für einen Käfer entspräche. Hin und wieder kommt auch einer ohne Punkte vor – ein Zombie? Nein, die Anzahl der Punkte ist ein Artmerkmal und hat mit dem Lebensalter nichts zu tun. Unser häufigster heimischer Marienkäfer ist übrigens der Siebenpunkt, den aber in vielen Regionen der zugewanderte asiatische Harlekin-Marienkäfer – zu erkennen an weitaus mehr als sieben Punkten – zu verdrängen droht.
Tausendfüßler haben 1000 Füße.
Vermutlich heißen die Tiere Tausendfüßler, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, genau nachzuzählen, bevor ihnen ihr Name gegeben wurde. Vielleicht steht die Zahl 1000 aber auch nur für »eine ganze Menge«. Wenn man aber nachzählt, hält den Rekord der extrem seltene nordamerikanische Tausendfüßler Illacme plenipes mit über 350 Beinpaaren, also 700 Füßen. Die Tiere, die wir im Alltag als Tausendfüßler bezeichnen, gehören manchmal zur Gruppe der Hundertfüßler (ein Beinpaar pro Körpersegment) und können zwölf, aber auch mehr als 100 Beinpaare besitzen. Einen Tausendfüßler, der wirklich 1000 Füße hat, gibt es nicht.
Elefanten haben ein außergewöhnliches Gedächtnis.
In den Geschichten aus der Sensationspresse rächt sich der Elefant Jahrzehnte später an dem Peiniger, der ihm als Jungtier Schläge zugefügt hat. Oder er erkennt einen kindlichen Spielkameraden wieder, obwohl dieser unterdessen zum Erwachsenen herangereift ist. Warum ausgerechnet der Elefant für die Geschichten über das phänomenale Gedächtnis herhalten muss, ist die Frage. Auch andere Tierarten haben ein gutes Langzeitgedächtnis, sie erinnern sich an traumatische Erlebnisse im positiven wie im negativen Sinne über lange Zeit. Ein Hund knurrt jemanden an, der ihn vor Jahren getreten hat, und ein tierquälerischer Dompteur, der junge Raubkatzen mit fragwürdigen und schmerzhaften Methoden »erziehen« wollte, sollte sich davor hüten, einem seiner hilflosen Opfer zu begegnen, wenn aus diesem mittlerweile ein erwachsenes und gefährliches Raubtier geworden ist.
Das Eichhörnchen hat etwas mit der Eiche zu tun.
Nein, die Eiche hat nichts mit dem Namen dieses Nagetiers zu tun – sagt die eine Fraktion der Sprachforscher. In der griechischen Antike nannte man es skiouros, was so viel wie Schattenschwanz bedeutet, wohl in dem Glauben, das Tier sei in der Lage, sich mit seinem großen Schwanz selber Schatten zu spenden. Aus dieser Bezeichnung ging das quirlige englische Wort squirrel hervor. Die germanische Mythologie gab dem lebhaften Nagetier den Namen Ratatöskr, und dieses uralte Eichhörnchen gehörte zum Tiergarten rund um die Weltenesche Yggdrasil. Aus dieser Zeit hat sich nichts zu uns herübergerettet. Das Eich im heutigen Eichhörnchen hängt mit dem mittelhochdeutschen Wort aig zusammen, das so viel bedeutet wie sich schnell bewegen – sagen die einen. Andere Linguisten hingegen sind durchaus der Meinung, dass die Eiche im Namen dieses Tieres eine Rolle spielt, denn Eicheln stellen einen Großteil seiner Nahrung dar. Eine Meinung von beiden ist also kein Irrtum – welche, vermag man noch nicht genau zu sagen.
Mäuse haben eine Vorliebe für Käse.
Nein, Hausmäuse haben keine besonderen Nahrungspräferenzen, sie sind Allesfresser und verzehren alles, was nahrhaft ist und was sie bekommen können. Nur im Cartoon, Comic und Trickfilm werden – gezeichnete und animierte – Mäuse von leuchtend gelbem Käse und seinem Geruch wie magisch angezogen. Deshalb ist ein Stück Käse in einer Mausefalle zwar ein verlockendes Angebot, ein Stück Brot oder Speck wäre aber ein genauso attraktives und damit lebensgefährliches Lockmittel für eine hungrige Maus. Eine Vorliebe für Käse hingegen haben bestimmte Vogelarten wie zum Beispiel Blaumeisen, die sich, wie der Autor selbst erfahren hat, gern an den Resten eines Frühstücks bedienen und dabei die Käserinden bevorzugen. Von anderer Seite wird berichtet, dass Katzen häufig Käse für eine Delikatesse halten.
Die Spitzmaus ist eine Maus mit spitzer Schnauze.
Nicht alles, was Maus heißt, ist biologisch auch tatsächlich verwandt mit unserer Hausmaus. Spitzmäuse sind keine Nagetiere wie unsere alltäglichen Mäuse, sie gehören zu den Insektenfressern, was sie aber in keiner Weise in der Auswahl ihrer Nahrung einschränkt: Spitzmäuse sind trotz ihrer geringen Größe Raubtiere und Fleischfresser. In ihr Beuteschema passen vor allem Insekten und deren Larven, Tausendfüßler, Asseln, aber auch Regenwürmer und Schnecken. Hin und wieder überwältigen sie auch kleine Wirbeltiere wie Eidechsen. Dabei steht ihnen eine besondere Waffe zur Verfügung: ihr giftiger Speichel, der bei einem Biss in die Blutbahn des Beutetiers kommt. Er enthält Blarina-Toxin, kurz BLTX, eine stark giftige Substanz, die eine lähmende Wirkung hat. Wühlmäuse, Frösche und Kröten oder sogar kleine Schlangen, manchmal doppelt so groß wie die Spitzmaus selbst, werden mit ihrer Hilfe überwältigt. Spitzmäuse verschmähen aber auch pflanzliche Nahrung wie etwa Beeren, Nüsse und andere Samen nicht und bedienen sich auch bei Vogeleiern, wenn es sich ergibt. Übrigens: Verwandtschaftlich stehen Spitzmäuse Maulwurf und Igel deutlich näher, obwohl die Verwandtschaft zu Letzterem unter Experten noch äußerst umstritten ist.