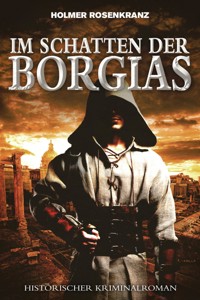0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
... mit kalten Augen beobachteten sie, wie die junge Frau, über dem dunklen Schlund hängend, um ihr Leben rang ...
Auf der abgelegenen Polarinsel Jan Mayen kämpft eine Wissenschaftlerin verzweifelt gegen den Tod. Ein isländischer Fischkutter kreuzt in der stürmischen Grönlandsee den Kurs eines mysteriösen Schiffes, dessen Mannschaft spurlos verschwunden ist. Archäologen stoßen in Tunesien auf einen uralten Grabstein, der Rätsel aufgibt. Drei Ereignisse, die räumlich und zeitlich nicht miteinander in Beziehung stehen. Oder doch ...?
Was am Anfang wie ein simpler Kriminalfall anmutet, entwickelt sich für den isländischen Kommissar Einar Jonsson und den deutschen Lehrer Maximilian Korff zu einem Abenteuer ungeahnten Ausmaßes, dessen Wurzeln tief in die Vergangenheit zurückreichen. Was sie am Ende des gemeinsamen Weges erwartet, liegt jenseits ihrer Vorstellungen.
573 – ist kein typischer Kriminalroman. Er verknüpft vielmehr reale geschichtliche Ereignisse mit einer fiktiven Handlung und gewährt tiefe Einblicke in die nordische Mythologie durch zahlreiche Textstellen aus der Edda und deren freie Interpretation durch den Autor. Umrankt mit einer Crime Story baut die Handlung auf eigene Weise Spannungsmomente auf. Es ist ein Buch, das die Zeit durchdringt. Ein Roman, der fiktiv wie real die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet.
Für Leser zu empfehlen, die sich für Archäologie, Geschichtswissenschaft, Religion und Mythologie interessieren.
Holmer Rosenkranz veröffentlicht Bücher auch unter dem Pseudonym – Tyron Tailor. Sein in diesem Jahr erschienener Roman – Die geworfene Münze – ist eine spannende Geschichte aus der Zeit der Kreuzzüge und durchlief auf der Literaturplattform – LovelyBooks – eine erfolgreiche Leserunde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
573
Roman
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenProlog
Atemringend hastete die junge blondhaarige Frau über das dunkle Lavagestein. Ein kurzer Blick zurück offenbarte, dass es ihr nicht gelungen war, die zwei Verfolger abzuschütteln. Bedrohlich rückten sie näher. Deutlich erkannte sie ihre Gesichtszüge, gezeichnet von den Strapazen der kräftezehrenden Verfolgungsjagd am Fuß des Vulkans Beerenberg. Die Ausrüstung hatte sie bereits fallen gelassen. Lediglich das Funkgerät hielt sie noch in der rechten Hand umklammert. Hektisch begann sie eine steile Anhöhe hinaufzuklettern, doch das mit Vulkanasche und Eisbrocken durchsetzte Geröll unter ihren Füßen war locker und rutschig. Das machte ihre Flucht noch beschwerlicher. Schon spürte sie den Atem der Verfolger im Nacken. Als sich hinter ihr eine Steinlawine löste und den Abhang hinunterrollte, hörte sie die Männer fluchen. Es bescherte ihr unerwartet wertvolle Sekunden im Wettlauf um Leben oder Tod. Auf dem Gipfelpunkt der Anhöhe blieb sie ratlos stehen. Wenige Schritte entfernt tat sich eine zwei Meter breite Erdspalte auf, die ihr den Weg versperrte. Die Tiefe des Hindernisses konnte sie bloß erahnen. Sollte sie aufgeben oder es wagen zu springen? Unschlüssig, sich zu entscheiden, hörte sie hinter ihrem Rücken eine krächzende Stimme tönen.
„Da vorn ist sie! Los, leg sie endlich um!“
In diesem Moment verlor ihr Verstand die Fähigkeit, rational zu urteilen. Ihr Selbsterhaltungstrieb übernahm das Heft des Handelns. Kraftvoll stieß sie sich vom Boden ab und sprang über den Graben. Im gleichen Augenblick registrierte ihr Unterbewusstsein den Knall eines Schusses und einen heißen Schlag am rechten Oberschenkel. Das Funkgerät entglitt ihren Fingern. Die Anspannung ihres Körpers löste sich. Um Haaresbreite verfehlte sie die andere Seite und krallte ihre Hände in die poröse Felswand. Die Rückkehr ihres Denkens glich dem Erwachen aus einem tiefen Schlaf. Im ersten Augenblick begriff sie nicht, was mit ihr geschehen war.
„Um Gotteswillen ... Hilfe!“, schrie sie verzweifelt.
Die Verfolger erreichten derweil den Rand des Abgrunds. Mit kalten Augen beobachteten sie, wie die junge Frau, über dem dunklen Schlund hängend, um ihr Leben rang.
„Helft mir!“, rief sie keuchend. Auf etwas anderes als das Mitleid der unbekannten Männer konnte Sie kaum hoffen. Die beiden reagierten nicht auf ihr Flehen, sondern blieben stumm und regungslos. Schließlich hatten sie sich genug an ihrem Leid ergötzt. Einer von ihnen begann, einen Revolver auf die Frau zu richten. Da verließen sie ihre Kräfte. Sie rutschte ab und fiel mit einem gellenden Schrei in die scheinbar bodenlose Tiefe. Der Aufschlag ihres Körpers am Boden erzeugte ein dumpfes Geräusch. Verblüfft über den Absturz, stellte sich der Mann mit dem Revolver an die Felskante und feuerte fünfmal in das finstere Loch hinein.
„Was soll der Quatsch?“, fragte der andere, nachdem die Echos der Schüsse verhallt waren.
„Ich gehe nur auf Nummer sicher“, erhielt er lapidar zur Antwort. Seelenruhig entfernte der Schütze die leeren Patronenhülsen aus der Trommelkammer und bestückte die Waffe mit neuer Munition. Dann steckte er sie unter die Jacke und trat den Rückweg in die Bucht an. Wortlos folgte ihm sein Begleiter.
Kapitel 1
1.
21. Juni
Es war 9:00 Uhr morgens, als auf dem Radar des kleinen Fischkutters Anna Katrin, drei Meilen vor der isländischen Hafenstadt Raufarhöfn, unerwartet das Signal eines Schiffes auftauchte. Der Steuermann betrachtete den leuchtenden Fleck auf dem Bildschirm mit Unbehagen. Das Wetter war rau, der Wellengang der See hoch und der Kurs des fremden Bootes äußerst ungewöhnlich. Er beschloss, den Skipper über die Beobachtung zu informieren. Kurze Zeit später betrat er die Steuerbrücke. Er erkannte sofort den Ernst der Situation und erteilte den Befehl, Kurs auf das mysteriöse Objekt zu nehmen. Nach einer Stunde näherten sie sich dem Objekt bis auf eine viertel Seemeile. Es handelte sich um eine Hochseejacht von ungefähr 23 Meter Länge und sieben Meter Breite. Vorn am Bug zeichnete sich in großen Lettern ein Name ab: Polarstar. Die zahlreichen Aufbauten über Deck ließen vermuten, dass es sich um ein Charterschiff für abenteuerlustige Urlauber handelte.
In allen isländischen Häfen existierten Betreiber, die Ausflüge im näheren Küstenbereich oder auch zu benachbarten Inseln anboten, da in den Sommermonaten regelmäßig Besucher aus Europa einflogen, um die Schönheit und Einsamkeit des nördlichen Eismeeres zu erleben. Auf Wunsch und bei guter finanzieller Lage der Fahrgäste fuhr solch ein Schiff auch nach Grönland, zur Insel Jan Mayen oder sogar nach Spitzbergen. Das waren Ausflugstouren der Extraklasse, die mehrere Tage bis Wochen dauerten und sich ein Pauschalurlauber kaum leisten konnte.
Das Schiff, so erkannten die Seeleute der Anna Katrin hinter dem Namenszug, nannte die Stadt Höfn als Heimathafen, einen kleinen Ort an der südöstlichen Küste des Landes. Es schlingerte antriebslos durch die meterhohen Wogen und lieferte sich den Kräften der Natur widerstandslos aus.
„Wahrscheinlich ist die Maschine defekt“, bemerkte der Skipper grübelnd zum Steuermann. „Anders kann ich mir den seltsamen Kurs des Schiffes nicht erklären.“
„Und weshalb sind auf dem Deck keine Positionslichter eingeschaltet? Es ist miserables Wetter. Mit dem Motor müssen gleichzeitig die Schiffsbatterien ausgefallen sein? Was für ein Zufall. Und wieso merkt von den Schlafmützen dort drüben niemand unsere Gegenwart und gibt uns ein Signal? Jetzt behaupte bloß noch, ihr Funkgerät hätte den Geist aufgegeben. Das würde dem Ganzen die Krone aufsetzen. Nein ... Irgendetwas stimmt nicht mit dem Kahn.“
Der Skipper schaute den Steuermann nach dessen argwöhnischen Worten verblüfft an. Er musste ihm recht geben. Das Verhalten der Seeleute auf der Polarstar war absonderlich, ohne jede Logik, ja ausgesprochen gefährlich und verantwortungslos gegenüber den Passagieren, sofern sich welche an Bord befanden. Der Anblick der führerlos treibenden Jacht in der stürmenden Grönlandsee besaß etwas Gespenstisches. Dem Kapitän der Anna Katrin war nicht wohl in seiner Haut. Die kritischen und nicht von der Hand zu weisenden Fragen des Mannes am Ruder ließen ihn zu dem Schluss kommen, dass die ausgefallene Maschine nicht das wahre Problem des fremden Schiffes darstellte.
Der Steuermann blickte den Skipper unsicher an. „Soll ich versuchen, längsseits zu gehen?“, fragte er zwiespältig.
„Bist du verrückt?“, bekam er empört zur Antwort. „Nicht bei diesem Seegang. Wenn wir die Anna Katrin beschädigen, saufen wir womöglich ab. Wir halten 200 Meter Abstand und fahren mit dem Schlauchboot rüber. Ehrlich gesagt, ist selbst das ein kühnes Unterfangen. Gleichwohl sind wir verpflichtet, alles Mögliche zu tun, um in Not geratene Seeleute zu retten. Vielleicht benötigt die Polarstar tatsächlich unsere Hilfe.“
Der Steuermann nickte zustimmend und manövrierte die Anna Katrin mit sicherer Hand näher an die mysteriöse Jacht heran.
2.
Zum wiederholten Male schaute Björn Andersen beunruhigt auf die Armbanduhr. Seit den Morgenstunden des gestrigen Tages hatte Inga Hallström kein Lebenszeichen von sich gegeben. Eigentlich schrieb die Dienstvorschrift vor, sich alle vier Stunden zu melden. Doch das Funkgerät schwieg. Für Björn Andersen eine beängstigende Situation.
Bisher hatte ihr Ausbleiben noch keinen der Kollegen beunruhigt. Dass die Vulkanologin ihre Inspektionen gelegentlich massiv ausdehnte, waren sie gewohnt. Zwar betrug die Distanz von der Wetterstation Helenesanden bis zum Beerenberg lediglich 20 Kilometer, dafür konnte die Kontrolle der seismologischen Geräte an den Hängen des Vulkans enorme Zeit in Anspruch nehmen.
In den vergangenen Stunden hatte Björn Andersen mehrmals versucht, sie anzufunken, allerdings keine Antwort erhalten. Die Sorge um Inga Hallström stand dem 30-jährigen Hünen mit den dunkelblonden Haaren ins Gesicht geschrieben. Abermals rief er ihren Namen in das Mikrofon und wartete ruhelos auf eine Rückmeldung. Auch jetzt schwieg das Funkgerät. Nur ein leises hintergründiges Rauschen tönte im Gleichklang aus dem Äther. Bedrückt begann er nachzusinnen, was ihr zugestoßen sein könnte. Der Angriff eines Eisbären erschien ihm unwahrscheinlich. Zugegeben, der Weg der gefährlichen Gesellen führte gelegentlich auf die Insel. Das galt eher für die Wintermonate, wenn das Polarmeer bis an die Küste von Jan Mayen zufror. Außerdem trug Inga eine Waffe bei sich und war kein Greenhorn mehr. Sie war in der Lage, mit einem derartigen Problem umzugehen. Somit blieb im Grunde nur ein Unfall oder ein defektes Funkgerät übrig. An den letzteren Umstand klammerte sich seine ganze Hoffnung.
„Inga ist bestimmt wohlauf“, meinte Sigurd Johannsen aufmunternd zu ihm.
Er verkörperte in seiner Statur das genaue Gegenteil von Björn Andersen. Klein und schmal gebaut konnte er sich bequem hinter ihm verstecken. Das blasse Gesicht des Mannes umrahmten lange dunkle Haare, die er im Nacken zu einem Zopf gebunden hatte. Sigurd wusste von Björns Zuneigung für Inga und verstand dessen Unruhe.
„Wahrscheinlich ist ihr am Wegesrand eine interessante Sache ins Auge gefallen. So wie im letzten Monat, als sie über eine abgestürzte deutsche Junkers aus dem Zweiten Weltkrieg stolperte. Ein dermaßen aufregender Fund lässt sie alles um sich herum vergessen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich deshalb verspätet. Gib ihr also noch ein wenig Zeit.“
„Vermutlich hast du recht und ich mache mir unnötig Sorgen“, erwiderte Björn Andersen. Für den Augenblick beruhigt, tippte er die meteorologischen Messwerte des vergangenen Tages in den Computer ein.
3.
Eine halbe Stunde war vergangen. Der Skipper und der Bootsmann der Anna Katrin saßen festgegurtet in einem motorisierten Schlauchboot und hielten Kurs auf die Polarstar. Unterwegs bereitete ihnen der hohe Seegang zunehmend Probleme. Mehrmals schlugen starke Windböen die Gischt der am Bug brechenden Wellen wie eine Faust in ihre Gesichter. Die Gefahr des Kenterns schwebte ständig über ihren Köpfen. Die beiden Männer erwiesen sich indessen als erfahrene Seeleute. Mit sicherer Hand steuerten sie das schwankende Gefährt durch das brodelnde Chaos und machten an der Jacht längsseits fest. Nacheinander stiegen beide an der Schiffswand die Sprossen einer verchromten Leiter nach oben. Eine dunstige Düsternis empfing sie auf dem Deck. Unterdessen hatte der Sturm den Himmel vollends mit dunklen Wolken verhangen, aus denen ein kalter Nieselregen fiel. Die tief liegende Sonne war nicht mehr fähig, sie zu durchdringen, und zeichnete knapp über dem Horizont einen hellgrauen Fleck ab.
„Hallo! Ist jemand an Bord? Benötigen Sie Hilfe?“, rief der Skipper laut über das Mittelschiff. Eine Antwort blieb aus. Allein der Wind fegte heulend über die Deckplanken der schaukelnden Jacht. Keine Menschenseele ließ sich blicken. Ihnen bot sich eine gespenstische Szenerie, die befremdliche Emotionen hervorrief.
„Mir ist richtig unheimlich“, meinte der Bootsmann. „Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber diese Totenstille geht mir gehörig an die Nieren. Weshalb laufen die Motoren nicht? Und wo zum Teufel ist die Besatzung geblieben?“
„Bleib ruhig. Es wird sich alles aufklären. Lass uns die Steuerbrücke kontrollieren“, erwiderte der Skipper und zog eine Taschenlampe aus der Jacke. Große Zuversicht strahlten seine Worte allerdings nicht aus.
Mit unsicheren Schritten schwankten beide zum Vordeck und stiegen die kurze Treppe zum Steuerhaus hinauf. Die Brücke war nicht besetzt. Führerlos drehte sich das Steuerrad von links nach rechts und wieder zurück. Die Armaturen waren ausgeschaltet. Nicht ein Lämpchen leuchtete auf dem Kontrollpaneel. Plötzlich blieben sie wie angewurzelt stehen. Ihnen stockte der Atem. Ein klirrendes Geräusch ertönte hinter ihrem Rücken. Erschrocken wandten sie sich um und atmeten erleichtert auf. Gleich einer Spukerscheinung rollte eine leere Bierflasche von Steuerbord nach Backbord quer durch den Raum und verursachte beim Anschlagen an die Wand ein helles Klimpern. Der Bootsmann wischte sich mit dem Taschentuch den kalten Schweiß von der Stirn. Nachdem sich die Flasche anschickte, nach Steuerbord zurückzukehren, packte er sie geistesgegenwärtig am Hals und warf sie ärgerlich durch die geöffnete Tür in die tobende See.
„Das verstehe ich nicht. Wo ist die Crew geblieben? In Reih und Glied den Lemmingen gleich ins Meer gestürzt?“, rätselte der Skipper und kratzte sich nachdenklich am Kopf.
„Vielleicht trieb der Sturm das Boot aus dem Hafen, ohne dass der Eigentümer den Verlust bemerkte. Wenn das zutrifft, können wir lange nach der Besatzung suchen. Wir finden unter Deck keine Seele“, orakelte der Bootsmann.
Dessen Mutmaßungen versuchten zumindest eine Erklärung für das Fehlen der Mannschaft zu geben, dennoch hegte der Skipper Zweifel. „Ein Abtreiben ist denkbar. Die hiesigen Strömungen lassen diese Möglichkeit zu. Doch ich kann nicht daran glauben.“
„Und wieso?“
„Dieses Schiff habe ich im Hafen von Raufarhöfn noch nie gesehen. Ich würde mich daran erinnern. Außerdem sind die Anker gelichtet. Das ist mir bereits während der Überfahrt im Schlauchboot aufgefallen. Eine Abdrift aus dem Heimathafen in Höfn fällt ebenso in den Bereich des Unmöglichen. In dem Fall hätten die Strömungsverhältnisse, die an der Südostküste herrschen, es weiter nach Nordosten abweichen lassen. Es muss einen anderen Grund für das Verschwinden der Seeleute geben. Lass uns die Kajüten unter Deck inspizieren. Womöglich finden wir dort den entscheidenden Hinweis.“
Ihr Weg führte zurück auf das Mittelschiff. Hier führte eine schmale Treppe hinunter in den Bauch des Schiffes, direkt zu den Unterkünften der Passagiere und Besatzungsmitglieder. Durch die Finsternis sah sich auch der Bootsmann gezwungen, die Taschenlampe einzuschalten. Darauf bedacht, nicht zu stolpern, stieg er behutsam die Stufen hinab. Der Skipper folgte ihm auf den Fuß. Am Ende der Treppe schloss sich ein langer, mit einem dunkelblauen Teppichläufer ausgelegter Korridor an. Von ihm führten zu beiden Seiten zahlreiche Türen in die einzelnen Unterkünfte.
Der Schalter für die Beleuchtung auf dem Gang funktionierte nicht. Unsicher tasteten sie durch die Finsternis, die allein die Lichtstrahlen ihrer Lampen durchbrachen. Kurz darauf blieben sie entgeistert stehen. Unter ihren Schuhen nahmen sie knackende Geräusche wahr. Neugierig blickten sie zu Boden. Er war mit glitzernden Glasscherben übersät. Erstaunt richteten sie ihre Augen nach oben.
„Eigenartig“, bemerkte der Bootsmann mit belegter Stimme. „Die Glühbirnen der Deckenlampen sind zerschlagen.“ Er wirkte durch diesen ominösen Umstand äußerst angespannt.
„Wir kontrollieren das gesamte Unterdeck“, ordnete der Skipper im Befehlston an und öffnete die Tür zur Linken. „Schau du inzwischen in die nächste Kajüte.“
Der Bootsmann, der die Worte deutlich gehört hatte, zögerte jedoch.
„Was ist los? Machst du dir in die Hosen?“, fragte der Skipper verwundert.
„Quatsch! Ich vertrete bloß den Standpunkt, dass es vernünftiger wäre, zusammenzubleiben.“ Davon war er überzeugt. Nichtsdestotrotz gestand er sich ein, auch die Furcht vor dem Ungewissen spielte eine Rolle. Im Grunde war ihm die Aktion zuwider und das Schiff nicht geheuer. Um sich keine Blöße zu geben, unterdrückte er seine Hemmungen und öffnete die Tür zur gegenüberliegenden Kabine. Im gleichen Augenblick traf das Boot ein gewaltiger Brecher von der Steuerbordseite, sodass es eine extreme Schräglage nach Backbord vollzog. In der Folge stürzte er regelrecht ins Innere des Raums hinein und kam ins Straucheln. Über die eigenen Füße stolpernd, prallte er unerwartet auf eine weiche Masse. Die Taschenlampe, die ihm beim Fallen entglitt, knallte mit dem Reflektor auf den Boden und erlosch. Er hörte noch, wie sie zur gegenüberliegenden Wand rollte und regungslos liegen blieb. Schaudernd fühlte er mit den Händen nach dem Gebilde unter seinem Körper. Ihm gefror das Blut in den Adern. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. „Verdammt! ... Scheiße! ... Was ist das?“, rief er angeekelt und sprang entsetzt vom Boden auf. Panisch rannte er zur Kabinentür, wo er heftig mit dem Skipper zusammenstieß.
„Was ist passiert?“, fragte der seinen Steuermann und rieb sich die schmerzende Schulter. „Du hast geschrien, als wäre der Teufel hinter dir her.“
„Ich glaube, in der Kabine liegt jemand. Ich bin über ihn gestolpert und auf ihn gestürzt. Er rührte sich nicht und sagte keinen Laut.“
„Ach was? Ist das wahr? Geh zur Seite!“, erwiderte der Skipper unbeeindruckt von dem konfusen Gestammel und suchte den Boden der Kajüte mit der Lampe ab. Schließlich kam der Lichtstrahl in der Mitte der Kajüte zum Stehen und offenbarte den blutüberströmten Leib eines toten Mannes. „Mein Gott! Der Bedauernswerte hat überhaupt kein Gesicht mehr!“, rief er fassungslos und hörte im selben Moment, wie sich der mental angeschlagene Bootsmann hinter seinem Rücken übergab. Dessen Ekel fühlte er nach, da der Tote einen missgestalteten, ja geradezu abscheulichen Anblick darbot. Jemand hatte ihm mit einem harten, scharfen Gegenstand den Kopf zertrümmert. Wenn er nicht an einer schweren Hirnverletzung verstorben war, dann an den Folgen des immensen Blutverlustes. Der Boden war von Blut geradezu durchtränkt. Es zeigte noch nicht den Zustand der vollständigen Gerinnung, was darauf schließen ließ, dass der Eintritt des Todes noch nicht lange zurücklag. Neben dem Leichnam lag ein Enterbeil mit einer breiten Schneide, das in Notsituationen zum Kappen von Tauen diente. In ihm die Tatwaffe des Täters zu vermuten, erschien dem Skipper logisch.
„Lass uns zur Anna Katrin zurückkehren“, meinte er erschüttert. „Wir müssen die Küstenwache informieren. Wer weiß, welche grauenvollen Geheimnisse das Totenschiff noch in sich verbirgt.“ Er verspürte kein Verlangen mehr, die restlichen Kajüten zu inspizieren. Auch an seiner Psyche zerrte die blutige Szenerie. Endlich saßen sie im Schlauchboot und atmeten die salzige Seeluft ein. Doch das Grauen ließ sie nicht los. Während der Rückfahrt zur Anna Katrin sprachen sie kein Wort miteinander. Schweigend versuchte jeder, das schreckliche Bild des toten Mannes aus dem Gedächtnis zu verdrängen.
4.
Ein Lebenszeichen von Inga Hallström blieb weiterhin aus. Tief beunruhigt brachte Björn Andersen das Problem auf den Punkt: „Ihr ist etwas zugestoßen. Wir müssen sie suchen.“
Niemand widersprach. Alle teilten diese Ansicht.
Die 75 Kilometer lange Tour auf dem nordöstlichen Inselteil war anspruchsvoll und setzte eine gute körperliche Kondition voraus. Um die seismologischen Instrumente an den beiden Messpunkten kontrollieren zu können, waren die Forscher gezwungen, auf den Berghängen des Vulkans mühsam über lockeres Lavagestein und eisige Gletscherzungen zu kraxeln. Daher veranschlagten sie für die Dauer der Route routinemäßig 20 Stunden. Ein Zeitraum, den die junge Frau längst überschritten hatte. Sie war überfällig.
Zu viert brachen sie mit zwei Quads in verschiedene Richtungen auf. Christof Vigeland und Sören Sinding, beide Geophysiker in ihrem Forschungsteam, wählten die Südostroute zu den Ruinen der alten Wetterstation Elsde Metten. Sie tangierte die Strecke zum ersten Kontrollpunkt, der auf dem Südhang des Beerenbergs lag. Von dort hatte sich Inga Hallström am gestrigen Morgen letztmalig gemeldet. Sigurd Johannsen und Björn Andersen entschieden sich für die Nordwestroute. Sie beabsichtigten, der Station Gamle Metten einen Besuch abzustatten. Einige Kilometer weiter, in der Nähe des Weyprecht-Gletschers, befand sich der zweite Kontrollpunkt. Falls die Nachforschungen an beiden Stellen erfolglos blieben, würden sich die Suchtrupps auf dem Pfad treffen, der an der Westseite des Vulkans die Nord- und Südküste miteinander verband. Die Aussicht, die verschollene Frau noch zu finden, erschien dort am wahrscheinlichsten.
Zügig fuhren Björn Andersen und Sigurd Johannsen über das hügelige Gelände. Nach zwei Stunden erreichten sie das erste Ziel. Gamle Metten hatte früher ebenfalls als Wetterstation gedient, war allerdings in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgegeben worden. Akribisch inspizierten sie jedes der gut erhaltenen Gebäude, aber von Inga Hallström fanden sie keine Spur. Um sicherzugehen, nichts zu übersehen, kontrollierten sie zum Abschluss das umliegende Gelände. Doch ihre Suche blieb erfolglos. Enttäuscht stiegen sie auf ihre Fahrzeuge und fuhren entlang der Küste weiter die Route zum Weyprecht-Gletscher. Nach 15 Minuten erreichten sie eine steile Anhöhe, die sich über eine kleine Bucht erhob. Sie richteten ihre Blicke zum Meeresufer. Dabei stach ihnen etwas Merkwürdiges in die Augen. Björn Andersen hielt neugierig das Fernglas auf die Szenerie und erkannte Inga Hallströms Quad. Einsam stand es neben einem aus dem Sand ragenden Felsblock. Wie ein Blitz eilten sie hinunter zum Strand. Inga Hallström indes sahen sie nicht. Nur ihr Gewehr lehnte unerklärlicherweise am Fahrzeug. Ein Umstand, der beunruhigte.
„Inga! ... Hörst du mich? Ich bin es ... Björn! ... Inga!“, rief er verzweifelt. Die erlösende Antwort blieb aus. Allein die Wellen des Meeres schlugen rauschend über den Strand der einsamen Bucht. Jäh überkam ihn ein unheilschwangeres Gefühl. Da wusste er, dass ihr Schlimmes widerfahren war.
Neben ihrer Spur entdeckte Sigurd Johannsen zwei weitere Fährten im Sand, die alle in dieselbe Richtung führten.
„Seltsam!“, bemerkte er. „Die Schuhabdrücke nehmen ihren Anfang am Uferrand.“
Björn Andersen nickte. „Hier hat ein Boot angelegt. Schau! Die Insassen sprangen an Land und steuerten in gerader Linie auf die Felsformation am Rande der Bucht zu. Ingas Weg führte gleichfalls dorthin. Vermutlich verfolgte sie die Fremden“, stellte er fest und wies mit der Hand in die angegebene Richtung.
„... oder die Fremden verfolgten sie“, präzisierte Sigurd Johannsen dessen Vermutung mit einem vielsagenden Blick.
Ihre Gesichter wirkten wie versteinert. Das abgestellte Fahrzeug, das zurückgelassene Gewehr und die Fußstapfen in der Bucht beschäftigten ihre Fantasie. Ein klares Bild ließ sich aus den Puzzleteilen dennoch nicht formen.
„Folgen wir den Spuren“, schlug Björn Andersen vor. „Ich schätze, sie führen zur Lösung des Rätsels.“
Mit schweren Schritten marschierten sie durch den lockeren Sand, bis sie die steilwandige Felsformation erreichten. Vor einer auftauchenden, scharfkantigen Öffnung im Vulkangestein blieben sie verwundert stehen. Inga Hallström und die beiden Besucher der Insel waren in das dunkle Loch hineingekrochen. Der erfahrene Blick der beiden Wissenschaftler offenbarte, dass es sich um eine Kaverne handelte, einen größeren Hohlraum, der manchmal nach dem Erkalten eines Lavastroms entstand. Mehrmals rief Björn Andersen Ingas Namen ins Innere der Höhle. Aber außer dem zurückhallenden Echo nahm er keine anderen Laute wahr. Es blieb totenstill. Womöglich war sie schwer verletzt und nicht in der Lage sich bemerkbar zu machen. Ein bedrückender Gedanke. Er beschloss hineinzukriechen, um sich Gewissheit zu verschaffen. Ein erstaunter Ausruf Sigurd Johannsens hielt ihn allerdings ab.
„Sieh dir das an! Eine der Spuren führt von der Höhle weg und endet hinter dem hohen Felsbrocken dort drüben. Die Schrittlänge ist enorm. Jemand suchte in panischer Eile das Weite. Vermutlich, um sich zu verstecken.“
Björn Andersen bestätigte die Beobachtung: „Ich stimme dir zu. Außerdem sind die Abdrücke die kleinsten unter den Fährten. Inga trägt Schuhgröße 37. Sie stammen zweifelsfrei von ihr. Die Inselbesucher folgten ihr. Und das auf getrennten Pfaden. Schau Sigurd, ihre Spuren führen in einem Bogen zu ihrem Versteck. Wahrscheinlich haben sie Inga entdeckt und in die Zange genommen.“ Trotz der wenigen Plusgrade fühlte er unter der Daunenjacke Hitze aufsteigen. Was erwartete ihn hinter dem Felsen? Das glückliche Ende einer verzweifelten Suche nach der Liebe seines Lebens oder unaussprechliches Leid über deren Verlust? Er vermochte es nicht zu sagen und die Angst vor einer grausamen Antwort lastete ihm auf der Seele.
Das angeknackste Selbstvertrauen des Freundes blieb Sigurd Johannsen nicht verborgen. Behutsam legte er ihm die Hand auf die Schulter. „Wir müssen nachschauen und uns überzeugen“, meinte er mitfühlend. Ihm war anzumerken, dass ihn dieselben Gedanken quälten. Seine Worte verschärften unbeabsichtigt Björn Andersens schlimmste Befürchtungen.
Mit Herzklopfen näherten sie sich dem einsam stehenden Felsbrocken. Die wenigen Schritte zogen sich zeitlupenhaft in die Länge. Meter wandelten sich zu Meilen, Sekunden zur Ewigkeit. Endlich wagten sie, hinter den Felsen zu blicken. Doch Inga Hallström war nicht da. Lediglich ihr knallroter Rucksack mit dem Überlebenspaket und dem Laptop lag einsam im Sand.
5.
Mühsam öffnete die junge Frau die Augen. Im ersten Moment war ihr nicht bewusst, an welchem Ort sie sich befand. Ein dämmriger Schein und eine beängstigende Stille umgaben sie. Dazu dröhnte der Kopf und das rechte Bein schmerzte. An der Stirn spürte sie ein Hämatom – offensichtlich die Folge eines Sturzes. Sie benötigte einige Minuten, um sich zu besinnen, was mit ihr geschehen war.
Schon in den frühen Morgenstunden hatte sie mit dem Quad die Wetterstation Helenesanden verlassen und war zum Vulkan Beerenberg aufgebrochen, um die allwöchentliche Kontrolle der dort stationären, seismologischen Instrumente durchzuführen. Ihr Weg hatte zuerst an den Ruinen der alten Wetterstation Elsde Metten vorbeigeführt. Elsde Metten, ein öder abgelegener Ort, war bereits zu Beginn des Zweiten Weltkrieges aufgegeben worden. Zehn Kilometer dahinter, an der Südostküste des einsam im nördlichen Polarmeer gelegenen Gestades, hatte sich ihr erster Kontrollpunkt befunden.
Jan Mayen war landschaftlich einzigartig. Das schmale, lang gestreckte Aussehen der Insel glich einem Teelöffel und besaß geologische Ursachen. Der Beerenberg, im Nordosten gelegen, war ein Hotspot. Während die Insel auf einer tektonischen Platte driftete, war die im Erdmantel sitzende Quelle der Eruptionen stationär gelegen. Das dort aufsteigende heiße Magma schmolz sich stets aufs Neue durch die Erdkruste und bildete an der Oberfläche neue Krater mit vulkanischer Aktivität. Ein geophysikalischer Vorgang, der ein ständiges Wachsen des Eilands bewirkte.
Sie kannte die Fakten. Mithilfe der Messsonden hielt die Vulkanologin den Feuerberg unter Kontrolle. Der letzte Ausbruch fand 1985 statt. Danach fiel der nördlichste aktive Vulkan der Erde bis heute in einen tiefen Schlaf. Die Ruhe inmitten des plattentektonisch äußerst dynamischen Gebietes, das den Namen Nördlicher Mittelatlantischer Rücken trug, blieb allerdings trügerisch.
Der technische Zustand der seismologischen Instrumente war makellos gewesen. Und so hatte sie ihr Weg ohne weiteren Aufenthalt an die Nordwestküste geführt. Am Fuß des 2277 Meter hohen Beerenbergs entlang, war sie über eine Reihe flacher, mit vielen leuchtenden Moos- und Flechtenarten bewachsener Hügel gefahren, auf denen der purpur blühende Steinwurz und der dottergelbe Löwenzahn gediehen. Jetzt im Juni begann der kurze polare Sommer und die spärliche Vegetation auf der rauen Insel drückte mit aller Macht farbenprächtig ihren ungebändigten Überlebenswillen aus.
Nach drei Stunden Fahrtzeit hatte sie die Nordwestküste erreicht und war an den beiden verlassenen Wetterstationen Atlantic City und Gamle Metten vorübergefahren. Sie tangierten die Route zum zweiten Kontrollpunkt, der 15 Kilometer entfernt vom Weyprecht-Gletscher lag. Er stellte in seiner Ausdehnung nicht den größten Gletscher des Vulkans dar, jedoch den Einzigen mit einer ins Meer ragenden Kalbungsfront. Mit ein wenig Glück waren das Abbrechen eines Eisbrockens und dessen tiefer Fall ins Meer zu beobachten. Ein beeindruckendes Schauspiel der Natur. Aber es war anders gekommen. Ein Bild hatte sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Es brachte sämtliche Erinnerungen zurück.
Wenige Kilometer nordöstlich von Gamle Metten war ihr etwas Eigenartiges aufgefallen, nachdem sie in einer kleinen Bucht aufs offene Meer geschaut hatte. Es handelte sich um eine Jacht, die 250 Meter vom Ufer entfernt vor Anker lag. Durch ein Fernglas beobachtete sie, wie ein motorisiertes Schlauchboot vom Mutterschiff ablegte und auf den Strand zuhielt. Kurz darauf erreichte es das Ufer und zwei Männer sprangen in den dunklen Sand. Das erschien nicht ungewöhnlich. Es kam öfters vor, dass Hochseejachten mit Abenteurern oder große Kreuzfahrtschiffe mit Urlaubern an Bord einen Stopp vor der beeindruckenden Kulisse des schneebedeckten Vulkans einlegten. Sie betraten die Insel allerdings nicht mit geschulterten Gewehren. Immerhin repräsentierte Jan Mayen norwegisches Hoheitsgebiet und kein Niemandsland. Natürlich steckte keiner der hier stationierten Wissenschaftler ohne eine Schusswaffe die Nase vor die Tür. Auch sie trug eine doppelläufige Flinte bei sich, um notfalls den Angriff eines Eisbären abzuwehren. Mit dem Auftauchen der gefährlichen Gesellen musste sie stets rechnen, da hier deren angestammter Lebensraum war. Im Polargebiet war der Mensch der Eindringling. Das Verhalten der Fremden indes, die ohne ihr Wissen, und damit ohne Legitimation, Waffen bei sich führten, erregte ihr Misstrauen. Sie beschloss, hinunter in die Bucht zu fahren und die Männer aus der Nähe ins Auge zu fassen. Um keinen Lärm zu verursachen, der ihre Präsenz verriet, schob sie das Quad bis in die Bucht hinein und stellte es neben einem Felsen ab. Als sie abermals nach den Unbekannten Ausschau hielt, blieben sie verschwunden. Nur das Schlauchboot mit der Kennung Polarstar, Höfn, Iceland ruhte einsam am Ufer. Die Jacht und ihre Crew kamen demnach aus der Hafenstadt Höfn. Ein Ort an der Südostküste Islands, der über 700 Kilometer von der Insel Jan Mayen entfernt lag. Sie fragte sich, was die Leute hier suchten, und folgte ihren Spuren im Sand. Sie führten zu einer Felswand und endeten vor dem Eingang einer Höhle. Deutlich hörte sie Stimmen aus dem Inneren nach außen dringen. Bis zu dem Zeitpunkt war ihr die akute Gefahr, in der sie schwebte, nicht bewusst. Das änderte sich schlagartig. Warnend signalisierte ihr Verstand, Vorsicht walten zu lassen. Leise trat sie den Rückzug an und versteckte sich hinter einem Felsblock. Nach einer halben Stunde krochen die beiden Männer wieder ans Tageslicht. Stumm zeigte einer der Unbekannten, der neben einem Gewehr auch einen Revolver in der Hand hielt, auf eine signifikante Stelle im Sand. Der andere nickte schweigend und brachte seine Waffe in Anschlag. Im selben Augenblick begriff Inga Hallström die Tragweite ihres unüberlegten Tuns. Ihr lief ein Schauer über den Rücken. Die Fremden begannen, ihre Spur im Sand zu verfolgen. Sie lockte sie unerbittlich zu ihrem Versteck.
„Kommen Sie hinter dem Felsen hervor“, hörte Inga Hallström den Mann mit dem Revolver rufen.
Sie war vollkommen wehrlos. Ihre Flinte lehnte dummerweise am Quad. Fest entschlossen, sich nicht freiwillig auszuliefern und einem ungewissen Schicksal entgegenzusehen, tat sie das einzig Richtige. Leise legte sie ihren schweren Rucksack ab und rannte einem Wiesel gleich davon. Bis die Fremden die Flucht bemerkten, war sie bereits 50 Meter von ihnen entfernt. So hatte die Jagd um ihr Leben begonnen und jetzt, am Grunde des dunklen Schlunds, einen ungewissen Ausgang genommen.
Ratlos schaute sie nach oben. Über ihr zeigte sich helles Licht. War es noch Tag? Oder doch schon Nacht? Sie vermochte es nicht zu ergründen, denn auf der kleinen Insel am 71. nördlichen Breitengrad herrschte zurzeit polarer Sommer. Von Mai bis Juli versank die Sonne nicht unter den Horizont. Wie lange sie ohnmächtig am Boden lag, blieb ein Geheimnis. Es konnte eine Stunde oder sogar ein ganzer Tag verstrichen sein.
Sie verspürte Durst und eine schleichende Kälte in ihren Gliedern. Auch in der warmen Jahreszeit kletterten auf Jan Mayen die Temperaturen wenig über Null. Zehn Grad gehörten eher zur Seltenheit. Zitternd versuchte sie aufzustehen, um ihren Kreislauf in Schwung zu bringen. Ein Brennen und Stechen an ihrem rechten Oberschenkel hinderte sie schmerzhaft daran. Blitzartig kehrte eine Szene in ihr Bewusstsein zurück: Sie war angeschossen worden. Behutsam befühlte sie mit den Fingern die Verletzung. Das Projektil hatte die Hose ihres Thermoanzugs an der Seite zerfetzt und ihre Haut gestreift. Zum Glück handelte es sich nur um eine Fleischwunde, die wenig blutete, aber höllisch schmerzte. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Felswand und grübelte über ihre missliche Lage nach. Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Er verdrängte das Schmerzgefühl in den hintersten Winkel ihres Empfindens. Auf dem Bauch liegend begann sie, den Boden abzusuchen. Nach einer Weile hatte sie das Objekt ihrer Begierde aufgespürt. Krampfhaft umklammerten ihre Finger den Rettungsanker in die Zivilisation: das Funkgerät. Nach dem Einschalten hörte sie ein leises Knacken. Offenbar hatte es den Sturz unbeschadet überstanden und funktionierte noch. Mit Zuversicht versuchte sie, ihre Kollegen in Helenesanden zu kontaktieren. Zu ihrer Enttäuschung kam keine Antwort. Verzweifelt wiederholte sie mehrfach den Hilferuf, doch das Ergebnis blieb dasselbe: eine beängstigende Stille, untermalt von einem gleichförmigen Hintergrundrauschen.
Deprimiert legte sie das Gerät zur Seite. Hatte es beim Aufprall auf den Boden einen Knacks bekommen? Sie versuchte, sich Mut zuzusprechen, um nicht in einen depressiven Zustand zu verfallen oder sich gar aufzugeben. Wahrscheinlich lag ihr Gefängnis zu tief unter der Erde – die mögliche Erklärung für die Funkstille. Um in Kontakt mit der Wetterstation zu treten, musste sie nach oben klettern. Einsam gefangen, am Grunde der Erdspalte, frierend, dürstend und den Launen der Natur ausgeliefert, bestand keine Chance, ihre Situation zu verbessern. Sie entschied sich, eine Weile auszuruhen, da der Aufstieg aus der unteririschen Falle ihr die letzten Kräfte abverlangen würde.
6.
Björn Andersen fiel eine zentnerschwere Last von der Seele. Doch freuen konnte er sich nicht. Inga Hallström blieb verschwunden und die Auflösung ihres Schicksals weiterhin im Dunkel verborgen.
Sigurd Johannsen hob ihren Rucksack auf und hängte ihn über die Schulter. Plötzlich rüttelte er Björn Andersen aufgeregt am Arm. Etwas am Boden stach ihm in die Augen. Vom Fuß des Felsens führten die Spuren der Vulkanologin und die ihrer Verfolger bis zu einer Anhöhe. War sie dort hinaufgeklettert, auf der Flucht vor den unbekannten Häschern? Ein Umstand, den es nachzuprüfen galt. Mühselig erklommen sie den holperigen Hang. Wiederholt gab das lose Geröll unter ihren Füßen nach, aber dies schreckte sie nicht ab. Beharrlich setzten sie den Aufstieg fort. Oben angekommen, fiel eine ungewöhnliche Erscheinung in ihr Blickfeld. 10 Meter vor ihnen schimmerten mehrere rätselhafte Objekte auf dem Boden. Sie reflektierten das Licht der tief stehenden Sonne.
„Was ist das?“, fragte Sigurd Johannsen verwundert.
„Keine Ahnung“, antwortete Björn Andersen. „Untersuchen wir die Sache näher.
Wie sich herausstellte, handelte es sich um Patronenhülsen aus einer Pistole. Sie lagen auf dem Lavagestein verstreut, direkt neben einem zwei Meter breiten Abgrund. Björn Andersen hielt eine der Hülsen unter seine Nase. Ihr haftete noch der Geruch verbrannten Schießpulvers an, was bedeutete, dass sie jemand erst vor Kurzem abgefeuert hatte. Kein Wissenschaftler auf der Insel nannte eine Pistole sein Eigen. Alle besaßen ein Gewehr für ihren Schutz. Wer also feuerte hier auf wen und weshalb? Björn Andersens Gesicht färbte sich kreidebleich. Die Pistole sprach für die unbekannten Besucher. Ingas Waffe lag unten am Strand. Wehrlos muss sie den Angreifern gegenübergestanden haben. Stürzte sie getroffen in den Abgrund? Erschüttert über seinen Verdacht, fiel er am Rande des Schlunds auf die Knie. Mit einem Gefühl der Verzweiflung schaute er hinunter in die gähnende Finsternis.
7.
Überraschend hörte sie ein prasselndes Geräusch. Kleine Steinchen fielen auf den Boden und rollten ihr zwischen die Füße. Sie hatten sich vermutlich oben vom Rand der Erdspalte gelöst. Neugierig hob sie den Kopf und erblickte 5 Meter über sich das vertraute Gesicht Björn Andersens. Im Glücksrausch der unerwarteten Rettung vergaß sie ihre schmerzenden Wunden, den Durst und die Kälte.
„Björn!“, schrie sie voller Freude. „Ich bin hier unten. Kannst du mich sehen?“
„Inga? Gott sei Dank, du lebst!“, rief er, von allen Sorgen befreit. „Ich glaubte, ich hätte dich verloren, und bin froh, deine Stimme zu hören. Leider kann ich nichts erkennen. Es ist zu Dunkel. Wie bist du in dieses Loch gefallen?“
„Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir später, nachdem du mich aus der eisigen Gruft befreit hast“, meinte sie erleichtert.
„Ich lass ein Seil zu dir hinunter. Gleich bin ich bei dir“, erwiderte er und kletterte vorsichtig die Felswand hinab. Sekunden später hielt er sie freudetrunken in den Armen.
8.
Missmutig ließ Luka Falcone den Spatel und die Bürste auf das trockene Geröll fallen und richtete sich auf. Sein Blick schweifte über die Nekropole des Byrsahügels, der höchsten Erhebung im Ausgrabungsgelände. Er war der Mittelpunkt des antiken Karthago gewesen. Hier hatte sich die prächtige Oberstadt befunden, mit den Tempeln der Götter und den Machtzentren der politischen und militärischen Elite im Zentrum. Der junge dunkelhaarige Archäologe aus Rom, der mit seinem Freund Andrea Favelli die Freilegung eines Gräberfeldes leitete, reckte die Glieder. Die unbequeme Haltung, die er während der Buddelei hatte einnehmen müssen, bereitete ihm zunehmend Unbehagen. Die Feldforschung war für ihn zwar das Nonplusultra der Archäologie, hatte allerdings ihren Preis. Er fühlte ihn in beiden Knien. Gleichwohl nahm er den Schmerz gern in Kauf. Die Geschichte Karthagos faszinierte ihn schon seit der Kindheit.
Das Wissen über das Leben der Menschen dieser Stadt war dünn gesät. Das lag in ihrer völligen Zerstörung begründet. Rom hatte 146 vor Christus ganze Arbeit geleistet und sie bis auf die Grundmauern geschliffen. Selbst die Bibliothek war nicht verschont geblieben. Mit ihr waren alle schriftlichen Zeugnisse jener Kultur dem Feuer zum Opfer gefallen und unwiederbringlich verloren gegangen. Nur wenige Inschriften auf gefundenen Grabstelen zeugten noch von der einstmaligen Großmacht an der afrikanischen Mittelmeerküste. Das antike Rom hatte zu keiner Zeit Rivalen neben sich geduldet. Rom hatte sie stets vernichtet. Und in diesem Fall beinahe bis zur Vergessenheit. Als Kaiser Augustus auf die Idee kam, die Stadt wiederzubeleben, und dort Tausende landhungrige Kolonisten ansiedelte, waren mit der Abtragung großer Areale des Byrsahügels, in denen noch die verkohlten Fundamente der von Scipio gebrandschatzten Häuser und Paläste ruhten, auch die letzten Spuren der punischen Metropole von der Bildfläche verschwunden. Was folgte, war ein Karthago, das römische Kultur und römischer Baustil prägte: Colonia Iulia Concordia Carthago. Vielleicht fühlte sich Luka Falcone aus diesem Grund dazu hingezogen, den Mantel des Vergessens vom Volk der Punier abzustreifen. Eine Art innerer Ruf der Wiedergutmachung, obwohl es für ihn nichts gutzumachen gab, denn er trug ja keine Schuld an dem Geschehen. So gesehen war es eher eine emotionale Regung, ein Gefühl der Verantwortung, das Bedürfnis, das Verlorene wiederzufinden, um ihm seinen Platz in der Geschichte zurückzugeben.
„Hier unten liegt irgendwas!“, hörte er Andrea Favelli plötzlich rufen. Neugierig schaute er auf ihn herab.
In der Brille des hageren Mannes spiegelte sich das Licht der heißen Nachmittagssonne wieder, als er Luka Falcone aus dem Loch mit der Hand zuwinkte. Unter vorsichtigen Bürstenstrichen kam unter dem Staub der Zeit das Bruchstück einer Marmorstele zum Vorschein.
„Sie trägt eine Inschrift“, stellte Andrea Favelli mit innerer Freude fest. „Endlich mal ein Fund mit Potenzial.“ Akribisch säuberte er mit einem Pinsel die in den Stein hineingeritzten Zeichen und las verdutzt:
„HIRON VON CARTHAGO - BEZWINGER DER BARBAREN“
„Wer zum Teufel war Hiron und wer die Barbaren, die er besiegte?“ Er war enttäuscht, hatte er doch gehofft, auf das Grabmal einer bekannten Person zu stoßen. Dabei dachte er an König Mago oder seinen Sohn Hasdrubal. Das wäre sensationell gewesen. Aber Hiron? Der Name sagte ihm nichts.
„Lass uns das Fundstück morgen ins Nationalmuseum überführen. Vielleicht fällt Professor Bouazizi dazu etwas ein“, schlug Luka Falcone vor.
Andrea Favelli nickte. Es schien im Moment die beste Lösung, um die Identität des besagten Hiron aufdecken zu können, denn Kemel Bouazizi, der Leiter des Nationalmuseums, war auf dem Gebiet der Geschichte Karthagos und der Phönizier eine Kapazität mit Rang und Namen. Überzeugt, das Richtige zu tun, nahm er sein Handy in die Hand, um ihn anzurufen und über den Ausgang der Grabung zu informieren.
9.
Das Wetter war umgeschlagen und die regenreiche Sturmfront nordwärts in die Grönlandsee gezogen. Die aufgewühlten Wogen des Meeres hatten sich geglättet und so der Anna Katrin die Möglichkeit gegeben, die Polarstar gefahrlos zu bergen und in den Hafen von Raufarhöfn zu schleppen.
Die besten Jahre des kleinen Fischerortes lagen lange zurück. Auf der Halbinsel Melrakkaslétta gelegen – was im Deutschen das Land der Polarfüchse bedeutete – lag er nur 17 Kilometer südlich vom Polarkreis entfernt und repräsentierte damit den nördlichsten bewohnten Punkt Islands. In den 1950er Jahren galt Raufarhöfn, bedingt durch die reichen Heringsvorkommen, als wirtschaftlich aufstrebender Ort. Ein Jahrzehnt später waren die Fanggründe allerdings leergefischt und er verfiel wieder in die Bedeutungslosigkeit, was die nachfolgende Landflucht erklärte. Heute zählte der verschlafene Ort nicht einmal 250 Einwohner.
Kommissar Einar Jonsson war in aller Eile aus Reykjavík angereist und am frühen Nachmittag mit einem Polizeiflugzeug auf dem kleinen Flugfeld am Rande des Ortes gelandet. Der 60-jährige, untersetzte, grauhaarige Fastpensionär mit dem dicken Oberlippenbart hatte den Auftrag erhalten, Licht in den Fall der mysteriösen Hochseejacht zu bringen. An der Seite eines Mitarbeiters des örtlichen Küstenschutzes verfolgte er mit Spannung das Anlegemanöver der beiden Schiffe. Kurz nachdem die Polarstar vertäut und die Gangway ausgelegt war, betrat der Skipper der Anna Katrin in Begleitung des Bootsmanns den Kai. Eine Gruppe Schaulustiger versperrte dem Kommissar und seinem Begleiter den Zugang. Unter den verwunderten Blicken der Einheimischen, die keine Anstalten machten, ihnen den Weg freizugeben, quetschten sie sich mit betontem Körpereinsatz bis zur Gangway durch.
„Guten Tag! Mein Name ist Einar Jonsson. Ich arbeite für die Kriminalpolizei in Reykjavík und leite die Untersuchungen“, begrüßte er die Seeleute freundlich mit einem festen Händedruck, um gleich zu Anfang ein vertrauensvolles Klima zu schaffen.
„Ihr Eintreffen teilte mir der Küstenschutz über Funk bereits mit. Mein Name ist Magnus Fridriksson. Ich bin der Kapitän des Fischkutters Anna Katrin und das ist mein Bootsmann Halldor Bergsson“, erwiderte der Skipper entgegenkommend. Eine Spur der Erlösung zeigte sich in ihren angespannten Gesichtern. Die Bergung der Jacht hatte sie offenbar seelisch tief mitgenommen.
„Bitte berichten Sie mir, was heute Morgen geschah, Herr Fridriksson“, ermunterte ihn Einar Jonsson, zu dem Fall auszusagen.
„Mein Steuermann nahm auf dem Radarschirm die Jacht zuerst wahr. Auf meine Anweisung näherten wir uns ihrer Position bis auf wenige Schiffslängen. Wie wir feststellten, trieb sie antriebslos und ohne eingeschaltete Positionslichter in der See. Halldor und ich setzten in einem Schlauchboot über. An Bord fanden wir jedoch keine lebende Seele. Die gesamte Crew blieb spurlos verschwunden. Das war richtig unheimlich. Später stolperte Halldor unter Deck über einen grässlich entstellten Leichnam. Vor Schreck blieb ihm beinahe das Herz stehen.“
„Ein Leichnam und eine verschollene Mannschaft? Seltsam? Was kann den Seeleuten widerfahren sein?“, fragte Einar Jonsson erstaunt.
„Die Lösung des Rätsels vermag ich nicht zu beantworten“, versicherte der Skipper glaubhaft und zuckte mit den Achseln. „Nach dem Leichenfund brachen wir die Kontrolle der Kajüten im Mittelschiff ab. Die Laderäume im Vorschiff warten ebenfalls noch auf eine Inspektion. Nach dem grässlichen Erlebnis in der Mannschaftslogis beschlossen wir, auf weitere Überraschungen zu verzichten.“
Einar Jonsson nickte verstehend. Die Handlungsweise der beiden Seeleute war leicht nachzuempfinden. „Weilten neben Ihnen noch andere Personen auf der Jacht?“
„Nein Kommissar, bloß ich und mein Bootsmann. Sonst keiner. Der Küstenschutz von Raufarhöfn bat uns heute Morgen, das Schiff zu bergen. Aus diesem Grund waren wir gezwungen, auf die Jacht zurückzukehren – und das mit Widerwillen.“
„Danke für die Informationen. Jetzt benötige ich Ihre Hilfe, auch wenn sie unangenehm sein kann“, erwiderte Einar Jonsson, um Verständnis ringend. „Führen Sie mich unter Deck und zeigen Sie mir die Leiche. Später überprüfen wir die restlichen Kajüten. Der Kollege vom Küstenschutz und Ihr Bootsmann warten hier solange. Ich möchte keine Verunreinigungen am Tatort hervorrufen. Meine Kollegin von der Spurensicherung wird erst heute Abend eintreffen.“
Während der Bootsmann nach dem Wunsch des Kommissars erleichtert aufatmete, wuchs das Missbehagen des Kapitäns über das Maß des Erträglichen. „Wie Sie wünschen“, antwortete er mit belegter Stimme. „Selbstverständlich helfe ich Ihnen, obwohl es weiß Gott Angenehmeres gibt. Bitte folgen Sie mir aufs Mittelschiff.“
Schweigend stiegen sie die Treppe zur Mannschaftslogis nach unten.
Vor der geöffneten Kajütentür des toten Seemanns blieb der Skipper stehen. „Hier ist es“, meinte er lapidar und drückte dem Kommissar eine Taschenlampe in die Hand.
Präzise richtete Einar Jonsson den Strahlenkegel in jede Ecke des Raumes. Schnell machte er sich ein Bild vom Ausmaß des Geschehens. Kein Detail entging seinem geübten Blick. Der Tote ruhte auf dem Rücken, die Arme und Beine vom Körper gestreckt, inmitten einer angetrockneten Blutlache. Die tödlichen Schläge hatten den Kopf von vorn getroffen und das Gesicht entstellt. Die Tatwaffe, ein Schiffsbeil, befand sich zur Linken des leblosen Körpers. Die Inneneinrichtung, ein heruntergerissenes Wandregal, ein kleiner Tisch und vier Stühle lagen umgekippt, zum Teil geborsten, auf dem Boden. Die Kajüte zeigte ein Bild der Zerstörung, das von einem verzweifelten Kampf zeugte. Vermutlich hatte sich der arme Seemann bis zum letzten Atemzug gewehrt. Doch am Ende war er dem Mörder unterlegen gewesen.
„Das reicht fürs Erste“, entschied Einar Jonsson und schob den Skipper zurück in den Flur. „Lassen Sie uns weitergehen. Wir müssen die restlichen Räume durchsuchen.“
Sie kontrollierten jeden Winkel, aber erst in der letzten Kajüte stießen sie auf weitere Spuren. Sie offenbarten blutige Details, die auf ein Massaker hindeuteten. Zwei Männer lagen tot am Boden. Einer war erschossen worden. Das Projektil hatte die linke Brust durchdrungen und aller Voraussicht nach das Herz zerfetzt. Der andere wies am Hals eine tiefe Schnittwunde auf. Jemand hatte ihm hinterrücks mit einem scharfen Gegenstand fast den Kopf abgetrennt. Ein Bild, geprägt von Brutalität und Abscheu.
Ein Tatort mit drei Leichen. Für isländische Verhältnisse ein absolutes Novum. Seit 40 Jahren arbeitete er bei der Reykjavíker Kriminalpolizei, aber ein Mordfall dieses Kalibers war ihm bis heute nicht untergekommen. „Führen Sie mich bitte auf das Vorschiff“, bat er seinen unfreiwilligen Begleiter. Einar Jonsson zeigte sich äußerlich unbeeindruckt. Natürlich nur, um seine Contenance zu wahren. In Wahrheit berührte ihn der Tod der Seeleute ungemein. Gleichwohl verlangte der Job eine sachliche Analyse der Morde, ohne den Einfluss von Gefühlen, da sie oft die Logik ausblendeten. Allein mit dem nötigen emotionalen Abstand war der Fall jedoch nicht zu lösen.
Im Lagerraum auf dem Vorschiff bot sich ein ähnliches Bild. Ein weiteres männliches Opfer lag leblos und blutüberströmt über dem Ladegut der Jacht. Der Leib des Mannes war von zahlreichen Kugeln getroffen. Er war regelrecht hingerichtet worden und hatte nicht den Hauch einer Chance zum Widerstand besessen.
„Ich denke, ich habe vorerst genug gesehen. Gehen wir von Bord“, meinte Einar Jonsson konsterniert. Jetzt zeigte auch sein Gesicht offen das Entsetzen über die Verbrechen.
Dem Skipper der Anna Katrin musste er den Vorschlag kein zweites Mal unterbreiten. Er war froh, von dem Höllenschiff herunterzukommen. Ein guter Schluck tat jetzt not, um auf andere Gedanken zu kommen.
Kapitel 2
1.
22. Juni
Mit dem milden Südwind zogen am Morgen die Ausläufer eines Tiefdruckgebietes zur Insel Jan Mayen. Feiner Nieselregen tauchte die Umgebung der Wetterstation Helenesanden in einen feuchten Dunst und der schneebedeckte Beerenberg lag hinter dunklen Wolken verhüllt. Inga Hallström wandte ihren Blick von dem eintönigen Grau hinter dem Fenster ab und blickte gelangweilt zum Fernsehgerät, wo die Nachrichten im Frühstücksfernsehen liefen.
Die junge Frau hatte sich von ihrem gefährlichen Abenteuer physisch wieder erholt. Lediglich der Streifschuss am Bein verursachte noch Probleme beim Laufen. Ingas äußerliche Ruhe und Gelassenheit täuschte allerdings. Die Balance ihrer Psyche stand nach wie vor auf wackligen Füßen. Ständig liefen ihr dieselben Gedanken durch den Kopf. Was hatte die beiden Männer auf die Insel geführt? Was hatten sie geglaubt, hier zu finden? Auch die Höhle am Strand spielte in ihren Überlegungen eine Rolle. Eine Komponente, die möglicherweise die Antworten auf ihre Fragen enthielt. Für ihre Verfolger tauchte sie zur falschen Zeit am falschen Ort auf, wo sie etwas beobachtete, was offenbar niemand zu sehen bekommen sollte. War das der Grund gewesen, weshalb man sie töten wollte? Die Bestätigung ihrer Hypothese konnte sie allein auf dem Nordostteil der Insel finden. In der Bucht hinter der verlassenen Wetterstation Gamle Metten.
Björn Andersen, der neben ihr saß und an seinem Frühstück kaute, stutzte plötzlich. „Schau Inga, was für ein Zufall! Das Schiff, das sie gerade in den Nachrichten zeigen, trägt den gleichen Namen wie die Jacht, die du vor zwei Tagen an der Nordküste ankern sahst“, meinte er verblüfft.
„Das ist kein Zufall“, antwortete sie und sah entgeistert auf den Bildschirm. „Es ist dasselbe Schiff. Ich erkenne es wieder. Merkwürdig? Auf welche Weise erreichte es so schnell die isländische Küste?“
„Das ist durchaus möglich“, mischte sich Sigurd Johannsen in ihr Gespräch ein. „Die Nordküste Islands liegt bloß 600 Kilometer von Jan Mayen entfernt. Ein Boot, das 15 Knoten in der Stunde erreicht, schafft die Distanz locker an einem Tag.“
Wie sie in den Nachrichten erfuhren, war das Schiff am gestrigen Morgen – führerlos auf dem Meer treibend – von einem Fischkutter entdeckt und in den Hafen von Raufarhöfn geschleppt worden. Die Untersuchung durch die Polizei förderte einen schrecklichen Fund zutage – vier tote Seeleute, ermordet auf bestialische Weise. Die Beamten tappten jedoch im Dunkel. Ein undurchdringlicher Nebel verschleierte die rätselhaften Ereignisse auf dem Schiff. Niemand sah sich in der Lage, das Geschehen an Bord zu erklären. Es fehlte ein Motiv für die Bluttat.
„Kannst du dich noch an die Gesichter deiner Verfolger erinnern?“, fragte Björn Andersen beiläufig.
„Im Angesicht des Todes brannten sie sich tief in mein Bewusstsein hinein. Sie standen direkt hinter mir, während ich über dem Abgrund hing. Als ich über meine Schulter blickte und sie um ihre Hilfe bat, zeigten sie kein Mitleid. Ich sehe noch immer ihre Waffen und ihre kalten gefühllosen Augen auf mich gerichtet. Mir gefriert das Blut in den Adern, wenn ich daran zurückdenke“, antwortete sie schaudernd.
Er spürte, mit der Frage unbeabsichtigt in ihr ein Gefühl geweckt zu haben, welches verdeutlichte, dass sie das Erlebnis am Beerenberg noch nicht verarbeitet hatte. „Ich fahre morgen in die Bucht zurück, um mir die Höhle anzuschauen. Vielleicht finde ich dort einen Anhaltspunkt, warum die Fremden versuchten, dich zu ermorden“, gab er überraschend bekannt.
„Ich begleite dich. Das ist sicherer“, bemerkte Sigurd Johannsen auf dessen unerwartete Eröffnung. „Und außerdem – vier Augen sehen mehr als zwei“.
„Seht euch vor, Jungs. Geht kein unnötiges Risiko ein.“
„Mach dir keine Sorgen, Inga. Wir passen auf uns auf“, gab sich Björn Andersen locker.
Ihrem Vorhaben zustimmend, fasste sie einen Entschluss. „In der Zwischenzeit nehme ich Kontakt zu den isländischen Behörden auf. Meine Beobachtungen sind für die Polizei bestimmt hilfreich.“
Die beiden Männer bestärkten sie in der Absicht. Es wäre für die Rückkehr ihrer seelischen Balance förderlich, wenn sie mit den Beamten über den Vorfall am Beerenberg sprechen würde.
2.
Gelangweilt legte Einar Jonsson die Zeitung beiseite. Das Büro des Küstenschutzes von Raufarhöfn war klein und die Möblierung antiquiert. Wenigstens gab es einen Computer mit Internetanschluss und ein Faxgerät, auch wenn die Anlage vorsintflutlich ausschaute. Er war also nicht gänzlich von der Außenwelt abgeschnitten.
Unerwartet klingelte das Telefon. Arne Fridthjofson, der Hafenmeister von Raufarhöfn, nahm wortlos den Hörer ab. Erschrocken verzog er sein schmales runzliges Gesicht. „Fassen Sie ihn nicht an! Lassen Sie ihn liegen, bis wir bei Ihnen eintreffen!“, rief er lautstark in den Hörer und legte ihn fahrig auf den Apparat zurück.
„Gibt es Neuigkeiten?“, fragte ihn Einar Jonsson.
„Und ob!“, erwiderte er aufgeregt. „Unterhalb des Leuchtturms spülten die Wellen einen toten Mann ans Ufer. Ein Fischer fand ihn zwischen den Klippen. Ob er zur Besatzung der Polarstar gehörte?“
„Das wäre möglich, Herr Fridthjofson. Schauen wir uns die Leiche an, dann wissen wir mehr.“
Erneut klingelte das Telefon.
„Es ist für Sie“, meinte der Hafenmeister lapidar und reichte ihm den Hörer in die Hand.
„Kommissar Jonsson am Apparat. Mit wem spreche ich bitte?“
„Mein Name ist Gunnar Halldorson. Ich leite die Polizeistation in Höfn. Sie hatten sich gestern bei meinen Kollegen über den Eigentümer einer Jacht erkundigt, die den Namen Polarstar trägt.“
„Ja, richtig! Haben Sie etwas über ihn in Erfahrung gebracht?“
„Der Mann heißt Magnus Stefansson und ist nicht nur ihr Besitzer, sondern gleichfalls ihr Kapitän. Er vermietet sein Schiff an Touristen und bietet ihnen Abenteuerfahrten in die Grönlandsee und nach Spitzbergen an. Im Moment befindet er sich auf einer Tour zur Insel Jan Mayen.“
„Wie viele Männer zählt die Crew der Polarstar?“
„Stefansson eingeschlossen: fünf Personen.“
„Herr Halldorson, ist Ihnen bekannt, wer die Jacht für die Fahrt nach Jan Mayen angemietet hat?“
„Diese Frage kann ich Ihnen nicht präzise beantworten. Angeblich haben zwei Männer sie gechartert, die einen Tag zuvor aus Reykjavík angereist waren. Es gibt Augenzeugen, deren Aussagen darauf hindeuten, dass es sich um Ausländer handelt. Ihre Namen sind mir leider noch nicht bekannt. Dem Anschein nach stiegen sie in einem Hotel ab, bevor sie zur Insel Jan Mayen aufbrachen. Eine Option, die meine Leute in Höfn gerade überprüfen.“
„Wie viel Zeit wird die Recherche ihrer Kollegen in Anspruch nehmen? Die Kenntnis über die Identitäten der Personen ist mir äußerst wichtig.“
„Nicht viel. In Höfn gibt es wenige Hotels. Wir sind bloß ein Provinznest“, erhielt Einar Jonsson zur Antwort.
„Können Sie mir einige Angaben über das Aussehen von Magnus Stefansson machen?“
„Selbstverständlich. Er ist 52 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, hat graue Haare und ist von kräftiger Statur. Seine linke Wange weist eine tiefe Narbe auf. Die Verletzung rührt von einer gerissenen Stahltrosse her, die ihm vor einigen Jahren während eines schweren Sturms ins Gesicht schlug. Ich schicke Ihnen gleich per E-Mail ein Foto von ihm nach Raufarhöfn rüber.“
„Vielen Dank, Herr Halldorson, und auf Wiederhören.“ Einar Jonsson wirkte nach dem Telefonat zuversichtlicher. Endlich kam Bewegung in die undurchsichtige Affäre. Mit seinen Gedanken war er bereits bei der angespülten Leiche unterhalb des Leuchtturms, als das Telefon zum dritten Mal läutete.
„Heute scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen. Sonst bleibt das Ding den ganzen Tag stumm“, meinte der Hafenmeister scherzend und griff abermals zum Hörer. Schweigend nahm er die Worte des Anrufers zur Kenntnis und legte grübelnd auf.
„Was ist geschehen?“, fragte Einar Jonssons beunruhigt.
„Der Anruf kam von Jon Gyrdirsson. Er betreibt in Raufarhöfn einen Supermarkt am Ortsrand. Sein Auto ist letzte Nacht gestohlen worden.“
Während Einar Jonsson über den Wert der Nachricht für den aktuellen Fall nachsann, traf die E-Mail von Gunnar Halldorson aus Höfn ein. Ratternd spukte der alte Drucker das Foto von Magnus Stefansson aus.
3.
Das weiß getünchte, drei Stockwerke hohe Nationalmuseum Karthagos lag nur einen Katzensprung vom Ausgrabungsgelände entfernt und beherbergte zahllose Zeugnisse punischer Geschichte. Andrea Favelli und Luca Falcone stoppten ihren Pick-up direkt vor dem Hauptportal. Verfolgt von neugierigen Blicken einiger Besucher, trugen sie ihr Fundstück in einer mit Holzwolle gefüllten Kiste durch die heiligen Hallen.
Im Labor des Museums, wo Restauratoren beschädigte Artefakte wiederherstellten oder vom Schmutz der Zeit befreiten, wartete Professor Kemel Bouazizi auf sie. Mit Interesse begutachtete er das Fragment, das die beiden Italiener auf dem Byrsahügel ausgegraben hatten. Es war knapp 40 cm breit und ebenso hoch. Die Unterseite zeigte eine schräg verlaufende Abbruchkante. Der Beweis, dass es sich um den oberen Teil einer Grabstele handelte, dessen Basis noch im Boden verborgen lag.
Der grauhaarige hagere Professor war schon jenseits der Siebzig und fuhr mit der Hand sanft über die Oberfläche des Steins. Jede Rille und jede Kerbe erkundete er genaustens mit den Fingern. Den Italienern schien es, als wolle er mit ihnen die Bedeutung der Inschrift erfühlen.
„Schauen Sie genau hin. Hier sind noch mehr Antworten zu finden. Darunter ein Relief. Leider hat der Sand der Zeit die Konturen weitgehend abgeschliffen“, verriet er ihnen. „Trotzdem lese ich viel aus dem Bild heraus. Es zeigt die Form eines Tempels. Unten am Bruchende sehen wir die Kapitelle von zwei Säulen, innen flankiert von je einer Dattelpalme, die das Dach des Gebäudes tragen. Dort gibt uns die Inschrift, eingemeißelt in punischen Lettern, Kunde über den Eigentümer der Grabstätte: Hiron von Carthago. Bezwinger der Barbaren.“ Kemel Bouazizi seufzte: „Hirons existierten mehrere in der Geschichte dieser Stadt. Um festzustellen, um welchen es sich handelt, brauche ich mehr Informationen. Wo befindet sich das Unterteil der Stele?“
„Wenn wir der Logik folgen, am selben Ort“, argumentierte Andrea Favelli. „In welcher Tiefe es liegt, bleibt abzuwarten. Da gestern die Zeit zu fortgeschritten war, haben wir die Arbeit eingestellt.“
„Sie müssen weitergraben und das fehlende Fragment bergen. Möglicherweise sehe ich mich dann in der Lage, Ihren Hiron zu identifizieren.“
Das Ergebnis löste Ernüchterung aus. Vielleicht hatten sie zu viel erwartet. Umso mehr war geboten, den Rest der Stele aufzuspüren und weitere Fakten zu sammeln. Die Aufgabe für den nächsten Grabungstag war damit vorgegeben und hoffentlich von Erfolg gekrönt.
4.
Auf dem Weg zur Bucht passierten Einar Jonsson und der Hafenmeister den Leuchtturm von Raufarhöfn. Das viereckige Gebäude erinnerte ihn an einen Wachturm, wenn es nicht die runde, rot überdachte Lichtanlage auf der oberen Plattform gäbe. Deren grellgelbe Fassade stach zwischen den vorherrschenden grauen und blassgrünen Farben des Küstenbereichs intensiv hervor und wirkte auf das Auge befremdlich. Ein steil abfallender Pfad führte die beiden hinunter zum Strand, wo Karen Gudmundsson und der Fischer, der den angespülten Leichnam entdeckt hatte, auf sie warteten. Die junge blondhaarige Polizistin, zuständig für die Spurensicherung in Jonssons Dezernat, arbeitete zugleich als Pathologin und war gestern am späten Abend aus Reykjavík eingetroffen.
Der Tote lag barfuß und spärlich bekleidet bäuchlings zur Hälfte im Wasser. Außer einer Jeans und einem zerrissenen Baumwollpullover trug er nichts auf dem Leib. Der Kopf steckte mit dem Gesicht im Sand, umspült von den auslaufenden Wellen der See.
„Haben Sie über die Todesursache etwas herausgefunden?“, kam Einar Jonsson direkt zur Sache.
„Der Mann ist mit Sicherheit nicht ertrunken. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt ohne Obduktion zweifelsfrei behaupten“, erwiderte Karen Gudmundsson.
„Und woran verstarb er dann?“, fragte Arne Fridthjofson ratlos.
Demonstrativ zog sie den zerfetzten Pullover am Rücken der Leiche hoch. Auf der nassen blassen Haut waren unübersehbar zwei Schusswunden zu erkennen.
„Die Eintrittsstellen der Projektile befinden sich in der Herzgegend. Der Mann war sofort tot. Ich vermute, er fiel vom Deck eines Schiffes ins Meer.“
„Oder seine Leiche ist über Bord geworfen worden“, orakelte der Fischer.
„Schon möglich“, räumte Karen Gudmundsson ein.
„Können Sie sich einen Reim über die Morde machen?“
„Aber ja, Kommissar. Heute am frühen Morgen inspizierte ich das Schiff und unterzog die Opfer einer ersten Untersuchung. An Bord haben sich entsetzliche Dinge abgespielt. Keiner der Seeleute starb eines natürlichen Todes. Zwei sind erschossen, ein Dritter mit einem Schiffsbeil erschlagen und einem Vierten mit einem Entermesser die Kehle aufgeschlitzt worden. Aber diese Tatbestände kennen Sie bereits. Auf dem Boot existieren jede Menge Fingerabdrücke. Sie bezeugen, dass sich mindestens sieben Personen auf dem Kahn aufhielten. Die zahlreichen Projektile und Patronenhülsen, die ich auf und unter Deck sicherstellte, deuten auf eine wilde Schießerei hin. Die Ballistiker bekommen reichlich Arbeit. Bis auf Weiteres liegen die Leichen in der Kühlkammer der Fischfabrik auf Eis. Unsere Dienststelle habe ich darüber informiert. Der Polizeipräsident verlangt, die toten Seeleute schnellstens in die Pathologie nach Reykjavík zu überführen.“
„Arnesson?“ Einar Jonsson reagierte angekratzt. „Weshalb engagiert er sich in diesem Mordfall? Für gewöhnlich zeigt er wenig Interesse an unserer Arbeit. Geschweige denn, dass er sie würdigt“, meinte er vergnatzt.
„Der Innenminister erwartet von ihm eine umgehende Aufklärung der Verbrechen. Das weiß ich aus sicherer Quelle“, antwortete Karen Gudmundsson bedeutungsvoll. „Ich begleite den Transport der Leichen und führe die Obduktionen eigenhändig durch. Über das Ergebnis meiner Analysen informiere ich Sie rechtzeitig.“
„Tun Sie das. Sie können mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Kommen wir noch einmal zum Schiff zurück. Fanden Sie neben den Fingerabdrücken und Patronenhülsen auch andere Anhaltspunkte?“
„Ach ja, Kommissar. Der Fakt ist mir beinahe entfallen“, entsann sich Karen Gudmundsson. „Das Rettungsschlauchboot fehlt. Entweder riss es sich von der Polarstar los oder jemand suchte damit das Weite.“
Die Meldung über den gestohlenen Wagen kam Einar Jonsson in den Sinn. „Na bitte!“, erwiderte er betont. „Letzte Nacht kam in Raufarhöfn ein Auto abhanden. Das kann kein Zufall sein. Hier muss es einen Zusammenhang geben. Wahrscheinlich sind der oder die Täter in der Nähe an Land gegangen. Anschließend schlichen sie in den Ort, entwendeten den Wagen und fuhren landeinwärts. Zwei wichtige Fragen müssen wir klären. Wo ist das Schlauchboot abgeblieben und in welche Richtung wandten sich die Flüchtigen?“
„Die Suche nach dem Schlauchboot hat äußerste Priorität. Wenn wir es aufstöbern, bekommen wir Gewissheit, ob Ihre Annahme stimmt. Außerdem kann es uns weitere Hinweise liefern“, gab Karen Gudmundsson ihrem Chef den Rat.
Einar Jonsson wandte sich an Arne Fridthjofson. „Bitte instruieren Sie Ihre Mitarbeiter und lassen Sie den gesamten Strandbereich in der Bucht absuchen. Es befindet sich in unserer Nähe. Ich fühle es geradezu.“
Er nickte wortlos und machte sich auf den Weg zurück ins Büro der Hafenmeisterei.
„Lassen Sie uns den Leichnam auf den Rücken drehen?“, schlug Einar Jonsson seiner Kollegin vor. „Ich trage ein Foto bei mir. Es zeigt den Eigentümer und Kapitän der Polarstar. Gunnar Halldorson, der Polizeichef von Höfn, hat es mir heute zugefaxt. Ich möchte mir das Gesicht des Mannes anschauen. Vielleicht ist es dieselbe Person.“
Karen Gudmundsson stimmte zu. Mit der Hilfe des Fischers zogen sie den Toten aus dem Schlick und rollten ihn auf den Rücken. Erst jetzt wurde deutlich, dass er noch weitere Wunden davongetragen hatte. Vor allem das Gesicht, das entstellt ausschaute, glich einem blutigen Klumpen. Gunnar Halldorsons Foto brachte ihm daher keinen Aufschluss über die Identität der Leiche.
„Der Körper muss in der Brandung mehrmals gegen die Felsen geschmettert sein, die sich am Ufer befinden. Anders kann ich mir die Verletzungen am Kopf nicht erklären, Kommissar.“
„Schauen Sie, Karen! Die linke Wange besitzt ein tiefes Wundmal, das schon vor längerer Zeit verheilt ist. Der Mann zog sich den Schmiss nicht an den Klippen zu“, stellte Einar Jonsson fest und hoffte den entscheidenden Hinweis gefunden zu haben, der die Identität des Toten preisgibt. „Laut dem Hinweis von Gunnar Halldorson weist das Gesicht von Magnus Stefansson eine auffällige Narbe auf. Ich bin mir gewiss, dass es sich um den Skipper der Polarstar handelt.
„Ich stimme Ihnen zu. Die Verletzung ist früheren Ursprungs“, bestätigte sie. „Der Haarschopf ist bereits ergraut. Der Mann war in einem fortgeschrittenen Alter. Durch die Entstellungen im Gesicht kann ich es nicht genauer eingrenzen. Halt! Warten Sie! Die Leiche lag nicht lange im Wasser. Eine Chance gibt es noch. Keine anderen Körperteile verraten das Alter eines Menschen markanter als dessen Hände. Selbst eine Schönheitsoperation kann es nicht kaschieren.“
Mit Interesse verfolgte Einar Jonsson das Tun der jungen Polizistin.
„Sehen Sie!“, begann sie ihm zu erklären. „Die Haut ist nicht so straff wie bei einem jungen Menschen. Dazu weist sie zu viele Fältchen auf dem Handrücken und an den Fingergelenken auf. Sie hat auch keine pergamentartige Struktur, die Menschen jenseits der Siebzig besitzen. Aber sie zeigt Altersflecken. Die ersten Male dieser Art treten ab einem Alter von 40 Jahren auf. Ihre Häufigkeit lässt bei dem toten Mann auf einen Menschen reiferen Alters schließen. Er war demzufolge Mitte Fünfzig, mit einer Toleranz von fünf Jahren.“
Einar Jonsson fühlte sich jetzt auf der sicheren Seite. Das fünfte Crewmitglied der Polarstar war gefunden. Plötzlich summte sein Handy. Gunnar Halldorson aus Höfn meldete sich, um das Ergebnis der überprüften Hotels durchzugeben.
„Unsere Vermutung hat sich bewahrheitet. Vor fünf Tagen checkten zwei Touristen, die mit einem Flugzeug aus Reykjavík einflogen, im Hotel Òsland ein. Anschließend führte ihr Weg zum Hafen, wo sie die Polarstar für eine Fahrt zur Insel Jan Mayen charterten. Diese Männer sind keine Isländer. Vermutlich kommen sie aus Großbritannien oder Irland“, berichtete er. Das Timbre in seiner Stimme strahlte Euphorie aus. Die Mordfälle brachten ihm wohl ein wenig Abwechslung in die routinemäßige Arbeit und stachelten seine Motivation an.