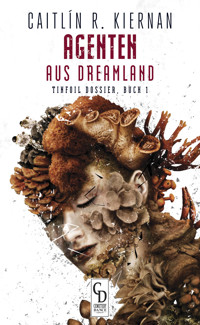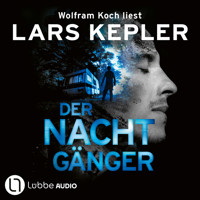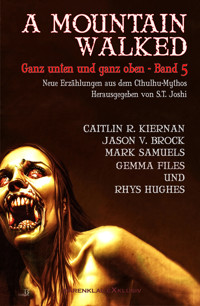
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
H. P. Lovecraft schrieb 1926 »Der Ruf des Cthulhu« und begründete damit den Cthulhu-Mythos, eines der am häufigsten nachgeahmten Weltenuniversen in der Weird Fiction. Schon zu seinen Lebzeiten haben viele andere Autoren den Mythos erweitert, und nach seinem Tod haben Hunderte von Autoren die grundlegenden Themen und Ideen Lovecrafts auf ihre ganz eigene Weise weiterentwickelt.
Dieser Band enthält einige der besten Cthulhu-Mythos-Erzählungen von Autoren wie Caitlín R. Kiernan, Jason V. Brock, Mark Samuels, Gemma Files und Rhys Hughes.
Dies ist der fünfte von sechs Bänden, herausgegeben von S.T. Joshi, die führende Autorität in Sachen H. P. Lovecraft. Er ist der Autor der Biographie I AM PROVIDENCE: The Life and Times of H. P. Lovecraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Caitlín R. Kiernan / Jason V. Brock /
Mark Samuels / Gemma Files / Rhys Hughes
A MOUNTAIN WALKED
Ganz unten und ganz oben
Band 5
Neue Erzählungen aus dem Cthulhu-Mythos
herausgegeben von S. T. Joshi
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Übersetzer: Bärenklau Exklusiv, Bearbeitung: Marten Munsonius
© der deutschen Übersetzung: Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer mit Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat/Bearbeitung: Thomas Ostwald
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
A MOUNTAIN WALKED
Ganz unten und ganz oben
Eine Einführung
Johannes Vier / Hoffnung für alle
Der Mann mit dem Horn
Ein Gentleman aus Mexiko
Wir sind [Anasazi], die Erben
Sigma Oktantis
Quellen – Nach der Originalausgabe
Das Buch
H. P. Lovecraft schrieb 1926 »Der Ruf des Cthulhu« und begründete damit den Cthulhu-Mythos, eines der am häufigsten nachgeahmten Weltenuniversen in der Weird Fiction. Schon zu seinen Lebzeiten haben viele andere Autoren den Mythos erweitert, und nach seinem Tod haben Hunderte von Autoren die grundlegenden Themen und Ideen Lovecrafts auf ihre ganz eigene Weise weiterentwickelt.
Dieser Band enthält einige der besten Cthulhu-Mythos-Erzählungen von Autoren wie Caitlín R. Kiernan, Jason V. Brock, Mark Samuels, Gemma Files und Rhys Hughes.
Dies ist der fünfte von sechs Bänden, herausgegeben von S.T. Joshi, die führende Autorität in Sachen H. P. Lovecraft. Er ist der Autor der Biographie I AM PROVIDENCE: The Life and Times of H. P. Lovecraft.
***
A MOUNTAIN WALKED
Ganz unten und ganz oben
Band 5 von 6
Neue Erzählungen aus dem Cthulhu-Mythos
Herausgegeben von S. T. Joshi
Eine Einführung
Die Veröffentlichung meines Buches »Aufstieg und Fall des Cthulhu-Mythos« (2008) hatte mehrere unbeabsichtigte Folgen, von denen die bemerkenswerteste ist, dass ich viel tiefer in das zeitgenössische Schreiben anderer Autoren über den Mythos eingetaucht bin, als ich es mir jemals vorgestellt hatte.
Es wäre unfair zu sagen, dass ich mit meinem Buch einen Abgesang des Cthulhu-Mythos schrieb und nicht loben wollte – jeder aufmerksame Leser wird feststellen, dass ich am Ende eine beträchtliche Anzahl von frühen und späten Werken hervorgehoben habe, die Lovecrafts Pseudo-Mythologie weiterentwickelt haben, und ich bin zuversichtlich, dass wir in Zukunft auch weitere Perioden erleben werden, wo der Cthulhu-Mythos kongenial fortgeschrieben werden wird. Es gibt eine Vielzahl von jüngeren Autoren, die sich weigern, sich auf bloße Nachahmung einzulassen, und stattdessen Lovecrafts Themen, Bilder und Konzepte als Sprungbrett für den Ausdruck ihrer eigenen Ideen nutzen.
Das Ausmaß, in dem selbst zu Lovecrafts Zeiten einige Autoren, die nichts mit Lovecraft selbst zu tun hatten, sein Werk als Auslöser für ihre eigenen Vorstellungen nutzten, wird durch das kuriose Werk »The House of the Worm« von Mearle Prout veranschaulicht, dass im Oktober 1933 in Weird Tales erschien. Über diesen Autor ist so gut wie nichts bekannt, abgesehen von der Tatsache, dass er drei weitere Geschichten in späteren Ausgaben von Weird Tales veröffentlichte, von denen keine in irgendeiner Weise Lovecraftianisch ist. Prout veröffentlichte kein Buch und anscheinend auch kein anderes Werk als diese vier Geschichten in Weird Tales. (Es gibt die These, dass Prout eine Frau gewesen sei, aber ich bezweifle, dass dies tatsächlich der Fall ist). Auf jeden Fall erinnert diese seltsame Story nicht nur ungewollt an den Titel eines Romans, den Lovecraft angeblich 1920 erdacht (aber wahrscheinlich nicht einmal begonnen hat), sondern enthält auch einige offensichtliche Anleihen von Formulierungen aus »Der Ruf des Cthulhu« und »The Dunwich Horror« und vielleicht auch aus »Die Farbe aus dem All«. Lovecraft nahm die Geschichte zur Kenntnis, als sie erschien, und schrieb an Clark Ashton Smith: »Letzterer [Prout] ist ein Neuling, aber seine Geschichte scheint mir trotz gewisser Anflüge von Naivität eine einzigartig authentische Qualität zu haben. Sie hat eine authentische Atmosphäre des Bösen – Dinge, die den meisten Pulp-Autoren fehlen.«
Unglaublicherweise deutet diese Passage nicht darauf hin, dass Lovecraft sich der offensichtlichen Anleihen, die Prout bei seinen eigenen Geschichten gemacht hat, überhaupt bewusst war; aber es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass er es nicht wusste. Das Entscheidende an »The House of the Worm« ist jedoch nicht, dass es einzelne Passagen aus Lovecrafts Geschichten entlehnt, sondern dass es sich tatsächlich um eine weitgehend originelle Geschichte handelt, die in keiner Weise durch ihre Lovecraft'schen Anklänge geschwächt wird.
Es mag in der Tat übertrieben sein, sie als eine »Cthulhu-Mythos«-Geschichte oder gar als eine Lovecraft'sche Geschichte im engeren Sinne zu bezeichnen; dass sie jedoch eine tiefgründige und kreative Auseinandersetzung mit Lovecrafts Werk offenbart und eine wirkungsvolle und zum Nachdenken anregende Erzählung ist, lässt sich kaum bestreiten.
Entgegen der landläufigen Meinung habe ich nie behauptet, dass nach-lovecraftsche Mythos-Erzählungen gezwungen sind, seine kosmische Perspektive zu übernehmen, um kraftvoll oder legitim zu wirken.
Es mag durchaus sein, dass der eigenwillige Kosmos das einzige Merkmal ist, das Lovecrafts Werk als Ganzes auszeichnet (nicht nur seine »Mythos«-Erzählungen), aber genau diese Tatsache macht jeden Versuch, ihn zu kopieren, zu einem gefährlichen Unterfangen.
In der Tat besteht eine der Möglichkeiten, wie sich neo-lovecraftsche Autoren ästhetisch einen Platz verschaffen können, darin, Lovecraftsche Elemente in Geschichten ganz anderer Art zu verwenden.
Lovecraft war, wie allgemein zugegeben wird, nicht besonders gut in der Charakterisierung, und seine Versuche, häusliche Konflikte darzustellen (wie z. B. in »The Thing on the Doorstep«), sie sind nicht sonderlich erfolgreich. Hier ist also ein Bereich, in dem Autoren ihre eigene Fähigkeit unter Beweis stellen können, neue Erzählungen beizutragen, und wir haben erfolgreiche Beispiele dafür in zwei sehr unterschiedlichen Erzählungen: Robert Barbour Johnsons »Far Below« (Weird Tales, Juni/Juli 1939) und C. Hall Thompsons »Spawn of the Green Abyss« (Weird Tales, November 1946).
»Far Below« wurde oft etwas überschwänglich als die größte Story bezeichnet, die jemals in Weird Tales veröffentlicht wurde – eine Ehre, die Lovecrafts »The Call of Cthulhu«, »The Whisperer in the Darkness« oder einige andere Geschichten durchaus in Frage stellen könnten.
Aber dass es in jeder Hinsicht ein Triumph für den Autor war, ist offensichtlich. Es wird angenommen, dass diese erschütternde Schilderung der Schrecken, die in der New Yorker U-Bahn zu finden sind, eine Anspielung auf die Andeutungen ähnlicher Schrecken in der Bostoner U-Bahn in Lovecrafts Story »Pickman's Model« (Weird Tales, Oktober 1927) ist, und wahrscheinlich ist das auch tatsächlich der Fall; aber dass Johnson sich eines Großteils des übrigen Lovecraft-Kosmos durchaus bewusst war, ist offensichtlich.
Die bedeutungsschwangere Formulierung »the charnel horrors of this mad Nyarlathotep-world far below« ist außerordentlich wirkungsvoll; und die kulminierende Enthüllung lässt darauf schließen, dass Johnson »The Shadow over Innsmouth« aufmerksam gelesen hatte.
Insbesondere diese Geschichte verkörpert genau die Art von »Nachahmung«, die Lovecraft selbst befürwortete, als er in einem Brief an August Derleth schrieb: »Je mehr diese Dämonen [Cthulhu und Yog-Sothoth] von verschiedenen Autoren in ihren Stories skizziert werden, desto besser eignen sie sich als allgemeines Hintergrundmaterial! Ich mag es, wenn andere meine Azathoths und Nyar-Lathoteps verwenden – und im Gegenzug werde ich Klarkash-Tons Tsathoggua, den Mönch Clithanus und Howards Bran in meinen Geschichten verwenden.«
Das Schlüsselwort hier ist und Johnsons Vorschlag, dass Nyarlathotep mit Dunkelheit und vielleicht auch mit Chaos und der Entropie assoziiert wird, ist nicht nur eine genaue Interpretation von Lovecrafts eigener Sicht auf seinen rätselhaften ägyptischen Gott, sondern auch ein Mittel, mit dem er auf Lovecrafts Erbe zurückgreifen kann, ohne die Originalität und Vitalität seiner eigenen Geschichte in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen.
Was Thompsons »Spawn of the Green Abyss« betrifft, so gelingt es dieser eindrucksvollen Novelle, einen echten emotionalen Konflikt zu beleben, in den der Arzt James Arkwright und die Frau, die er heiratet, Cassandra Heath, die Tochter des Einsiedlers Lazarus Heath, verwickelt sind; Cassandra ist hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu ihrem Mann und dem Ruf ihrer zweifelhaften Abstammung.
Es mag stimmen, dass Thompsons erfundene Stadt Kalesmouth in New Jersey – die zweifelsohne die Anleihen der Erzählung an »Der Schatten über Innsmouth« verdeutlichen soll – keine besonders gelungene Ausprägung ist; aber die Erzählung als Ganzes ist so großartig strukturiert und emotional mitreißend, wie es nur wenige von Lovecrafts eigenen Werken sind, und in diesem Maße hat sich Thompson eine echte Nische damit geschaffen.
Es überrascht nicht, dass August Derleth Thompson offenbar dazu drängte, die Idee weiterer Pastiches aufzugeben – nicht, weil Thompson gescheitert war und Lovecrafts Ruf in irgendeiner Weise schadete, sondern gerade, weil er erfolgreich war, und zwar weitaus besser als Derleth selbst in seinen eigenen Lovecraft-Imitationen!
Die Arbeit von Lovecrafts verstorbenen Kollegen Robert Bloch und Fritz Leiber verdient sicherlich Anerkennung, aber ihre Lovecraft'schen Erzählungen sind hinreichend bekannt, so dass sie hier nicht detailliert weiter erwähnt werden müssen.
Es dauerte noch etwa eine weitere Generation, bis der Mythos in Schwung kam, aber Ende der 1960er Jahre gab es einige neue interessante Lebenszeichen.
James Wades »The Deep Ones« hatte ebenfalls die Ehre, in Tales of the Cthulhu Mythos zu erscheinen, aber meiner Meinung nach hat James Turner von Arkham House einen Fehler begangen, als er es in der überarbeiteten Ausgabe des Bandes (1990) weggelassen und stattdessen eine Reihe minderwertiger Geschichten aufgenommen hat (auch wenn einige von so bekannten Autoren wie Stephen King und Philip José Farmer stammen).
Es mag sein, dass Wades Einsatz von »Hippies« in dieser Aktualisierung von »Der Schatten über Innsmouth« eine gewisse Geschmacklosigkeit aufweist, aber der Reichtum des kalifornischen Schauplatzes – ein Schauplatz, den Henry Kuttner in seinen frühen Lovecraft-Pastiches zu nutzen versucht hatte, aber daran scheiterte – und die Einbeziehung anderer zeitgenössischer sozialer Elemente machen die Geschichte zu einem herausragenden Werk, und ich bin froh, sie wieder in diesem Band publizieren zu können.
In Walter C. DeBills »Where Yidhra Walks«, das den amerikanischen Südwesten – den Lovecraft nur in den Geistergeschichten »The Curse of Yig« und »The Mound« erwähnte, und auch das nur aufgrund von Informationen aus zweiter Hand, da er diesen Ort nie besucht hatte – in den Rahmen des Cthulhu-Mythos einbezieht, befinden wir uns jedoch in einer ganz anderen Umgebung.
Wie Thompson, Campbell und andere hat auch DeBill seine Charaktere klar und lebendig gezeichnet, und zwar auf eine Weise, die sich deutlich von Lovecrafts eigenem Aufgebot an nüchternen Professoren und halbverrückten »Suchern nach dem Grauen« unterscheidet, und gerade durch die Lebendigkeit dieser Charakterisierung kann der Lovecraftsche Kosmizismus schleichend Einzug halten.
Lovecraft wurde schon zu Lebzeiten zu einer Art Ikone, ja sogar zu einer Art fiktiver Figur, zumindest unter seinen Kollegen.
Man muss niemanden daran erinnern, dass Frank Belknap Long (»The Space-Eaters«) und Robert Bloch (»The Shambler from the Stars«) Lovecraft-ähnliche Charaktere in ihren Geschichten verwendet haben – und dieses Muster hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt und gipfelt vielleicht in Werken wie Peter Cannons The Lovecraft Chronicles (2004) und Richard A. Lupoffs Marblehead (2007).
T. E. D. Kleins »Der schwarze Mann mit einem Horn« mag nicht nach Lovecraft geformt sein, aber sein Ich-Protagonist, der offensichtlich auf Frank Belknap Long basiert, wird sich bewusst, dass er einen Großteil seines Lebens in Lovecrafts Schatten verbracht hat und im Verlauf dieser reich strukturierten Novelle feststellt, dass er offenbar in eine von Lovecrafts eigenen Geschichten geraten ist.
Einige der schaurigen Momente in Kleins Erzählung sind der Gipfel der Subtilität in der Darstellung des Übernatürlichen, und diese Geschichte wird zu einem triumphalen Erfolg, nicht nur als Lovecraft-Imitation, sondern als eigenständige moderne Horrorgeschichte.
Unter den zeitgenössischen Schriftstellern gibt es nur wenige, die das Wesen einer bestimmten Art von Lovecraft'scher Erzählung besser erfasst haben als Thomas Ligotti.
»The Last Feast of Harlequin« wurde zwar erst 1990 veröffentlicht, ist aber ein frühes Werk, das die Messlatte für Lovecraft'sche Imitationen – in diesem Fall eine Nachahmung sowohl von »The Festival« als auch von dessen umfassenderer Neufassung »The Shadow over Innsmouth« – so hoch angesetzt hat, dass nur wenige ihm gerecht werden können.
Es wäre in der Tat eine Beleidigung, diese Erzählung (die jetzt in der Library of America's American Fantastic Tales zu finden ist) als bloße Imitation zu bezeichnen, denn sie offenbart Ligottis unverwechselbare Vision einer zutiefst verrückt gewordenen Welt.
Ich freue mich, den deutschsprachigen Lesern das voluminöse Werk A MOUNTAIN WALKED in sechs Bänden präsentieren zu dürfen.
S. T. JOSHI
Seattle, Washington
Johannes Vier / Hoffnung für alle
(Org. Titel: John Four)
Caitlín R. Kiernan
Der Tempel heißt Tempel, weil er ein Ort des Gebets ist, auch wenn niemand mehr betet, weil es besser ist, wenn die Götter einen nicht bemerken. Es ist besser, ein anonymer Splitter im Auge zu sein als ein Splitter im Auge, der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Vielleicht ist es das, was mit der Welt geschehen ist, in diesem letzten Zeitalter der Menschheit, vor dem Beginn dieser unendlichen Eschatologie (Begriff aus der Theologie, der das Endzeitliche beschreibt.). Es mag sein, dass die Götter endlich aufgewacht sind und auf sich aufmerksam gemacht haben. Nach zwei Millionen Jahren Gebet, Blutopfer und magischem Denken sind sie vielleicht nur aufgewacht und aus dem Himmel und aus der Hölle heraufgekrochen, um zu sehen, was so einen schrecklichen Krach macht. Vielleicht ist dies nur ein Flehen der Götter um Frieden und Ruhe.
Aber diejenigen, die sich an früher erinnern, erzählen eine andere Geschichte, diejenigen von früher, die noch sprechen können. Diejenigen von früher, die sich erinnern, wie diejenigen von früher, die noch sprechen können und sich daran erinnern, wie es geht, und die dumm genug sind, dies zu tun.
Diese immer kleiner werdende Gruppe erinnert sich daran, dass etwas von irgendwoher kam und dass Astronomen es zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig Jahre vor seiner Ankunft kommen sahen.
Es gibt keinen Konsens darüber, was dieses Etwas gewesen sein könnte, nur dass es immer zwischen den Galaxien oszilliert ist und schließlich, unvermeidlich, viel zu nahe kam und die gesamte Milchstraße verschluckte und diese neue Welt ausschüttete, in der sich der Tempel, in dem niemand betet, aus einer horizontlosen Kohleebene erhebt.
Er wurde nicht hier gebaut, der Tempel, sondern ist eine Absonderung, ein architektonischer Auswuchs. Die von früher nennen ihn krumm, weil sie sich an die andere Geometrie erinnern, diejenige, in der Worte wie krumm noch eine Bedeutung hatten.
So erhebt sich ein krummer Tempel aus einer krummen Kohleebene, und um den Tempel herum breitet sich die letzte krumme Stadt der Menschheit unter dem krummen schwarzen Himmel aus. Es wird mühsam, all diese Krummheit zu katalogisieren, und völlig absurd, denn es bleibt nichts Gerades, das einen Bezugspunkt bietet. Wenn es noch Wolken gäbe, würden die Türme des Tempels gegen ihre Bäuche stoßen. Wenn es noch Sterne gäbe, wäre es, als ob der Tempel ein anklagender Finger wäre, der auf sie zeigt.
Die Ebene. Die Stadt. Der Tempel. Der sternenlose Himmel.
Das reicht für den Moment aus.
Eine Frau, der nie ein Name gegeben wurde und die sich barmherziger Weise nicht an früher erinnert, sitzt in der großen Vorhalle des Tempels. Sie kümmert sich um eines der Becken der größeren Dunkelheit, die hier und da aus den fettigen, harzigen Wänden und Böden entspringen, weil ein Schluck oder ein Bad oder ein Ertrinken in einem dieser Becken vorübergehend das unaufhörliche Pfeifen der Flöten und das ständige Trommeln ausblendet, das immer aus den unzugänglichen oberen Regionen der Turmspitze herabströmt.
Ein Balsam aus Gewässern, die kein Wasser sind, aber die monotonen Hymnen dämpfen können, die zum Vergnügen des Chaos erdacht wurden, in jener Ära vor der Ankunft der Zeit.
Sie kümmert sich um das Becken, dessen Blut das Lachen, die Schreie und sogar das Weinen zu dämpfen vermag. Die Tümpel sind also kostbar, und diejenigen, die die Kraft, die Gabe und den nötigen Wahnsinn haben, sie zu bewahren und zu melken, sind der einzige Trost, der in all dem zerrütteten Geist der zerrütteten Rasse, die einst die Menschheit war, noch übrig ist.
Man könnte sie Mercy nennen, wenn dieses Wort nicht vergessen worden wäre. Sie könnte Befreiung heißen, aber das Konzept der Befreiung ist geschwunden, bis es kaum mehr als das unerreichbare Jucken eines Phantomglieds ist. Befreiung wurde zusammen mit Tod und Hoffnung, Blindheit und Schlaf amputiert.
Oh ja, sie kann sehen. Alle, die in der Stadt in der Ebene wohnen, können sehr gut sehen, obwohl es nirgendwo Licht gibt, sondern nur ein komplexes Kontinuum von abgestufter Dunkelheit. So sitzt die namenlose Frau, die nicht blind ist, am Rande dieses Teiches, der einer von einem halben Hundert solcher Quellen in der Stadt ist. Sie hat einen Fingerhut, einen Löffel, einen Becher und eine Schüssel. Der Fingerhut kann kaum genug fassen, um das Leiden zu lindern. Der Löffel ist verrostet und seine Kanten sind scharf wie eine Rasierklinge. Der Becher hat einen Riss und sein Henkel fehlt. Die Schale hat mehrere kleine Löcher im Boden.
Und das sind die einzigen Gefäße, mit denen sie den missgestalteten Pilgern, die zu ihr kommen, das geben kann, was als Linderung gilt.
Sie kniet schon so lange am Rand des Beckens, dass sie sich nicht daran erinnern kann, jemals gestanden, gegangen oder gelaufen zu sein. Das ist auch gut so, denn irgendwann beschloss der lebendige Boden des Narthex, dass ihre Beine und Füße wohl ein Teil seiner Ausscheidungen sein müssten, und so wurde sie inkorporiert, teilweise absorbiert und zu einem festen Bestandteil des Tempels; allerdings höchstens ein Anhängsel. Sie sprießt aus dem fettigen, schwitzenden Stein, und alle taumelnden Massen kommen zu ihr.
In der Stadt gibt es eine Art Lotterie, die festlegt, wann eine bestimmte Person den Tempel besuchen darf, so dass sie niemals überrannt wird. Trotzdem gibt es keinen Moment, in dem sich die bedürftigen, ungeduldigen Menschen nicht um sie herum drängen.
Aber sie wagen es nicht, zu ungeduldig zu werden. Denn sie bestimmt die Dosierung, die man aus dem Teich erhält – ob einen Löffel, eine Tasse oder eine Schale – und niemand widerspricht ihr, denn sie kann den Segen des Teiches auch zurückhalten. Sie kann sich weigern, und dann verschließt sich der Teich, und niemand kann auch nur noch einen Fingerhut davon haben. Auf diese Weise gibt es noch Manieren in einer Welt, in der es keine Ordnung mehr gibt. Angst und Verzweiflung haben sich den geringsten Anschein bewahrt. Und sie fördern auch Akte der Großzügigkeit, denn bei sehr seltenen Gelegenheiten kommt ein Pilger zu ihr und bringt ein kleines Stückchen von Früher mit. Die Gabe wird ihr dargebracht und auf dem Boden abgelegt, an jenem unbestimmten Ort, wo sie zum Boden des Narthex wird und der Boden des Narthex zu ihr.
»Freundlich«, flüstert sie vielleicht, oder »nachdenklich«. Selten hört man sie mehr als ein einziges Wort auf einmal sagen, denn ihr Kiefer und ihre Zunge, ihr Gaumen und ihre Zähne sind für eine Unterhaltung nicht mehr geeignet. Aber sie sagt immer mindestens ein Wort, bevor sie die Gabe an sich nimmt, was auch die Art des eifersüchtigen Tempels ist, diese Almosen für sich zu beanspruchen. Ein Pilger kann ihr einen geschmolzenen Klumpen Fensterscheibe überreichen, einen abgenagten Knochen, einen Pfennig oder das Bildnis eines vergessenen Heiligen aus Spritzgusskunststoff. Geachtete Schätze aus den Trümmern. Seltsame Andenken von früher. Sie findet sie amüsant.
Obwohl dies ein Zeitalter ohne Sekunden, Minuten oder Stunden ist, ist es nicht gerade ein Zeitalter ohne Zeit. Vielleicht sollte man eher sagen, dass es sich um ein Zeitalter handelt, in dem die Illusion von Zeit hartnäckig fortbesteht, so wie sie im Primatengehirn fest verankert ist. Die Momente scheinen immer noch aufeinander zu folgen, auch wenn es keine Möglichkeit gibt, sie zu verfolgen. Es gibt keine Tage, weil es keine Sonne gibt. Man könnte behaupten, dass mit dem Kentern der Weltkugel, die Pol über Pol in diesen Abgrund stürzte, eine Ära der unendlichen Nacht begann.
Nur gibt es weder Sterne noch Mond noch irgendeinen anderen leuchtenden Körper, der einst dazu beitrug, die Nacht als Nacht zu definieren. Diese Dunkelheit ist auch nicht einfach das Fehlen des Tageslichts. Diese Dunkelheit ist ein positiver Zustand, etwas von greifbarer Substanz, das sich über dem Kopf und unter den Füßen windet.
Die Frau, die den Brunnen in der Vorhalle des Tempels hütet, hat normalerweise kein Bedürfnis nach der Illusion der Zeit. Sie hat einen Sinn für ihre Aufgabe, etwas, das fast allen Lebenden verwehrt bleibt. Ohne sie gäbe es keine Leitung, die das Wasser des Teiches zu den Menschen bringt, die das schwächste Anodyn (Anodynum ist eine veraltete Bezeichnung für schmerzstillende Mittel) suchen.
Wenn sie etwas im Auge behält, dann ist es die durstige Parade, und wenn es ihr auffällt, zählt sie sie, bis das Zählen mühsamer wird als das Nicht-Zählen, und es wieder einmal genügt, einen Zweck zu haben. Gelegentlich kommt es ihr in den Sinn, die Pilger zu katalogisieren, sie in Typen zu sortieren. Sie weiß, dass dieses Ordnen ein Akt der Ketzerei ist, eine Blasphemie gegen den dämonischen Sultan und seinen Boten, den Schwarzen Pharao, die in der Turmspitze des Tempels wohnen. Aber sie kümmert sich um den Teich und wird deshalb bevorzugt, und die Götter halten selten inne, um in ihre Gedanken zu schauen.
Sie ist damit beschäftigt, einen neuen Plan zu entwerfen – einen, bei dem die Pilger nach den Geräuschen ihres Fleisches klassifiziert werden, wenn sie sich bewegen –, als sie aufblickt, um zu sehen, dass eine Frau von früher als Nächste an der Reihe ist. Nicht nur eine Frau von früher, nein, sondern etwas, das so selten zu sehen ist, dass es schon fast in den Bereich des Mythos verschwunden ist. Der nackte Körper der Pilgerin trägt nur wenige Spuren der Passage. Sie ist fast ein Abbild der Menschheit, wie sie vor dem Kommen der Götter und dem Durchbrechen der Schöpfungspforte existierte. Erschrocken lässt die Frau, die den Brunnen hütet, fast den Löffel aus den Fingern gleiten und für immer in der Tiefe verschwinden.
»Oh«, flüstert sie, und die um sie herum Gedrängten neigen den Kopf (oder das, was man als Kopf bezeichnen könnte), denn sie sind privilegiert, sie sprechen zu hören, ohne vorher mit einer Opfergabe für dieses Privileg bezahlt zu haben. Aber die Frau von früher verneigt sich nicht. Sie steht auf der anderen Seite des Teiches, beobachtet, wartet, unpassend in ihrer scheinbaren Ruhe. Niemand, der an den Pool kommt, verbirgt sein Bedürfnis danach. Nur wenige wären dazu überhaupt in der Lage, und doch zeigt diese Frau keinerlei Anzeichen eines Bedürfnisses. Ihre Augen (sie hat zwei, und nur zwei) sind klar und blau geblieben, wie der Geist eines jeden verlorenen Herbsthimmels. Ihr Blick ist entwaffnend, und die Frau, die den Pool hütet, tut etwas, an das sie sich nicht erinnern kann, jemals zuvor getan zu haben.
Sie wendet den Blick ab.
»Ich habe versucht, das Wasser nicht zu brauchen«, sagt die Pilgerin. Und ihre Stimme ist, wie ihre Augen, unfassbar klar. »Du bist schon so belastet, dass ich versucht habe, nicht hierher zu kommen.«
»Wie?«, fragt die Frau, die wie angewurzelt am Beckenrand steht und sich wünscht, sie könnte den Trick, Wörter aneinanderzureihen, in zusammenhängende Sätze verwandeln. Es gibt mindestens ein Dutzend Fragen in ihrem Kopf, die sie gerne beantwortet bekommen hätte, wenn sie sie denn stellen könnte.