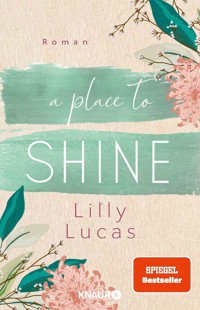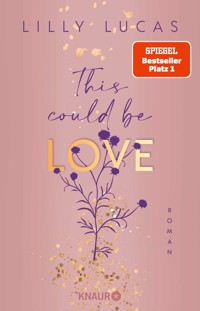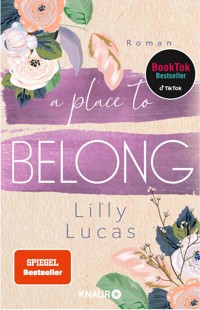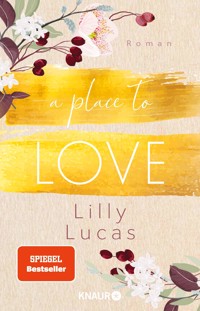
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cherry Hill
- Sprache: Deutsch
Where our hearts meet – willkommen auf Cherry Hill: »A Place to Love« ist der erste New-Adult-Roman der Reihe »Cherry Hill« von Bestseller-Autorin Lilly Lucas um ungleiche Schwestern, eine Obstfarm in Colorado und die Macht der Liebe. Manchmal hat das Leben (und die Liebe) andere Pläne … Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor drei Jahren leitet Juniper (June) McCarthy mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Cherry Hill, die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado, und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihrer großen Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seinen Zukunftsplänen in Wales nicht im Weg zu stehen. Als er jedoch eines Tages auf Cherry Hill auftaucht, stürzt er June in ein absolutes Gefühlschaos … Mit viel Romantik und einer Prise Humor entführt uns Lilly Lucas – Bestseller-Autorin der New-Adult-Reihe »Green Valley Love« – auf die traumhafte Obstfarm Cherry Hill, wo man sich beim Lesen sofort zu Hause fühlt. »Cozy Romance wie sie schöner, herzergreifender und ehrlicher kaum sein könnte.« Magische Momente Blog Lust auf mehr? Die New-Adult-Reihe »Cherry Hill« besteht aus den folgenden Liebesromanen: - A Place to Love (June & Henry) - A Place to Grow (Lilac & Bo) - A Place to Belong (Maggy & Flynn) - A Place to Shine (Poppy & Trace) Lust auf noch mehr New Adult von Lilly Lucas? Dann entdecke auch die Liebesromane der Hawaii Love-Reihe! Der erste Band ist »This could be love«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Lilly Lucas
A Place to Love
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Manchmal hat das Leben (und die Liebe) andere Pläne …
Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor drei Jahren leitet Juniper (June) McCarthy mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Cherry Hill, die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado, und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihrer großen Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seinen Zukunftsplänen in Wales nicht im Weg zu stehen. Als er jedoch eines Tages auf Cherry Hill auftaucht, stürzt er June in ein absolutes Gefühlschaos …
Der erste Band der wunderschön-romantischen Cherry-Hill-Reihe von Bestsellerautorin Lilly Lucas.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Portland, vor vier Jahren
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Portland, vor vier Jahren
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Portland, vor vier Jahren
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Portland, vor vier Jahren
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Portland, vor vier Jahren
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Portland, vor vier Jahren
Danksagung
Für Laura, Nina und Lucas
Sisters are different flowers from the same garden.
(Anonym)
Kapitel 1
Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, ist ein schlechtes Geschäft«, hat mein Vater immer gesagt – und vor ihm Henry Ford. Wenn ich mir die Exceltabelle mit den Einnahmen und Ausgaben unserer Farm ansah, dann war ein Geschäft, das kein Geld einbrachte, allerdings auch ein schlechtes Geschäft. Betrübt nahm ich einen Schluck von meinem Kaffee. Er war kalt. So kalt, wie Kaffee in einem nicht klimatisierten Büro im Juli sein konnte. Ich erhob mich vom Schreibtisch, machte einen großzügigen Schritt über unsere schnarchende Labradorhündin Coco und ließ frische Nachtluft durch das Fenster hinein. Fast konnte ich hören, wie das aufgeheizte Zimmer vor Erleichterung seufzte. Es war ein heißer Tag gewesen. So heiß, dass wir die Pfirsichernte über Mittag aussetzen mussten. Die verlorene Zeit würden wir morgen wieder reinholen müssen, wenn sich das Minus unter dem Strich jemals in ein Plus verwandeln sollte. Mit einem tiefen Atemzug kämpfte ich gegen die Enge in meiner Brust an und konzentrierte mich auf die kühle Luft auf meinen Wangen. Den Duft von reifen Früchten, den sie herantrug. Die Gitarrenklänge, die von den Trailern der Erntehelfer zu mir herüberwehten. Kurz geriet ich in Versuchung, meine Hüften zum Takt der Musik zu bewegen.
»Du arbeitest ja immer noch.«
Die Stimme meiner Schwester ließ mich herumfahren.
»Du offenbar auch«, erwiderte ich mit Blick auf ihre Schürze und den feinen Mehlstaub in ihren Haaren.
»Ich hab ein neues Rezept für den Contest ausprobiert.« Lilac zog einen Teller hinter ihrem Rücken hervor, der aussah, als könnte man ihn von der Stelle weg in einem Food-Magazin ablichten. »Tadaaa … Peach Melba Pie mit Caramel Crumble.«
»Whoa«, stieß ich aus, während mein Magen so laut zu knurren begann, dass Coco die Ohren spitzte, die Lage aber als nicht bellenswert einstufte und weiterdöste.
»Am Crumble muss ich noch feilen. Der ist zu kross geworden.« Selbstkritisch rümpfte sie die Nase. »Und er könnte ein bisschen mehr Süße vertragen. Eventuell nehme ich das nächste Mal New Havens.«
»Ich bin mir sicher, er schmeckt jetzt schon perfekt.«
Wie alles, was meine Schwester in der Küche kredenzte. Mit ihren Kuchen holte sie Jahr für Jahr den ersten Platz beim Baking Contest des örtlichen Peach Festivals, und ihre selbst gemachten Leckereien fanden so reißenden Absatz in unserem Farmladen, dass es leider kein Witz war, wenn ich sagte, dass Marmelade gerade unsere Rechnungen bezahlte.
Lilac suchte meinen Schreibtisch indessen nach ein paar freien Quadratzentimetern ab, gab es aber schnell auf und stellte den Teller auf einen Aktenordner.
»Das sieht aber nicht gut aus«, bemerkte sie mit Blick auf den Bildschirm. Auf ihrer Stirn hatte sich eine Sorgenfalte gebildet, dieselbe, die auch meine Mutter hatte, wenn sie etwas beunruhigte. Manchmal war es beängstigend, wie sehr sie und Lilac sich ähnelten. Dasselbe rotbraune Haar, dieselbe helle Haut, die feinen Sommersprossen auf der Nase. Ich selbst kam eher nach unserem Vater, hatte seine dunklen Augen und Haare geerbt und eine Haut, die im Sommer eher braun als rot wurde.
»Na ja, es sah schon mal schlechter aus«, sagte ich in einem halbherzigen Versuch, optimistisch zu klingen.
Dabei war das nicht mal gelogen. Nach Dads plötzlichem Tod vor drei Jahren hatte ich einige Umstellungen und Optimierungen vorgenommen, weshalb die Kurve immerhin wieder leicht bergauf ging. Schwarze Zahlen schrieben wir aber noch lange nicht. Wenn wir die diesjährige Erntesaison nicht gut über die Bühne brachten, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Bank wieder auf der Matte stand.
»Hast du mal über Poppys Idee nachgedacht?«, fragte Lilac und lehnte sich mit der Hüfte gegen die Tischkante.
»Kommt drauf an, welche du meinst.« Ich stieg ein weiteres Mal über unsere Hündin und schnappte mir den Teller. »Die Alpakas? Das Marihuana? Die ...«, ich gab vor, nachzudenken, und schob mir die Gabel in den Mund, »... Bienen?«
»Das Baumhaus«, bemerkte Lilac schmunzelnd.
Seit unsere jüngste Schwester Poppy ihr Studium geschmissen hatte und wieder bei uns auf Cherry Hill lebte, kamen ihr nahezu täglich neue Einfälle, wie man die Farm auf gesunde Beine stellen konnte. Der neueste war, das Baumhaus, das sie zusammen mit ihrem besten Freund Flynn auf Cherry Hill gebaut hatte, über Airbnb zu vermieten. Flynn studierte Architektur im benachbarten Grand Junction und lebte seit knapp einem Jahr in einem der Trailer hinter unserem Haus. Dafür, dass er kostenlos dort wohnen durfte, half er uns auf der Farm – und Poppy bei der Umsetzung ihrer Hirngespinste.
»Ich finde die Idee wirklich nicht schlecht. So was boomt doch gerade. Abenteuer … Urlaub … und so.« Eine zarte Röte kroch ihr in die Wangen, und ich musste mir ein Grinsen verkneifen. Wenn es zwei Dinge auf dieser Welt gab, die wirklich gar nichts mit Lilac zu tun hatten, dann waren es Abenteuer und Urlaub. Abgesehen von einem Schulausflug nach Utah, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass sie Colorado jemals verlassen hatte, und das größte Abenteuer ihres Lebens war vermutlich die Umstellung unseres Gasherds auf Induktion gewesen.
»Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand Geld dafür zahlt, in einem Baumhaus im Nirgendwo zu übernachten«, gab ich zu bedenken.
Auch wenn es ein schönes Nirgendwo war. Unsere Obstfarm lag am Rand von Palisade, einer idyllischen Kleinstadt in Westcolorado. Malerisch eingebettet zwischen den Book Cliffs im Norden, dem Grand-Mesa-Tafelberg im Osten und dem Colorado National Monument im Süden, war Palisade vor allem für eins bekannt: Obst. Auf 2500 Einwohner kamen mehr als 30 Plantagen und Weinberge, die, aus der Luft betrachtet, einen Quilt aus Grüntönen ergaben. Unser Ortsschild hatte die Form eines Obstkorbs und die Aufschrift »Welcome to Palisade – Where life tastes good all year long«.
»Hast du dir das Baumhaus in letzter Zeit mal angesehen? Die beiden haben echt was daraus gemacht. Es gibt sogar eine Toilette und eine Dusche. Und wenn man im Bett liegt, kann man durch ein Fenster in die Sterne schauen.« Ein verträumter Ausdruck trat in ihre Augen. »Denk wenigstens mal drüber nach, June. Es wäre eine zusätzliche Einnahmequelle für uns, und Poppy hätte endlich wieder eine Aufgabe. Mom hält es auch für eine gute Idee.«
»Ich denk drüber nach«, versprach ich und schob mir die Gabel in den Mund. Gott, dieser Kuchen schmeckte wirklich himmlisch. »Wo ist sie eigentlich?«
»Mom? Schläft schon.«
»Poppy.«
»Die ist noch mit Flynn und ein paar Erntehelfern losgezogen.«
Ich seufzte. »Wehe, sie ist morgen nicht fit.«
»Gönn ihr den Spaß. Es war nicht leicht für sie in letzter Zeit.«
»Es war für niemanden von uns leicht«, murmelte ich und schielte zu Dads gerahmtem Foto auf meinem Schreibtisch. Seinem Schreibtisch.
In den letzten Jahren hatte meine Familie gleich zwei schwere Schicksalsschläge verkraften müssen. Erst war bei meiner Mutter Multiple Sklerose im Frühstadium festgestellt worden, und ein halbes Jahr später hatte Dad einen Herzinfarkt erlitten. Er und unser Vorarbeiter Javier hatten gerade die Triebe der Apfelbäume beschnitten, als es passiert war. Im einen Moment hatte Dad noch pfeifend auf der Leiter gestanden und im nächsten war er mit Blaulicht ins Krankenhaus nach Grand Junction gefahren worden. Ich war mir sicher, er wäre lieber auf Cherry Hill gestorben als auf dem Freeway. Immerhin konnte er in heimischer Erde seine letzte Ruhe finden. Wir hatten ihn auf dem Hügel begraben, dem Cherry Hill seinen Namen verdankte, unter einem knorrigen Kirschbaum, der jeden Frühling blühte und ein Meer aus zartrosa Blüten auf sein Grab regnen ließ.
»Ja, aber Poppy ist 19«, holte Lilac mich zurück ins Jetzt. »Da hab ich mich auch für andere Dinge interessiert als die Pfirsichernte.«
»Oh ja. Für Theo Marino«, zog ich sie auf.
Lilac revanchierte sich mit einem Klaps auf meine Schulter.
»Weißt du noch, wie Dad ihn nachts mit der Schrotflinte durch die Apfelbäume gejagt hat, weil er dachte, er wäre ein Einbrecher?«, gluckste ich.
»Und Theo sich bis zum nächsten Morgen auf einem Baum versteckt hat? Erinnere mich nicht daran.« Sie kicherte. »Sein Bruder hat übrigens neulich nach dir gefragt. Ich glaube, er würde gerne mal mit dir ausgehen.«
Ich verschluckte mich fast. »Vince Marino? Unser Bankberater?«
»Komm schon, er sieht nicht schlecht aus. Und er könnte dir damit helfen.« Sie schielte auf den Bildschirm und wackelte mit den Brauen.
»Kommt gar nicht infrage.«
»Na schön. Dann eben nicht Vince. Aber du solltest wirklich mal wieder ausgehen, June. Bei deinem letzten Date hatte Poppy noch eine Zahnspange.«
»Ganz so lange her ist es auch wieder nicht.«
»Ein Jahr mindestens.«
Es waren eineinhalb, aber das sagte ich ihr nicht. Genauso wenig wie ich ihr sagte, dass mir für Dates einfach die Energie fehlte. Für alles, was damit einherging. Die Frage, was ich anziehen sollte, um nicht zu sehr nach Farm, aber immer noch wie ich selbst auszusehen. Die Auswahl der Location, die gezwungenen Gespräche und das ewige Verstellen. Die seltsame Stille, die eintrat, wenn man feststellte, dass man keine Gemeinsamkeiten hatte. Denn eins stand fest: Ich war nicht die Frau, mit der man sich über die neuesten Netflix-Serien unterhalten konnte. Ich hatte keine Ahnung, wo es die besten Ramen in Grand Junction gab, welcher Club neu aufgemacht hatte oder welche Reiseziele gerade hip waren. Ich war 25 und hatte die Verantwortung für eine 50 Hektar große Obstfarm, die seit drei Generationen im Besitz meiner Familie war. Und ich würde alles – alles – dafür tun, damit das auch so blieb.
Kapitel 2
Es dämmerte noch, als mein Wecker klingelte. Ich war inzwischen daran gewöhnt, früh aufzustehen, leicht fiel es mir aber nie. Schläfrig tastete ich nach meinem Smartphone und stellte den Alarm aus, bevor ich mich noch einmal ins weiche Kissen sinken ließ und die Ruhe vor dem Sturm genoss. Es würde ein langer, unglaublich anstrengender Erntetag werden, und wir mussten ein gewaltiges Pensum schaffen, wenn wir den optimalen Reifezustand der Pfirsiche nicht verpassen wollten. Den punto óptimo, wie Javier dazu sagte. Was wir heute nicht von den Bäumen ernteten, würde schnell zu reif sein, um den Weg zum Kunden zu überstehen, und schließlich in Lilacs Marmeladen und Kuchen landen.
Aus dem Erdgeschoss drangen Stimmen und das Klappern von Geschirr. Offenbar waren Mom und Lilac schon auf und bereiteten das Frühstück für uns und die Erntehelfer zu. Auf Cherry Hill war es Tradition, dass alle zusammen in den Erntetag starteten. Nicht ohne Grund thronte auf unserer Veranda ein Tisch, an dem bis zu 20 Leute Platz fanden. »Wir arbeiten zusammen, wir essen zusammen«, hörte ich meinen Vater sagen und spürte diese unglaubliche Wehmut in meinem Herzen, wie immer, wenn ich an ihn dachte.
Ich schlug die Decke zur Seite und schwang die Beine aus dem Bett, spürte den kühlen Dielenboden unter meinen Fußsohlen, die kleinen Macken und Unebenheiten, die daran erinnerten, dass ich nicht die Erste war, die dieses Zimmer bewohnte. Drei Generationen von McCarthys hatten in diesem Haus gelebt, seit sich meine Urgroßeltern Anfang des 20. Jahrhunderts in Palisade niedergelassen und die ersten Bäume gepflanzt hatten. Es hatte Unwetter und Stürme überlebt, Tornados und Überschwemmungen. Es hatte das größte Glück und den größten Kummer erlebt, Menschen auf die Welt kommen und sie wieder verlassen sehen. Es war vor mir da gewesen und würde nach mir da sein – ein Gedanke, den ich an manchen Tagen schön, an anderen angsteinflößend fand.
Als ich das Fenster öffnete, flutete kühle Morgenluft den Raum. Es roch nach Tau und Erde, nach Moos und feuchtem Gras. Nebelschwaden hingen über den schier endlosen Reihen von Obstbäumen, die sich vor meinen Augen erstreckten, und im Norden erhoben sich die Book Cliffs majestätisch über den Dunst. Noch war die Gebirgskette, die an aneinandergereihte Buchrücken erinnerte, unspektakulär grau, aber sobald die Sonne aufging, würde sie feuerrot leuchten. Ein Anblick, an dem jeder Landschaftsmaler seine Freude gehabt hätte.
Nachdem ich unter die Dusche gesprungen war, zog ich eine meiner karierten Arbeitsblusen aus dem Schrank und schlüpfte in die abgewetzte Jeans-Latzhose, von der ich mich einfach nicht trennen konnte – auch wenn ich die wirklich schon getragen hatte, als Poppy noch eine Zahnspange gehabt hatte. Ich band meine Haare zu einem tief sitzenden Pferdeschwanz, schnappte mir meinen breitkrempigen Stetson und lief die Treppe nach unten. Coco kam mir schwanzwedelnd aus der Küche entgegen und verpasste mir eine unfreiwillige Gesichtswäsche, als ich mich zu ihr hinunterbeugte.
»Morgen«, trällerte Lilac viel zu gut gelaunt und schob sich mit zwei Kaffeekannen in der Hand an uns vorbei, wobei mir der Duft ihrer Sonnencreme in die Nase stieg. Lilacs Haut war so hell, dass sie in den Sommermonaten quasi in Lichtschutzfaktor 50 badete, bevor sie das Haus verließ.
Coco und ich folgten ihr nach draußen auf die Veranda. Der Tisch war bis auf wenige Plätze besetzt. Brotkörbe wurden herumgereicht, Teller und Besteck klapperten, und meine Mom verteilte Apfelkuchen vom Blech. Während ich an einer Tasse Kaffee nippte, gab Javier den Erntehelfern letzte Anweisungen – mal auf Englisch, mal auf Spanisch. Ein paar von ihnen waren Kommilitonen von Flynn, die sich ihre Studiengebühren finanzierten, indem sie den Sommer auf den umliegenden Obstplantagen und Weingütern jobbten. Der Großteil allerdings waren Saisonarbeiter aus Mittelamerika. Auch wenn es niemand gerne zugab, war Colorado – wie der Rest des Landes – auf Hilfskräfte aus dem Ausland angewiesen. Umso mehr ärgerte es mich, wie wenig Wertschätzung ihnen entgegengebracht wurde, dafür, dass sie eine Arbeit verrichteten, für die sich der Durchschnittsamerikaner oft zu fein war. Auch hier in der Region waren nach wie vor nicht alle Farmer bereit, ihnen den gesetzlichen Mindestlohn zu bezahlen, was im Farmerverband regelmäßig für hitzige Diskussionen sorgte. Mein Vater hatte sich dort jahrelang für faire Entlohnung und angemessene Unterbringungen eingesetzt, womit er sich nicht nur Freunde gemacht hatte. Unser Nachbar George Radisson hatte uns mal das »Hilton für Mexikaner« genannt, weil die Trailer unserer Erntehelfer mit kleinen Fernsehern ausgestattet waren, und der Erste Vorsitzende, Mitch Rudolphs, der immer noch Trump nachweinte, hatte Dad vorgeworfen, auf diese Weise noch mehr Drogenbarone ins Land zu locken. »Drogenbarone haben es nicht nötig, für ein paar lausige Dollar deine Äpfel zu pflücken, Mitch«, hatte Dad damals mit einem trockenen Lachen erwidert. Manchmal wünschte ich, ich hätte seine Gelassenheit geerbt. Die Gabe, Bullshit an sich abprallen zu lassen. Stattdessen fühlte ich mich nach jedem Verbandstreffen wie ein prall gefüllter Luftballon, der jeden Moment platzen konnte.
»Wo bleiben Poppy und Flynn?«, fragte ich mit Blick auf die Uhr. »Wir müssen bald loslegen, wenn wir im Zeitplan bleiben wollen.« Mir entging nicht der Blick, den Mom mit Lilac tauschte. Eine unbestimmte Vorahnung überkam mich.
»Flynn ist beim Arzt«, schaltete Devi sich ein, eine Studentin, die zum ersten Mal bei der Ernte half. »Er hat sich den Knöchel verstaucht.«
»Was?« Ich riss die Augen auf. »Wann?«
»Äh … heute Nacht«, antwortete sie sichtlich eingeschüchtert.
»Heute Nacht?«
»Er ist … gestolpert.«
Ihre Augen huschten nervös zu ihren Kommilitonen, die sich plötzlich sehr intensiv mit dem Inhalt ihrer Kaffeetassen auseinandersetzten.
»Gestolpert?«, hakte ich nach.
»Na ja, also … er … hat Poppy zum Auto getragen, und dann ist er über eine …«
»Er hat sie getragen?« Ich versuchte, die Ruhe zu bewahren. »Wo ist Poppy jetzt?«
»Ihr geht es nicht so gut«, antwortete Mom.
»Ihr geht es nicht so gut?«, wiederholte ich langsam und hob die Brauen.
»Wir fangen schon mal an, June«, murmelte Javier, als hätte in diesem Moment sein Radar für schlechte Stimmung ausgeschlagen.
»Ja«, murmelte ich abwesend, bevor ich mich wieder an Mom und Lilac wandte.
»Sie hat sich heute Nacht mehrmals übergeben«, sagte Lilac, die ihr Zimmer direkt neben dem Bad hatte.
Ein ersticktes Lachen kam aus meinem Mund. »Ich fasse es nicht. Heute ist unser wichtigster Erntetag, und sie liegt verkatert im Bett?! Sie wusste doch, dass ich sie dringend brauche!«
Mom zuckte seufzend mit den Schultern, und in meinem Kopf begann es zu arbeiten. Mit Flynn und Poppy fielen zwei fest eingeplante Erntehelfer weg. Wir würden unseren Rückstand nicht aufholen können. Eine Mischung aus Verzweiflung und Wut packte mich. »Nicht mit mir«, schnaubte ich und erhob mich so ruckartig vom Tisch, dass mein Stuhl lautstark über den Boden schabte.
»June!«, riefen Mom und Lilac mir nach, als ich ins Haus stürmte und die Treppe hinaufpolterte. Ohne anzuklopfen, riss ich die Tür zu Poppys Zimmer auf. Ein Lichtkegel fiel vom Flur auf ihr Bett. Zusammengekauert wie ein Embryo lag sie auf der Matratze und schirmte ihre Augen stöhnend vom Licht ab. Während mir der beißende Geruch von Alkohol und Erbrochenem in die Nase stieg, stapfte ich zum Fenster, zog die Jalousien hoch und ließ frische Luft in den Raum. Poppy mutierte endgültig zum Vampir und gab qualvolle Laute von sich.
»Was soll das, June?!«, jammerte sie und zog sich das Kissen über den Kopf.
»Was das soll?! Sag du’s mir. Du wusstest, dass ich dich heute brauche, und trotzdem hattest du nichts Besseres zu tun, als dich wegzuschießen?!«
»Ich hab mich nicht weggeschossen. Mit dem Bier war irgendwas nicht okay.«
»Ja, die Menge. Mir fehlen jetzt zwei Leute, Poppy!«
»Wieso zwei?«, krächzte sie und lugte unter dem Kissen hervor.
»Weil Flynn sich offenbar den Knöchel verstaucht hat, als er dich getragen hat«, sagte ich unter Aufbietung all meiner Selbstbeherrschung.
»Er hat mich getragen? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.«
Ich schloss die Augen und unterdrückte einen Aufschrei. »Du hast zehn Minuten, um deinen Hintern auf die Pfirsichplantage zu bewegen, Poppy McCarthy!«
»Ich kann nicht«, stöhnte sie und verschwand wieder unter ihrem Kissen.
»Du kannst, und du wirst!«, wetterte ich, steuerte auf ihr Bett zu und entzog ihr das Kissen.
»Hey!«, protestierte sie.
Ich nahm mir einen Moment, um meinen Puls unter Kontrolle zu bringen. »Wenn wir die Pfirsiche heute nicht vom Baum kriegen, haben wir ein ernstes Problem.«
»Wenn ich sie vollkotze, haben wir auch eins.«
»Zehn! Minuten!«
Ohne ihre Reaktion abzuwarten, machte ich auf dem Absatz kehrt und stürmte aus dem Zimmer.
Eine Stunde später tauchte Poppy kreidebleich und mit finsterer Miene bei den Pfirsichbäumen auf. Sie trug abgerissene Jeansshorts und ein in der Taille geknotetes Shirt, das einen Streifen gebräunte Haut freilegte. Ihr langes, blondes Haar lugte noch feucht unter einem Cowboyhut hervor und verströmte einen zitronigen Duft, der immerhin ansatzweise ihren Katergestank überdeckte. Wortlos schnappte sie sich einen Tragekorb und steuerte auf ein paar Studenten zu. Sie begrüßten meine Schwester mit Gejohle und etwas, das wie Party Queen klang. Ich verdrehte die Augen und kippte den Inhalt meines Beutels vorsichtig in einen der Bottiche auf dem Transporter.
»Wir sind zu langsam«, bemerkte Javier mit Blick auf die bisherige Ausbeute. Er war kein Mann der vielen Worte, aber einer der ehrlichen, was Dad immer an ihm geschätzt hatte.
»Uns fehlen einfach zwei Leute«, seufzte ich.
»Poppy ist doch jetzt da.«
Gleichzeitig sahen wir zu meiner Schwester, die wie ein Häufchen Elend auf einer der Leitern kauerte und in diesem Moment den Pfirsich fallen ließ, den sie soeben vom Baum gepflückt hatte. Javier grinste unter seinem tief ins Gesicht gezogenen Strohhut.
»Vielleicht sollte ich bei den Radissons anfragen, ob sie mir kurzfristig Leute leihen können«, dachte ich laut nach.
Javier stieß ein kehliges Lachen aus. »Die werden dir den doppelten Lohn berechnen, das ist dir klar, oder?«
»Ja«, raunte ich.
Die Radissons waren unsere direkten Nachbarn und besaßen die größte Obstplantage in Palisade und ein exklusives Weingut mit Gäste-Lodge. Im Gegensatz zu uns belieferten sie nicht die Bio-Lebensmittelgeschäfte der Region, sondern Walmart und Target und setzten statt auf Biodiversität und Nachhaltigkeit auf … Profit. Sie standen für alles, was Dad verurteilt hatte, weshalb ich den Gedanken schnell beiseiteschob und zurück auf die Leiter stieg.
Bis zum späten Vormittag arbeiteten wir im Akkord, aber die Hitze machte uns erneut einen Strich durch die Rechnung. Am Himmel stand keine einzige Wolke, und die Sonne brannte gnadenlos auf uns herab. Meine Hemdbluse klebte mir am Rücken, und die Krempe meines Huts triefte vor Schweiß.
»Wir müssen eine Pause machen, June«, sagte Javier.
»Wir haben noch nicht mal ein Drittel geschafft.« Verzweiflung und Stress schwangen in meiner Stimme mit.
»Sieh sie dir doch an. Die sind fix und fertig. Manche mehr«, er schielte zu Poppy, »manche noch mehr.«
»Aber …«
»June«, ertönte die Stimme meiner Mutter hinter uns.
»Gleich, Mom«, seufzte ich, während sich die Gedanken in meinem Kopf überschlugen. Wenn wir jetzt eine Pause machten, mussten wir …
»June«, setzte sie erneut an.
Ich schnellte herum und konnte mich gerade so davon abhalten, ihr ein zermürbtes »Was?!« entgegenzuschleudern.
»Da … ist ein Mann, der dich sprechen möchte.«
»Ich kann jetzt nicht«, sagte ich und wollte mich wieder Javier zuwenden.
»Ich glaube, es ist wichtig.« Ihr Gesicht hatte einen seltsamen Ausdruck angenommen.
»Mom, wir haben hier gerade ein Riesenproblem, also …«
»Er behauptet, er wäre mit dir verheiratet.«
Ich blinzelte. Schluckte. Blinzelte. »Was?«
»Er sagt … sein Name wäre Henry.« Sie machte eine Pause, als wollte sie die Wirkung ihrer Worte auf mich testen. Den Klang dieses Namens. »Und … er wäre mit dir verheiratet.«
Henry, hallte es in meinem Kopf nach, während ich Moms Blick auf mir spürte. Ihre Augen, die mein Gesicht studierten. Nach Hinweisen suchten.
»Wo ist er?«, brachte ich schleppend hervor.
Mom runzelte die Stirn, als hätte sie mit einer anderen Reaktion gerechnet. »Ich hab ihn gebeten, auf der Veranda zu warten, bis sich die Sache aufgeklärt hat.« Die Sache wird sich doch aufklären, oder? Ich wüsste es, wenn meine Tochter verheiratet ist. Sie sprach es nicht aus. Musste sie auch nicht. In meinen Ohren begann es zu rauschen. Schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen.
»June?«
Moms Stimme drang nur gedämpft zu mir durch.
»June? Geht es dir gut?« Sie berührte mich an der Schulter. »Javier, hast du eine Flasche Wasser für sie?«
»Ich brauch kein Wasser«, murmelte ich. Und dann setzten sich meine Beine in Bewegung.
»June?«, riefen beide mir nach.
»Was ist los?«, hörte ich Lilac fragen, aber ich war bereits zu weit weg, um Moms Antwort zu hören.
Kapitel 3
Der Weg von den Pfirsichbäumen zum Haupthaus war mir noch nie so lang vorgekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mehrmals haltmachen musste, um das Zittern in meinen Beinen in den Griff zu kriegen. Die Stimmen in meinem Kopf zur Ruhe zu bringen. Kann es wirklich sein? Ist er wirklich hier? Und wenn ja, warum? Ich bog um die Ecke und erstarrte. Auch wenn er mit dem Rücken zu mir stand, erkannte ich ihn sofort. Die große, schlanke Statur. Das dunkle, leicht gewellte Haar. Die gerade Haltung. Ich konnte den Blick nicht von ihm abwenden und fürchtete gleichzeitig den Moment, wenn er sich umdrehen würde. Wenn ich Gewissheit haben würde, dass er das wirklich war. Henry.
Als hätte er meine Gedanken gehört, fuhr er herum. Es war drei Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen hatte, und ich fragte mich, wie es möglich war, dass er sich nicht verändert hatte. Wo sich doch alles verändert hatte.
»Juniper.«
Beim Klang seiner Stimme durchzog mich ein sehnsüchtiger Schmerz. Henry war immer der Einzige gewesen, der mich konsequent bei meinem vollen Namen genannt hatte, und ein Teil von mir freute sich, dass sich auch daran nichts geändert hatte. Der andere registrierte die Kälte in seiner Stimme. In seinen Augen. Graublau. Blaugrau. Wie ein bewölkter Himmel im Sommer.
»Was … machst du hier?«, fragte ich mit viel zu hoher Stimme und stieg die zwei Verandastufen zu ihm hoch.
Zum ersten Mal zeigte sein Gesicht eine Regung. Seine Miene wechselte von reserviert zu ungläubig. »Gut, danke. Und dir?«
Ich schluckte. »Tut mir leid, ich … hab nicht damit gerechnet …« … dich je wiederzusehen. »Wie geht es dir?«
Auch wenn die Frage nun schrecklich erzwungen wirkte, interessierte mich seine Antwort. Mich interessierte so viel, stellte ich fest. Warum er eine lange Hose trug. So blass war. Ob die Schuhe neu waren. Was das für ein Umschlag in seiner Hand war. Warum er immer noch so verdammt gut aussah.
»Gut. Und dir?«, kam es nüchtern aus seinem Mund.
»Auch gut«, antwortete ich, weil es das war, was die Leute hören wollten, wenn sie diese Frage stellten. Henry hingegen sah nicht aus, als würde ihn meine Antwort überzeugen. Bist du sicher?, fragte er nur mit seinen Augen, die in diesem Moment mein ramponiertes Äußeres scannten. Nach unserer Trennung hatte ich mir manchmal vorgestellt, wie es wäre, ihm noch einmal zu begegnen, aber dreckige Fingernägel und Schweißflecken waren nie darin vorgekommen. »Wir stecken mitten in der Pfirsichernte«, schob ich hinterher.
»Ja, das hat deine Mum erwähnt.« Er sprach es britisch aus, mit offenem, kurzem a, und ich erinnerte mich an unsere erste Begegnung. Dass ich mich in seinen Akzent verliebt hatte, bevor ich mich in ihn verliebt hatte. »Sie war nett.« Er schnaubte. »Wenn man bedenkt, dass sie keine Ahnung hatte, wer ich bin.«
Die Kälte in seiner Stimme war zurück. Aber jetzt schwang noch etwas anderes mit. Kränkung.
»Henry, ich …«
»Schon okay«, unterbrach er mich mit einer flüchtigen Handbewegung. »Tut nichts mehr zur Sache.« Als hätte er nur auf die entsprechende Überleitung gewartet, reichte er mir den Umschlag. »Mein Anwalt hat schon mal was aufgesetzt. Ich würde es gerne kurz mit dir durchgehen. Wenn du einverstanden bist, kann alles Weitere über ihn laufen, und du sparst dir die Kosten für …«
Den Rest hörte ich nicht mehr, weil ich wie benommen auf den Umschlag in meiner Hand starrte. 200, vielleicht 300 Gramm, die sich wie hundert Kilo anfühlten. Meine Hand wurde schwer. Mein Herz. Es begann zu rasen, und ich spürte, wie das Blut in meinen Schläfen pochte.
»Du willst dich scheiden lassen«, brachte ich stockend hervor.
»Ja. Das hätten wir längst tun sollen.«
Ich schwieg. Mein Herz nicht. Es pochte und krampfte, zuckte und schmerzte.
»Bist du extra deswegen aus Wales hergeflogen?«
»Nein. Ich besuche Addie und Miles. Da … hat es sich angeboten.«
»Ihr habt noch Kontakt?«, fragte ich erstaunt.
»Natürlich. Sie waren unsere besten Freunde auf dem College.«
Unsere Trauzeugen. Sein stummer Vorwurf entging mir nicht.
»Ich bekomme immer diese ewig langen Rundmails von ihnen, aber meistens schaffe ich es nicht, darauf zu antworten, bis die nächste kommt.« Ich versuchte mich an einem Lächeln, aber es prallte an ihm ab wie eine Kugel an einer schusssicheren Weste.
»Ja, das hat Addie gesagt.«
Ihr redet über mich?, wollte ich fragen. Stattdessen sagte ich: »Ich hab viel um die Ohren. Die Farm … Es … Hier ist irgendwie immer was zu tun.«
Der letzte Teil meines Satzes war nur noch als Murmeln aus meinem Mund gekommen. Schweigen senkte sich zwischen uns.
»Also … hast du einen Moment Zeit?«, fragte er schließlich und deutete auf den Umschlag. »Dann können wir das hier schnell durchgehen.«
»Jetzt?«, fragte ich verdutzt.
»Es dauert nicht lange. Ich möchte die Sache so schnell wie möglich klären.«
Die Sache. Das war aus uns geworden. Drei Jahre später. Mein Herz füllte sich mit Backsteinen, und ich spürte eine Schwere, die sonst nie auf dieser Veranda lag.
»Ich kann jetzt nicht. Heute ist der letzte Erntetag. Ich muss zurück zu meinen Leuten, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig.«
An seiner Schläfe pochte eine Ader, aber er antwortete vollkommen ruhig: »Gut, wann würde es dir passen? Heute Abend?«
»Du willst so lange warten?«, erwiderte ich überrascht.
»Wie gesagt, ich will die Sache schnellstmöglich klären.«
»Du hast es eilig«, bemerkte ich zynischer, als es mir zustand.
»Drei Jahre sind nicht eilig, Juniper«, kam es in einem bitteren Tonfall zurück. Ein Tonfall, der nicht zu seinen Zügen passte, die plötzlich ganz weich wurden. »Wer bist du denn?«
Mit etwas Verspätung begriff ich, dass sein Lächeln nicht mir galt, sondern Coco, die neben mir aufgetaucht war und sich an mein Bein schmiegte.
»Das ist Coco.«
»Coco«, murmelte er, ging in die Hocke und streckte seine Hand nach ihr aus. »Du bist aber eine Schönheit.« Er tätschelte ihr den Kopf und die Seite, und Coco wedelte mit dem Schwanz und schleckte ihm einmal quer übers Gesicht.
»Coco!«, ermahnte ich sie, aber Henry begann zu lachen. Ein lautes, ehrliches Lachen, das mich zusammenzucken ließ. Weil ich es so lange nicht gehört hatte. Weil mir in diesem Moment bewusst wurde, wie sehr ich es vermisst hatte. Und dann stahl sich auch meine Kehle ein Lachen hinauf. Henry sah auf, und unsere Blicke trafen sich. Zum ersten Mal seit drei Jahren. Aber es dauerte keine Sekunde, bis das Sanfte in seinen Zügen wieder von Reserviertheit abgelöst wurde. Er kraulte Coco ein letztes Mal das dunkle Fell und erhob sich. Sein Blick wurde ernst. Geschäftsmäßig. Als würde er sich wieder darauf besinnen, warum er hergekommen war.
»Also ist heute Abend okay?«
Ich nickte ein wenig überfordert. »Was willst du denn bis dahin machen?«
»Schlafen.« Fast war ich überrascht, dass seine Antwort nicht »Geht dich nichts an« gelautet hatte. »Der Flug hat mich ziemlich geschafft. Ich hätte sowieso irgendwo einen Stopp einlegen müssen.«
Hieß das, er wollte eine Nacht hierbleiben? In Palisade?
»Kannst du mir irgendein Hotel empfehlen?«
Ja, hieß es.
»Das Dancing Moon in der Main Street«, antwortete ich wie fremdgesteuert.
»Okay. Dann komme ich heute Abend wieder. Um acht?«
Ich nickte, ehe ich darüber nachdenken konnte, ob das eine gute Zeit war, und er gab mir nur mit einem Blick zu verstehen, dass er den Umschlag wieder an sich nehmen wollte. Ich reichte ihn Henry und sah zu, wie er Anstalten machte, zu gehen.
»Warum hast du nicht angerufen?«, platzte es aus mir heraus, vielleicht nur um ihn aufzuhalten. Um noch ein wenig in sein Gesicht blicken zu können. Auch wenn mir daraus pure Ablehnung entgegensprang. »Du hättest mir das alles auch am Telefon sagen können.«
»Im Gegensatz zu dir kläre ich solche Dinge lieber persönlich.«
Seine Worte trafen mich bis ins Mark, und er sah es. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzte etwas wie Bedauern in seinen Zügen auf, dann wurde seine Miene wieder hart. »Außerdem hab ich deine Nummer gelöscht.«
Ich schluckte.
»Bis später«, murmelte er, drehte sich um und lief zu seinem Mietwagen. Ein schwarzer Toyota, der neben Dads altem Pick-up stand und wie ein gestriegelter Hengst in der Sonne glänzte.
»Bis später«, flüsterte ich, aber er hörte es nicht mehr.
Ich stand immer noch an Ort und Stelle, als er in den Wagen stieg, der kurz darauf in einer Staubwolke verschwand und über die Schottereinfahrt holperte. Als er aus meinem Blickfeld verschwunden war, atmete ich aus und spürte, wie die Anspannung aus meinem Körper wich. Als hätte jemand die Fäden durchgeschnitten, die mich aufrecht gehalten hatten. Aber es war kein schönes Gefühl. Keine Erleichterung ging damit einher. Nur Leere. Und so viele Empfindungen, die ich mir in diesem Moment nicht erlauben durfte. Nicht leisten konnte. Ich musste zurück zur Plantage. Funktionieren. Zu viel hing davon ab. Und ich musste mich dringend auf etwas konzentrieren, das mich von dieser Begegnung ablenkte. Davon, wie sehr Henry mich jetzt hasste. Ich habe das Richtige getan, sagte ich mir. Damals. Es war richtig gewesen, ihn gehen zu lassen, ihm seine Zukunft nicht zu verbauen. Denn das hätte ich auf lange Sicht getan. Nicht ich. Aber mein Leben. Cherry Hill. Ich habe das Richtige getan, wiederholte ich im Geiste. Immer und immer wieder. Coco stupste mich mit ihrer Schnauze an, als wollte sie mich zurück ins Jetzt holen. Ich ging ins Haus, lief ins Bad und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht, während meine Gedanken rasten, mein Kopf mir Bilder aufzwängte. Gesprächsfetzen. Hi, ich bin Henry … Niemand nennt mich Juniper … Heirate mich … Bitte ruf mich nicht mehr an … Ich liebe dich …
Von der Veranda drangen Stimmen zu mir, als ich das Badezimmer verließ. Mom, Lilac, Poppy. Aufgeregt, durcheinander. Ich schielte zur Hintertür und rang mit mir, spielte mit dem Gedanken, mich einfach davonzustehlen. Aber im letzten Moment überlegte ich es mir anders. Ich holte tief Luft, straffte die Schultern und trat hinaus. Die Stimmen verstummten schlagartig, und drei Paar Augen musterten mich. Neugierig, abwartend, verwirrt.
»Ich muss mit euch reden.«
Kapitel 4
Also?«, fragte meine Mom, nachdem ich eine ganze Weile geschwiegen hatte. Überlegt hatte, wie ich anfangen sollte. Und wo. Bei unserer ersten Begegnung? Unserem ersten Kuss? Dem Standesamt in Portland? Dem Tag, an dem ich Henrys Herz gebrochen hatte?
»Okay«, sagte ich mehr zu mir selbst. »Als ich in Portland studiert habe, hatte ich einen Freund. Henry. Wir waren ein Jahr zusammen und haben kurz vor Studienende geheiratet.« Keiner sagte etwas. Alle starrten mich an. »Es war ein Fehler. Wir waren zu jung und … unsere Leben zu unterschiedlich.« Das war nur die halbe Wahrheit, vielleicht sogar nur ein Viertel davon. »Es hat nicht funktioniert, und ich hab es kurz darauf beendet. Aber auf dem Papier sind wir noch verheiratet. Deswegen war Henry hier. Er will die Scheidung einreichen.«
Ich wartete auf das Gefühl der Erleichterung, das sich nach solch einer Beichte einstellen müsste – vergeblich. Vielleicht weil ich intuitiv wusste, dass mir der schwerste Teil noch bevorstand.
»Du hast geheiratet und uns nichts davon gesagt?«, erwiderte Mom ungläubig.
Solche Fragen, zum Beispiel.
»Ich wollte es euch sagen, aber dann ist Dad gestorben, und … es war nicht der richtige Zeitpunkt.«
»Der Tod deines Vaters ist drei Jahre her, June«, kam es fassungslos von Mom zurück.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Poppy den Blick senkte. Wie immer saß sie rittlings auf dem Verandageländer. »Irgendwann fällst du da noch runter und brichst dir was, Popps«, hörte ich meinen Dad schimpfen und verspürte eine unglaubliche Sehnsucht nach ihm. Dabei wäre er in diesem Moment nicht weniger fassungslos gewesen. Nicht weniger enttäuscht.
»Es … hat … keine Rolle mehr gespielt.«
Mom riss die Augen auf. »Es hat keine Rolle mehr gespielt, dass du verheiratet bist?!«
»Es hat keine Rolle mehr gespielt, weil ich mich kurz nach Dads Tod sowieso von Henry getrennt habe.«
»Aber wir sind deine Familie«, schaltete sich nun Lilac ein. Ihr Tonfall war sanfter, auch wenn sie ähnlich erschüttert wirkte. »Wir wären für dich da gewesen.«
»Wir wären vor allem gerne auf der Hochzeit gewesen«, raunte Poppy und zuckte mit den Schultern, als Mom und Lilac sie mit einem Blick bedachten. »Was?! Fragt sich keine von euch, warum sie uns nicht eingeladen hat?«
»Wir wollten diesen Moment für uns allein«, sagte ich leise.
Mom schluckte.
»Es war niemand dabei«, fügte ich hastig hinzu. »Nur Henry und ich. Und … unsere Trauzeugen.«
Jetzt schluckte Lilac.
»Hast du ein weißes Kleid getragen?«, fragte Poppy mit einem Hauch Provokation in der Stimme.
»Nein. Ein Kleid, aber … kein weißes.«
»Und der Ring?«, kam es trotzig aus ihrem Mund.
»Poppy«, sagte Lilac.
»Er war … Er ist schmal und aus Gold«, antwortete ich. »Liegt oben in meinem Schmuckkästchen.«
»Hast du ihn bezahlt?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wollte er ihn nicht zurück?«
»Poppy«, sagte nun auch meine Mutter.
»Wenn sie sich gleich nach der Hochzeit von ihm getrennt hat, hätte ich den Ring an seiner Stelle zurückgewollt«, erwiderte sie schulterzuckend.
»Du hast recht. Ich hätte ihn zurückgeben sollen«, antwortete ich ruhig, weil ich wusste, dass unter ihrer schnippischen Schale ein gekränktes Herz lauerte. Und weil es stimmte. Ich hätte Henry den Ring zurückgeben sollen. Ein paar Mal hatte ich darüber nachgedacht, es aber nicht übers Herz gebracht. Dieser Ring war alles gewesen, was mir von ihm geblieben war. Der Ring und Erinnerungen. Aber manchmal reichte es nicht aus, an etwas zu denken. Manchmal musste man es spüren. Berühren. Festhalten.
»Ich kann nicht glauben, dass du uns das verheimlicht hast, June. Das ist …« Meine Mutter schüttelte den Kopf. »Wusste dein Vater Bescheid?«
»Nein.«
Für den Bruchteil einer Sekunde verdrängte etwas wie Genugtuung die Kränkung in ihren Augen. Mom und ich hatten ein gutes Verhältnis, aber es kam nicht an die Verbindung heran, die Dad und ich gehabt hatten, und das nagte zuweilen an ihr. Sie sprach es nie an, aber in schwachen Momenten schimmerte es durch.
»Und seine Familie?«
Ich schüttelte den Kopf. »Henry kommt aus Wales. Sie hätten sowieso nicht dabei sein können.«
»Wales.« Sie runzelte die Stirn, als würde eine Erinnerung aufblitzen. »Ist er … dieser Junge, den du mal zu Thanksgiving mitbringen wolltest?«
Ich nickte kaum merklich, woraufhin es in Moms Gesicht zu arbeiten begann. Auch in Lilacs Augen blitzte etwas auf. Wir wussten alle drei, warum es nicht dazu gekommen war. Mom hatte in der Woche zuvor ihre Diagnose erhalten, und Thanksgiving war ausgefallen. Henry war in Portland geblieben und ich allein nach Hause gefahren. Statt über meinen neuen Freund hatten wir uns über Therapiemöglichkeiten und barrierefreies Wohnen unterhalten.
»Du hast ihn danach nie wieder erwähnt«, sagte Lilac. »Ich dachte, das wäre nichts Ernstes gewesen.« Sie runzelte die Stirn, und mein Kopf nutzte diese Pause, um mir weitere Erinnerungen aufzuzwängen. Rwy’n dy garu di … Ist das aus Herr der Ringe? … Nein, das ist Walisisch … Ich dachte, ihr sprecht Englisch? … Tun wir auch, aber die wirklich wichtigen Dinge sagen wir in unserer Sprache …
»Das heißt, er ist extra aus Wales hergeflogen, um dir zu sagen, dass er sich scheiden lassen will?«, fragte Lilac verwundert.
»Nein, er ist hier, um Freunde in Portland zu besuchen.«
»Wusstest du, dass er kommt?«
»Nein, natürlich nicht.«
Lilac kniff die Augen zusammen. »Und er hat nicht mal vorher angerufen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Dumm gelaufen«, bemerkte Poppy und kassierte einen weiteren Blick von Mom und Lilac. »Was? Sie hätte es uns nie erzählt, wenn er heute nicht aufgetaucht wäre.«
»Wahrscheinlich nicht«, gab ich zu.
Die Stille, die darauf folgte, war ohrenbetäubend. Einen Moment lang fragte ich mich, ob es auf dieser Veranda jemals so still gewesen war.
»Ich verstehe das nicht, June. Ich … verstehe es einfach nicht. Das bist doch nicht du. Das …« Mom schüttelte den Kopf. »Wir waren doch immer ehrlich zueinander. So haben wir euch Mädchen erzogen.« Voller Unverständnis sah sie mich an, wie ein Rätsel, das es zu ergründen galt. »Und wie geht es jetzt weiter? Brauchst du einen Anwalt? Musst du nach … Wales fliegen?«
»Nein, so wie ich Henry verstanden habe, kann alles über seinen Anwalt laufen, wenn ich … einverstanden bin.«
»Und das bist du?«, fragte Lilac.
Ein, zwei Sekunden lang war ich überrascht – von der Tatsache, dass ich mir diese Frage noch nicht selbst gestellt hatte. »Ja. Sicher«, raunte ich, weil Lilac mich abwartend ansah.
»Ich verstehe trotzdem nicht, warum er extra hergekommen ist. Das hätte er dir doch am Telefon sagen können. Oder mailen. Ich meine, das muss doch komisch für ihn gewesen sein, einfach hierherzufahren«, erwiderte sie.
Im Gegensatz zu dir kläre ich diese Dinge lieber persönlich.
»Er will irgendetwas mit mir besprechen. Aber ich hatte vorhin keine Zeit wegen der Ernte. Er kommt heute Abend noch mal vorbei.«
Poppy spitzte die Ohren. »Er kommt hierher?«
Kurz fragte ich mich, ob es schlauer gewesen wäre, Henry irgendwo in der Stadt zu treffen, aber die Wahrscheinlichkeit, für den Gossip des Jahres zu sorgen, wäre zu groß gewesen. Als einzige Frau im Farmerverband hatte ich sowieso schon Schwierigkeiten, mich zu behaupten. Eine verheimlichte, noch dazu gescheiterte Ehe würde die Sache nicht leichter für mich machen. Nein, es war richtig gewesen, ihn hierherzubestellen. »Wir gehen ins Büro. Ihr werdet nichts davon mitbekommen.«
»Ich will aber was davon mitbekommen«, sagte Poppy. »Wenigstens wie der Typ aussieht. Du hast ihn doch schon gesehen.« Neugierig sah sie zu unserer Mutter.
»Das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache«, entgegnete Mom scharf, woraufhin Poppy mit den Augen rollte.
Im selben Moment klingelte unser Telefon. Mom zögerte kurz, verschwand jedoch ins Haus. Wieder setzte Stille ein. Nur ein paar Gesprächsfetzen drangen zu uns. Und das Klirren eines Schlüsselbundes.
»Das war Flynn«, sagte Mom, als sie zurück auf die Veranda kam. »Jemand muss ihn aus dem Krankenhaus abholen.«
»Aus dem Krankenhaus?«, erwiderte ich überrascht.
Sie nickte. »Sein Fuß musste geröntgt werden. Er hat eine Bänderdehnung und fällt für mindestens zwei Wochen aus.«
»Fuck«, stöhnte ich und ließ den Kopf hängen.
»Man möchte meinen, dass das gerade dein kleinstes Problem ist«, kam es schnippisch von meiner Mutter.
Ich wünschte, sie hätte recht gehabt. Aber das bedeutete, dass Flynn nicht nur für den heutigen Erntetag ausfiel, sondern auch für das gesamte Wochenende. Für den Aufbau unseres Standes auf dem Peach Festival, für den Standdienst und den Abbau. Vielleicht sogar für die Pflaumenernte in ein paar Wochen.
»Ich kann ihn abholen«, sagte Poppy und hielt die Hand nach dem Schlüssel auf.
»Bist du dafür überhaupt schon nüchtern genug?«, erwiderte Mom mit hochgezogenen Brauen. »Du hilfst deinen Schwestern bei der Ernte! Ich werde fahren.« Sie sah zu Lilac. »In der Küche stehen noch zwei Krüge Eistee für die Erntehelfer. Kümmerst du dich darum?«
Lilac nickte.
»Dann bis später.«
Mom bedachte mich mit einem langen, unschlüssigen Blick, bevor sie den Kopf schüttelte, die Veranda verließ und zum Auto lief.
»Bis später«, murmelte ich trübsinnig.
Lilac sah mich nachdenklich an, bevor sie ins Haus verschwand, und Poppy begann, auf ihrem Handy herumzutippen. Ich ließ den Blick in die Ferne schweifen, sah ein paar Erntehelfer aus der Mittagspause kommen. Beobachtete einen Schwarm Vögel am Himmel. Das perfekte V, das sie bildeten. Für meine Familie war ich der Vogel an der Spitze. Der, der den Weg vorgab. Sich dem Wind entgegenstellte. Die anderen mitzog. Aber diesen Platz hatte ich nie gewollt. Das Leben hatte mich dorthin geschubst. Moms Krankheit. Dads Tod. Eigentlich war ich der Vogel gewesen, der den Schwarm verlassen wollte. Um sich einem neuen anzuschließen.
Kapitel 5
Nachdem Poppy irgendwann wortlos ins Haus verschwunden war, lief ich allein zurück zur Pfirsichplantage. Ein paar Erntehelfer saßen im Schatten der Bäume und aßen Sandwiches, während Javier neben dem Pritschenwagen stand und die randvollen Behälter zählte. Als er mich bemerkte, sah er auf und versicherte sich nur mit einem Blick, ob alles okay war. Ich nickte knapp und schnappte mir einen Tragekorb. Kurz darauf stießen die letzten Erntehelfer sowie Poppy und Lilac zu uns. Ich suchte ihren Blick, aber sie sahen nicht zu mir herüber.
»Wir haben heute noch einiges vor uns«, sagte Javier und klatschte zweimal in die Hände. »Ich will volle Körbe sehen! ¡Vamos!«
Seine Ansprache fruchtete. In Windeseile verteilten sich alle auf die Leitern, und wenig später erfüllte nur noch leises Gemurmel, das Rascheln der Zweige und das Summen der Bienen die Luft. Nach all den Gesprächen, die ich in den letzten Stunden geführt hatte, genoss ich die Ruhe um mich herum. In meinem Kopf herrschte leider das Gegenteil davon. Wir hinkten hinterher, und das verursachte mir mindestens genauso viele Bauchschmerzen wie die Tatsache, dass ich Henry heute Abend wiedersehen würde. Ich schielte auf meine Uhr. Ob er sich tatsächlich ein Zimmer im Dancing Moon genommen hatte? Ob er jetzt gerade schlief? Ob er dabei immer noch lächelte?
»Ey! ¡Chico Surfista!«, holte mich Javiers Stimme zurück ins Jetzt.