
A Reason To Hope (Intensive New-Adult-Romance von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau) (Liverpool-Reihe 2) E-Book
Jennifer Benkau
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liverpool-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Hanna fehlt ein Jahr ihres Lebens, das noch immer einen Schatten auf ihre Gegenwart wirft. All ihre Träume scheinen unmöglich: mit ihrer Stimme Geld zu verdienen, zu reisen, ein freies Leben zu leben. Als sie Sawyer kennenlernt, der ein Pub in Liverpool besitzt und ihr anbietet, dort zu singen, ergreift sie diese Chance nur zögerlich. Denn in Sawyers Nähe fühlen sich ihre Probleme weit weg an. Und Hanna darf nicht unvorsichtig werden. Zu groß ist das Risiko, dass ihre Vergangenheit sie einholt … Intensive New-Adult-Romance von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau "Die Queen der Emotionen hat wieder zugeschlagen." Stefanie Hasse, Autorin von "Bad Influence" Die komplette New-Adult-Reihe (die Bände können unabhängig voneinander gelesen werden): A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2) Jennifer Benkaus epische Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Sammlungen
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2022 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag © 2022 Ravensburger Verlag Originalausgabe Copyright © 2022 by Jennifer Benkau Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de) Covergestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von©Amelia Austin, ©Mari Dein und ©pzAxe, alle von Shutterstock Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg. ISBN 978-3-473-51099-3www.ravensburger.de
TRIGGERWARNUNG
Dieses Buch enthält Themen, die potenziell triggern können. Am Ende des Buches befindet sich ein Hinweis zu den Themen.
ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.
Liebe Leser*innen,
ich bin nicht sicher, ob dieses Buch eine Inhaltswarnung benötigt. Aber wer bin ich, das zu entscheiden?
Diese Geschichte handelt von Musik und Stille. Von Ängsten, Fesseln und Panikattacken sowie Mut, dem Drang nach Freiheit und dem Wunsch, Grenzen zu sprengen. Die Figuren machen dabei mit Gewissheit nicht alles richtig. Wer tut das schon?
Eine Auflistung potenziell triggernder Themen findet ihr bei Bedarf auf Seite 509 – diese spoilert allerdings die Handlung.
Ich bedanke mich herzlich bei meiner Sensitivity Readerin Joana M’Baku.
Teil 1
When first I landed in Liverpool, I went upon the spree
My hard-earned cash, I spent it fast, got drunk as drunk could be
But when my money was all gone, it was then that I wanted more
But a man must be blind to make up his mind, to go to sea once more.
Once more, once more, go to sea once more
But a man must be blind to make up his mind
To go to sea once more.
Aus »Off to Sea once more«, Traditional Folk Song/Sea Shanty
HANNA
»Nobody dies a virgin. Life fucks us all.«
Die Bahn rollt an, und das gesprayte Kurt-Cobain-Porträt nebst seinem Zitat, das ich die letzten zwanzig Minuten in Spiegelschrift von der anderen Seite der Scheibe betrachtet habe, fährt ohne mich weiter.
Der Bahnhof Lime Street ist voller Menschen. Hunderte von Stimmen, das Rauschen und Quietschen der Räder auf Schienen und Abertausende von Schritten auf Stein steigen in die Höhe. Unter der Glaskuppel werden sie zu einer Masse, zäh und grau wie zu oft vermischte Knete. Noch ein paar harmlose Laute mehr, und der ganze Mist stürzt auf uns herunter. Unweigerlich ziehe ich den Kopf ein, würde mich am liebsten in meiner Jacke verstecken vor all dem Lärm.
Doch für einen Rückzieher ist es zu spät, daher setze ich mich in Bewegung in Richtung meines Bahnsteigs. Ich weiche Studenten, mit Fotoapparaten behängten Touristengrüppchen und Rucksackträgern auf den Spuren der Beatles aus.
Das Gefühl, nach Hause zu kommen, das ich mir insgeheim von Liverpool erhofft habe, stellt sich nicht ein.
Auf der Suche nach einem Hauch des Vertrauten trotte ich in die Bahnhofshalle. Die zu weit gewordene Jeans rutscht mir bei jedem Schritt tiefer auf die Hüfte, und als ich schließlich vor Costa Coffee stehe und bemerke, dass es hier riecht wie immer – wie früher –, wird mir klar, dass Liverpool noch ist, wie es war, und ich mich trotzdem nicht mehr heimisch fühlen kann.
Weil ich nicht mehr dieselbe bin.
In den orange leuchtenden Buchstaben und blinkenden Zahlen der Anzeigetafel suche ich meine Bahn: die Northern Line Richtung Wigan North Western. Die nächste kommt in knapp zwanzig Minuten, stelle ich fest, während ich in meiner Parkatasche nach dem Portemonnaie grabe, um drei Pfund in einen Kaffee zu investieren – einen wirklich guten Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen und heißer, aufgeschäumter Milch. Wow. Allein die Vorstellung ist großartig. Allerdings bannen alle anderen Linien meine Aufmerksamkeit, und die Städtenamen säuseln wie leise Versprechungen in meinen Ohren, sodass ich mit den Münzen in der Hand stehen bleibe.
Leeds. London. Glasgow.
Es wäre so einfach, in irgendeine Bahn zu steigen und weit wegzufahren. Irgendwohin, wo mich niemand kennt und ich einfach von vorn beginnen kann.
Doch bevor meine Fantasie an dem Punkt angelangt ist, wie ich mit einer alten, irgendwo billig besorgten Gitarre meinen Lebensunterhalt bestreite, weist mein Gehirn sie mit scharfer Stimme zurecht: Du warst nicht da, um Nanny in ihren letzten Stunden die Hand zu halten. Du warst nicht da, um die Worte zu hören, die sie dir vielleicht noch hatte sagen wollen. Du warst einfach nicht da. Und nun fantasierst du vom Weglaufen, auch wenn ihr letzter Wunsch an dich war, auf ihrer Beerdigung zu singen. Warst du immer schon so ein abgrundtief egoistischer Mensch, Hanna? Oder haben sie das aus dir gemacht, in diesem Jahr, in dem …
»Hey, pass au …!«
Bevor ich die Warnung auch nur gehört, geschweige denn verstanden habe, kracht jemand in mich hinein und trifft mich hart gegen Brust und Schulter. Mir wird die Luft aus der Lunge gedrückt. Der Zusammenstoß ist so heftig, dass ich zurückgeworfen werde und schmerzhaft auf dem Hintern lande. Die Münzen verteilen sich klimpernd auf dem Steinboden, und ein brennender Schmerz zieht mir in den Handballen.
»Oh Shit, entschuldige bitte! Tut mir so leid, tut mir …« Der Typ, der mich umgerannt hat, ist etwa in meinem Alter. Er greift nach meiner Hand, zieht unschlüssig an mir, lässt dann sofort wieder los, bevor ich Schwung nehmen kann, um mich aufzurappeln. »Tut mir so leid! Aber dieser Penner vorhin … Ich wollte bloß hinterher.« Hektisch wuselt er um mich herum und sammelt das heruntergefallene Geld auf. Dann greift er nach meinem Arm und hilft mir nun wirklich auf. Eine ältere Dame und ein Mann mit langen Locken, der den wenigen Grad über null trotzt und barfuß herumläuft, bieten mir ebenfalls Hilfe an, aber ich winke ab. »Schon gut, danke. Alles in Ordnung.« Sie sind so freundlich und aufmerksam, dass es mir unangenehm ist.
»Wie kann ich das wiedergutmachen?« Der Typ hat große, dunkle Augen, und unser Zusammenstoß scheint ihm wirklich peinlich zu sein.
»Ist doch nichts passiert.« Ich ringe mir ein Lächeln ab und verkneife mir den Blick auf meine Hand. Fühlt sich aufgeschürft an. Aber wenn der arme Kerl nur einen Tropfen Blut sieht, fällt er vermutlich in Ohnmacht.
Immer noch hält er meinen Ärmel fest und drückt mir nun unbeholfen mein Geld in die unversehrte Hand. »Es tut mir wirklich sehr leid.«
»Ich hab mir nicht wehgetan.« Nicht doll zumindest. Ich weise zu den Treppen hinter uns, die zu den Gleisen führen. »Du hast es eilig, oder? Fährt dein Zug?«
Der Typ schaut mich einen Moment lang irritiert an, schüttelt dann den Kopf. »Ich wollte diesem Wichser nach. Der hat mir das Handy geklaut.«
»Shit, tut mir leid. Am Eingang steht doch immer der Wachdienst. Geh zu denen.«
»Wirklich alles in Ordnung?« Auf mein Nicken murmelt er eine letzte Entschuldigung und läuft dann Richtung Haupteingang; auch diesmal nicht gerade langsam, aber wenigstens sieht er nach vorn.
Meine Hand brennt, und mein Hintern fühlt sich an, als wäre er morgen grün und blau. Die Lust auf einen Kaffee ist mir vergangen. Ich beschließe, lieber gleich zum Bahnsteig zu gehen, und will mein Geld zurück ins Portemonnaie stecken. Als ich die Hand in die Tasche meines Parkas schiebe, wird mir schlagartig kalt. Eiskalt.
Verdammt.
Verdammt, verdammt, verdammt.
Die Tasche ist leer. Die andere ebenfalls, und das hastige Abtasten aller weiteren Möglichkeiten zeigt, dass ich das Portemonnaie auch nicht in die schmale, kleine Innentasche oder meine Hose gezwängt habe. Es ist weg! Unnötigerweise lasse ich den Blick über den Boden wandern, wo ich gestürzt bin. Aber natürlich weiß ich längst, dass es mir dabei nicht aus der Tasche gefallen ist. Ich könnte schreien vor Wut auf mich selbst. Ich bin einem dreckigen kleinen Trickbetrüger auf den Leim gegangen! Ich! Ein Jahr lang war ich nicht in der Stadt, und schon falle ich wie ein Touri auf eine dieser dreisten Mistkröten herein.
Der Ärger über meine Naivität trifft mich einen Moment lang schmerzhafter als der Verlust meines Geldes. Es waren ohnehin keine zehn Pfund im Portemonnaie. Doch dann wird mir bewusst, was sonst noch drin war. Mein Ausweis. Und die Fahrkarte nach St Helens, wo Nan in knapp eineinhalb Stunden beerdigt wird. Ohne ein letztes Lied von mir, wenn ich es nicht rechtzeitig zum Friedhof schaffe.
Unvermittelt schießen mir die Tränen in die Augen. Ich habe drei Pfund in der verkrampften Faust. Das reicht nicht für ein neues Ticket. Das darf doch alles nicht wahr sein!
Ein Grüppchen Anzugträger drängt mich aus dem Weg, und ich stolpere fast über den kleinen, zotteligen Hund einer empört schimpfenden Frau.
»Reiß dich zusammen«, flüstere ich mir selbst zu. »Du wirst für Nan singen. Denk nach!« Der Hund schaut sich zu mir um, als hätte ich mit ihm gesprochen.
Denk. Nach.
Hastig eile ich zum Haupteingang. Ich mache mir nicht die geringste Hoffnung, den Dieb noch zu sehen. Was sollte ich auch tun? Ihn einfangen und vermöbeln? Lächerlich. Aber ich werfe einen kurzen Blick in jeden Mülleimer in der Bahnhofshalle und auf dem Vorplatz, wo mir ein eiskalter Januarwind Regentropfen ins Gesicht peitscht. »Komm schon«, murmle ich. Taschendiebe sind auf Geld und Kreditkarten aus. Alles andere wollen sie schnell loswerden und werfen es weg. Aber meine Suche bleibt erfolglos, und der Bettler, den ich verzweifelt frage, in welche Richtung ein junger Mann mit dunklen Haaren gelaufen ist, schaut mich aus nachvollziehbaren Gründen ratlos an und schweigt. Ich lasse eine Pfundmünze in seine Hand gleiten – auf die kommt es für mich jetzt auch nicht mehr an – und laufe wieder in die Bahnhofshalle.
Wenn ich wenigstens ein Handy dabeihätte, könnte ich Mum anrufen, um ihr zu sagen, dass ich mich verspäte. Aber wie soll ich überhaupt nach St Helens gelangen?
Trampen? Mir wird flau bei der Vorstellung, zu Wildfremden ins Auto zu steigen, aber es beruhigt mich, eine Option zu haben.
Dann fällt mir etwas Besseres ein.
Unauffällig blicke ich mich nach dem Sicherheitsdienst um, aber ich kann niemanden in dunkelblauer Uniform erkennen. Vielleicht machen sie gerade Frühstückspause?
Ich werde einfach die Augen offen halten – und selbst wenn mich jemand erwischen sollte, wird mein Vergehen wohl kaum ausreichen, um meine Personalien aufzunehmen. Wie auch, wenn mein Ausweis gestohlen wurde?
Auf dem Boden finde ich eine kleine Pappschale aus einem Imbiss, die beinah unbenutzt aussieht. Das muss reichen. Wer hat schon rein zufällig immer einen Hut bei sich? Hale natürlich. Aber ich schon lange nicht mehr.
Früher fiel es mir leicht, Geld mit Straßenmusik zu verdienen, und auch damals hatte ich nicht immer eine Lizenz für den Ort, an dem ich spontan spielen wollte. Gut gegangen ist es immer. Normalerweise wird man mit einem nachsichtigen Lächeln weggeschickt.
Trotzdem schlägt mein Herz hart und schnell, während ich mich nach einer geeigneten Stelle umsehe. Normal gibt es für mich nicht mehr. Abgehakt, verloren. Für immer.
Der Platz zwischen dem Pasty Shop und den Fahrplänen, in guter Hörweite zu den langen Bankreihen, auf denen viele Leute auf ihre Weiterreise warten, ist perfekt. Wenn nur mein Atem nicht so hastig ginge – wie soll ich so singen?
Ohne Gitarre fühle ich mich unvollständig. Als würde ich mich diesen Menschen mit nackten Brüsten präsentieren.
Hale hätte trotzdem nicht gezögert. Sie hätte einfach gesungen, wäre in ihrem Song aufgegangen und hätte die Gefühle mitsamt den Noten durch die Halle schweben lassen. Zu allen Menschen, die offen sind für die Berührungen der Musik.
Vielleicht mache ich mir etwas vor. Vielleicht ist es Zeit zu akzeptieren, dass es Hale nicht mehr gibt. Dass nur Hanna übrig geblieben ist. Wer immer das auch ist, ohne Hale.
Ich weiß ja nicht einmal, was ich singen soll.
Doch ich erinnere mich zu gut an die Stimme meiner Mutter am Telefon. Wie sie brach, als Mum mir sagte, dass Nanny in ihrer letzten Stunde kaum noch hatte sprechen können. Aber eines konnte sie noch sagen: Ich sollte zurückkommen, nur für einen Tag, nur für ihre Beerdigung. Sie wollte, dass ich dort, meinen überschaubaren Französischkenntnissen trotzend, »Le Moribond« singe, dieses Lied über den Abschied, das sich beharrlich weigert, schwermütig oder gar trauernd zu klingen. Wie gut gelaunte Kinder am ersten Sommertag würden die Klänge über den Friedhof tanzen, und ich weiß genau, warum Nan das wichtig war: Die bleichen, dünnen Gerippe in der Erde sollten Bescheid wissen, dass nun Schluss mit Totenruhe war. Denn jetzt war Maud Edison hier, und ihr Name stand für laute Musik in Sprachen, die sie nicht verstand, ein loses Mundwerk, Turnschuhe beim Pferderennen und zu jedem Feiertag einen neuen Hut und eine teure Zigarre. Ja, es ist tatsächlich vonnöten, die anderen Gespenster auf die Ankunft meiner Nan vorzubereiten.
Und darum werde ich pünktlich sein.
Ich atme aus. Lasse meinen Blick über die wartenden Menschen wandern. Wenig Einheimische, kaum Studenten. Überwiegend Touristen.
Okay, dann ist die Sache entschieden. Die Beatles. Sie wollen es nicht anders.
Ich trete auf der Stelle. Positioniere jeden Fuß noch einmal sorgfältig auf dem Boden, fühle den Untergrund und erinnere mich daran, was Nan vor vielen Jahren zu mir gesagt hat, als ich zum ersten Mal drohte, am Lampenfieber zu scheitern und die Bühne zu verlassen, bevor ich auch nur einen Ton gesungen hatte.
»Hast du die Bux voll?«, hatte Nan mich liebevoll gefragt. »Dann schau mal all die Leute da an. Die hätten allesamt die Bux voll. Voll bis obenhin! Aber du bist die, die trotzdem singt, und allein dafür werden sie dich respektieren. Weil du eine von den wenigen bist, die auch mit voller Bux keinen Rückzieher machen!«
»Ich mach keinen Rückzieher, Nan«, flüstere ich. Und dann stimme ich »Yesterday« an.
Die erste Zeile wackelt. Ich singe viel zu leise, um gegen das Summen vieler Stimmen und noch mehr Geräusche anzukommen. Doch dann setzt der Zauber ein, den die Musik immer über mich wirkt. Trotz all der langen Zeit, die ich nicht mehr gesungen habe, dauert es nur Augenblicke. Es passiert unweigerlich, wie ein Reflex, gegen den ich mich nicht einmal wehren könnte, wenn ich wollte.
Mein Blick kehrt sich nach innen. Die Menschen, Stimmen und der Lärm verschwinden, und meine Töne werden lauter, sicherer. Und sie werden gehört. Ich fühle keine Angst mehr, keine Sorge und keine Unsicherheit. Mein ganzes Denken ist erfüllt von den melancholischen Worten des Liedes und der Melodie, die diese Gefühle nach außen trägt.
Ich habe »Yesterday« unzählbar oft auf der Straße gesungen. Kaum ein Lied wird von den Touristen häufiger gewünscht. Und immer versuche ich, es ein klein wenig anders zu singen. Etwas Besonderes hineinzulegen, etwas Einmaliges.
Mein Lächeln streift die beiden Frauen, die klimpernde Münzen in meine Pappschale werfen.
Ich achte nicht bewusst auf die Menschen, wenn ich singe, doch das bedeutet nicht, dass ich sie nicht wahrnehme. Irgendetwas in mir nimmt auf, wie sie mir zuhören, was sie besonders anspricht, und manchmal glaube ich zu spüren, an welchen Stellen sie eine Gänsehaut bekommen. Ich empfange all das und lege einen Hauch von meinem Publikum in meine Stimme, gebe es ihnen zurück. Mal intensiviere ich einen Part, singe eine besondere Strophe leiser oder verändere die Emotion. Dadurch bekommt jedes Lied eine gewisse Magie, etwas, das nicht reproduzierbar ist und nur durch die Menschen entsteht, die mir zuhören. Doch noch nie ist geschehen, was nun passiert. Dieses alte, hundertmal gesungene und tausendmal gehörte Lied, das ich eigentlich schon längst leid war – es trifft mich.
Zum ersten Mal spüre ich das Lied in jeder Faser meines Körpers und bis in den hintersten Winkel meiner Seele. Und das liegt nicht allein daran, dass es so lange her ist, seit ich zuletzt gesungen habe, sodass ich mich völlig ausgedörrt fühlte und nun jeden Ton aufsauge, als könnte mich nur die Musik wieder vollständig zum Leben bringen – länger als über die knappen zwei Minuten hinaus, die es braucht, um das Lied zu singen. Denn heute kenne ich die Seele des Stücks. Heute verstehe ich, was es bedeutet, sich nach dem Vergangenen zu sehnen, das weit fort ist. Unerreichbar fern, weil man einen einzigen Fehler gemacht hat und nun nie wieder die Person sein kann, die man vorher war. Die man sein wollte.
Ein paar Leute klatschen und holen mich zurück ins Hier und Jetzt.
Ich blinzle rasch und verkneife mir die Tränen. Das Lied ist längst zu Ende, und ich stoße erleichtert die Luft aus, weil die Münzen in der Pappschale zusammen mit denen in meiner Tasche für das Ticket nach St Helens ausreichen. Die Bahn, die ich hatte nehmen wollen, dürfte gerade abfahren, aber die nächste kommt bereits in zwanzig Minuten, und das reicht, um es rechtzeitig zum Friedhof zu schaffen.
»Singst du noch ein Lied?«, fragt ein kleiner Junge von vielleicht fünf oder sechs Jahren halb verständlich, weil er dabei an einem Keks nuckelt.
»Nein, tut mir leid. Ich muss meinen Zug bekommen.«
»Schade.« Die Mutter des Kleinen drückt ihm ein Geldstück in die Hand und zeigt ihm, wo er es reinwerfen soll, bevor sie weitergehen. Die anderen Zuhörer haben sich bereits zerstreut. Nur noch ein Typ steht dort, als warte er auf etwas. Er trägt einen dicken braunen Parka und eine senfgelbe Beanie und mustert mich, während ich mich eilig umschaue, ob irgendwo jemand vom Sicherheitsdienst zu sehen ist, und dann das Geld an mich nehme, mit zitternden Händen, als würde ich es stehlen.
Der Typ steht immer noch da und hakt einen Daumen in die Jackentasche. »Singst du noch was anderes als die Beatles?«
Ich schüttle den Kopf, und aus irgendeinem Grund wird mein Mund trocken. »Heute nicht, nein. Meine Bahn …«
»Ich meine nicht jetzt. So grundsätzlich.«
So grundsätzlich fallen mir Antworten ein, wenn ich angesprochen werde. Auf den Mund gefallen bin ich nicht. Schlagfertigkeit ist das Erste, was man lernt, wenn man in Liverpool Kirkdale aufwächst. Doch jetzt … Irgendetwas in dem Murmeln und Summen der Geräusche um uns herum hat sich verändert, und mir ist, als würden alle Menschen hier jedes Wort hören, das ich sage.
»Was singst du sonst so?«, fragt der Typ, und mir wird bewusst, was mich so aus dem Konzept bringt. Seine Stimme. Die kehligen Laute im Liverpooler Akzent klingen bei den meisten Männern hart. Bei ihm liegt etwas Weiches darin, als schmiege man einen rauen Stoff nachgiebig über eine weiche Rundung.
Ich würde meinem Hirn oft gern verbieten, mir Bilder zu Stimmen, Tönen und Geräuschen vorzuspielen, aber vermutlich könnte ich eher aufhören zu atmen.
»Ich will dich echt nicht zulabern«, sagt er, und in mir drin erwidert etwas: ›Schade eigentlich‹. Ich höre ihn wirklich gern reden. Seine Stimme beschäftigt meinen Kopf mit angenehmen Bildern, die die bedrohlichen verdrängen.
»Und du musst deine Bahn kriegen, oder?«
Ich schaue zu der großen Uhr unter dem Glasdach. Eine Viertelstunde habe ich noch. »Schon okay, ich …« Als ich wieder zu ihm sehe, verhakt sich mein Blick in seinem, verharrt dort, und das Wort, das ich gerade hatte sagen wollen, verschwindet einfach.
Er hat grün-braune Augen, und die Art, wie er in meine sieht, macht es mir unmöglich wegzuschauen. Ich kann nicht einmal wegdenken. In seinem Blick steht vollkommen offenes Interesse, Neugierde – aber nichts Bohrendes.
»Nein, ich sing nicht nur die Beatles. Ich singe die Beatles nicht mal gern. Ich meine, nichts gegen die Beatles. Aber …«
»Die Touristen wollen nichts anderes«, führt er meinen Satz zu Ende. »Früher oder später hat man sie über.«
Damit ist alles gesagt.
»Warum ich dich das frage …« Er lächelt, ich ahne eine Spur Verlegenheit. »Ich hab ein Pub am Hafen und unterstütze gern Straßenmusikerinnen aus der Stadt.«
»Sofern sie nicht die Beatles singen.«
»Du hast es erfasst.« Er gibt ein nachdenkliches kleines Geräusch von sich, tief und summend und irgendwie angenehm in meinem Bauch. »Vielleicht hast du Lust drauf?«
»Ein Pub also«, wiederhole ich nicht sehr geistreich. Er hat schon ein Pub? Ich schätze ihn auf Mitte zwanzig, wie kommt man in dem Alter an einen eigenen Laden? Doch irgendwie passt es zu ihm. Ein Drei-bis-vier-Tage-Bart betont seinen kantigen Kiefer. Zwar hat er die Beanie tief in die Stirn gezogen, aber man erkennt mehrere Ringe im linken Ohr und einen in der rechten Augenbraue, der fast unter dem Rand der Mütze verschwindet. Ich kann ihn mir verdammt gut vorstellen, wie er mit hochgekrempelten Hemdsärmeln Bier zapft oder Drinks mixt und jedem Gast an der Bar dieses offene Lächeln schenkt.
»Das Stoertebeker’s«, sagt er.
Das sagt mir allerdings gar nichts. Was ist das überhaupt für ein Wort? Ich könnte es vermutlich nur mit einem Knoten in der Zunge aussprechen.
Er legt den Kopf schief. »Du bist doch von hier, du hast auf jeden Fall davon gehört.« Einen Moment lang scheint er vollkommen sicher, dann bröckelt die Überzeugung und weicht einer tiefen Verwunderung.
»Ich war eine Weile nicht in der Stadt.« Meine Wangen werden heiß, was sich trotz der Kälte nicht angenehm anfühlt. Ich will nicht, dass er mich gleich fragt, ob ich unter einem Stein gelebt habe, weil ich sein offenbar ultraangesagtes Pub nicht kenne. Denn leider kommt das der Wahrheit verdammt nah.
Doch dann lacht er lautlos in ein Kopfschütteln hinein. »Nein, du kennst es nicht. Niemand kennt es.«
»Ein Geheimtipp also?«
»So ähnlich. Ich supporte auch keine lokalen Musiker. Ich brauche sie. Sie retten mir gelegentlich meinen … Laden.«
»Den Laden, verstehe.«
»Okay. Den Arsch auch.« Er lacht, und ich muss unweigerlich ebenfalls lächeln. Was allerdings dazu führt, dass mir schlagartig klar wird, was ich hier mache. Nanny ist tot. In einer Stunde wird ein Pfarrer, der sie nicht kannte, über ihre guten Taten sprechen, aber vermutlich all ihre liebenswerten Schrullen weglassen. Und danach werden wir ihren Körper in eiskalte, durchgeregnete Erde hinabsenken, und …
Mir schnürt es die Kehle zu.
Und ich flirte mit dem ersten Scouser, der mehr von mir will, als mir mein Portemonnaie zu klauen?
Plötzlich bekomme ich kaum mehr Luft. Mein Herz schlägt schnell und hart, aber ich habe das Gefühl, es pumpt das Blut nur ein Stück weit in meinen Körper. Es scheint irgendwo zu stoppen. Meine Finger kribbeln eisig kalt.
»Um ehrlich zu sein, zahle ich richtig schlecht. Und entdeckt wurde im Stoertebeker’s auch noch niemand. Aber ich versprech dir eh keine große Karriere – auch wenn du ohne jeden Zweifel gut genug bist –, sondern bitte dich, einen Abend lang meinen Arsch zu retten. Hey, alles okay?« Er sieht mich besorgt an, streckt die Hand nach meinem Arm aus, zieht ihn dann aber wieder zurück. Vermutlich hat er den Schrecken in meinem Gesicht gesehen. »Du bist ganz blass, geht’s dir gut?«
Ich schlucke, zwinge mich zum Atmen und nicke. »Ja, alles in Ordnung. Ich bin nur … Ich muss wirklich meinen Zug kriegen. Ist’n Scheißtag.« Ich habe keine Ahnung, wie ich es hinbekommen soll, Nans Wunsch zu erfüllen und im Regen an ihrem Grab ein halbwegs glaubwürdiges »Le Moribond« zu singen. Der Gedanke lässt mir jetzt schon die Tränen kommen.
»Tut mir leid.« Er sagt das leise, ruhig. Jedes Wort klingt ehrlich. »Ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Kann ich dir irgendwie helfen, den Tag besser zu machen?«
»Danke. Aber nein, wohl nicht.« Ich deute nach links zu den Treppen. »Ich muss da runter.«
»Okay, dann wünsche ich dir, dass der Regen aufhört. Vielleicht … würde das schon helfen?«
Das Lächeln zuckt nur kurz über meine Lippen, wie ein Reflex, aber ich fühle es trotzdem. »Das würde es, ja.«
»Ich tue, was ich kann.«
Fast muss ich lachen, weil er so ernst klingt.
»Und falls es mir gelingt, das Januarwetter zum Besseren zu verändern … rettest du mir dann einen Abend lang mein Pub?«
Wohl nicht, nein.
Meine Antwort sollte sehr klar ausfallen. Ich kann ihm nicht helfen. Aber irgendwas in meiner Kehle verhindert, dass ich Nein sage. Ich kann mich bloß räuspern.
»Überleg es dir einfach.« Er gräbt in der großen Tasche seines Parkas. Ich will gar nicht zu genau hinschauen, was er zwischen seinem Smartphone, einem Schlüsselbund, Kassenbons und nicht allzu benutzt aussehenden Taschentüchern noch hervorzaubert, aber schließlich hat er gefunden, was er sucht, und hält mir eine in Sepiatönen bedruckte Streichholzschachtel hin. Ich nehme sie mit den Fingerspitzen an mich, um seine nicht zu berühren, und hoffe, er merkt es nicht. Oder versteht es zumindest nicht falsch.
STOERTEBEKER’S steht in einem Halbkreis unter der Zeichnung eines Segelschiffes zwischen gewaltigen Wellen. Auf der Rückseite finden sich Adresse und Telefonnummer. Und ein Name. Sawyer Richardson.
»Und wenn du es dir überlegt hast, dann ruf mich an. Frag nach Sawyer und glaub den anderen Schmocks, die möglicherweise ans Telefon gehen, kein Wort, das sie über mich sagen.« Er grinst breit. »Ah, vergiss es, ich gehe ab heute nur noch selbst ans Telefon.«
Wieder huscht ein Lächeln über meinen Mund, das nicht geplant war. Aber seine Worte klingen irgendwie … froh. Hoffnungsvoll, als würde er sich schon jetzt darauf freuen, dass ich ihn anrufe. Leider wird das so bald nicht geschehen.
»Ich bleibe nicht in Liverpool«, sage ich, damit er sich keine falschen Hoffnungen macht. »Und ich muss wirklich los.«
»Klar. Mach’s gut. Und falls du mal wieder in die Stadt kommst …« Er lacht wieder. »Ach, vergiss es. Du bist aus Liverpool. Früher oder später kommst du zurück.«
SAWYER
Es ist mir leichtgefallen, meine Schwester ein paar Minuten warten zu lassen. Der Blick, mit dem sie mich jetzt quer über den Bahnsteig zu grillen versucht, lässt mich die Entscheidung allerdings fast bereuen.
Zoe wohnt bereits seit dem ersten Advent offiziell wieder in Liverpool, aber noch immer bringt sie jedes Mal Unmengen an Kram mit, wenn sie bei ihren Freundinnen und Freunden in London war, wo sie studiert hat. Der gewaltige Seesack, den sie heute nebst ihrem Rucksack und einer kleinen Reisetasche dabeihat, sieht schon von Weitem aus wie ein gewichtiger Grund, sich chauffieren zu lassen, statt den Bus zu nehmen. Ich verstehe nicht ganz, warum sie nicht in London geblieben ist, bis auch ihr Freund umziehen kann. Jonathans neuer Job beginnt erst im Frühsommer. Aber Zoe hat immer ihre Gründe, egal was sie tut oder lässt. Wann ich sie erfahre, ist die andere Frage.
Beim Näherkommen wird mir zumindest klar, warum Zoe mich angerufen hat statt unserer Eltern, die sich darum reißen, ihr jeden Wunsch zu erfüllen, seit sie endlich heimgekehrt ist: Außen an dem Ungetüm von Seesack baumelt eine Reitkappe. Unsere Mutter würde beim Anblick dieses mehr als deutlichen Hinweises darauf, dass Zoe wieder auf Pferde steigt, vermutlich den halben Bahnhof zusammenbrüllen. Zugegeben: Mir gefällt der Gedanke auch nicht besonders.
»Schön, dich zu sehen, Schwesterchen. Wie war es in London? Du siehst toll aus.« Meine Erfolgsaussichten sind miserabel, aber ich muss wenigstens versuchen, so zu tun, als sei mir meine Verspätung gar nicht bewusst. Ich beuge mich zu einer Umarmung zu ihr hinab.
»Vor zehn Minuten sah ich noch viel besser aus«, murmelt sie und drückt mir einen dieser Küsse auf die Wange, bei denen ich mich immer frage, ob sie mir damit den Kiefer brechen will. »Weniger blau gefroren.«
Ich richte mich wieder auf und mustere sie. »Steht dir aber, das Blau. Solltest du häufiger tragen.«
Sie seufzt theatralisch. »Du bist wenigstens charmant, wenn du mich versetzt.«
»Übertreib mal nicht, ich bin doch hier. Und allenfalls fünf Minuten zu spät. Ich wurde aufgehalten.«
Zoe betrachtet mich eine Spur zu neugierig, und ich habe das Gefühl, sie könne mir ansehen, dass das, was mich aufgehalten hat, immer noch in meinen Gedanken herumspukt. Sie konnte mich schon als kleines Kind durchschauen. Zoe kam auf die Welt, und ich hatte bereits als babyspeckiger Dreijähriger in Knickerbockern den Eindruck, dass sie alles über mich wusste.
»Es sind mindestens acht Minuten. Eher neun. Und sie geben mir Rätsel auf, diese acht, eher neun Minuten, Sawyer.«
»Ich hab’s geahnt.« Ich werfe mir Zoes Seesack über die Schulter und will nach ihrer Tasche greifen, aber meine Schwester positioniert sie bloß bequemer auf ihren Oberschenkeln, dreht ihren Rollstuhl um hundertachtzig Grad und hält eilig auf die Aufzüge zu. Während ich ihr nacheile, sehe ich zu den anderen Bahnsteigen hinüber, ob ich das Mädchen noch mal sehe. Ob es ihr wirklich gut geht? Sie sah … verloren aus.
Vor dem Aufzug mustert Zoe mich mit kaum verhohlenem Grinsen. »Nach wem oder was hältst du eigentlich die ganze Zeit Ausschau?«
»Was tu ich?« Sie hat mir doch den Rücken zugewandt. Hat dieses Biest einen versteckten Spiegel am Rolli installiert?
Statt einer Antwort verdreht sie nur vielsagend ihre großen, goldbraunen Augen. »Sawyer.«
Okay, sie hat gewonnen. »Da war eine Frau vorhin. Eine Straßenmusikerin.« Wenn sie denn eine war. Sie gibt mir Rätsel auf. Sie wusste haargenau, wie viel Volumen sie in ihre Stimme legen musste, um laut genug für die Bahnhofshalle zu singen, ohne auch nur im Geringsten angestrengt zu wirken. Sie klang erfahren und souverän. Und sah trotzdem aus, als würde sie jeden Moment davonlaufen.
»Du hast also schnell noch eine Straßenmusikerin gevögelt, verstehe. Hättest du gleich sagen können.«
»Hey!« Zugegeben, unsere Kommunikation wird gern zotig. Meist ist der Punkt, an dem es nervt, bei Zoe viel schneller erreicht als bei mir. Diesmal ist es umgekehrt. »Hab ich nicht.«
»Aber du wolltest.«
»Zoe!«
»Was denn?« Die Fahrstuhltür gleitet auf, Zoe dreht auf der Stelle, rollt rückwärts hinein und lacht mich an. Sie macht das absichtlich: diese beiden Zöpfe, zu denen sie ihr rotes Haar flicht. Die Bohemian-Bluse unter dem Anorak. Das unschuldige Grinsen. Sie spielt mit diesem Eindruck, ein süßes, liebenswertes und harmloses Mädchen zu sein. Man fällt sogar darauf rein, wenn man es besser weiß. Und sie hat großen Spaß daran, den Eindruck zu brechen. »Du wolltest sie vögeln! Ich seh das doch!«
Ich bleibe in der Lichtschranke stehen und bin selbst irritiert, dass ich nicht mit ihr lache. Es geht einfach nicht.
Sie wird wieder ernst, zumindest ansatzweise. Das Grinsen kann sie jedoch nicht verbergen, auch wenn sie es sichtlich versucht. »Hast du dich verguckt?«
Natürlich nicht! Nicht nach »Yesterday«. Nicht nach ein paar vollkommen belanglosen Worten, noch weniger Blicken und der aufgezwungenen Höflichkeit, die mir das Mädchen entgegenbrachte. »Ich weiß nicht mal, wie sie heißt.«
»Hast du?«
»Bin ich gleich ein Vollpfosten, weil mir eine Frau gefällt?«
Zoe lacht auf, aber diesmal klingt es warmherzig und nicht mehr, als lache sie mich aus. »Du hast dich verguckt. Und musstest weg, weil deine kleine Schwester ihre Tasche nicht allein tragen kann. Das tut mir leid, Sawyer. Wirklich. Ich hätte auch länger gewartet. Sollen wir schauen, ob wir sie noch finden?«
»Nein. Sie musste ihren Zug erwischen. Und nur, damit du es weißt: Das ist keine Tasche, das ist ein Monster. Lass bloß Mum und Dad nicht sehen, was drin ist. Wenn sie das rauskriegen …«
»Lenk nicht ab!« Zoes Augen leuchten vor Vergnügen. »Erzähl mir mehr über das Mädchen. Wie sieht sie aus?«
»Hm. Klein?«
»Oh. Klein. Doch so aussagekräftig. Komm schon, Details, bitte. Haarfarbe und Schnitt, Augenfarbe und Cup-Größe!«
Ich gebe den Widerstand auf und trete zu ihr in den Fahrstuhl. Ob die auf Bahnhöfen überall auf der Welt den gleichen widerlichen Geruch verströmen? »Braun«, erwidere ich, »lockig und vom Wind durcheinander, bis zur Schulter lang. Blau, glaube ich. Sie trug eine weite Jacke; sah aus, als gehörte die ihrem Freund, wenn ich ehrlich bin. Und ihre BHs haben vermutlich die Größe Geht-dich-einen-Scheiß-an,-Zoe.« Ob sie einen BH trägt? Oder nur ein lässiges Shirt? Himmel, bis gerade dachte ich, die Phase, in der ich über die Wäsche bekleideter Frauen nachgedacht habe, hätte ich vor knapp zehn Jahren beendet.
»Gefragt hast du aber nicht?«
»Nach ihrem BH? Zoe …«
»Ob die Jacke ihrem Freund gehört.«
»Nee.«
»Und was an braunen Haaren und blauen Augen hat dir nun so gut gefallen?«
Der Fahrstuhl öffnet die Tür, und wir machen uns auf den Weg zum Parkhaus. »Ich weiß nicht. Etwas an der Art, wie sie gesungen hat? Etwas an der Art, wie sie sich umgesehen hat?« Als bräuchte sie jemanden. »Etwas an der Art, wie sie gegangen ist.« Als bräuchte sie niemanden.
»Seht ihr euch wieder?«
Ich hebe bloß resigniert die Schultern.
»Wie jetzt?« Zoe parodiert mein Achselzucken völlig übertrieben. »Und was soll das heißen, du weißt nicht mal, wie sie heißt? Hast du nicht gefragt? Hat es dir die Sprache verschlagen?« Sie stößt einen kehligen kleinen Laut aus, mit dem man niedliche Katzenbabys kommentiert, aber keine – mit fünfundzwanzig Jahren und einer Körpergröße von über bangen Jahren hart erhofften immerhin eins dreiundsiebzig – großen Brüder. »Hast du nur andächtig gelauscht, während sie wie ein Engel gesungen hat?«
Mir reicht’s. Ich bleibe stehen, und Zoe rollt ein ganzes Stück weiter, bis ihr klar wird, dass ich ihr nicht nachkomme. Sie wendet, und ich verschränke die Arme. »War es so ätzend in London, oder ist es so ätzend, nach Hause zu kommen?«, frage ich.
»Was soll das jetzt heißen?« Auch sie verschränkt die Arme, was viel lässiger aussieht, weil sie sich dabei entspannt zurücklehnen kann. Aber der bittere Zug um ihren Mund verrät, dass ich einen Treffer gelandet habe. Die Verbindung zwischen uns ist keine Einbahnstraße. Ich durchschaue sie selten so schnell wie sie mich. Aber wenn sie mir ein bisschen Zeit gibt, kann ich das genauso gut.
»Komm schon, Zoe, was ist los? So zänkisch und zynisch bist du sonst nie. Zumindest nicht ohne guten Grund«, füge ich hinzu. »Gehen dir unsere Eltern auf den Keks?« Es war keine gute Idee, dass Zoe ins Management eines der Hotels einsteigt, die im Besitz unserer Familie sind. Sie hat sich von Mum und Dad bequatschen lassen. Vermutlich, weil sie nicht ahnte, dass sie Zoe vor allem deshalb im Familienbetrieb haben wollen, weil sie diesen als sicheren Rahmen für ihre Tochter betrachten. Nur dass Zoe weder Sicherheit noch einen Rahmen will, den unsere Eltern stecken. Mir war klar, dass es Streit geben würde. Aber wer hört schon auf mich?
Zoes Pokerface ist nutzlos, und sie weiß es. Seufzend löst sie die Arme und streicht sich den Pony aus der Stirn. »Ich fühle mich wie die Praktikantin, nur dass alle im Hotel den Auftrag haben, mir den Hintern zu pudern, wenn ich ihn nur das kleinste Stück aus dem Rolli lupfe.«
Ich griene. »Lässt sich das ausnutzen? Bringen sie dir wenigstens Gin Tonic zum Frühstück?«
»Ich wette, sie würden mir den Gin Tonic zum Frühstück sogar von einem halben Dutzend Stripper servieren lassen, wenn ich darum bitte.«
»Klingt nicht übel!«
Zoe prustet entnervt. »Sie nehmen mich nicht ernst, und das ist nicht witzig, Sawyer.«
»Weiß ich doch. Tut mir leid.«
»Können wir später darüber reden? In Ruhe?«
»Immer. Mit welchem Level von schlechter Laune muss ich rechnen?«
»Ein Bier wird reichen.«
»Du säufst mir diesmal nicht den Laden leer?«
»Ein andermal.«
Wir setzen uns wieder in Bewegung, und als ich Zoe unauffällig aus dem Augenwinkel beobachte, treffen unsere Blicke aufeinander, weil sie dasselbe versucht hat. Wir müssen beide lachen.
»Aber ernsthaft«, sagt Zoe. »Was war das für ein Mädchen? Und warum hast du sie nicht angesprochen?«
»Hab ich!« Auf dem Weg zum Auto erzähle ich ihr von meinen kümmerlichen Versuchen, die namenlose Straßensängerin dazu zu überreden, einen Abend lang mein Pub und meinen Arsch zu retten.
»Und warum bietest du ihr einen Job an, wenn du sie daten willst?«, fragt Zoe.
Ich hasse sie! Sie trifft immer ins Schwarze. Dorthin, wo es wehtut. »Weil … Weil …«
»Ach, weil«, wiederholt Zoe hilfsbereit.
»Genau. Weil!«
Wir erreichen meinen Ford Transit im Parkhaus. Zoe macht ein grüblerisches Gesicht, während sie sich mühsam aus dem Rolli auf den Beifahrersitz hievt, was einer sportlichen Hochleistung gleichkommt, da dieser in einem Lieferwagen sehr viel höher liegt als in einem Pkw. Ich würde allerdings niemals wagen, ihr zu helfen, bevor sie darum bittet. Es gibt Fehler, die macht man nur ein einziges Mal.
»Hast du sie gar nicht gefragt, wohin sie fährt?«, erkundigt sie sich. »Es klingt irgendwie … als hätte es sie belastet.«
Mir fällt nicht viel mehr als ein weiteres Schulterzucken ein. »Kennst du das Gefühl, wenn dir klar wird: Wenn ich ein falsches Wort sage, ist die Person weg?«
»Von ängstlichen Pferden«, erwidert Zoe, und obwohl das irgendwie fies klingt, scheint sie es respektvoll zu meinen. »Will man zu schnell zu viel, wirft einen das um Jahre zurück. Parkst du für mich ein, bitte?«
Ich hebe den Rolli in den Laderaum und fixiere ihn neben ein paar Kästen Leergut mit einem Spanngurt. Schließlich steige ich ein und starte den Motor.
»In Filmen«, sagt Zoe, »tauchen solche Frauen wieder auf, wenn der Held Jahre später Option zwei geheiratet hat.«
»Danke. Genau das wollte ich hören.«
»Es bedeutet immerhin, dass du heiraten wirst.«
»Toll. Du bist zur Hochzeit eingeladen.«
»Oh, mein Gott, wirklich? Ich komme, aber nur, wenn ich das Brautkleid aussuchen darf.«
»Bestimmt. Ich such die Frau danach aus, ob sie dich ihr Kleid aussuchen lässt.«
Wir fahren aus dem Parkhaus, und meine Hand hält auf dem Weg zum Scheibenwischerhebel inne, weil ich den Scheibenwischer wider Erwarten gar nicht brauche.
»Es hat aufgehört zu regnen!«, ruft Zoe erfreut. »Wenn das mal kein gutes Omen ist. Ich komme zurück nach Liverpool, und der wochenlange Regen zieht ab. Schau mal, Richtung Osten kommt sogar die Sonne raus.«
HANNA
Die Fahrt nach St Helens dauert nur gut zwanzig Minuten, aber diese Minuten ziehen sich zu einer Ewigkeit hin. Wie soll ich gleich dieses Lied singen, wenn ich doch nichts weiter als heulen möchte?
Um mich abzulenken, denke ich über den Typen nach, der mich für sein Pub engagieren wollte. Früher habe ich häufig in Pubs gesungen. Es war immer etwas Besonderes, die ganz individuelle Stimmung einzufangen und in meine Songs zu weben wie einen glitzernden Faden in einen schönen Stoff. Allein die Vorstellung bringt meinen Bauch zum Kribbeln. Und ich würde diesem Sawyer wirklich gern helfen.
Aber was mache ich mir vor? Ich sollte erst mal mir selbst helfen.
Der Bahnhof in St Helens ist nicht überdacht, und ich blinzle beim Aussteigen in einen überraschend hellen Himmel. Über den Bäumen spannt sich klares, von Sonnenlicht durchflutetes Blau. Einen Moment lang starre ich wie blind ins Helle, eine Stimme im Ohr, als würden die Worte in diesem Moment gesprochen, genau hier:
Dann wünsche ich dir, dass der Regen aufhört.
Ich tue, was ich kann.
Im nächsten Augenblick schüttle ich über mich selbst den Kopf. Sawyer Richardson wird den verdammten Wetterbericht angesehen haben. Es soll vorkommen, dass der hin und wieder stimmt. Und womöglich fängt es auch gleich wieder an zu schütten.
Ich beeile mich, zur Bushaltestelle zu kommen, bevor mir noch der Bus vor der Nase wegfährt. Als ich an der Swinburne Road wieder aussteige, bringen die Sonnenstrahlen die Nässe auf dem Asphalt zum Glitzern. Nan hat ganz in der Nähe gewohnt, daher kenne ich hier jede Straße. Vögel singen, als versuchten sie, den Frühling ein paar Wochen eher anzulocken. In der Ferne läuten die Kirchenglocken der Abbey, und bei der Grundschule spielen Kinder auf dem Hof.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so frei atmen konnte. Und diese Feststellung tut gut und weh zugleich, denn ich bin immerhin auf dem Weg zum Begräbnis meiner Nan.
Als mich ein vorbeischlurfender Mann mit einem dichten Bart und einer speckigen Schirmmütze besorgt mustert, bemerke ich, dass ich weine. Ich eile weiter, bevor er mich ansprechen kann, und lasse die Tränen einfach laufen. Wann geht das schon? Erst als ich mich dem Friedhof nähere und meine Familie am Rand des Parkplatzes warten sehe, wische ich mir das Gesicht mit dem Ärmel ab und reiße mich zusammen. Für Mum. Für sie ist diese Beerdigung von uns allen am schlimmsten, denn sie hatte ein unglaublich inniges Verhältnis zu ihrer Mutter. Ich dagegen habe ihr im letzten Jahr bloß Kummer bereitet. Nun bin ich es ihr schuldig, für sie da zu sein. So stark zu sein, wie ich nur kann.
Wir umarmen uns zur Begrüßung.
»Da bist du ja endlich, Hanna, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Gab es Probleme?« Sie drückt mich fest an sich, dennoch spüre ich eine Distanz. Sie kann mir nicht verzeihen, was ich getan habe, und selbst jetzt, in ihrer Trauer, ist ihre Wut spürbar, auch wenn sie sich bemüht, sie mich nicht sehen zu lassen.
Tut mir so leid, Mum. Ehrlich.
Ich zwinge mich zum Lächeln. »Bloß ein blöder Zwischenfall auf dem Bahnhof, durch den ich meinen Anschluss verpasst habe. Aber jetzt bin ich hier.«
Mum trägt einen Strickmantel, den ich bisher nur an Nanny gesehen habe. Er ist leuchtend bunt, und an einigen gestopften Stellen sieht man ihm die Jahre an. Nan hat ihn geliebt, und ich finde es eine wunderschöne Geste, dass Mum ihn nun trägt und ein Teil von Nanny immer noch bei uns ist. »Gut, dass du hier bist, Hanna. Wirklich.«
Lane schiebt sich unbeholfen an meine Seite und nickt. »Find ich auch. Hi, Hanna. Geht’s dir gut?«
Mein Halbbruder hat große Hände und dazu unpassend dünne Arme, mit denen er hilflos herumhantiert, als wüsste er nicht, ob er mich umarmen darf. Er hat mich schon als Kind an eine scheue große Spinne erinnert, und diese Assoziation werde ich bis heute nicht los, dabei ist er inzwischen dreiundzwanzig, knappe zwei Jahre älter als ich. Mit seinen großen Augen in dem hellen Gesicht bricht er heute reihenweise Herzen. Die Verbindung aus überdurchschnittlicher Intelligenz und seiner sozial eher unbeholfenen Art, wegen der er als Kind von den anderen bestenfalls ausgeschlossen und schlimmstenfalls verprügelt wurde, kommt in erwachseneren Kreisen sehr viel besser an.
»Alles okay«, sage ich und erlöse ihn aus seiner Unsicherheit, indem ich ihn umarme.
Er hält mich einen Moment zu lange fest. »Wirklich?« Sein schlechtes Gewissen mir gegenüber rührt mich normalerweise, aber momentan kann ich es kaum ertragen.
»Wirklich.« Wir wissen beide, dass das gelogen ist. Heute belassen wir es dabei, denn heute geht es nicht um mich. »Und bei dir?«
»Alles super. Hab ich dir doch erzählt.«
Ja, dass das Studium läuft und sein Job toll ist, wird er nicht müde zu betonen.
»Und Alec?«, flüstere ich. »Lässt er dich in Ruhe?«
Allein diesen Namen zu nennen, reicht aus, dass sich meine Nackenhaare sträuben.
»Ich hab es dir geschworen: Wir haben keinen Kontakt mehr. Er hat vergessen, dass ich existiere.«
Ich würde Alecs Existenz auch liebend gern vergessen, so ist es nicht. Aber ich weiß zu gut, was er getan hat, und kann nicht ausschließen, dass er zu Schlimmerem bereit ist. Vor allem wird er mich definitiv nicht vergessen haben.
»Hale.« Mein Vater ist der Einzige, der mich noch so nennt. Er ist auch der Einzige, der Nan nicht gut genug kannte, um zu wissen, dass er heute kein Schwarz tragen muss. Zwischen meiner Mutter, Lane und Nannys vielen engen Freundinnen und Freunden, die allesamt farbenfroh gekleidet sind, wirkt er in seinem Anzug wie ein Fremdkörper, und das tut mir leid. Er ist keiner, auch nicht seit der Trennung von meiner Mutter. Meinen Eltern gelingt bis heute, was viele für unmöglich halten: Sie sind geschieden und trotzdem noch beste Freunde, auch wenn sie sich nur noch selten sehen, seit Dad nach Sheffield gezogen ist.
Dad ist Lane unglaublich ähnlich; schlaksig und dunkelhaarig, nur einen guten Kopf kleiner als sein Sohn. Er ist einer dieser Michael-J-Fox-Typen, die nie wirklich erwachsen aussehen, sondern irgendwann über Nacht vom Jungen zum Greis werden. Noch ist er Junge, wenn er heute durch die Sorgenfalten im Gesicht auch deutlich mitgenommen wirkt. »Gut, dass du da bist, Liebes.« Er drückt mich an sich und flüstert: »Juniper braucht dich. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, um sie zu trösten.«
Ich verkneife mir einen Blick zu meiner Mutter, die ein älteres Ehepaar begrüßt. Sie macht einen gefassten Eindruck, aber ich kenne sie: Nach außen hin tut sie immer stark, auch wenn es in ihrem Inneren völlig anders aussieht. Ich habe leider keine Ahnung, wie ausgerechnet ich ihr helfen sollte. »Du wirst es mitbekommen haben«, antworte ich meinem Vater tonlos. »Es läuft nicht ganz so blendend zwischen uns.«
»Sie denkt doch gerade nicht an diesen Mist.«
Dieser Mist. So nennt er es immer.
Dieser Mist, der mein Leben ist.
Ich löse mich aus seiner Umarmung und schiebe meine eiskalten Hände in die Jackentaschen. Meine Fingerknöchel streifen etwas, tasten, und ich halte die Streichholzschachtel bereits in der Hand, bevor ich mich daran erinnere, wie sie dort hingekommen ist. Wer sie mir gegeben hat. Und aus welchem Grund.
Dieser Sawyer Richardson will mich nicht aus Mitleid in seinem Pub singen hören oder weil er denkt, mir helfen zu müssen. Sondern weil ich gut war. Weil ich – zumindest wenn ich singe, zumindest, wenn ich Hale bin – den Menschen vielleicht doch noch etwas zu geben habe.
Vielleicht hat Dad recht, und ich kann auch Mum etwas geben. Ich hoffe es in jedem Fall, nicht nur, weil ich ihr gern beistehen möchte. Sondern auch, weil ich mir wünsche, sie würde mir etwas mehr beistehen. Ich atme durch und nicke.
Er lächelt mich an und reibt meinen Arm. »Denkst du, du schaffst es, das Lied zu singen? Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwer das sein muss, aber es würde Juniper viel bedeuten.«
»Uns allen«, korrigiere ich leise. »Mum, Nan … und mir würde es auch viel bedeuten.« Vor etwas mehr als einer Stunde hätte ich ihm nicht mehr versprechen können, als dass ich es versuchen würde. Doch jetzt weiß ich, dass ich es kann.
Ich will dieses Lied nicht nur für Nan singen. Ich werde.
Teil 2
What care we though white the Minch is
What care we, boys, the wind and weather
When we know that, every inch is
Closer homeward to Mingulay
Heel ya ho, boys, let her go, boys
Heave her head round to the weather
Heel ya ho, boys, let her go, boys
Sailing homeward to Mingulay
Aus »Mingulay Boat Song«, Traditional Sea Shanty, by Sir Hugh S. Roberton
SAWYER
SECHS WOCHEN SPÄTER
»Zweimal das Craftbeer von eben und noch einen Steel Bonnet für mich.« Der Typ brüllt über den Tresen, als würde man im Pub sein eigenes Wort nicht verstehen. Dabei ist die Musik aus der Anlage recht leise, und die Gäste, die knapp die Hälfte der Tische besetzen, machen nicht gerade Radau. Nur Simon klappert in der Küche hinter der Bar beim Zubereiten der letzten Speisen für heute Abend mit seinen Töpfen und Pfannen und lässt in unregelmäßigen Abständen Fisch, Suppe und Lobscouse wissen, dass er nichts Gutes von ihnen hält. Irritierenderweise schmeckt trotzdem alles, was er durch die Durchreiche schickt. Speisen profitieren offenbar davon, beschimpft zu werden. Soll mir recht sein.
»Und einen Bonnet für dich, Landlord.«
»Danke schön. Aus Leeds?« Ich hab den drei Männern Mitte dreißig vorhin unfreiwillig zugehört. Bedauerlicherweise fühlt sich das Trio wichtig genug, um den halben Laden wissen zu lassen, wie erfolgreich ihr letzter Geschäftsabschluss war. Ich habe ihretwegen schon die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet, sodass das ganze Pub nur noch von den künstlichen Kerzen in den Vintage-Laternen an den Wänden sowie den echten auf den Tischen beleuchtet wird. Die meisten verstehen den Hinweis. Mein Trio aus Leeds hat allerdings keinen Sinn für Atmosphäre. Ich würde fünfzig Pfund darauf setzen, dass all ihre Erfolgsgeschichten erlogen sind. Nur Blender achten so penibel darauf, gehört zu werden. Vor allem natürlich von den anwesenden Frauen.
»Ja!«, ruft der Mann erfreut. »Wir haben Karten für das Spiel morgen. Trifft es dich hart, wenn ich dir verspreche, dass wir euren Reds eine Packung verpassen werden, nach der sie geschlossen in Therapie müssen?«
Ach herrje. Solche sind das. »Mitten ins Herz, Mann.«
Ich zapfe die bestellten Biere und kippe den Whisky in Gläser, wobei ich in meines nur einen kleinen Schluck gieße. Um ehrlich zu sein, habe ich absolut keine Lust, mit diesem Großmaul zu trinken. Aber die Woche lief mies. Der Februar war bislang total verregnet, und bei Dreckswetter kommen noch weniger Gäste als sonst bis zum Stoertebeker’s, das am südlichsten Zipfel der Docks liegt, wo die meisten kein Pub mehr erwarten, sondern schlicht und einfach nichts mehr. Man muss sich die Mühe machen, ein Stück zu laufen, und bei Dauerregen bleiben die meisten in den Läden, die sich zentral um die Marina sammeln. Ich kann es mir gerade nicht leisten, auch nur einen einzigen zahlenden Gast zu verprellen, also lasse ich mein Glas gegen seines klirren.
»Slainte.« Auf dein Großmaul, was soll’s. »Denk an mich, wenn der Plan nicht aufgeht.« Innerlich schwöre ich dem Wichtigtuer, dass die Reds die Peacocks nicht nur schlagen, sondern vom Platz fegen, bis die Federn fliegen.
Ich drehe eine Runde, um leere Flaschen und Gläser einzusammeln, und mache eine kurze Pause an dem Tisch, an dem sich Cedric und Billy mit einem befreundeten Pärchen niedergelassen haben.
»Setz dich doch kurz zu uns.« Billy rückt auf der Bank ein Stück näher an Cedric heran, sodass ich Platz finde. »Wir überlegen, in welchen Club wir später umziehen wollen, und gerade haben wir eine Pattsituation. Zwei sind für das Level, zwei für die Ink Bar.«
Ein Blick reicht, um zu ahnen, dass Billy und ihre Freundin Carlina ins Level wollen, während ihre Freunde die durchgeknallte Ink Bar bevorzugen, in der man sich vor Publikum einen neuen Haarschnitt oder auch mal ein Tattoo verpassen lassen kann. Ich habe mir schon mehrmals geschworen, dort keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren. Meine Entschlusskraft hielt immer mindestens so lange, bis meine Haare wieder nachgewachsen waren.
Ich schieb den Twilby zurecht, und Cedric muss lachen, weil er sich vermutlich erinnert, dass ich meine Vorliebe für Hüte nach einem solchen Kahlschlag entdeckt habe.
»Sorry«, sage ich in seine Richtung. »Aber ich bin für das Level. Mehr Auswahl bei der Musik.«
»Der Frauenversteher«, seufzt Steven, kassiert einen Knuff von seiner Liebsten und tröstet sich mit einem Schluck Bier. Er hat keine Ahnung, dass ich ihm vermutlich die bleiche Haut rette. Steven ist ein netter Typ, aber er und Cedric werden wohl niemals gute Kumpels. Daran ändert die Freundschaft zwischen ihren Freundinnen nichts. Wer weiß, was passiert, wenn die beiden gemeinsam in der Ink Bar landen. Cedric ist kein Arsch, aber manchmal dicht dran.
»Dann kommst du mit?«, fragt Billy und sieht mich aus braunen Augen erwartungsvoll an.
»Wenn ihr bis elf wartet, gern. Vorher kann ich nicht zumachen.« Zumindest nicht, wenn bis dann noch Gäste da sind; eine Vorstellung, die heute zumindest nicht absurd erscheint.
»Noch zwei Stunden in dieser Kaschemme?« Cedric mimt Entsetzen. »Was nehmen wir nicht alles in Kauf, um dich glücklich zu machen, Sawyer. Schlechtes Bier, lauwarmen Wein.« Er schnippt gegen sein Glas, in dem sich – wie eigentlich immer – nur Wasser befindet. »Selbst das Wasser schmeckt hier trocken.«
»Dir gebe ich noch mal was aus.«
»Tust du eh nie, du bist ein Geizknochen.«
»Nicht wahr! Dein Wasser geht immer aufs Haus. Ich nehme es meist sogar aus der Leitung und nur ganz selten aus dem Spülbecken.«
Wir können es selten lassen, einander aufzuziehen, was allerdings nichts daran ändert, dass der Mann mein bester Freund ist und ich ihm jederzeit einen meiner Hüte schenken würde, sollte es passieren, dass er sich nach zu viel Wasser mal den Kopf rasieren lässt. (Okay, das ist eher unwahrscheinlich.)
Carlina lehnt sich zufrieden zurück. »Dann also ins Level. Ich werde dir ewig dankbar sein, Sawyer. Und du weißt, warum.« Sie wirft einen unauffälligen Blick auf Stevens volles Haar, und ich muss lachen.
Diesmal kassiert sie einen Knuff von ihm. »Flirtet ihr über meinen Kopf hinweg? Du bist verheiratet, Darling.«
»Ach, Darling, ich vergaß.«
Lachend stehe ich auf. »Mit dem Landlord zu flirten, ist laut Gesetz auch verheirateten Ladys gestattet«, lasse ich meinen Freunden noch da, während ich mit meinem Tablett zurück an die Bar gehe.
»Ach ja?«, ruft Steven mir nach. »Was ist denn das für ein komisches Gesetz?«
»Meins«, erwidere ich grinsend. »Gilt hier drin für jeden.«
Und dann friert mir das Grinsen im Gesicht fest, denn eine der beiden jungen Frauen, die gerade reinkommen, kenne ich.
»Hi, Sawyer. Schön, dich mal wieder zu sehen.«
Chris sieht haargenau so aus wie vor gut drei Jahren, als sie mir und jedem anderen in diesem Pub den Kopf verdreht hat. Nur einem nicht: Cedric. Und natürlich wollte sie ihn. Wie es so läuft, sind sie am Ende dann doch zusammengekommen.
Ich muss mich zurückhalten, mich nicht zu ihm umzusehen, denn ich wüsste schon gern, wie er reagiert, wenn er sie erkennt. Er mag sie verlassen haben, aber ich glaube nicht, dass es daran lag, dass er keine Gefühle mehr für sie hatte. Er hatte zu der Zeit einfach überhaupt keine Gefühle.
Erst als Chris’ Lächeln noch ein wenig strahlender wird, erinnere ich mich, dass ich ihr antworten sollte. »Hey. Hi, Chris. Toll siehst du aus.« Das ist eine Untertreibung. An Chris ist alles perfekt. Sie ist schlank mit Kurven wie gemalt, hat seidiges blondes Haar mit einem Rotstich, der es rosa schimmern lässt, volle Lippen und dunkle Wimpern, die große, grüne Augen einrahmen.
»Was treibt dich her?« Nach so langer Zeit!
Sie kann das immer noch: ihre Wirkung intensivieren, indem sie vorspielt, sich ihrer gar nicht bewusst zu sein. »Ich bin jobbedingt wieder in Liverpool und dachte, ich schau mal rein. Das ist Leah.« Sie deutet auf ihre Begleiterin, die ihr Dekolleté tiefer und die Schminke intensiver trägt und neben Chris trotzdem blass wirkt. »Leah, Sawyer.«
»Freut mich, hi. Willkommen im Stoertebeker’s. Hierher kommen Piraten, Seeleute und die armen Schlucker, die sie im Jachtclub nicht reinlassen. Was macht ihr hier?«
Chris grinst, weil sie meine Standardbegrüßung bereits kennt. »Ich hab Leah ein paar Geschichten von früher erzählt, und sie war neugierig.«
Neugierig, ja? Auf was denn? »Geschichten. Cool.« Ob sie Cedric schon gesehen hat? Bislang scheint sie sich nicht einmal richtig umgeschaut zu haben. Ich bin nicht sicher, ob ich sie vorwarnen sollte. Einerseits ist es lange her. Andererseits könnte es ihr durchaus den Abend ruinieren, ihren Ex zu treffen. Aber ich bin nicht ihr Kindermädchen oder für ihr Seelenheil verantwortlich. »Was trinkt ihr?«
Dummerweise wünsche ich mir, dass es Chris gut geht.
Chris und Leah bestellen Weißwein und entscheiden sich für eines der kleinen Ruderboote, die im vorderen Bereich des Pubs als Sitzgelegenheit dienen. Von dort aus dürfte Chris Cedric kaum sehen können. Ich will trotzdem nicht, dass sie ins offene Messer rennt.
»Chris?«, rufe ich ihr nach, als sie mit Leah zum Boot gehen will.
Sie wendet sich zu mir um. »Sawyer?«
»Hast du gesehen, dass Cedric hier ist? Dort hinten am Tisch, mit seiner Freundin.«
Ein Hauch Irritation huscht über ihr Gesicht, und sie sieht sich um. Cedric sitzt mit dem Rücken zu uns, aber nun, da sie weiß, dass er es ist, erkennt sie ihn trotzdem. Sie mustert mich, als sie sich mir wieder zuwendet. »Dann ist zwischen euch wieder alles okay?«
Es wundert mich, dass sie überhaupt wusste, dass es eine ganze Weile nicht okay war. »Ja.«
»Das ist schön zu hören, Sawyer. Ich hab mir so viele Gedanken gemacht.«
»Es war nicht deine Schuld. Nichts davon.«
Ihr Blick wird weich. »Lieb, dass du das sagst, aber …«
»Ich meine es so. Es war niemand schuld.« Es kamen einfach verschiedene Dinge ungut zusammen. Die Tatsache, dass ich verliebt in Chris war – und sie nicht in mich, sondern in Cedric. Der nicht in der Lage war, ihr das zurückzugeben, was sie ihm gab. Was ich wiederum von ihm erwartet habe, weil ich nicht begriff, was ihn hinderte.
Und vermutlich wäre alles zwischen uns nach kürzester Zeit wieder in Ordnung gekommen, wenn nicht Luke seine furchtbare letzte Entscheidung getroffen hätte und …
Chris streicht sich in einer hilflosen Geste durch die Haare. »Ich bin nicht wegen Cedric hier, falls du das denkst. Aber ich sag ihm später mal Hallo.«
Ich hebe beide Hände und will irgendeinen lässigen Spruch bringen, aber mein Kopf gibt gerade nichts her. »Schön, dass du hier bist, Chris. Egal warum.«
Simon kommt aus der Küche und hält mich dankenswerterweise davon ab, ihr nachzustarren. Ich weiß nicht, was genau mich in ihrer Nähe damals dazu brachte, mich wie ein Teenager zu fühlen, aber sie hat immer noch diese Wirkung auf mich – und vermutlich auf jeden anderen auch. Als sie damals hier auftauchte, ging ich sogar mehrmals die Woche ins Fitnessstudio und zum Laufen, weil ich dachte, dass eine optimierte Version von mir bessere Chancen bei ihr hätte. Inzwischen ist mir schon klar, dass es nicht Cedrics definierte Bauchmuskeln waren, die Chris den Kopf verdreht hatten. Das Problem war wohl eher, dass er der Düstere, Geheimnisvolle war: schwer zu knacken. Und ich eben nur … der nette Typ an der Bar.
Ich gieße mir noch einen Steel Bonnet ein. Was soll’s.
»Die Typen vom Foodsharing waren noch nicht da«, sagt Simon. »Die Kiste für sie steht auf dem Tisch. Obendrauf sind wieder fertig portionierte Päckchen, die sollten sie heute Abend noch an die Obdachlosen verteilen, ist frisches Zeug drin.«
»Danke dir, ich sag’s ihnen. Schönen Feierabend.«
Simon zieht sich seine knallgelbe Regenjacke über. »Dir auch einen schönen Abend, bis morgen.«
»Morgen hab ich frei. Lizzy hat Dienst.«
Simon lacht dreckig. »Ja, ganz bestimmt. Bis morgen.«
Darauf antworte ich nichts. Lizzys Unzuverlässigkeit ist ein Problem, das lässt sich nicht abstreiten. Aber sie gibt sich Mühe.
Ich nehme eine Bestellung an, zapfe zwei Bier, nippe am Bonnet und werfe Chris einen Blick zu, den sie erwidert. Danach plaudere ich mit zwei älteren Frauen über den Klimawandel, spüle Gläser und erwische mich trotz aller Geschäftigkeit schon wieder dabei, zu Chris rüberzusehen.
Geschichten wie unsere passieren. Alles ist leicht mit dem Typen hinter der Bar: Das Ansprechen ergibt sich von allein, der Smalltalk ist unverbindlich, das Flirten so einfach mit jemandem wie mir, bei dem es zum Job gehört. Und alles Weitere … Nun es sind ein paar Schritte, fünfzehn Treppenstufen und wieder ein paar Schritte bis in mein Bett, und ich habe nicht das Geringste dagegen, nicht allein reinzufallen. Von Chris allerdings habe ich mehr gewollt als nur Spaß. Ich wollte alles von ihr. Den Spaß, den Kummer. Wollte mit ihr schlafen und neben ihr aufwachen. Ich wollte wissen, wer sie war. Was sie tat, wenn sie allein und ungeschminkt war, und woran sie dachte, wenn ihr Lächeln kurz gefror. Manchmal frage ich mich noch immer, was wohl passiert wäre, wenn ich ihr das direkt gesagt hätte, statt es bei vagen Andeutungen zu belassen.
Noch ein kurzer Blick zu ihr. Leah sitzt allein am Tisch und tippt auf ihrem Handy. Die Anlage spielt die Playlist, die Lizzy »Sound für nette Unterhaltungen« genannt hat. Ich nenne es seichtes Gedudel und stelle mal wieder fest, dass Seichte-Gedudel-Songs zum netten Unterhalten fast immer von gebrochenen Herzen, tragischen Beziehungsenden und unerfüllter Liebe erzählen.
Klar. Man fühlt sich gleich wohlig und gemütlich, wenn man nicht der einzige triefnass in Selbstmitleid getränkte Lappen ist.
Billy kommt zu mir an den Tresen und bestellt Getränke. Aus irgendeinem Grund beobachtet sie mich intensiv, während ich einschenke.
»Was denn?«, frage ich, als ich ihr zu den beiden Lager und dem Wein noch einen Cider rüberschiebe.
Ihre dunklen Augen leuchten. »Du hast sie also wirklich angerufen?«
Zuerst verstehe ich nicht mal, wovon sie redet. Wen soll ich angerufen haben? Ich wollte die letzten Wochen durchaus eine Frau anrufen: das Mädchen aus der Lime Street. Aber ohne Nummer oder auch nur einen Namen wird das schwierig. Und sie wollte mich offenbar nicht anrufen.
Doch dann erinnere ich mich. Im letzten Sommer haben Billy und ich über Chris gesprochen, und sie gab mir den Rat, sie anzurufen. Was ich auch getan habe. Wir haben allerdings nur ein paar Worte gewechselt. Doch woher kennt Billy Chris? Ein Blick zum Tisch, wo sie mit Cedric und ihren Freunden sitzt, gibt mir die Antwort: Chris ist zu ihnen rübergegangen. Sie steht neben dem Tisch und lehnt sich dicht neben Cedric zu ihm herab. Ich höre ihr Lachen bis hierher.
»Du hattest recht«, sagt Billy. »Sie ist bildschön.«
Es verwundert mich ein wenig, dass sie dabei lächelt. Die meisten Frauen wären weniger entspannt dabei, den Freund so nah mit der Ex zu sehen. Der bildschönen Ex. Und Billy geht noch Getränke holen und lässt die beiden allein?
»Bist du die am wenigsten eifersüchtige Frau der Welt?«, erkundige ich mich vorsichtig. »Oder …«
Billy lässt das Lächeln fallen und nickt hastig. »Oder«, sagt sie mit gesenkter, schneller Stimme. »Es ist in jedem Fall das Oder. Mach, dass sie da weggeht, Sawyer. Ich kippe ihr ihren Wein über den Kopf, wenn sie noch ein einziges Mal ›Weißt du noch …?‹ säuselt. Hat sie damals wirklich auf dem Tresen getanzt?«
»Hat sie.« Ich muss lachen. »Barfuß. Aber mach dir keine Sorgen. Cedric liebt dich.«
»Cedric hat vorgeschlagen, dass sie nachher mit uns ins Level kommt. Ihre Freundin hat nämlich Kopfschmerzen und will schon heim, sie aber nicht.«
»Oh. Echt jetzt?«
»Ja: Oh. Und ja: Echt jetzt.«


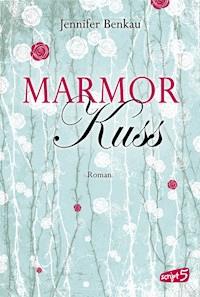















![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)









