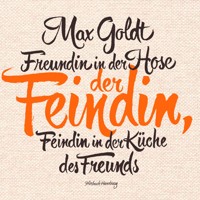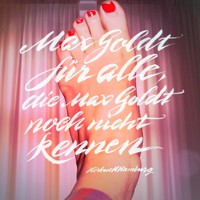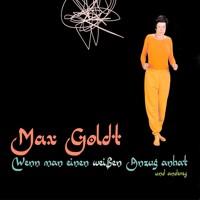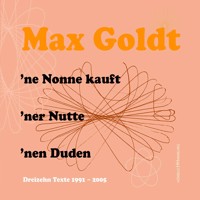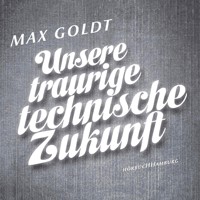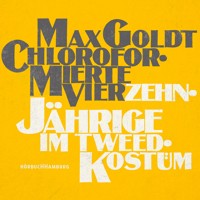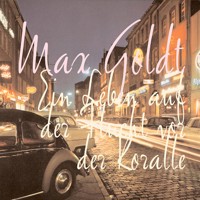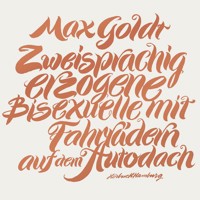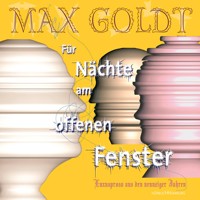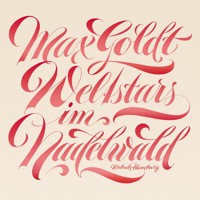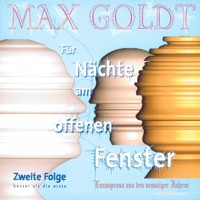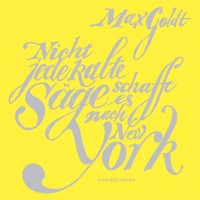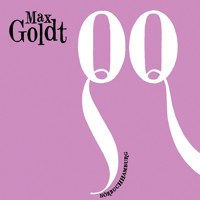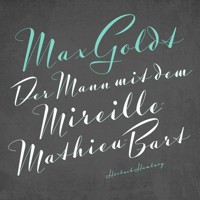19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Max Goldt ist der Inbegriff von Menschlichkeit.« Durs Grünbein »Der hat aber eine richtig schöne Schrift. Diese Unterschrift ist ja ein richtiges kleines Kunstwerk.« »Muß ja sein. Seine Texte sind ja auch richtige kleine Kunstwerke!« »Aber wie der den Stift hält! So krumm!« »Aber eine schöne Schreibmappe hat er! Sogar aus echtem Leder.« »Der Stift ist auch sehr schön! Der Mann ist eben ein richtiger Profi!« »Meine Mutter hatte auch mal so einen schönen Stift wie der, aber sie ist nach Thailand gefahren und hat den Stift dann nie wiedergefunden. Wahrscheinlich geklaut! Das Hotelpersonal wird ja so schlecht bezahlt!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Seine Werke sind das Witzigste, was die deutsche Literatur zu bieten hat… Wer seine perfekte Syntax liest, wird nicht durch Zufall oft an Thomas Mann erinnert – und tatsächlich ist das einer der wenigen Autoren, zu deren Einfluss sich Goldt bekennt. Bei beiden nämlich entsteht der Witz aus selbstbewusstem Manierismus, aus einer ironischen Überinstrumentierung des sprachlichen Materials; aber bei Goldt wird dieses Material konfrontiert mit etwas ganz anderem: dem Sprachmüll der Medien, allen Registern von Umgangssprache und Slang.« Daniel Kehlmann
»Max Goldt ist ein Monument der Menschlichkeit.« Durs Grünbein
Max Goldt
Aber?
»HOMO-EHE« UNDFRAUENFUSSBALL
Manchmal freue ich mich wie am Spieß, in einer Zeit leben zu dürfen, in der es niemandem aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit oder sexuellen Orientierung verwehrt ist, bestimmte Dinge zu tun. Daher lacht mir das Herz angesichts eines jeden Mannes, der sich seine Fingernägel lackiert, und ich hoffe, daß die Geschlechtergerechtigkeit eines Tages so weit gehen wird, daß man demnächst auch mehr Frauen auf Baustellen sieht, insbesondere auf Straßenbaustellen im Hochsommer – bin aber auf meiner phantastischen Reise in die Unwahrscheinlichkeit bereit, mich fürs erste mit lackierten Männerfingernägeln zu begnügen.
Immerhin genießt der Frauenfußball inzwischen eine allerdings bisweilen etwas gewollt, ja erzwungen wirkende Popularität.
Ich kombiniere das Thema Frauenfußball sehr gern mit dem Thema »Ehe für alle«. Anfangs sagte man noch »Homo-Ehe«; daß man mit diesem umgangssprachlichen Begriff nicht zufrieden war, kann ich ohne weiteres einsehen, aber »Ehe für alle« klingt wie eine Drohung. Ich wüßte nicht, warum »alle« heiraten sollten. Von der Institution der Ehe profitieren vornehmlich Scheidungsanwälte. Warum sind Verliebte und Familiengründungswillige so erpicht darauf, die Anwaltszunft zu alimentieren?
Die Frauen sind es, die heiraten wollen, und zwar wegen der Fotos und der Videos, und die Männer lassen sie gerührt gewähren, weil sie die Frauen lieben, zu Recht – Liebe hat immer Recht. Für viele Frauen jedoch ist die Hochzeit – das sag ich ohne Häme, sondern mit meinem bisweilen herben Realitätssinn – nicht selten die erste und manchmal auch schon letzte Gelegenheit zu einem Friseurbesuch in ihrem ganzen Leben. Das will ich niemandem madig machen. Ich mache auch ständig Fotos und Videos. Man will das flüchtige Dasein festhalten, und damit sich die Anschaffung der Kameras lohnt, baut man sich eben ein paar künstliche Höhepunkte ins Leben, bei denen man besser aussieht als beim Müllrunterbringen. Natürlich könnte man auch ohne Standesamt und ohne Geistlichen ein Schlößchen mieten, dort Hüpfspiele ausrichten und Videos noch und nöcher drehen und sich drei Jahre später ohne Anwalts- und Gerichtskosten einfach wieder trennen: Die Friseure sollen die Bräute mit turmhohen Frisuren verzieren, die Caterer Lachs auf salzige Plätzchen legen und mit der Quetschtube Sahne-Meerrettich auf die Lachsscheiben quetschen; wenn das zu einem videotauglichen Lebenshöhepunkt führt, will ich mich da nicht bewertend einmischen. Man kann auf den Sahne-Meerrettich noch ein paar schwarze Kügelchen aufbringen und alle glauben lassen, das wäre Kaviar. Dazu kann man gern zweihundert Leute in kurz zuvor gekaufter und daher noch nicht besonders gutsitzender Festbekleidung einladen, aber Staat und Kirche sollten doch bitte zu Hause bleiben.
Ich bin also gegen die Homo-Ehe, weil ich bereits die Originalversion, die Hetero-Ehe, für falsch und unterwürfig halte. Aus dem gleichen Grunde bin ich gegen Frauenfußball. Da ich allerdings als nachdenklicher und friedliebender Mensch die Neigung habe, überall nach dem Positiven Ausschau zu halten, sage ich über Fußball zunächst drei nette Dinge.
Erstens mag ich gern junge Leute, die gutgelaunt herumwetzen. Auf dem Platz der Republik vor dem Berliner Reichstag, damals noch »Reichstagswiese« genannt, trafen sich in den achtziger Jahren an Sonnabendnachmittagen oft Amateurmannschaften, z.B. spielte die Mannschaft eines Berliner Indie-Plattenladens gegen eine Mannschaft, die sich aus den Mitarbeitern eines Rockkonzertveranstaltungs-Büros zusammensetzte. Da konnte man sich im Schneidersitz auf die Wiese setzen und so ein bißchen halbironisch herumjohlen. Bin manchmal hingegangen, hat mir gefallen, hinterher ging’s noch ins Baumkuchen-Café am Holsteiner Ufer, oder man hob einen mit den fröhlich erschöpften Spielern.
Zum Zweiten mag ich den Klang großer Stadionspiele. Diese akustischen Begeisterungs-und Enttäuschungswellen, von zig Zehntausenden verursacht, sind tontechnisch bezaubernd, ähnlich den Krähenschwärmen an frühen Winterabenden oder den von Millionen und Abermillionen Individuen erzeugten Froschkonzerten, die man im Frühjahr allabendlich am Federsee in Baden-Württemberg erleben kann. Als Tontechniker würde ich meine kostspieligsten Stereomikrophone nicht für zu schade halten, Material für großartige Soundcollagen in Fußballstadien zu sammeln, nur bin ich mir ziemlich sicher, daß sich bereits Dutzende der erlesensten Klangfüchse mit diesem Thema auf höchstem Niveau beschäftigt haben. Vergleichbar sicher bin ich mir, daß ein guter Teil der Stadionbesucher nicht wegen des Sports das Stadion besucht, sondern um mitverursachender Bestandteil dieser popkulturellen Froschkonzerte zu sein.
Zum Dritten möchte ich berichten, wie ich in den neunziger Jahren die Nachmittage verbrachte, an denen Endspiele von Welt- oder Europameisterschaften ausgetragen wurden. Ich ging Klamotten, auch »Anziehsachen« genannt, einkaufen. Ich bin nie gern Anziehsachen einkaufen gegangen, dachte jedoch, wenn »Fußball ist«, dann sind die Kaufhäuser leerer als sonst. Waren sie auch. Doch waren sie durchaus nicht ganz leer. Ich durchstreifte die Kaufhäuser, wo ich ziemlich viele muskulöse junge Kerle mit den ihnen gebührenden heißen Tanten sah und alsbald wußte: Das sind Eishockey-Fans. In deren Augen ist Fußball ein lächerlicher Sport für »Weicheier«. Meine Wortwahl wäre das nicht, aber inhaltlich bin ich d’accord.
Fußball ist populär wegen seiner ungeheuren Verläßlichkeit und ähnelt darin den Shows unserer Schlager-Queens. Niemals würde Helene Fischer die Zuhörer mit unerwarteten Takten und gewagten harmonisch-melodischen Einfällen überraschen. Es herrscht unerbittlich überbetonter Viervierteltakt bei gleichmäßiger Lautstärke und konstantem Feuerwerk. Die gleiche garantierte Überraschungslosigkeit herrscht im Stadion – die Variationsbreite dessen, was dort geschehen könnte, ist extrem gering. Das letzte Mal, daß während eines Fußballspiels etwas wirklich Überraschendes geschehen ist, war 1985, als bei der Begegnung Turin – Liverpool das Brüsseler Heysel-Stadion zusammenstürzte.
Eine interessante, aber nur selten öffentlich gestellte Frage ist, warum kommerzieller Fußball von der Politik sämtlicher Richtungen als so ungemein befürwortens- und fördernswert angesehen wird. Der ursprüngliche Gedanke war ja wohl, Menschen, die Hannah Arendt noch angenehm unvorsichtig »den Pöbel« nannte, mit solchen Angeboten zu bändigen und die destruktiven gesellschaftlichen Kräfte in kontrollierbare Bahnen zu lenken. Daß dies indes überhaupt nicht gelingt, wird einfach ignoriert. Man denke an die Mundwinkel der Nachrichtensprecher. Zehn Minuten berichten sie mit teils schnurgeraden, teils entrüsteten Mundwinkeln von Missetaten und Unwettern, bis sich die Mundwinkel plötzlich nach oben biegen, weil von Fußball die Rede ist. Weil, in der Sprache des Establishments ausgedrückt, als deren Sprecher und Bestätiger sie dienen, Fußball etwas »einfach nur Wunderschönes« ist.
Als »wunderschön« gilt z.B. die Annahme, daß der Arbeiter und der Universitätsprofessor im Stadion nebeneinandersitzen und sich gemeinsam ihren sogenannten »emotionalen Momenten« hingeben. Tun sie das wirklich? Wenn ja, fühle ich mich an die Befürworter der Plattenbauten in der DDR erinnert, die stets verkündeten, Schweißer und Herzchirurg würden darin Wand an Wand in identischen Wohnungen neidlos und friedensreich nebeneinander hermurkeln.
Obendrein wird im allgemeinen berichtet, daß Fußball eine ungeheure integrative Kraft habe. Hier deutet sich eine weitere zu selten gestellte Frage an: In was genau wird man eigentlich als fußballspielender Malier, Bosnier oder Syrer integriert? Natürlich »nicht wirklich« in eine neugierige, geistig bewegliche, innovationsbegrüßende Gesellschaft, sondern in die konsumistische, kleinbürgerliche Normalität, auf deren Beifahrersitz winkend eine entsprechende heiratswillige sexy Ische sitzt, die da allerdings garantiert nicht mehr sitzen wird, wenn die Aufenthalte in Florida und auf der sogenannten Insel »Malle« weniger regelmäßig werden.
Einmal war ich in Leipzig und wollte mit der Bahn irgendwo hinfahren, der Hauptbahnhof war wegen eines Fußballschnickschnacks jedoch gesperrt. Die Reisewilligen wurden mit Bussen zu einem Bahnhof mit dem mir unvergeßlichen Namen Leipzig-Liebertwolkwitz gefahren, wo sie erst mal eine halbe Stunde in einem reiseunwilligen Regionalzug saßen. Dann kamen plötzlich etwa hundert extrem unintegriert wirkende einheimische junge Männer die Treppe zum Bahnsteig hinaufgestapft, sogenannte Ultras, worauf ein Bahnmitarbeiter die Insassen der dösenden Waggons aufgeregt aufforderte, den Zug zu verlassen. Er kam auch extra in die erste Klasse und rief: »Auch aus der ersten Klasse die Reisenden sofort raus. Die Herrschaften hier kennen keine erste Klasse.«
»Herrschaften« nannte der Bahnmitarbeiter Brutalos, die einen Zug kapern. Das ist ein schönes Beispiel für versteinerte Ironie.
Seit dem Ende des Feudalismus hat man, insbesondere polizeilich, gern Leute vom unteren Ende der sozialen Skala als »Herrschaften« bezeichnet. Noch im Jahr 2024 lautete eine an osteuropäische Obdachlose gerichtete Durchsage am Berliner Bahnhof Zoo: »Die Herrschaften da bitte mal nicht ihre Bierdosen auf den Briefkasten stellen. Da wollen Leute ihre Post einwerfen!«
Also alle raus in Leipzig-Liebertwolkwitz. Die »Herrschaften« rein. Da stand man wieder auf dem Bahnsteig als armer Untertan. Normalerweise hätte davon anderntags in der Zeitung berichtet werden müssen, aber Gewalt und untertäniges Kuschen in Zusammenhang mit Fußball werden grundsätzlich verharmlost. Es stand nichts in der Zeitung. »Ist halt Fußball«, wird gesagt, als ob das eine Jahreszeit wäre, deren Kapriolen man nichts entgegensetzen könne.
Gegen Frauenfußball würde ich sehr gern keinen Mucks sagen, schon weil er bislang keine Gewaltexzesse verursacht. Ich würde ihn sogar befürworten, wenn pro übertragenem Frauenspiel ein Männerspiel wegfiele. Und wenn es gar Ziel des Frauenfußballs wäre, den Männerfußball zu vernichten, würde ich einem Förderungsverein beitreten. Aber so ist es nicht. Es soll ja bloß immer mehr Fußball sein, immer mehr Bedröhnung, immer mehr Ablenkung und Gejohle, und wenn die jungen Männer, die normalerweise für die Bedröhnung zuständig sind, sich mal ausruhen, dann müssen eben U-18-Leute ran, Behinderte, Frauen, Senioren und am Ende gar LGBTQ-Menschen, und falls sich diese aus reinem Resttrotz zu schade fürs Fußballspielen sein sollten, wird eben Handball gespielt von Männern und Frauen und Kindern und Rentnern und allem anderen, was Hände und Füße und ähnliches hat. Aber wird es nicht irgendwann doch zu viel? Im Sommer 2024 folgten direkt auf die Fußball-Europameisterschaft die Olympischen Spiele in Paris, bei denen auch schon wieder Fußball gespielt wurde. Braucht man nicht irgendwann mal etwas anderes? Allem Anschein nach leider nicht. Schaut man sich bei Wikipedia in den Einträgen über Städte die Rubrik »Söhne und Töchter der Stadt« an, wird offenbar, daß seit etwa 1975 fast nur noch Fußballspieler und ähnliches geboren werden. Vorher überall bedeutende Astronomen, Rechtsgelehrte, Künstler und Entdecker chemischer Elemente, seit 1975 jedoch, egal in welcher Stadt, nur noch Fußballer, Snowboarder und Hawaii-Triathlon-Teilnehmer. Zwischendurch ist allenfalls mal ein Rapper und die eine oder andere Rapperin einem Muttermund entschlüpft. Wird man mit diesen Leuten die herausfordernde Zukunft meistern? Frag ich nur mal so und schlage vor, ab und zu auch mal wieder nützlichere Leute zu zeugen und zu gebären.
Interesse für Fußball gehört, ähnlich dem unentwegten Verzehr von Pizza, zum deutschen Konzept von Bodenständigkeit. Wer nicht bodenständig ist, gilt als abgehoben, und wer abgehoben ist, gehört nicht dazu. Gegner des kommerziellen Fußballs haben heute den Status, den noch vor wenigen Jahrzehnten Homosexuelle hatten, sind also prädestinierte Mobbing-Opfer. Wer nicht gemobbt werden will, lügt eben und behauptet, er würde sich für Fußball interessieren, sogar für Frauenfußball. Im Privaten meint zwar beinahe jeder, daß er sich für das Herumgebolze von Frauen nicht im Traum interessiert, in der Fernsehtalkshow jedoch sagt das niemand. Diese Gegensätzlichkeit von privaten und öffentlichen Äußerungen erinnert mich abermals heftig an die DDR.
Und erinnert sich noch jemand an den Mucks, den ich nicht äußern wollte? Ich sag den Mucks jetzt aber doch: Das Einzige, was ich am Fußball reizvoll zu finden mich durchringen könnte, ist die zuvor erwähnte an- und abschwellende Soundkulisse bei großen Spielen. Die kriegt man bei Frauenfußball freilich nicht geboten. Diese Spiele klingen, als ginge man an einem heißen Sommertag an einem Kinderfreibad vorbei. Und wie langsam all diese Polizistinnen, Zöllnerinnen und Parkraumbewirtschafterinnen sind! Mich persönlich stört das mangelnde Tempo nicht. Im wahren Leben muß man selten schnell rennen. Und wenn doch, im Bahnhof etwa, muß man sehr achtgeben, daß man andere nicht umrennt. »Ein Gentleman beeilt sich nicht«, lautet ein Satz, den ich seit meiner Kindheit kenne und als einleuchtend begreife; da ich in meiner Kindheit nicht von Menschen umgeben war, die sich mit Ladies und Gentlemen auskennen konnten, nehme ich an, daß ich dieses Lebensprinzip durch eine Fernsehserie kennengelernt habe, »Graf Yoster gibt sich die Ehre« vielleicht. Am besten also, man bewegt sich zivilisiert und gemächlich. So wie die Fußballerinnen in den trotz aller von ARD und ZDF betriebenen Propaganda nach wie vor glücklicherweise nur mäßig besuchten Stadien oder wie die beiden Parkraumbewirtschafterinnen, die fast täglich durch meine Wohnstraße schlendern. Da ich kein Auto habe, grüße ich sie immer höflich, und sie grüßen zurück, ebenso höflich, aber auch verwundert, weil sie sich fragen, warum ich sie bloß immer so höflich grüße.
Etwas ermüdet fasse ich zusammen: Die Homo-Ehe ist genauso nutzlos wie die Hetero-Ehe, und Frauenfußball so kläglich und trist wie Männerfußball, aber noch ein kleines bißchen langweiliger.
ABER?
Ein Stück, das Fragen der gesellschaftlichen Ungleichheit berührt, also das, was man neuerdings»Klassismus«nennt.
Eine Compagnie historisch kostümierter Stelzenläufer bewegt sich mit beeindruckender Geländegängigkeit an einem Straßencafé vorbei.
Auf der Schankterrasse sitzen zwei Männer an runden Tischchen. Sie kennen einander nicht. Der eine ist ein ungezwungenes älteres Kerlchen der Sorte, vor der sich in acht nehmen sollte, wer nicht zugetextet werden möchte, der andere ein auf Distanz bedachter Neo-Bourgeois, gut gekleidet, zumindest so gut, wie es im deutschen Straßenleben gerade noch ertragen wird. Beide betrachten die Stelzenläufer lächelnd.
Der Bourgeois denkt: Herrlich! So was Phantasievolles! So was Berührendes! Die poetische Kraft des Alltäglichen … oder vielleicht eher: des Nicht-Alltäglichen. Was macht eigentlich André Heller?
Die Stelzenläufer sind weitergezogen. Man sieht nun, daß sich gegenüber des Cafés ein Friseursalon befindet, vor dem zwei Friseurinnen stehen und frisösenhaft rauchen.
Der Bürgerliche sieht der Stelzenläufercompagnie hinterher und sinniert: Sogar der Bahnhof von Mannheim hat neulich seinen 140. Geburtstag mit historisch kostümierten Stelzenläufern gefeiert, die allerdings Zuckerwatte an die Reisenden verteilten, was ich einen Zacken zu unhistorisch fand – und auch unpraktisch: In überfüllten Nahverkehrszügen steht sich’s nicht gut mit Zuckerwattespießen. Muß man leider sagen, bei aller Freude an der Watte – und der Poesie!
Das Kerlchen wanzt sich an den Sitznachbarn ran: Gucken Sie mal: Frisösen!
Der Bourgeois(unwirsch, weil abrupt aus seinem Gedankenfluß herausgerissen): Was denn? Wer denn? Wo? Wo ist was? Was ist denn irgendwo? Was genau meinen Sie?
Das Kerlchen(mit nacktem Finger auf angezogene Leute deutend): Na, da drüben! Frisösen!
Der Bourgeois(stolz darauf, genauestens informiert zu sein über die Gepflogenheiten des 21. Jahrhunderts): Werter Zeitgenosse! Nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, daß wir im 21. Jahrhundert leben, einer Zeit, in der man Mitarbeiterinnen von Haarpflegestudios Friseurinnen nennt und nicht Frisösen.
Das Kerlchen(arglos die Arroganz seines Gesprächspartners ignorierend)