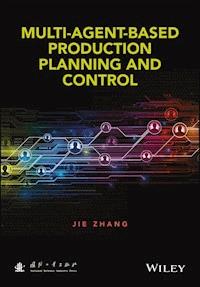8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit unerbittlicher Ehrlichkeit erzählt Zhang Jie über ihre Unfähigkeit, von der Mutter Abschied zu nehmen. Durch Krieg, Hunger und die Wirren der Revolution stützten die beiden sich gegenseitig in den Härten eines Alltags ohne Vater und Ehemann. Dann wird die Mutter gebrechlich und krank. Bald weicht die Sorge ohnmächtiger Wut und Überforderung, Mitgefühl und Selbstvorwürfen. Reue über so viele unausgesprochene Gedanken und in der Hast des Alltags verpasste Gesten der Zuneigung bleiben zurück. Verlorene Augenblicke können nicht nachgeholt werden und breiten sich in der Erinnerung aus. Erst der Tod durchtrennt die Nabelschnur, die Mutter und Tochter ein Leben lang verband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Mit unerbittlicher Ehrlichkeit erzählt Zhang Jie über ihre Unfähigkeit, von der Mutter Abschied zu nehmen. »Dieses Buch ist ein Tatsachenroman, der die letzten Monate unseres gemeinsamen Lebens erzählt. Aus engster Nähe schildert es unsere Kämpfe gegen den Tod. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen Mutter und Tochter.«
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Zhang Jie (*1937) studierte Volkswirtschaft in Peking und arbeitete zwanzig Jahre in einem Industrieministerium. Nach der Kulturrevolution veröffentlichte sie ihre ersten Erzählungen. Sie schreibt über die Umwälzungen der Modernisierung und über das Schicksal der Frauen.
Zur Webseite von Zhang Jie.
Eva Müller (*1933) arbeitete als Professorin für Sinologie und Literatur Chinas. Sie ist Mitherausgeberin des Lexikon der chinesischen Literatur.
Zur Webseite von Eva Müller.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Zhang Jie
Abschied von der Mutter
Roman
Aus dem Chinesischen von Eva Müller
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel Shijieshang zui teng wo de nageren qule bei Cosmos Books, Hongkong.
Originaltitel: Shijieshang zui teng wo de nageren qule (1994)
© by Zhang Jie 1994
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30813-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 21:37h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ABSCHIED VON DER MUTTER
Ende Juli 1991 wurde Mutter auf einmal richtig …BilderAbbildungsverzeichnis
Mehr über dieses Buch
Über Zhang Jie
Über Eva Müller
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema China
Zum Thema Frau
Zum Thema Asien
Ende Juli 1991 wurde Mutter auf einmal richtig alt, auch ihr Körper verfiel zusehends. Für mich kam es wie ein Blitz aus heiterem Himmel, gestern noch schien sie gesund, und nun war sie mit einem Mal dem Tod nahe. Sie selbst aber hatte es wohl schon länger geahnt.
Nach ihrem Tod erzählte mir Tang Dis ehemalige Schulfreundin Shi Xiaomei, ihr sei bereits bei ihrem letzten Besuch im Juni aufgefallen, wie sehr Mutter gealtert war. Diese hatte ihr Notizbuch geholt, um sich Xiaomeis Telefonnummer aufzuschreiben, dann jedoch unsicher gefragt: »Was wollte ich denn eigentlich damit?«
»Wollten Sie sich nicht meine Nummer aufschreiben?«
Und da habe Mutter voller Wehmut gesagt: »Ich werde Tang Di gewiss nicht wieder sehen!«
Xiaomei hatte derlei Äußerungen schon öfters von meiner Mutter zu hören bekommen, sie aber bisher nie ernst genommen, weil alte Menschen eben so daherredeten. Diesmal aber spürte sie, dass Mutter Tang Di wohl wirklich nie mehr sehen würde.
Nachdem Mutter im Jahre 1987 von einer Hepatitis genesen war, ließ ich sie jedes halbe Jahr untersuchen und Leber, Milz, Darm sowie die Gebärmutter einer Ultraschallkontrolle unterziehen. Jedes Mal hatte der Arzt sie für vollkommen gesund erklärt und versichert, sie werde garantiert noch ihren hundertsten Geburtstag feiern. Auch wenn ich mich nicht gerade in so überspannte Erwartungen verstiegen hatte, machte ich mir doch immerhin vor, dass sie ein Alter von neunzig oder fünfundneunzig Jahren erreichen könne.
Mein blinder Optimismus lässt sich wohl auch mit Mamas großer Selbstständigkeit erklären. Sie war kaum auf meine Fürsorge angewiesen und schaffte alles ganz allein. Im Herbst des Jahres 1987, kurz bevor sie wegen der Hepatitis ins Krankenhaus musste, war sie noch allein zu Fuß den weiten Weg zur HNO-Klinik in Weigongcun gelaufen, um ihre Zähne behandeln zu lassen. Und nur wenige Monate vor ihrem Tod hatte sie mir noch chinesische Kräutermedizin gekocht.
Sogar unserer Bekannten Hu Rong, einer bekannten Herausgeberin, war aufgefallen, wie sehr meine Mutter gealtert war, nachdem Tang Di 1984 ins Ausland gegangen war. Und nach ihrer Gelbsucht hatte sich dieser Prozess eher noch beschleunigt. Ich hingegen war mir ihrer zunehmenden Altersschwäche nie bewusst geworden und muss mir nun die Frage stellen, ob nicht Außenstehende Mamas Befinden mehr Aufmerksamkeit gewidmet haben, als ich selbst.
Die gut gemeinte Prophezeiung des Arztes hatte mich beflügelt und, da sie meinen geheimen Hoffnungen so sehr entgegenkam, meine Wachsamkeit geradezu paralysiert. Fest in mein Gehirn geprägt, beherrschte seine günstige Prognose mein ganzes Denken und ließ mich völlig übersehen, dass Mutter letztendlich eine achtzigjährige Greisin war. Ich wurde fahrlässig, und möglicherweise liegt hierin eine der Ursachen, weshalb sie für mich so überraschend vom Tod ereilt wurde. Darüber hinaus habe ich in unerklärlicher Dummheit den Befund der halbjährigen Ultraschalluntersuchung als aussagekräftig für ihre gesamte körperliche Verfassung angesehen und sie für völlig gesund gehalten, nachdem der untersuchende Arzt keinerlei Beschwerden festgestellt hatte. Heute erst ist mir klar, dass so ein Bauchhöhlencheck ja gar nichts über den Zustand des Herzens, der Lunge und des Gehirns aussagt.
Als Mama allmählich alt wurde, kümmerte ich mich nicht etwa ständig persönlich um ihr Wohl, sondern überließ sie der Obhut unseres jungen Hausmädchens, derweil ich selbst in der ganzen Welt umherreiste oder irgendwelchen gesellschaftlichen Pflichten hinterherjagte. Die Schriftstellerei füllte meine Zeit vollkommen aus, und außerdem musste ich noch meinem Gatten Gesellschaft leisten. Dabei verließ ich mich ganz darauf, dass Mama bei der Haushaltshilfe gut aufgehoben sei.
Was hilft es da, dass ich heute immer etwas von der Asche meiner Mutter mit mir führe, egal, wohin ich auch gehe? Damals, als sie mich dringend gebraucht hätte, habe ich sie mir vom Leib gehalten.
Im Juli 1991, als ich zu Recherchen in den Ölbetrieb Nr.7 nach Daqing bei Harbin fuhr, vermisste sie mich mehr als bei irgendeiner meiner früheren Reisen. Wie unser Hausmädchen mir später erzählte, hatte Mutter damals ununterbrochen wiederholt: »Zhang Jie kommt ja bald zurück, Zhang Jie wird bald wieder da sein«, als wolle sie sich angesichts meiner fehlenden Fürsorge selbst Mut zusprechen. Rief ich jedoch aus Harbin an und befragte sie ausführlich nach ihrem Befinden, dann versicherte sie mir immer wieder: »Ist nichts, mir gehts gut, alles in Ordnung.«
Einmal drängte sie: »Wäre doch Zhang Jie nur da, ach ja, dann wäre alles gut«, und dabei stotterte sie besonders schlimm. Ich aber war bei Harbin in eben jenem siebten Ölbetrieb.
Niemals hatte sie mir vorgeworfen, dass ich sie im hohen Alter von achtzig Jahren ständig achtlos an das Hausmädchen abschob. Es musste ihr schon richtig schlecht gehen, wenn sie sich schließlich doch nicht zurückhalten konnte und dem Mädchen gegenüber ständig nach mir verlangte. Sie spürte wohl instinktiv, dass der kritische Augenblick nahte.
Ich war nur zehn Tage in Harbin geblieben. Wieder zu Hause, fiel mir sofort auf, wie tatterig und schief Mutter in dieser kurzen Zeit geworden war. Ihr Gang war schwerfällig, jeder Schritt bereitete ihr Mühe, die Fußsohlen schlurften geräuschvoll über den Boden. Sie vergaß auch ständig, ihre Hosenbänder zu schließen, die immer sichtbar über dem Saum ihres Unterhemdes schlenkerten.
Das war gar nicht mehr meine allzeit so akkurate Mutter.
»Wie lauft Ihr denn, Ma? Geht doch anständig«, mahnte ich. Spürte ich vielleicht undeutlich tief in meinem Herzen – ungeachtet meiner subjektiven Wunschvorstellung, sie könne fünfundneunzig Jahre alt werden –, dass es mit Mutter zu Ende ging? Sie aber bemäntelte und leugnete. Entweder passten ihr die Schuhe nicht richtig, oder sie erklärte, sie wäre gerade aufgestanden und ihre Beine seien noch nicht recht in Gang gekommen.
Sie wusste schon längst Bescheid, sonst hätte sie nicht ständig irgendwelche Gründe gesucht, um uns beide zu beruhigen und irrezuführen. Gewiss war ihr damals schon klar, dass ihr in Wirklichkeit nicht mehr zu helfen war. Aber sie wollte mir nicht die Wahrheit sagen, weil sie fürchtete, ich könnte ihr nicht gewachsen sein. Wir beide hatten ja bis heute nur überleben können, weil wir ein Leben lang einander geholfen hatten, und nun sollte nur ich allein von dieser Zweiermannschaft übrig bleiben. Ihr Leugnen, ihr Vertuschen und Erklären bargen daher auch immer ein geheimes Schuldbewusstsein. Als bedeute es einen Verrat an mir, wenn sie mir kein Halt mehr sein konnte und mich dann noch einsam zurückließ.
Ihre Augen waren immer von Alterstränen getrübt.
Viele Jahre hindurch hatten wir dem Augenarzt vertraut, dass Mutters Sehkraft durch den grauen Star geschwächt sei und dieser definitiv erst dann operiert werden könne, wenn die Trübung das ganze Auge erfasst habe. Wir verstanden das nicht und hakten auch nicht nach, warum nach zehn Jahren Mutters Sehkraft fast völlig geschwunden war, ohne dass dieser Fall eingetreten wäre.
Hu Rong besuchte Mutter zweimal, als ich gerade nicht zu Hause war. Diese öffnete ihr die Tür, konnte jedoch nicht deutlich sehen, wer vor ihr stand, und fragte: »Zu wem möchten Sie denn?«
Hu Rong erwiderte: »Aber Großmutter, erkennt Ihr mich denn nicht?«
»Meine Güte, jetzt erst höre ich an der Stimme, dass du es bist.«
1991 legte sich der Schatten noch schwerer über uns. Mutter erklärte immer öfter, dass sie mich doppelt sähe. Und wenn sie nachts aufwachte, wäre da zuweilen jemand im Zimmer, manchmal sogar herumtollende Kinder. »Anfangs machte mir das große Angst, doch jetzt habe ich mich daran gewöhnt.«
Auch ohne Medizin studiert zu haben, weiß ich heute, dass man in Erwägung ziehen muss, ob nicht ein Tumor auf den Sehnerv drückt, wenn die Sehkraft eines Menschen nachlässt und keine andere Augenkrankheit diagnostiziert wird. Es wäre wohl ungerecht, diese Ärzte als Quacksalber zu bezeichnen. Mir bleibt nur festzustellen, dass sie nicht daran gedacht hatten. Denn wenn nur einer von ihnen der Sache richtig nachgegangen wäre, hätte er wohl in Betracht ziehen müssen, dass bei einem fast erblindeten Patienten, bei dem der graue Star noch nicht völlig ausgereift ist, möglicherweise pathologische Veränderungen im Hirnbereich vorliegen könnten, etwa ein Druck auf den Sehnerv. Wäre sie rechtzeitig operiert worden, in einem Alter, als das noch möglich war, dann wäre meine Mutter heute noch bei mir.
Ihre linke Schulter hing immer schiefer herab.
Das fing etwa 1989 an. Als ich am 13. Mai 1989 nach Italien reiste, hatte ich noch nichts davon bemerkt. Ich ging dann von Italien aus in die USA, und als ich sie im Februar 1990 nachkommen ließ, fiel mir plötzlich auf, wie schief ihre linke Schulter herabhing. Wenn auch noch nicht so gravierend wie später im Sommer 1991.
»Mama, wieso lasst Ihr die Schulter so hängen?«
»Das kommt, weil ich mich dauernd mit der rechten Hand auf den Stock stütze, da sinkt die linke Schulter ab«, rechtfertigte sie sich. Doch Mutters Krückstock erfüllte eher eine psychologisch stützende oder schützende Funktion, sie nutzte ihn kaum zum Gehen. Es konnte also keine Rede davon sein, dass die linke Schulter deshalb schief hing, weil sie sich rechts auf den Gehstock stützte, sie wollte bloß nicht zugeben, dass diese Schulter ein Anzeichen des Alters war. Hinter ihren Rechtfertigungen steckte wohl der Versuch, ihre Gebrechlichkeit und Hilflosigkeit zu tabuisieren. Und ein noch triftigerer Grund lag für sie in der Gewissheit, dass ich ihr Älterwerden nicht akzeptieren wollte.
In meinen Wunschvorstellungen war sie immer noch jene kämpferische Mutter, die mich, als es uns schlecht ging und wir kaum das Notwendigste zum Leben hatten, unter verzweifelten Anstrengungen großgezogen hatte. Und solange es sie gab, würde ich mich niemals ohne Zuflucht und Rückhalt fühlen. Wenn ich heute auch einen ziemlich selbstständigen und unabhängigen Eindruck mache, Mutter allein kannte mich gut genug, um zu wissen, dass das alles nur Schein war.
Auch ihren eigenen Wunschträumen zufolge durfte sie auf keinen Fall alt werden und schon gar nicht sterben. Denn wer sollte mich dann umsorgen, lieb haben, trösten und mir zuhören?
Ich habe noch immer vor Augen, wie Mutter einen Tag, bevor wir sie ins Krankenhaus brachten, auf ihren Leibesübungen beharrte: Wie eh und je balancierte sie in der rechten Hand ihren Stock waagerecht in der Luft und behauptete dabei ständig: »Ich brauche den gar nicht zum Gehen, ich mache mir damit nur Mut.« Was ihr das Schicksal auch bringen mochte, sie würde unter Aufbietung aller Kräfte ihres achtzigjährigen alten Leibes danach trachten, den Zeitpunkt hinauszuschieben, da sie von anderen Menschen oder Gegenständen abhängig sein würde.
Die Haarklemmen steckten unordentlich in ihrem Haar, aus dem dünne weiße Strähnen nach allen Richtungen hervorstachelten. Mutter legte sehr viel Wert auf ihr Äußeres, unter allen Umständen und in jeder Situation achtete sie darauf, sich selbst und auch mich sauber und ordentlich zu halten. Aber für jeden Menschen kommt wohl früher oder später der Augenblick, wo die Kräfte dem Willen nicht mehr gehorchen. Angestrengt ruderte sie mit den Armen, schwang sie hastig, noch wie abgestimmt auf schnelle, behände Beine, doch diesen Beinen fiel in Wahrheit schon jeder Schritt recht schwer. Die Arme schwenkend kämpfte sie sich vorwärts, dabei spiegelte ihre Miene zugleich völliges Unverständnis über die Tatsache, dass ihre Lebenskraft mit einem Schlag spurlos geschwunden sein sollte. Aber auch der Wille zeigte sich auf ihrem Gesicht, sich keinesfalls unterkriegen zu lassen, doch die Leere nach totaler geistiger und körperlicher Erschöpfung in diesem aussichtslosen Ringen war nicht zu leugnen.
Ihre Esslust nahm sichtbar ab, sie vermochte keiner Speise mehr Geschmack abzugewinnen.
Früher hatte sie immer guten Appetit gezeigt und konnte größere Mengen verspeisen, als ich selbst. Besonders beunruhigend war, dass sie bloß Reis aß, wenn ich ihr nicht noch etwas anderes dazugab. Und auch dann nahm sie nur, was ich ihr auf den Reis legte. Sie ließ sich auch nicht von mir füttern, sodass ich schließlich dazu übergehen musste, Reis, Gemüse und Fleisch in ihrer Essschale miteinander zu verrühren. Während der Mahlzeiten starrte sie ausdruckslos vor sich hin und stopfte das Essen mechanisch in sich hinein, ohne seinen Geschmack wahrzunehmen. Dabei zitterten die Hände, in denen sie Reisschale und Essstäbchen hielt, so stark, dass kaum etwas in den Mund gelangte. Sogar ihre Art, die Reisschale zu halten, hatte sich verändert, sie hielt sie nicht mehr waagerecht in der Hand, sondern schlug den Zeigefinger der linken Hand um den Rand und klemmte die Schale zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Ich korrigierte diese Haltung immer wieder, aber vergeblich, beim nächsten Mal machte sie es wieder so.
Es schien, als fände nichts mehr Zugang zu ihrem Gehirn.
Bei weit geöffneter Tür döste sie den ganzen Tag lang auf dem Sofa vor sich hin. Bis heute erscheint das Bild meiner lethargisch dasitzenden Mutter immer wieder deutlich vor meinen Augen. Ich erinnere mich besonders an einen bestimmten Tag, als ich in ihr Zimmer kam und sie wie betäubt schlafen sah. Als ich hin und her ging und dies und jenes erledigte, fühlte sie sich überhaupt nicht gestört. Ihr immer dünner werdendes Haar (es war seit jeher spärlich, aber kahl war sie nicht) lag über der Sofalehne. Es war ein ziemlich unmodernes Sofa, wir hatten es gekauft, als es mit uns gerade finanziell aufwärts zu gehen begann. Das Sofa hatte eine recht hohe Lehne, die ihren Hals so verbog, dass das Kinn in die Halsgrube gepresst wurde. Sie zog geräuschvoll die Luft ein, denn weil ihr Mund vom heruntergedrückten Kinn schiefgezogen wurde, konnte sie nicht frei atmen. Ihr ganzer Körper hing fast leblos auf dem Sofa, als wäre er gar kein lebendig Fleisch und Blut mehr.
Es kümmerte sie auch nicht mehr, ob die Türen verschlossen waren und etwas gestohlen werden konnte. Früher rief sie sofort »Wer ist da?«, wenn irgendjemand – und mochte es auch ich sein – hereingekommen war, ganz als ob sie auf den Angriff eines gefährlichen Feindes vorbereitet sei.
Noch als sie zu mir in die USA gekommen war und wir im absolut sicheren Wohnhaus für die Mitarbeiter im Campus jener Universität wohnten, an der ich lehrte, war sie immer besorgt, wenn einer der anderen Bewohner beim Verlassen oder Betreten des Hauses vergaß, die Tür abzuschließen. Wiederholt ermahnte sie mich zu mehr Wachsamkeit. Ich versprach es ihr aufs Geratewohl, bemühte mich aber in Wahrheit nie wirklich, und da sie keine Veränderung sah, wurde ich von ihr immer wieder »erinnert«. Das brachte mich auf, und ich fragte dann stets: »Wozu abschließen, wer sollte uns beide hier schon bestehlen oder ausrauben? Haben wir etwa Geld? Nein, und die Möbel aus diesem Appartement interessieren auch niemanden, auch unsere Kleider passen keinem. Darüber hinaus sind auch wir beide nicht nach dem Geschmack gewisser Schurken, also beruhigt euch!«
Sie war ihr ganzes Leben lang auf sich selbst gestellt gewesen, nie hatte ihr jemand Schutz geboten. Sie hingegen musste mich noch beschützen und war daher von dem Komplex besessen, Türen und Fenster immer streng verschlossen halten zu müssen, ein Komplex, von dem sie nur schwer loskam. Zu ihren Lebzeiten hatte ich mich jedoch nicht bemüht, sie zu verstehen, sondern hielt ihre übertriebene Vorsicht für total überflüssig.
Sogar das Fernsehen, das sie zu ihrer Unterhaltung nie hatte missen wollen, verlor für sie allen Reiz, obwohl der Fernseher ständig lief, wie wenn sie wach gewesen wäre. Auch verfolgte sie nicht mehr insgeheim die Wettervorhersage, wie sie es immer getan hatte, weil unser Dienstmädchen und ich täglich zwischen meiner und der Wohnung meines Mannes hin und her flitzen mussten. Denn jeden Abend ging ich zu meinem Gatten hinüber, bereitete sein Abendessen zu und gab mich meinen übrigen ehelichen Pflichten hin. Morgens dann lief ich zu meiner Mutter hinüber, leistete ihr Gesellschaft, pflegte sie, machte ihr das Mittagessen und verdiente außerdem mit meiner Schriftstellerei am Computer das Geld für unseren Unterhalt. Daher wünschte sich Mutter immer gutes Wetter, damit ich, wenn ich so hin und her sprang, nicht Wind, Regen und Sonne ausgesetzt war. Und sie ermahnte mich immer rechtzeitig, mich entsprechend anzuziehen. Nach ihrem Tod hat nie wieder jemand für mich den Wetterbericht verfolgt und mir zu einer zweckmäßigen Kleidung oder einem Schirm geraten.
Eigentlich ist es falsch, wenn ich behaupte, ich hätte Mutter Gesellschaft geleistet. War ich verschwitzt zur Tür hereingestürzt, dann begrüßte ich sie nur kurz und aß mit ihr gemeinsam Frühstück, danach widmete ich mich ganz meinem Computer. Was hätte ich auch anderes tun können, das Schreiben war meine Leidenschaft und zugleich das Mittel, uns zu erhalten.
Ich weiß nicht warum, aber unser Unterhalt bedeutete für mich immer eine schwere Last, wir waren ständig knapp bei Kasse. Nur selten konnten wir uns irgendwelche Leckerbissen leisten oder seidene Kleidung, ganz zu schweigen von Rotholzmöbeln oder Teppichen aus reiner Wolle. Bei allen Gebrauchsgegenständen machten wir Jagd auf »für den Binnenmarkt freigegebene Exportartikel«, bemühten uns also, möglichst preiswert erlesene Qualität zu ergattern. Mutter hatte nie materielle Ansprüche gestellt, sondern mich im Gegenteil bis zum Tage ihres Todes nach besten Kräften finanziell unterstützt. Sie gab ihre ganze Rente für uns aus. Diese betrug zuletzt so um 150, 160 Yuan. Vor mehr als zehn Jahren, als sie noch nicht so viel Rente erhielt und ich auch nur ein Monatsgehalt von 56 Yuan nach Hause brachte, hatte sie noch mit siebzig unter glutheißer Sonne einen kleinen Karren durch die Straßen geschoben und Eis am Stiel verkauft. Und im Winter hatte sie als Verkäuferin in einem Gemischtwarenladen versucht, ein wenig Geld für die Aufbesserung unseres Familienbudgets zu verdienen, da ich nicht genug für uns heimbringen konnte. Damals nahm man beim Verkaufen von Eis noch nicht so viel Geld ein wie heutzutage, nur etwas mehr als zwanzig Yuan. Diesen zusätzlichen Verdienst bezeichnete man als Auffüllbetrag. Doch die Einkünfte aus Eis- oder sonstigem Verkauf durften zusammen mit der Rente nicht höher sein als der Lohn zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Arbeitsleben. Für uns aber bedeuteten diese zwanzig Yuan schon ein beträchtliches Einkommen.
Erst als ich dann Honorare nach Hause brachte, brauchte Mutter nicht mehr nebenher zu arbeiten. Ich erinnere mich, wie ihr Mund einfiel und sie weinte, als ich mein erstes Honorar in Höhe von 178 Yuan in ihre Hände legte und zu ihr sagte: »Mama, jetzt haben wir Geld, nun müsst Ihr nicht mehr hinaus und Eis am Stiel verkaufen.«
Auch heute noch tauchen ihre dicken, schweren und ungestümen Tränen immer wieder vor meinen Augen auf. Sie saß damals auf dem Bett unseres kleinen Nordzimmers in der alten Wohnung, das Bett stand längs an der Wand, und sie lehnte am Kopfende, mit dem Blick nach Westen …
Ihr Frühstück war recht einfach, bestand lediglich aus einem Glas Milch und einem Ei. Wie lange kann man an einem Glas Milch nippen? Nur für diese kurze Zeitspanne war uns das morgendliche Beisammensein vergönnt, nach dem sich Mutter die ganze Nacht lang sehnte. Mit den Mahlzeiten für Mutter machte ich mir nicht solche Umstände wie mit denen für meinen Gatten, ich begnügte mich im Allgemeinen damit, ihr den Bauch zu füllen. Denn mein Mann war ja, verglichen mit meiner Mutter, in unserer Familie ein Außenstehender, deshalb musste ich mir mehr Mühe geben. Das war auch eine der Lehren aus der Familienerziehung meiner Mutter gewesen, dass Außenstehende nicht in Mitleidenschaft gezogen werden durften, wie schwierig die Lage der eigenen Familie auch sein mochte. Ganz im Gegensatz zur Maxime des Cao Cao, jenes Machthabers aus dem alten China, nämlich eher andere Menschen zu vernachlässigen, als ihnen zu gestatten, Gleiches mit ihm zu anzustellen. Und Mama war schließlich meine leibliche Mutter, sie würde mir unter keinen Umständen Vorwürfe machen oder gar Streit anfangen. Damit nicht genug, sie half mir auch noch, jeden Kupferling einzusparen.
Eine Zeit lang erkrankte Mama immer wieder an Infektionen der Harnröhre. Ich wunderte mich sehr darüber, denn ich konnte bei uns eigentlich keinen Grund dafür finden. Später jedoch entdeckte ich, dass sie niemals Toilettenpapier benutzte, sondern stattdessen einen Waschlappen nahm.
»Wieso nimmst du nicht Toilettenpapier, das Ding da ist ja so dreckig, da können sich die Bakterien richtig vermehren, kein Wunder, dass du dauernd einen Harnweginfekt bekommst«, warf ich ihr vor.
Sie erwiderte: »Der ist überhaupt nicht schmutzig, ich koche ihn alle paar Tage aus, desinfiziere ihn und kann ihn deshalb wieder verwenden. Papier zu nehmen wäre einfach eine zu große Verschwendung.«
Damals kostete eine Rolle vom allerbilligsten, groben Toilettenpapier gerade mal fünfundzwanzig Fen. Wir hatten noch nie weiches Papier gekauft, schon gar nicht die Marke Goldfisch. Aber selbst das kratzige zu fünfundzwanzig war Mutter noch zu teuer. Immer wieder sagte sie, dass ich mein Geld schließlich mühsam verdiene.
Ich warf den Waschlappen fort. »Schon einmal täglich auskochen wäre noch zu wenig, und du machst das erst nach ein paar Tagen! Das gibt es in Zukunft nicht mehr. Oder denkst du etwa, durch deine Art von Sparsamkeit könnte ich reich werden?«
Von da an hörten die Infektionen der Harnwege auf. Aber ich bemerkte, dass sie jetzt zwar Toilettenpapier verwendete, doch immer nur ganz winzige Fetzen. Ich konnte sagen, was ich wollte, sie machte einfach so weiter.
Kaum war unser Frühstück beendet, sehnte Mutter auch schon das Mittagessen herbei, denn während ich unser Essen zubereitete, holte ich sie zum Plaudern zu mir in die kleine Essdiele neben der Küche. So konnte ich in der Zeit, in der ich nicht schrieb, wenigstens mit ihr zusammen sein. Sosehr sie unsere Gespräche auch liebte, fehlte ihr doch Ende Juli dazu schon jegliche seelische und körperliche Kraft. Sie war völlig apathisch. Ich bin überzeugt, dass es ihr normalerweise leid um jede gemeinsame Minute gewesen wäre, doch ihre Kräfte waren erschöpft.
Aus Angst, mich beim Schreiben zu stören, unterdrückte sie für gewöhnlich den Wunsch, dass ich noch etwas bleiben möge. Sogar wenn sie für ihre Katze, mit der sie sich die langen einsamen Stunden teilte, das Futter kochen wollte, kündigte sie vorher bescheiden und schuldbewusst an: »Ich störe dich hoffentlich nicht, wenn ich ihr was zum Fressen mache.« Jeder nahm sich das Recht, großzügig meine Zeit, Kraft und Energien zu verschwenden, doch Mutter war eben nicht so.
Meine Mutter hatte großen Respekt vor meinem Computer, der in Wahrheit durchaus nicht mehr dem neuesten technischen Stand entsprach. Nur zweimal, im Juli oder August, lehnte sie in ehrfurchtsvoller Entfernung hinter mir und dem Gerät am Türrahmen: »Ich traue mich nicht näher heran, sonst mache ich ihn dir womöglich noch kaputt.«
Ich zog sie vor den Computer und zeigte ihr, wie ich damit umging und auf seinem Monitor Schriftzeichen hervorlockte. »Du brauchst keine Angst zu haben, der ist doch nicht aus Pappe zusammengekleistert, sieh nur, wie einfach, wie deutlich.«
Nur sie allein und keinen anderen hätte ich sonst an meinen Computer gelassen! Sie allein hatte das Recht, über mich und alles, was mein war, zu verfügen. Doch da ich mich stets geniert habe, zärtlichen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, habe ich ihr nur selten ein liebes Wort gesagt. Wenn ich heute daran denke, wie viel Freude ich damit bei ihr ausgelöst hätte, dann überkommt mich Reue.
Ich weiß nicht, ob sie die Schriftzeichen auf dem Computer wirklich wahrgenommen hat, aber ich hörte sie sagen: »Ist das schön!« Wie ich schon erwähnt hatte, war damals Mutters Sehkraft fast völlig geschwunden. Wenn sie also die Vorzüge des Computers würdigte, so lobte sie in Wahrheit stolz ihre Tochter, die sich bei ihrer literarischen Produktion eines solchen Gerätes zu bedienen verstand. Hätte sie jedoch nicht zufällig neben mir gestanden und mich am Computer beobachtet, ich wäre wohl von selbst nie darauf gekommen, ihr diese Genugtuung zu verschaffen.
Sie wurde schwerhörig, immer wieder verstand sie etwas falsch.
Jeweils am letzten Sonntag des Monats rief Tang Di, meine Tochter, an. Als sie sich am 28. Juli telefonisch meldete, verstand Mutter so gut wie nichts und umklammerte nur symbolisch den Hörer. Ich musste ihr hinterher alles erzählen, was Tang Di gesagt hatte, und dennoch war sie so glücklich, weil sie die Stimme ihrer geliebten Enkelin gehört hatte.
Dann wurde sie inkontinent, sie trank viel und musste oft zur Toilette. Selbst sie war überrascht, dass sie ständig Durst verspürte. Noch heute sehe ich, wie sie sich immer wieder von ihrem Sessel erhob, um aus einer Tasse auf dem Fenstersims zu trinken. Es war eine schwere, alte Porzellanmagnettasse, dunkelrote Craquelé-Glasur. Ich fragte mich, ob ihr Durst auf die Hitze zurückzuführen war und kaufte ihr jede Menge Melonen, aber es half nichts.
Ich höre immer noch, wie sie ihre Beschwerden schildert, ganz im Vertrauen darauf, dass ich sie davon erlösen könne.
Sie wurde immer teilnahmsloser, ihre Gefühle stumpften ab. Als wir im Juli 1990 aus den USA zurückkamen, zeigte sie keine übermäßige Traurigkeit, nicht wie früher, da hatte sie immer herzzerreißend geweint, als würde sie Tang Di niemals wieder sehen. Meine Tochter und ich nahmen damals an, der Grund läge in der Aussicht, bald wieder nach Amerika kommen zu können. Wahrscheinlicher aber ist, dass der Tumor der Hirnanhangdrüse bereits in ein bedenkliches Stadium eingetreten war. Selbst wenn mein Ehemann und ich uns an ihrem Krankenlager unerbittlich in den Haaren lagen, richtete sie sich nur schweigend in ihrem Bett auf und schlich sich aus dem Zimmer, um draußen auf dem Korridor das Ende unserer Auseinandersetzung abzuwarten.
Ich erinnere mich, dass meine Mutter eigentlich nur sehr selten krank war. Vielleicht verheimlichte sie mir aber auch ihre Beschwerden und ging allein zum Arzt, so wie sie sich immer allein allen Problemen stellte.
Zum Beispiel damals, 1966, als sie an einem Leistenbruch operiert wurde. Damals lebten wir in Peking, und ich hätte sie im Krankenhaus betreuen müssen. Aber ich tat es nicht. Denn zu jener Zeit versuchte ich mir gerade durch eifriges Studium der Werke des Vorsitzenden Mao Zedong und deren lebendige Anwendung Verdienste zu erwerben und mich als Aktivistin hervorzutun. Der Vorsitzende Mao stand einem damals näher als Vater und Mutter, also schob ich Mama seinetwegen natürlich beiseite. Ich legte mich damals für den Vorsitzenden so sehr ins Zeug, dass ich schließlich dank meines pflichtvergessenen Verhaltens mein Ziel tatsächlich erreichte, Aktivistin zu werden. Ich habe meine Mutter lediglich ein paar Mal mit meiner damals dreijährigen Tochter im Krankenhaus besucht. Doch wir haben ihr nicht einmal Leckereien, Obst oder Gebäck mitgebracht, nein, darüber hinaus aßen wir auch noch die Krankenkost, die Mama für uns bestellt hatte. Wir lümmelten in den Krankenhausstühlen und schlangen alles genießerisch herunter. Ich erinnere mich gut an jene Mahlzeiten: Eier, Holzohrenpilze, Tagliliengemüse, Fleischstückchen, schneeweiße nahrhafte Nudeln mit Fleisch- oder Eiersoße. So alltägliche Gerichte waren für uns in jener Zeit besondere Delikatessen.
Und 1987 fuhr ich abermals nach Europa, diesmal für ganze fünf Monate. Am Tag meiner Rückkehr fiel mir Mutters quittengelbes Aussehen auf. Eine Ärztin, die neben uns wohnte, äußerte mir gegenüber heimlich den Verdacht, Mutter könne an einem Krebsgeschwür der Bauchspeicheldrüse leiden. Sofort brachte ich sie zu einem Arzt.
Obwohl wir gleich neben dem Xiyuan-Hotel wohnten, war absolut kein Taxi aufzutreiben. Die Fahrer beendeten entweder gerade ihre Schicht, oder sie wurden zum Schichtbeginn neu eingeteilt. In ganz Peking fand ich kein Taxi, mit dem ich Mama ins Krankenhaus bringen konnte. Ich konnte keine Rikscha lenken, und selbst wenn ich mich darauf verstanden hätte, wo sollte ich eine Rikscha mit einer Ladefläche herkriegen, auf der Mutter liegen konnte? In der Not kommen einem die besten Einfälle: Ich hielt ein Taxi an und erklärte sogleich, dass ich in Devisen zahlen würde. Erst da hatte ich Erfolg. Aus Dankbarkeit gegenüber diesem Chauffeur, durch den Mama schließlich doch noch zur Klinik kam, ließ ich mir nicht einmal auf meine Devisen herausgeben, deren Wert den Fahrpreis um ein Mehrfaches überstiegen hatte.
Die namhafte Ultraschallspezialistin Dr. Chen Minhua vom Krankenhaus der Pekinguniversität untersuchte persönlich meine Mutter, schloss eine Krebsgeschwulst aus und diagnostizierte treffsicher eine Hepatitis. Ich brachte Mutter sofort in ihr zuständiges Krankenhaus. Damals war sie sechsundsiebzig Jahre alt und ich einundfünfzig. Ich hatte erst fünfzig Jahre alt werden müssen, um zu begreifen, wie man seiner Mutter etwas mehr Herzenswärme entgegenbringt. Nun wollte ich bei ihr in der Klinik bleiben und sie anständig pflegen, doch da sie an einer ansteckenden Krankheit litt, wurde mir das nicht erlaubt. Ich musste sie also in der Isolierstation allein lassen, besuchte sie aber täglich und brachte ihr nahrhafte Suppen und Speisen. Da ich jetzt Geld hatte, war das nichts Besonderes mehr, doch ich bewies ihr meine Liebe nun auch dadurch, dass ich täglich ihre Schlüpfer wusch und ihr zum Wechseln ins Krankenhaus brachte. Ihre übrige Wäsche konnte unser Hausmädchen erledigen, aber da Hepatitis hauptsächlich durch Kot, Urin und Körperflüssigkeit übertragen wird, musste ich mich über Mutters Unterwäsche schon selbst hermachen. Ohne die geringste Furcht vor einer eventuellen Ansteckung wusch ich ihre Wäsche mit dem einzigen Wunsch, sie möge sich darin frisch und wohl fühlen. Natürlich wollte sie es mir verbieten, konnte mich jedoch nicht davon abhalten. Hatten wir alles erledigt, plauderten wir friedlich miteinander. Von ihrem wunschlos glücklichen Gesicht konnte ich ablesen, wie zufrieden sie war.
Jetzt, da ich dies niederschreibe, steht Mamas Foto neben meinem Computer. Ich drehe mich um und starre es an. Voller Zuversicht blickt sie erwartungsvoll zu mir auf, vertraut sich meinem Schutz an, legt gewissermaßen die zweite Hälfte ihres Lebens in meine Hände. Und ich? Ohne jeden Zweifel war es ein weiteres Pech in Mamas an Missgeschicken reichem Leben, dass sie ausgerechnet eine Tochter wie mich hatte, die sich nicht genügend um sie zu kümmern verstand.
Nur einmal blickte ich sie während des Mittagessens ganz unabsichtlich an und bemerkte, wie sehr ihr Gesicht aus der Form geraten war. Ihre gütigen, wohlproportionierten Züge, an denen nie etwas auszusetzen gewesen war, erschienen auf einmal schief und lang gezogen. Die Augen waren starr, tot, die Muskeln straff gespannt, das ganze Gesicht von unnatürlichem Glanz. Ich erschrak.
1976 hatte ich schon einmal so eine Eingebung gehabt, als ich in der Zeitung ein Foto von Mao Zedong beim Empfang des Staatsoberhauptes von Malta zu Gesicht bekommen hatte, und richtig, vier Monate später hatte der große alte Herr das Zeitliche gesegnet.
Nun erst kam mir in den Sinn, Mutter war so apathisch, heiser und schwerhörig geworden, war ständig durstig und ohne Appetit, hartleibig und inkontinent, gleichgültig und schwerfällig in ihren Reaktionen, dass sie zusammenhanglose Reden führte und ihre Sehkraft fast völlig geschwunden war, und all dies waren Anzeichen einer Krankheit. Nur worin bestand ihr Leiden?
Es konnte sich bloß um eine Krankheit des Gehirns handeln, denn alle infrage kommenden Organe waren ja mit Ultraschall durchgecheckt worden.
Es gelang mir durch Vermittlung Wang Yis von der Politischen Konsultativkonferenz der Stadt Peking, für Mutter einen Untersuchungstermin bei einem berühmten Arzt für traditionelle chinesische Medizin zu vereinbaren. Ich war der Auffassung, dass ein Arzt für chinesische Medizin doch recht erfahren sein müsste bei der Behandlung einer leichten Erkrankung der Hirnarterie, die ein Spezialist für westliche Medizin möglicherweise gar nicht diagnostizieren konnte. Außerdem wollte ich sie durch chinesische Arzneien etwas kräftigen.
Nachdem ich allmählich begriffen hatte, dass man vieles im Leben mit mehr Gleichmut betrachten und dass die Liebe einer Mutter das einzig Wertvolle auf der Welt ist, reifte in mir eine sehr einfache Vorstellung von unserem zukünftigen Leben: Mama sollten noch ein paar glückliche und zufriedene Jahre beschieden sein. Das hätte zugleich auch mein eigenes Glück bedeutet. Zunächst wollte ich sie 1992 erneut auf eine USA-Reise mitnehmen, damit sie bei Tang Di sein konnte. Außerdem fasste ich für mich den Entschluss, nie mehr ohne sie länger als drei Monate ins Ausland zu fahren. Früher hatte ich mich auf meiner Reise nach Österreich ja auch von meinem Gatten begleiten lassen, warum bei zukünftigen Reisen also nicht von meiner Mutter? Ganz zu schweigen von den vielen Schriftstellertagungen in China selbst. Für dieses Vorhaben musste Mutter jedoch in rüstiger Verfassung sein.
Dr. Zhu, der berühmte Arzt, fühlte ihren Puls und konstatierte dann: »Die Energien der alten Dame sind völlig aufgebraucht.« Mehr verriet er nicht über den Gesundheitszustand meiner Mutter, doch dieser eine Satz sagte alles aus. Der Arzt hatte wohl erkannt, dass Mutters Lebenslicht am Verlöschen war und dass niemand und nichts die Macht besaß, daran etwas zu ändern. Ich werde nie vergessen, wie sich das Lampenlicht in jenem Zimmer plötzlich verdüsterte und mich ein Gefühl der Ohnmacht überwältigte. Ich traute mich nicht, den Arzt detaillierter auszufragen, denn ich fürchtete mich davor, meine Mutter an zahlreiche Begebenheiten aus ihrem Leben zu erinnern, die sie all ihre Kräfte gekostet hatten. Mama jedoch wirkte ganz teilnahmslos, als hätten die Worte des Arztes gar nicht Eingang in ihr Bewusstsein gefunden. Die alten Geschichten kümmerten sie nicht mehr, sie hing den Erinnerungen nicht nach.
Vom Winter 1990 bis in das Frühjahr 1991 hinein schluckte sie Medikamente, ohne dass der Speichelfluss nachließ. Daraufhin brachte ich sie am 26. Februar in die Klinik der Pekinguniversität zur Computertomografie. Dabei wurde ein Tumor der Hirnanhangdrüse entdeckt. Nun begriffen wir auch, dass der Rückgang ihrer Sehkraft nicht allein auf den grauen Star zurückzuführen war. Aber der Arzt war der Auffassung, dass man bei einer Achtzigjährigen keine Operation zur Entfernung eines Hirntumors mehr vornehmen sollte. Ein solcher Tumor wachse nur sehr langsam, und der alte Mensch erlebe daher den schlimmsten Tag möglicherweise gar nicht mehr.
Erst später wurde mir klar, dass der Arzt Mutters Leiden verharmlost hatte, besonders was die Rolle der hormonellen Veränderung anbelangt.