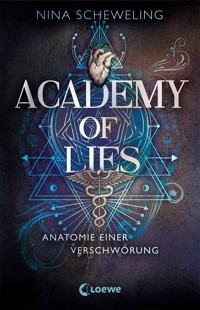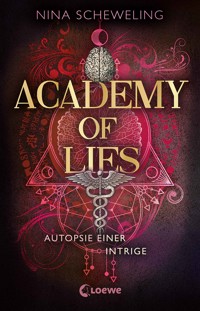
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Academy of Lies
- Sprache: Deutsch
Was würdest du für die Wahrheit riskieren? Als Medizinstudentin Quinn mit einem Filmriss erwacht, weiß sie, dass sie etwas Wichtiges vergessen hat. Und sie ist sich sicher: Es muss etwas mit dem geheimen Zirkel zu tun haben, dem sie auf die Schliche gekommen ist – und mit dessen mysteriösen Medikament. Da will der Geheimbund ausgerechnet Quinn in seine Reihen aufnehmen. Trotz ihrer Bedenken willigt sie ein, an den Aufnahmeprüfungen teilzunehmen. Denn Quinn braucht Antworten. Und so beginnt ein gefährliches Spiel ... Das packende Finale der Medizinthriller-Dilogie Im zweiten Band von Nina Schewelings Academy of Lies kehren wir zurück an eine medizinische Eliteuniversität voller dunkler Machenschaften – mit noch mehr Spannung und noch mehr Geheimnissen. - Fesselnder Abschluss der Medizinthriller-Dilogie - Dark Academia: Düstere Atmosphäre an einer Eliteuniversität, die einst ein Kloster war und die Geheimgänge und versteckte Gewölbe beherbergt. - Suspense rund um Geheimbünde, dunkle Machenschaften und gefährliche Prüfungen meets zarte Slow-Burn-Romance - Außergewöhnliche Protagonistin, die mit ihrem Sarkasmus besticht und berührt. - Über Tod, Krankheiten und die Hoffnung auf Heilung sowie ethische Fragen rund um Forschung und Medizin - Erstauflage mit opulentem Farbschnitt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Prolog
Kapitel 1 – Mein Körper fühlt …
Kapitel 2 – Drei Stunden und …
Kapitel 3 – Als ich das …
Kapitel 4 – Der trübe Dezemberhimmel …
Kapitel 5 – Ich sollte rennen …
Kapitel 6 – Das Wochenende verbringe …
Kapitel 7 – Ich fühle mich …
Kapitel 8 – »Das war’s schon …
Kapitel 9 – Schon mein ganzes …
Kapitel 10 – Verdammtes Ding, geh …
Kapitel 11 – Jemand stellt eine …
Kapitel 12 – Die nächsten drei …
Kapitel 13 – »Mama, bitte!« …
Kapitel 14 – Am zweiten Weihnachtstag …
Kapitel 15 – Mira Die sind …
Kapitel 16 – Die Visitenkarte steckt …
Kapitel 17 – Gestrüpp, das zwischen …
Kapitel 18 – Es ist genauso …
Kapitel 19 – Als ich am …
Kapitel 20 – »Wir führen eine …
Kapitel 21 – Das mit dem …
Kapitel 22 – Die nächsten Tage …
Kapitel 23 – Kälte. Mein Körper …
Kapitel 24 – Als ich am …
Kapitel 25 – Der restliche Tag …
Kapitel 26 – Das Akademiegebäude ragt …
Kapitel 27 – »Es ist wirklich …
Kapitel 28 – Das Feuer breitet …
Kapitel 29 – Als die Flammen …
Epilog
Content Note
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine Content Note.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte!
Wir wünschen euch das bestmögliche Lesevergnügen.
Eure Nina und das Loewe-Team
Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens.
Novalis
Mors auxilium vitae.
(frei übersetzt: Der Tod ist eine Hilfe für die Lebenden.)
PROLOG
Sie muss hier weg. Muss in Ruhe über alles nachdenken, einen Plan schmieden, überlegen, wem sie noch trauen kann. Aber sie weiß nicht, wohin sie gehen soll. Sie ist nirgendwo sicher. In der Villa nicht. Im Alphahaus nicht. In der WG erst recht nicht.
Stirnrunzelnd sieht sie sich um. Wo ist sie überhaupt? Wie ist sie hierhergekommen, in dieses Gewirr aus Straßen und Gassen, die sie nicht kennt? In manchen Fenstern blinkt Weihnachtsdekoration, und erst jetzt fällt ihr auf, wie dunkel es ist. Es muss bereits Abend sein. Wieso ist es schon so spät? Sie bleibt stehen und fasst sich an die Schläfen. In ihrem Kopf herrscht ein merkwürdiger Druck, oder nein, kein Druck, genau das Gegenteil: eine immer größer werdende Leere. Es fehlt etwas – nur was? Eine Information, ganz viele Informationen; sie kann es spüren, merkt, wie sie ihr entgleiten, will sie fassen, aber weiß gar nicht, wonach sie überhaupt greifen soll.
Sie muss hier weg. Muss irgendwohin, wo sie in Sicherheit ist und versuchen kann, die immer blasser werdenden Gedanken wiederzufinden. Es ist kalt, und sie schlingt den Mantel enger um sich. In einem Fenster fällt ihr ein roter Weihnachtsstern auf, der ihr vage bekannt vorkommt. Ist sie schon einmal an ihm vorbeigegangen? Er ist rot, so rot wie der Mantel, den sie trägt. Sie hat ihn sich von Mira geliehen. Mira … Irgendetwas ist mit Mira. Sie muss zurück in die WG, doch eine leise Stimme sagt ihr, dass sie genau das nicht tun sollte. Aber warum?
Warum?
Ihr wird schwindelig, und sie sucht an der Hauswand neben sich nach Halt. Schwarze Punkte tanzen vor ihren Augen. Als sich ihr Blick wieder klärt, ist auch der Druck in ihrem Kopf verschwunden, genau wie die Stimme. Sie will nur noch nach Hause. In die WG. Raus aus der Kälte, aus der Dunkelheit. Bestimmt ist sie bloß müde nach allem, was in letzter Zeit geschehen ist. Sie geht weiter, bis die Straßen langsam vertrauter werden, sie sich wieder zurechtfindet und endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, das Wohnheim in Sicht kommt.
Die WG ist leer. Miras Zimmertür steht offen. Sie ist nicht da, aber ihr Geruch hängt noch in der Luft – zusammen mit etwas Scharfem, Unangenehmem, das ihr in den Augen brennt. Sie öffnet das Fenster, dann zieht sie den Mantel aus und legt ihn Mira aufs Bett.
Erst im Bad, im Spiegel, sieht sie es: Ihr Pullover ist zerfetzt und blutdurchtränkt. Ihr Herz beginnt, in einem harten, unbarmherzigen Stakkato zu schlagen. Hastig tastet sie über ihren Bauch, aber da ist nichts, keine Wunde, nicht die kleinste Schramme. Fassungslos blickt sie ihr Spiegelbild an. So viel Blut. Wenn es nicht ihres ist – wem gehört es dann?
Wieder fasst sie sich an die Schläfe, wieder ist da dieser Druck, der keiner ist; diese Leere, das Fehlen von etwas, das einmal da war und jetzt verschwunden ist – Zeit, Ereignisse, Gespräche, Erkenntnisse, für immer verloren. Wo ist sie gewesen? Was hat sie getan? Was ist mit ihr passiert?
Panik steigt in ihr auf. Das Stakkato ihres Pulsschlags wird immer stärker, und sie ringt verzweifelt nach Luft. Hektisch reißt sie sich die blutigen Klamotten vom Körper, stopft sie in einen Müllbeutel, zieht sich rasch etwas anderes an und läuft nach unten zu den großen Tonnen vor dem Wohnheim. Sie öffnet eine Klappe, wirft die Sachen hinein und rennt wieder zurück, ohne dass jemand sie bemerkt hat. Dann stellt sie sich unter die Dusche, dreht sie so heiß auf, wie sie es ertragen kann, und wäscht das Blut ab, das noch an ihr klebt. Sie wundert sich, wie salzig das Wasser schmeckt, bis ihr bewusst wird, dass sie weint. Ihre Schultern beginnen zu beben, sie schluchzt auf, lässt den Tränen freien Lauf.
Sie weint so heftig, wie sie es seit Jahren nicht getan hat. Weint über alles, woran sie sich erinnern kann, alles, was sie vergessen hat, alles, was gewesen ist, und alles, was noch sein wird.
Mein Körper fühlt sich an wie aus Blei. Ich versuche, die Augen zu öffnen, doch selbst meine Lider lassen sich kaum bewegen. Als es mir endlich gelingt, sie aufzuschlagen, brauche ich eine Weile, um mich zu orientieren. Ich liege in meinem Bett in der WG. Durch das Fenster fällt trübes graues Licht, und der Wecker auf dem Nachttisch zeigt 8.17 Uhr. Ich überlege, welcher Tag heute ist. Mittwoch? Donnerstag?
Langsam verflüchtigt sich das Blei aus meinen Adern, und mein Kopf fängt an zu arbeiten. Vor zwei Tagen war Flos Beerdigung. Gestern Morgen ist meine Mutter abgereist; nachmittags bin ich zurück in die WG gezogen. An die Zeit danach kann ich mich nicht erinnern, aber vermutlich bin ich todmüde ins Bett gefallen und eingeschlafen. Jetzt, nachdem die Schwere langsam aus meinen Gliedern verschwindet, fühle ich mich dagegen so ausgeruht wie lange nicht mehr.
Ich stehe auf und nehme wahllos eine Jeans und einen Pullover aus dem Schrank. Während ich mich anziehe, betrachte ich mich im Spiegel. Trotz meiner ungewöhnlichen Energie heute Morgen begegnen mir lange, zerzauste Haare, ein blasses Gesicht und Augenringe. Ich habe so sehr abgenommen, dass mein Schlüsselbein und meine Hüftknochen unschön hervorstehen. Unwillkürlich fahre ich mir mit einer Hand über den Bauch, ohne dass ich sagen könnte, warum. Die Haut dort ist glatt und unversehrt – im Gegensatz zu der leicht erhabenen, zwanzig Zentimeter langen Narbe auf dem Brustkorb, wo man mir vor zehn Jahren mein Herz herausgeschnitten und durch ein anderes ersetzt hat.
Sobald ich ins Wohnzimmer komme, fühle ich mich, als hätte ich einen Dekoshop für Weihnachtsartikel betreten. Überall sind Lichterketten, Papiersterne und bunte Kugeln angebracht. Auf der Fensterbank stehen kleine Engelsfiguren und ein Lichterbogen, und neben der Badezimmertür hängen zwei Schokoadventskalender an der Wand. Beim linken sind ein paar Türchen geöffnet, beim rechten noch keins. Der Anblick lässt mich lächeln. Zwar kann ich mit Miras übertriebenem Sinn für Dekoration nichts anfangen, aber dass sie mir einen Adventskalender besorgt hat, obwohl ich in den letzten zwei Wochen gar nicht hier war, rührt mich. Ich öffne die entsprechende Anzahl an Türchen, breche die kleinen Figuren heraus und stecke sie mir nacheinander in den Mund.
Mira steht normalerweise nach mir auf, aber heute Morgen ist ihre Zimmertür offen und von ihr weit und breit nichts zu sehen. Eigentlich gehen wir immer zusammen den kurzen Weg zur Akademie, selbst dann, wenn wir unterschiedliche Kurse haben. Vielleicht will sie mir nach Flos Tod ein bisschen Raum lassen. Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass sie gar nicht hier war heute Nacht. Wer weiß, ob sie in den letzten zwei Wochen nicht einen neuen Mann – oder eine neue Frau – kennengelernt hat. Es können ja nicht alle so kontaktarm veranlagt sein wie ich.
Als ich das Bad verlasse, ist es Viertel vor neun. Ich sollte langsam los. Mein erster Kurs heute ist Anatomie, und da Konrad um Punkt neun Uhr die Türen zuschließen lässt, will ich auf keinen Fall zu spät kommen. Schon gar nicht, nachdem ich das Semester nur mit einer Sondergenehmigung beenden darf.
Eigentlich habe ich zu viele Einheiten verpasst, um alle Anforderungen zu erfüllen. Aber aufgrund außergewöhnlicher Umstände, wie die Verwaltung den Tod meines Bruders genannt hat, wird bei mir eine Ausnahme gemacht: Wenn ich am Ende des Semesters sämtliche Prüfungen bestehe, bekomme ich die Kurse trotz der Fehlstunden angerechnet. Ich werde in den nächsten Wochen Tag und Nacht lernen müssen, um das Pensum zu schaffen, was mir jedoch gerade recht ist. So bleibt mir keine Zeit, an Flo zu denken, an seinen toten Körper, die Fixer-Nadel noch in der Hand. Und auch nicht an die erschreckend kleine Kiste mit seiner Asche, die in ein ebenso kleines Loch in der Erde versenkt wurde.
Auf dem Weg zur WG-Tür fällt mein Blick auf den Mülleimer neben der Kommode. Er quillt fast über, also hole ich den Beutel heraus und nehme ihn mit nach unten. Die großen Tonnen stehen schon an der Straße; heute ist Müllabfuhr, und die Behälter sind ziemlich voll. Als ich den Beutel hineinwerfe, stutze ich. Obenauf liegt eine durchsichtige Tüte mit einem Pullover, der genauso aussieht wie meiner. Darunter ist ein T-Shirt … mit dem Wappen meines ehemaligen Internats.
Was soll das? Wieso schmeißt irgendjemand meine Sachen in den Müll?
Es fühlt sich komisch an, mich in die Tonne zu beugen, beinahe, als würde man in der Privatsphäre anderer Leute herumschnüffeln. Aber der Gedanke, dass jemand meine Klamotten geklaut und weggeworfen hat, lässt mich alle Hemmungen über Bord werfen. Also ziehe ich den Beutel heraus und öffne ihn.
Mit zitternden Fingern – warum zittern meine Finger? – hole ich den Pullover hervor. Auf Höhe des Bauches befindet sich ein Schnitt, und der Stoff ist durchzogen von rot-braunen Flecken. Das T-Shirt sieht noch schlimmer aus. Und die Hose ebenfalls.
Mein Herz beginnt zu rasen. Ich taste über die verkrusteten Stellen und rieche vorsichtig daran. Als ich einen leichten, süßlichen Geruch wahrnehme, zucke ich erschrocken zurück. Ist das … Blut? Wie kommt es auf meine Sachen? Meins kann es nicht sein, eine derart schlimme Verletzung hatte ich noch nie. Aber wessen ist es dann?
So viel Blut.
Was zum Teufel ist hier passiert?
Eine Passantin kommt den Gehweg entlang, und obwohl sie mich nicht beachtet, drehe ich mich hastig zur Seite und stopfe die Sachen zurück in den Beutel. Dabei fällt etwas zu Boden: eine kleine weiße Visitenkarte. Wie in Trance bücke ich mich und hebe sie auf.
Entsetzen strömt in meine Adern wie flüssiges Eis. Ich kenne diese Karte. Es ist die gleiche wie im Fell der Katze, mit einem in Gold geprägten Sigillum Dei auf der Vorderseite. Meine Hände zittern immer noch, als ich sie umdrehe und den Text lese, den jemand mit schwarzer Tinte auf die Rückseite geschrieben hat.
Du hast unsere Einladung angenommen. Halte dich bereit.
Eine Nachricht des Zirkels. Was hat das zu bedeuten? Ich starre auf die Worte und bin sicher, dass sie mir etwas sagen sollten, aber sosehr ich mich auch anstrenge, ich komme nicht darauf. Dabei habe ich das Gefühl, dass da etwas sein müsste. Etwas, das ich vergessen habe.
Das Eis in meinen Adern wird zu Feuer und treibt meinen Puls schlagartig in die Höhe. Das Blut, die Karte des Zirkels, die unangenehme Leere in meinem Kopf … Habe ich gestern Abend wirklich nur geschlafen? Oder … kann ich mich nicht daran erinnern, was geschehen ist, weil ich das Medikament bekommen habe?
Plötzlich höre ich das Schlagen einer Kirchturmuhr. Scheiße. Es ist neun Uhr. Konrads Anatomiekurs! Wenn ich nicht da bin, bevor die Tür verschlossen wird, kann ich mein Studium an den Nagel hängen.
In meinem Inneren herrschen so viele Gefühle gleichzeitig – Unglaube, Entsetzen, Panik –, dass ich mich wie gelähmt fühle. Doch irgendwo in meinem Gehirn legt sich ein Schalter um auf Autopilot. Eilig stecke ich die Visitenkarte in die Hosentasche, werfe die Klamotten zurück in den Müll und rase wie eine Irre auf die Akademie zu. Ich nehme die Abkürzung durch den Innenhof, durchquere das Foyer des Hauptgebäudes, haste wieder raus in einen kleineren Hof und erreiche völlig außer Atem das Nebengebäude, in dem die Anatomiekurse stattfinden. Als ich die Tür zum Vorraum aufreiße, renne ich fast Selina um, eine der Tutorinnen, die gerade auf dem Weg war abzuschließen.
»Glück gehabt«, brummt sie und dreht den Schlüssel im Schloss, doch meine Antwort besteht nur aus einem Nicken, weil mir zum Sprechen die Luft fehlt. Mein Herz springt mir fast aus der Brust, so heftig schlägt es. Trotzdem grenzt es an ein Wunder, dass ich den Sprint überhaupt geschafft habe.
Ich bin immer noch außer Atem, als ich mir den weißen Kittel überstreife, das Präparierbesteck aus der Tasche hole und dann hinter Selina den Anatomiesaal betrete. Die anderen stehen bereits an den Seziertischen, um mit der Arbeit an den Körperspendern zu beginnen. Eine konzentrierte Stille liegt über dem Raum, doch während ich zu meiner Präp-Gruppe gehe, ändert sich die Atmosphäre schlagartig. Es wird so leise im Saal, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Die meisten starren mich an, einige wenden den Blick ab, manche tuscheln hinter vorgehaltener Hand miteinander. Ich kann mir denken, worum es geht: Ich bin nicht nur die Enkelin des Akademiegründers, sondern auch die Schwester eines Mörders, der sich in einem Drogenunterschlupf den goldenen Schuss gesetzt hat. Ich bin ein wandelnder Skandal, und vermutlich wissen meine Kommilitonen nicht, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollen; ob ihr Mitleid überwiegt oder ihre Abscheu. Was sie erst denken würden, wenn sie von den blutigen Klamotten in meinem Müll wüssten?
So viel Blut …
Schnell verdränge ich das Bild, genau wie das Getuschel und die verstohlenen Blicke. Ich habe kein Problem damit, die Außenseiterin zu sein, die Außenstehende, auf die alle mit dem Finger zeigen. Aber bei dem Gedanken, dass mein Bruder – der friedlichste, sanftmütigste Mensch auf der Welt – von einem Geheimbund in einen Sumpf aus Verrat und Tod gezogen wurde und nun ewig als Drogenabhängiger und der Mörder unseres Rektors in Erinnerung bleiben wird, krampft sich mein Herz zusammen.
Den anderen aus meiner Präp-Gruppe ist ihr Unbehagen mir gegenüber ebenfalls anzusehen. Sobald ich an den Tisch trete, nicken Carl und Selim mir nur kurz zu, ehe sie rasch wieder auf den Körper der alten Frau hinabschauen, der in den vergangenen Wochen ein gutes Stück weiter ausgeweidet wurde. Amira starrt mich mit großen Augen an, als wäre ich ein Gespenst. Erst, als ich ihren Blick mit hochgezogenen Augenbrauen erwidere, ringt sie sich ein knappes »Hi« ab und fummelt dann verlegen an ihrem Präparierbesteck herum. Nur Bens Lächeln ist aufrichtig.
»Hey«, sagt er leise. »Schön, dass du wieder da bist.«
In dem Moment tritt noch jemand an unseren Tisch. Mein Puls, der sich nach dem Sprint beinahe beruhigt hatte, beschleunigt wieder, während Leonas einen Rollwagen mit Instrumenten neben dem Tisch platziert und sich ans Kopfende stellt.
»Guten Morgen«, sagt er zu niemand Bestimmtem. »Am besten fangen wir gleich an. Es dauert eine Weile, bis wir den Brustkorb geöffnet haben.«
Er wirft mir einen schnellen Blick zu, beachtet mich dann jedoch nicht weiter. Trotzdem weiß ich, dass es bei ihm weder ein Zeichen von Ablehnung noch Unsicherheit ist, sondern eher ein Ausdruck des stillschweigenden Abkommens zwischen uns, in der Akademie nicht mehr als nötig miteinander zu reden. In Wahrheit haben wir sogar eine ganze Menge zu besprechen, besonders nach meiner Entdeckung heute Morgen. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Aber dieses Gespräch muss warten. Jetzt ist erst mal der Körper vor mir auf dem Tisch dran. Und ehrlich gesagt, bin ich froh, mich auf anatomische Details konzentrieren zu können und so den Gedanken an meinen Fund zu verdrängen.
Während ich weg war, haben die anderen ganze Arbeit geleistet. Die Körperspenderin liegt wieder auf dem Rücken. Sämtliches Gewebe, das den Brustkorb bedeckt – Muskeln, Bindegewebe, Nerven und Blutgefäße –, wurde bereits präpariert, sodass die Rippen frei liegen und wie ein knöcherner Käfig hervorragen. In Gedanken zähle ich die Strukturen auf, die in den letzten Wochen in die Kiste unter unserem Tisch gewandert sind und die ich nun vermutlich nur noch in Anatomieatlanten zu Gesicht bekommen werde: musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, musculus obliquus externus abdominis … Bei der Vorstellung, was ich alles an Stoff verpasst habe, muss ich ein Seufzen unterdrücken.
Leonas deutet auf den Brustkorb. »Es gibt zwei Möglichkeiten, den Thorax zu öffnen. Bei der ersten wird das Brustbein längs durchtrennt und die Rippen seitlich meist mit den Fingern gebrochen. Dann kann man das Rippenschild nach rechts und links aufklappen wie bei einer Flügeltür. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man einen guten Überblick über den Aufbau des Thorax bekommt. Der Nachteil ist, dass dabei sehr viele Strukturen wie beispielsweise das Zwerchfell zerstört werden. Wir werden daher die zweite Methode anwenden. Sie ist etwas aufwendiger und ermöglicht nur ein kleines Sichtfenster auf die Organe und Gefäße darunter, aber wenn ihr es ordentlich anstellt, bleiben die meisten davon intakt.«
Während Leonas sich dem Rollwagen zuwendet, mustere ich neugierig die Instrumente darauf. Ganz vorne liegt eine Handknochensäge, die nicht viel anders aussieht als die, mit der ich als Kind im Garten meiner Großeltern junge Triebe abgesägt habe. Daneben befinden sich zwei Knochenscheren, die große Ähnlichkeit mit einer Geflügelschere besitzen, und eine elektrische Autopsiesäge mit einem kleinen, runden Sägeblatt.
»Carl?«, fragt Leonas. »Womit würdest du die Rippen durchtrennen?«
Carl betrachtet abwägend die Instrumente und deutet schließlich auf die Autopsiesäge. »Damit, denke ich. Ist vermutlich am schnellsten.«
»Und am lautesten«, entgegnet Leonas. »Außerdem birgt sie das größte Risiko. Wenn man abrutscht, zerstört man möglicherweise wichtige umliegende Strukturen.« Leonas deutet auf die Knochenschere. »Ich würde euch die hier empfehlen. Weniger cool, aber genauso effektiv. Wer will?«
Es reizt mich, das Durchtrennen von Knochen auszuprobieren, doch bevor ich etwas sagen kann, hebt Carl die Hand. »Ich mach’s.«
Er greift nach der Knochenschere und drückt sie ein paar Mal auf und zu, um ein Gefühl dafür zu bekommen. »Wo fange ich an?«
Leonas deutet auf den Brustkorb. »Den ersten Schnitt setzt du an der zweiten Rippe.«
»Warum an der zweiten?«, fragt Selim. »So lässt sich die erste doch gar nicht ablösen.«
»Stimmt«, erwidert Leonas. »Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die regio cervicalis anterior, die Verbindung zwischen Thorax und Hals, vorerst erhalten bleibt. Damit beschäftigen wir uns später.«
Carl setzt die Knochenschere am Brustbein an und drückt zu, doch es geschieht nichts. Ratlos sieht er Leonas an, dessen Mundwinkel amüsiert zucken.
»Die Schere ist scharf, trotzdem braucht ihr Kraft. Knochen sind kein Papier.«
Carl verzieht das Gesicht, nimmt die zweite Hand zu Hilfe und drückt erneut zu. Mit einem schabenden Geräusch gleitet der Stahl der Schere durch das Brustbein und hinterlässt einen glatten Schnitt.
Leonas nickt knapp. »Als Nächstes löst ihr die Muskulatur und die Pleura entlang der Rippen ab.«
»Pleura?«, wispert Ben in meine Richtung.
»Brustfell«, erwidere ich ebenso leise, ohne ihn anzusehen. Stattdessen beobachte ich interessiert, wie Leonas mit dem Finger zwischen Muskulatur und Rippe entlangfährt und den Muskelstrang Stück für Stück ablöst. Für die Pleura nimmt er das Skalpell zur Hand, und nachdem wir das Prinzip begriffen haben, sind wir an der Reihe.
Als wir zehn Minuten später fertig sind, drückt Leonas Selim und mir die beiden Scheren in die Hand, sodass wir von beiden Seiten gleichzeitig arbeiten können. »Jetzt sind die übrigen Rippen dran. Sie werden seitlich am Brustkorb durchtrennt, möglichst nah Richtung Rücken.«
Selim setzt die Schere an und schneidet die Rippe mit einem glatten Schnitt entzwei. Als Flüssigkeit aus dem Spalt schwappt, zuckt Amira angeekelt zurück.
»Das ist Konservierungsflüssigkeit«, erklärt Leonas, erneut mit leicht belustigter Miene. »Sie sammelt sich im Brustbereich und Bauchraum. Das ist ganz normal.«
»Weiß ich eigentlich«, erwidert Amira und nickt. »Ich war im ersten Moment nur … ach egal.« Sie tritt wieder an den Tisch zurück, aber ihre Gesichtsfarbe ist eine Spur blasser geworden. Offenbar hat sie ihre Probleme mit dem Präparieren nach all der Zeit immer noch nicht ganz abgelegt.
Ich beuge mich ebenfalls über die Rippen. Genau wie Selim und Carl vor mir setze ich die Klingen an den Knochen und drücke kräftig zu. Mit Fingerfertigkeit hat das nicht mehr viel zu tun, nur noch mit roher Gewalt. Doch als ich den Dreh einmal raushabe, fährt die Schere erschreckend mühelos durch die einzelnen Schichten der Knochen. Konzentriert arbeite ich mich von Rippe zu Rippe, bis Leonas mir vor der letzten bedeutet aufzuhören.
»Die lassen wir aus«, sagt er. »Aus dem gleichen Grund wie die erste Rippe: damit die untere Thoraxapertur intakt bleibt.«
Ich lege die Schere aus der Hand, richte mich auf und stoße beinahe mit jemandem zusammen, der direkt hinter mir steht. Verwundert drehe ich mich um und sehe in das Gesicht von Professor Konrad, der mich mit einem kritischen Blick fixiert. Sofort fühle ich mich in die erste Anatomiestunde zurückversetzt, als Konrad bezweifelte, dass ich in der Lage sei, den Kurs durchzustehen, da mein Großvater noch nicht allzu lange verstorben war. Jetzt hat er noch mehr Grund, meine mentale Stabilität zu hinterfragen, aber das stört mich nicht. Im Gegenteil.
»Frau Schreiber«, sagt er ohne die Spur eines Lächelns. »Ich hätte nicht gedacht, Sie noch einmal wiederzusehen.«
»Unkraut vergeht nicht.«
Jetzt lächelt er doch, aber nur kurz. »Sie sind sich hoffentlich bewusst, dass Sie bei mir keinen Sonderstatus erhalten werden – weder aufgrund der Ereignisse noch aufgrund Ihres Namens.«
»Das würde ich auch nicht wollen«, erwidere ich.
»Gut. Ich habe größeren Respekt vor Leuten, die sich Dinge erarbeiten, als vor denen, die alles in die Wiege gelegt bekommen.« Ohne mich weiter zu beachten, tritt er an mir vorbei und mustert den aufgetrennten Brustkorb. »Gute Arbeit, Herr Akbay«, sagt er zu Selim, ehe er zum nächsten Tisch geht.
Carl schlägt Selim anerkennend auf die Schulter. »Ein Lob von Konrad«, wispert er für den Fall, dass der Professor noch in Hörweite ist. »Nicht schlecht.«
Während Selim grinsend die Knochenschere weglegt, sieht Ben mich stirnrunzelnd an. »Hat Konrad was gegen dich?«
»Nicht direkt«, erwidere ich. »Aber er hat mal angedeutet, dass er sich mit meinem Großvater verkracht hat. Vielleicht liegt’s daran.« Ich versuche, mich an Konrads Bemerkung zu erinnern, die er vor ein paar Wochen mir gegenüber gemacht hat – irgendetwas darüber, dass Wilhelm und er sich akademisch in unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten. Ein spöttisches Lachen steigt in mir auf, doch ich schlucke es schnell wieder hinunter. Konrad ahnt vermutlich nicht mal, wie unterschiedlich. Immerhin war mein Großvater in den Zirkel verwickelt, hat ihn wahrscheinlich sogar gegründet. Wer weiß, wie sehr ihn der Geheimbund beeinflusst hat. Wenn Konrad nicht die gleichen Überzeugungen hatte wie er, wundert es mich nicht, dass mein Großvater ihn irgendwann auf Abstand gehalten hat.
»Ich werde aus ihm nicht schlau«, sagt Amira und schaut sich rasch nach Konrad um, der inzwischen jedoch in ein Gespräch mit einem Studenten am Nebentisch vertieft ist. »Einerseits tut er so, als gäbe es nichts Wichtigeres als ein Medizinstudium. Andererseits stellt er so hohe Anforderungen, dass es schon fast vorprogrammiert ist zu scheitern.«
»Neulich hat er erwähnt, dass es für ihn selbstverständlich ist, während des Studiums die Nächte durchzuarbeiten«, sagt Carl. »Das hätte ihm damals auch nicht geschadet.«
»Was zwar ätzend ist, aber auch irgendwie fair«, wirft Selim ein. »Es gibt genug Professoren, die sofort einen Bonus verteilen, sobald sie einen bekannten Namen hören. Bei Konrad zählt nur die Leistung.«
Ich verziehe das Gesicht. Das ging eindeutig gegen mich, obwohl ich gerade erst erwähnt habe, dass Konrad mich sogar noch kritischer beurteilt als andere. Fair ist etwas anderes. Doch bevor ich ihm widersprechen kann, unterbricht Leonas die Diskussion.
»Hey, Leute«, ruft er uns zu. »Falls es noch irgendjemanden interessiert: Wir haben hier einen Thorax zu öffnen.«
In der folgenden Stunde lassen wir Konrad Konrad sein und machen uns wieder an die Arbeit. Mit dem Skalpell lösen wir Bindegewebe und Muskeln von den Knochen, schneiden so nach und nach das Rippenschild heraus und können es schließlich abnehmen wie einen Deckel, der sich über die darunterliegenden Organe gelegt hat. Neugierig beuge ich mich über den offenen Brustraum, suche nach dem Herzen und glaube, es in einer Lücke zwischen dem Lungengewebe auszumachen – das Organ, das einmal der Motor dieses Körpers gewesen ist, das Zentrum dieses Lebens, sowohl physisch als auch emotional. Jetzt ist es nur noch ein mit Fixierflüssigkeit vollgesogener Klumpen.
Entschieden konzentriere ich mich wieder auf meine eigentliche Aufgabe und bin gerade dabei, an dem mir zugewiesenen Teil des rechten Lungenflügels die Pleura abzulösen, da verkündet Konrad das Ende des Kurses. Ich helfe Ben, die Spenderin abzudecken, damit sie nicht austrocknet. Dann gehe ich zu einem Waschbecken, um meine Hände zu waschen, auch wenn keine Seife der Welt gegen den stechend süßlichen Formalingeruch ankommt. Ich packe mein Präparierbesteck zurück in die Tasche und will in den Vorraum gehen, um mich umzuziehen, als Leonas mich aufhält.
»Quinn? Hilfst du mir kurz?«
Eilig folge ich ihm zurück zu unserem Seziertisch, der als Einziger noch in der Mitte des Saals steht. Unter der Abdeckung ist die Spenderin nichts weiter als ein unförmiger Umriss, der vage menschliche Formen besitzt. Nach dem Kurs werden die Spender normalerweise von dem Präparator der Akademie in einen Nebenraum gebracht, aber irgendjemand erwähnte, dass er heute krank ist.
Leonas deutet auf den Rollwagen mit den Instrumenten. »Nimmst du den?« Ohne mir Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, entriegelt er die Bremse des Seziertisches und schiebt ihn in Richtung der Tür am Ende des Saals.
Der Raum dahinter ist kleiner, mit schmalen Fenstern und funktionaler Einrichtung. Eine Klimaanlage sorgt für eine gleichmäßig kühle Temperatur. An einer Seite steht eine Reihe mit Edelstahltischen, auf denen ebenfalls abgedeckte Körper liegen. Vermutlich gehören sie zu dem Präparierkurs, der nach uns dran ist.
Leonas schließt die Tür zum Anatomiesaal und parkt den Tisch auf der gegenüberliegenden Seite neben den Körperspendern aus unserem Kurs. Dann kommt er zu mir.
»Wie geht es dir?« Seine grauen Augen mustern mich, und ich erkenne echte Anteilnahme darin.
Seit Flos Beerdigung haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich habe ihn weggeschickt, weil ich niemanden in meiner Nähe ertragen konnte. Die Anwesenheit meiner Mutter war genug, womit ich mich in meinem angeknacksten Zustand auseinandersetzen musste. Dabei ist mein anfängliches Misstrauen, ob Leonas zu den Guten oder Bösen gehört, inzwischen vollkommen verschwunden. In letzter Zeit ist so viel passiert – der Einbruch in die Villa, der Besuch bei seinem Vater, die Suche nach den Gewölbekellern, der Trip zum Militärkrankenhaus, in dem wir Flo gefunden haben –, dass ich keine Zweifel mehr habe, auf wessen Seite er steht. Seine Mutter ist dem Zirkel zum Opfer gefallen; mein Bruder ebenso. Wir wollen beide herausfinden, wer hinter dem Ganzen steckt, was es mit dem geheimnisvollen Wirkstoff auf sich hat und warum so viele deswegen sterben mussten. Wir sind zu Komplizen geworden, die beide das gleiche Ziel verfolgen.
»Ganz okay«, antworte ich trotzdem nur und merke selbst, wie lahm es klingt. Ich will Leonas erzählen, wie es in mir aussieht – aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Damit, dass der Gedanke an Flo mir das Herz zerreißt? Oder damit, dass ich heute Morgen meine blutigen Klamotten und die Visitenkarte des Zirkels im Müll gefunden habe und mir das eine Scheißangst macht, weil ich keine Ahnung habe, wie sie dahin gekommen sind?
Ich setze erneut zu einer Antwort an, doch es kommt mir kein Wort über die Lippen. Ich verstehe selbst nicht, warum. Vielleicht, weil das Themen sind, die ich nicht zwischen halb zerfledderten Körpern und eingehüllt in Formalingeruch mit ihm besprechen sollte.
Leonas sieht mich fragend an, als wisse er genau, dass mehr in mir vorgeht, als ich zugebe. Doch ich wende mich ab und rolle den Wagen zu einem Waschbecken. Dann nehme ich die Knochenschere und fange an, sie abzuwaschen – nicht, weil ich scharf darauf bin, sondern weil ich so einen Grund habe, Leonas den Rücken zuzukehren. Ich reibe wie verrückt mit einer Bürste über das Werkzeug, als wäre es schon seit Jahren nicht mehr sauber gemacht worden, und versuche, das Kribbeln zu ignorieren, das sein Blick in meinem Nacken auslöst.
Leonas tritt neben mich und dreht den Wasserhahn zu. »Quinn. Du musst mir nichts vormachen.«
»Es ist alles okay«, wiederhole ich entschieden.
»Die Beerdigung ist zwei Tage her«, sagt er ruhig.
Ich werfe die Knochenschere weg, die klirrend ins Waschbecken fällt. »Verdammt noch mal«, knurre ich. »Was willst du hören?«
»Die Wahrheit. Sonst hätte ich nicht gefragt.«
»Ich fühl mich beschissen! Zufrieden?«
Er antwortet nicht, sieht mich einfach nur an und scheint darauf zu warten, dass ich weiterrede.
Ich weiß nicht, wie er es macht, ob es an seinem Blick liegt, seinem Schweigen, seiner sanften Bestimmtheit, aber plötzlich brechen die Worte aus mir hervor wie Gefangene, die endlich freikommen. »Du willst wissen, wie es in mir aussieht? Also schön. An manchen Tagen kann ich immer noch nicht begreifen, dass Flo wirklich tot ist. Der Gedanke an ihn tut so weh, dass ich am liebsten ununterbrochen schreien würde. Als hätte jemand ein riesengroßes Stück aus mir rausgerissen. Manchmal fehlt so viel, dass ich Angst habe, einfach in mich zusammenzufallen. Und ich glaube nicht, dass sich dieses Loch jemals wieder schließen wird.«
»Wird es auch nicht«, erwidert Leonas. »Aber irgendwann tut es weniger weh, wenn du an deinen Bruder denkst. Versprochen.«
Unweigerlich steigen die Bilder des verlassenen Krankenhauses wieder in mir auf. Dreckige dunkle Räume. Flo auf einem Bett, die Spritze noch halb in der Hand, einen friedlichen Ausdruck in seinem leblosen Gesicht. Ein Ort, der mit glücklichen Kindheitserinnerungen verbunden war, die von jetzt auf gleich von einem unfassbaren Schmerz überschrieben wurden. So sehr, dass ich noch tagelang das Rauschen in den Ohren hatte, mit dem mein Verstand mich von der Außenwelt abschirmen wollte. Ich würde Leonas gerne glauben. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Verlust, den dieser Moment mit sich gebracht hat, jemals weniger wehtun wird.
Ich ziehe die Nase hoch und ärgere mich sofort über mein Geschniefe. Ich will nicht weinen. Nicht hier. Nicht so. Überhaupt nicht. Deswegen spreche ich auch die Klamotten im Müll nicht an. Später, schwöre ich mir. »Du hast mich hoffentlich nicht hierher gelotst, um mir zwischen halb auseinandergenommenen Leichen ein paar Lebensweisheiten zukommen zu lassen, oder?«, frage ich gereizt, um die aufsteigenden Tränen zu überspielen.
Leonas lächelt. »Nein, das war nicht mein Plan. Ich …« Er zögert. »… ich muss dir was zeigen. Können wir uns irgendwo treffen? Wo wir in Ruhe reden können?«
Ich sehe mich demonstrativ in dem leeren Raum um. »Hier ist doch niemand.«
»Schon, aber gleich beginnt der zweite Kurs.«
»Du könntest heute Nachmittag in die WG kommen.«
Er zögert kurz und sagt dann: »Lieber nicht.«
Ich sehe ihn verwundert an. »Okay. Wie wäre es mit der Villa? Um acht?«
»Ginge auch morgen? Heute habe ich noch was vor.«
»Aha. Und was?«
Kurz überlege ich, ob ich zu weit gegangen bin. Es geht mich schließlich nichts an, was er in seiner Freizeit tut. Doch zu meiner Überraschung reagiert Leonas beinahe verlegen. Er nimmt eine der Knochensägen und beginnt, sie abzuwaschen, obwohl ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass wir sie benutzt haben. »Ich muss noch was bei den Alphas erledigen«, druckst er herum.
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Leonas ist nur deswegen in das Verbindungshaus gezogen, weil er Flo ausspionieren wollte. Flo ist nicht mehr da, aber natürlich ist es gut möglich, dass noch weitere Alphas Mitglieder in dem Geheimbund sind.
»Hat es was mit dem Zirkel zu tun?«, hake ich daher nach, als Leonas schon wieder nicht weiterspricht.
»Nein. Aber es ist wichtig. Gewissermaßen.«
Ich greife seufzend nach dem Desinfektionsmittel und sprühe die Schere damit ein. »Hat dir mal jemand eingeredet, dass Einsilbigkeit sexy ist? Ich finde sie gerade nämlich eher mühsam.«
Jetzt wird er tatsächlich rot. »Ich …« Er zögert immer noch, doch dann gibt er seinen Widerstand auf. »Ich muss eine Mensur fechten.«
»Wie bitte?«, frage ich entgeistert.
»Du weißt schon, dass die Alphas eine schlagende Verbindung sind, oder?«
»Ja. Und ich finde es total bescheuert.«
»Ich auch. Aber wenn ich es nicht mache, fliege ich raus. Außerdem ist es nicht so wie früher, mit Mantel und Degen nachts im Nebel. Wir fechten auf einer Matte, mit Schutzanzügen und nach Punkten. Und im Idealfall überleben auch alle.«
»Haha.« Ich verziehe das Gesicht, um ihm klarzumachen, dass ich nichts daran lustig finde.
Plötzlich öffnet sich die Tür, und jemand betritt den Raum. Leonas und ich stieben auseinander, als hätten wir etwas Verbotenes getan. Die Säge fällt klirrend ins Waschbecken, und das Wasser aus dem Hahn spritzt in alle Richtungen, während wir gleichzeitig versuchen, es abzustellen. Als ich mich umdrehe, stelle ich überrascht fest, dass Mira im Türrahmen steht.
»Sorry. Ich wusste nicht, dass …« Sie sieht unsicher von mir zu Leonas und dann zu den Körperspendern auf den Bahren. »Ich wollte nur den Spender holen. Für unseren Kurs.« Trotzdem steht sie immer noch in der Tür, als traue sie sich nicht, näher zu kommen. Es ist genau wie gestern, als ich nach zwei Wochen in der Villa wieder zurück in die WG gezogen bin. Da war sie genauso zurückhaltend, als wisse sie nicht, wie sie sich mir gegenüber verhalten soll. Dabei ist Mira der unbedarfteste, sorgloseste Mensch, den ich kenne. Eigentlich hätte sie mir gestern um den Hals fallen und mir eine Million Fragen stellen müssen, nachdem wir uns so lang nicht gesehen hatten, und es versetzt mir einen Stich, dass selbst sie sich mir gegenüber anders verhält als sonst.
Leonas reagiert ebenfalls merkwürdig. Er sagt nichts, legt nur die gesäuberten Geräte zurück auf den Beistelltisch und lässt Mira dabei keine Sekunde aus den Augen. Was ist denn mit ihm los?
Plötzlich geht ein Ruck durch Miras Körper, und wie angeknipst erscheint ein Lächeln auf ihrem Gesicht. »Ich will euch gar nicht lange stören. Hier irgendwo müsste …« Sie läuft suchend an den Tischreihen entlang, bis sie auf einem der Zettel am Fußende die richtige Nummer entdeckt. »Ah, hier ist er ja. Heute sind die Lungenflügel dran. Der alte Knabe hier war Raucher, das wird bestimmt ein Riesenspaß. Schon verrückt, oder? Wie wir die hier in alle Einzelteile zerlegen?«
»Ja … schon.« Ich bin erleichtert, ihr übliches Geplapper zu hören, auch wenn es ein wenig aufgesetzt wirkt.
»Bis später, ja?« Sie löst die Bremsen, ehe sie den Tisch mit leichtem Schwung ins Rollen bringt und auf die Tür zusteuert.
»Warte. Ich helfe dir«, sage ich, laufe an ihr vorbei und halte die Tür auf.
»Danke«, sagt sie, immer noch lächelnd. »Schön, dass du wieder da bist.«
»Finde ich auch«, sage ich. Die Studierenden des Folgekurses strömen in den Anatomiesaal wie ein Schwarm aus weißen Kitteln, der sich gleichmäßig im Raum zu verteilen beginnt.
»Sehen wir uns heute Abend?«, fragt Mira mich.
»Klar.« Da Leonas ja bekloppten archaischen Traditionen nachgehen muss, habe ich Zeit.
»Supi.« Damit schiebt sie den Wagen zu einem der Arbeitsplätze, wo ihre Gruppe bereits auf sie wartet.
Ich hoffe sehr, dass ihre Anspannung sich wirklich gelegt hat. Ich will keine Mira, die nicht weiß, wie sie sich mir gegenüber verhalten soll. Ich will die alte Mira, die mir mit ihrer penetrant fröhlichen Art auf den Geist geht und mir gleichzeitig gar keine Chance lässt, in düsteren Gedanken zu versinken. Die Mira, die ich am Anfang des Semesters am liebsten zum Mond geschossen hätte und die ich in den Wochen danach so sehr zu schätzen gelernt habe. Die Mira, die in nur wenigen Wochen zu meiner Freundin geworden ist.
Und das habe ich schon lange nicht mehr über einen Menschen gedacht.
Drei Stunden und eine Doppelvorlesung Einführung in die Chemie später sitze ich in der Bibliothek und starre auf die Mauer aus Büchern um mich herum, alle randvoll mit Stoff, den ich nachholen muss. Keines ist aufgeschlagen, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Mein Laptop steht vor mir, und der Cursor blinkt in einem leeren Dokument, in dem ich eigentlich meine Notizen der Vorlesung aufarbeiten wollte. Doch anstatt etwas zu tippen, starre ich nur auf die weiße Seite und denke immer wieder an den blutbeschmierten Pullover zurück, den aufgeschnittenen Stoff und die Visitenkarte, die aus meiner Hosentasche gefallen ist.
So viel Blut.
Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass ich tatsächlich das Medikament des Zirkels erhalten habe. Was wiederum bedeutet, dass es vermutlich doch mein Blut gewesen ist; dass die Verletzung nur genauso verschwunden ist wie das Wissen darüber, wie sie entstanden ist.
Kurz flammt in mir ein Gedanke auf: Ob das Mittel auch mein Spenderherz heilt? Ich erinnere mich daran, wie fit ich mich heute Morgen gefühlt und wie gut ich den Sprint zur Uni weggesteckt habe, obwohl ich normalerweise schon nach zehn Minuten Fußmarsch vollkommen aus der Puste bin. Doch die Hoffnung verglüht sofort wieder. Für eine volle Genesung ist garantiert eine höhere Dosis notwendig als eine, die mich nur ein paar Stunden vergessen lässt.
Ich presse die Hände an die Schläfen und versuche verzweifelt, mich an irgendetwas zu erinnern. Warum habe ich so viel Blut verloren? Hatte ich einen Unfall? Hat mich jemand überfallen? Hat der Zirkel mich gerettet?
Oder … war es womöglich der Zirkel selbst, der mir die Verletzung zugefügt hat? Bin ich ihm zu nahe gekommen? Habe ich etwas herausgefunden, was ich nicht hätte wissen dürfen? Kam es zu einer Auseinandersetzung, die ich wieder vergessen sollte? War das der wahre Grund, warum ich das Mittel bekommen habe?
Aber was hat dann diese Karte zu bedeuten? Diese Einladung … wozu auch immer? Das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn!
Ich balle die Hände, schließe die Augen und suche nach einem Bild, einem Gespräch, irgendwas, das von gestern Abend übrig geblieben ist. Doch egal, wie sehr ich mich anstrenge, die Erinnerungen sind weg. Eine Hilflosigkeit breitet sich in mir aus, wie ich sie noch nie gekannt habe. Es ist fast so, als hätte jemand Macht über meinen Körper bekommen, als er mein Gedächtnis gelöscht hat – eine Macht, die ich ihm nie gegeben habe.
Vielleicht schaffe ich es auf andere Weise, den Abend zu rekonstruieren. Könnte Mira etwas mitgekriegt haben? Schließlich war sie da, als ich von der Villa in die WG zurückgekommen bin. Das ist so ziemlich das Letzte, woran ich mich noch erinnere. Wir haben uns kurz unterhalten, ich bin in mein Zimmer gegangen, auf dem Bett eingeschlafen, und dann … ist alles wie weggewischt. Vielleicht weiß sie, ob ich danach die WG verlassen habe. Oder ob jemand zu uns gekommen ist. Ob ich mit jemandem telefoniert habe.
Telefoniert … ich ziehe mein Handy aus der Tasche und öffne die Anruferliste. Ganz obenauf stehen unzählige Anrufe von Mira, die mich in den Wochen nach Flos Tod so oft versucht hat zu erreichen, dass ich das Handy ausgeschaltet habe. Aber von gestern ist dort nichts verzeichnet. Als Nächstes klicke ich auf meine Nachrichten. Die meisten sind ebenfalls von Mira und schon ein paar Tage alt. Doch dann stelle ich überrascht fest, dass Ben mir gestern Abend geschrieben hat.
BenSind im Pub. Kann verstehen, falls dir nicht danach ist. Aber wenn du ein bisschen Ablenkung brauchst, dann komm doch auch.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich zu den anderen in den Pub gegangen bin. Zumal sie heute Morgen dann sicher anders auf mich reagiert hätten.
Aber was, wenn ich es doch vorhatte? Wenn ich losgegangen, aber nie dort angekommen bin? Wenn mich jemand aufgehalten oder abgefangen hat?
Wieder denke ich an Mira. Vielleicht weiß sie ja wirklich etwas. Doch wie soll ich sie fragen, was ich gestern Abend getan habe, ohne ihr von der Gedächtnislücke zu erzählen? Damit würde ich bei ihr nur Fragen hervorrufen, die ich nicht beantworten kann. Der Zirkel hat bewiesen, wie skrupellos er ist, und je mehr Mira weiß, desto mehr bringe ich sie in Gefahr.
Nein, Mira ist keine Option.
Trotzdem muss ich irgendwie die Kontrolle über die Situation zurückbekommen. Mein Blick fällt auf den blinkenden Cursor. Vielleicht hilft es mir, wenn ich verstehe, auf welche Weise meine Erinnerungen verschwunden sind. Also öffne ich den Browser und suche nach Informationen zu Substanzen, die einen Blackout verursachen können. Natürlich ist mir bewusst, dass ich den Wirkstoff des Zirkels kaum im Internet finden werde, aber eventuell erfahre ich so mehr über das Prinzip, das hinter dem Gedächtnisverlust steht.
Eine halbe Stunde später habe ich so viele Tabs geöffnet, dass ich kurz davor bin, den Überblick zu verlieren. Auf diese Weise bringe ich keine Ordnung in meine Gedanken. Und dann weiß ich plötzlich, was ich machen will. Ich krame in meiner Tasche und fördere das Buch zutage, in dem ich so sorgfältig sämtliche Todesarten aufgeschlüsselt habe, die mir in den letzten Wochen begegnet sind. Gedächtnisverlust ist zwar keine Todesart, aber stirbt dabei nicht auch ein Teil von uns?
Ich nehme einen Stift, schlage das Tagebuch auf und beginne einen neuen Eintrag.
Amnesieverursachende Medikamente
Eine ganze Reihe von Medikamenten können Gedächtnislücken hervorrufen, wie zum Beispiel Antidepressiva, Antiepileptika oder Opiate. Tatsächlich ist das gar nicht so ungewöhnlich, wie man auf den ersten Blick meint.
Substanzen wie Benzodiazepine wirken angstlösend, beruhigend, muskelentspannend und schlaffördernd. Sie werden oft als Hypnotikum oder Beruhigungsmittel eingesetzt; es sind anerkannte Medikamente, die zum Teil sogar auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation WHO stehen. Einige der Wirkstoffe verursachen zusätzlich eine vorübergehende Amnesie, weswegen sie bewusst vor Operationen eingesetzt werden, um den Patienten die Angst zu nehmen. Dieser Eigenschaft verdanken sie auch den Einsatz als K.-o.-Tropfen, die heimlich in Drinks gemischt werden, um potenzielle Opfer nicht nur gefügig zu machen, sondern auch, um dafür zu sorgen, dass diese hinterher keine Erinnerungen an die Tat haben. Es gibt über hundert Wirkstoffe, die in diese Kategorie fallen, und fast alle haben gemeinsam, dass sie geruchlos, geschmacklos und schon nach wenigen Stunden im Körper nicht mehr nachweisbar sind.
Partydrogen wie die Gamma-Hydroxybuttersäure, kurz GHB oder Liquid Ecstasy genannt, können ebenfalls eine vorübergehende Amnesie auslösen. Auch der Konsum von Cannabis beziehungsweise THC beeinträchtigt das Kurzzeitgedächtnis. Doch die Droge, die mit Abstand am häufigsten einen Filmriss auslöst und für so gut wie jeden zugänglich ist, ist Alkohol.
Das Mittel des Zirkels hat sicher nichts mit herkömmlichen Medikamenten, Partydrogen oder Rauschmitteln zu tun. Aber das Prinzip dahinter scheint ähnlich: Bestandteile des Wirkstoffs sorgen für eine Bewusstseinsveränderung und blockieren gleichzeitig bestimmte Vorgänge im Hippocampus, dem Bereich des Gehirns, der für die Speicherung und den Abruf unserer Erinnerungen verantwortlich ist. Warum – und wie genau – das geschieht, weiß man nicht.
Die meisten Amnesien umfassen nur die Zeit, in der man unter dem Einfluss des Mittels stand, und selbst nach massivem Drogenmissbrauch wird das Gehirn nur selten dauerhaft geschädigt. Das Medikament des Zirkels hingegen wirkt sich auch auf das Langzeitgedächtnis aus und verursacht nicht nur vorübergehende Amnesie, sondern radiert auch Erinnerungen an die Zeit vor der Einnahme aus: ganze Wochen, Monate, Jahre. Je höher die Dosis, desto gravierender der Gedächtnisverlust.
Im Grunde sind die fehlenden Erinnerungen aber nur eine Nebenwirkung, die die Leute in Kauf nehmen, um von der eigentlichen Wirkung des Medikaments des Zirkels zu profitieren: seiner enormen Heilkraft. Das Mittel ist so mächtig, dass sich Wunden innerhalb von Minuten schließen, Knochen über Nacht zusammenwachsen, Krebszellen nach wenigen Tagen verschwunden sind.
Aber … ist es nicht, genau genommen, nur fair, dass ein Mittel, das eine so große Macht besitzt, einen ebenso hohen Preis fordert? Liegt es nicht im Wesen der Natur, nach dem Gleichgewicht in allen Dingen zu streben? Was sind schon ein paar Erinnerungen im Gegenzug zu dem Privileg, leben zu dürfen? Oder sind es die Erinnerungen, die unser Leben überhaupt erst ausmachen?
Als ich das Tagebuch zuklappe, ist die Bibliothek schon fast leer, obwohl sie erst in einer halben Stunde schließt. Draußen wird es bereits dunkel, und die Lampen auf den Lesetischen verbreiten ein gemütliches Licht. Seufzend betrachte ich den Bücherstapel vor mir. Es ist utopisch, heute noch irgendetwas nacharbeiten zu wollen, also kann ich genauso gut früher in die WG zurückgehen und den Abend mit Mira verbringen.
Doch anstatt zusammenzupacken, bleibt mein Blick auf der Wandvertäfelung hinter der Ausleihtheke hängen, die ich von meinem Platz aus gut sehen kann. Das verborgene Schloss, das sich nur mit einem Siegelring des Zirkels öffnen lässt, tarnt sich unter einer Schnitzerei im Holz. Wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss, fällt es einem nicht auf. Nach unserer Entdeckung und der anschließenden Flucht haben sich so viele Dinge in so kurzer Zeit ereignet, dass wir die geheime Tür etwas aus den Augen verloren haben. Leonas und ich sind uns sicher, dass sie zu den Gewölbekellern hinunterführt, die dem Zirkel aus irgendeinem Grund wichtig sind. So wichtig, dass Johann Sailer, der die Keller sanieren lassen wollte, sterben musste.
Er musste nicht einfach sterben, wispert eine Stimme in meinem Kopf. Flo hat ihn umgebracht, um in den Zirkel aufgenommen zu werden. Weil er dir unbedingt das Medikament besorgen wollte. Weil er eure beiden Leben gegeneinander aufgewogen hat und ihm deins wichtiger war.
Mit einem ärgerlichen Kopfschütteln bringe ich die Stimme zum Schweigen, stehe auf und schlendere langsam hinter die verlassene Ausleihtheke, um das Schloss noch einmal aus der Nähe zu betrachten. Doch das Licht ist hier so schummerig, dass ich es nicht auf Anhieb finde. Suchend fahre ich mit der Hand über das Holz, gerade als der Bibliothekar mit einem dicken Bücherstapel zur Theke zurückkommt und bei meinem Anblick überrascht innehält.
»Was machen Sie hier?«, fragt er misstrauisch.
»Ich … ähm … die Vertäfelung ist wirklich ungewöhnlich. Ich wollte sie mir genauer ansehen«, improvisiere ich und komme der Wahrheit damit immerhin sehr nahe.
Die argwöhnische Miene des Mannes glättet sich. Er legt den Bücherstapel auf die Theke und kommt zu mir. »Das stimmt. Die Wandverkleidung stammt noch aus der Originalbauzeit des Klosters. Allerdings befand sie sich ursprünglich nicht an dieser Stelle, sondern wurde kurz nach der Umwidmung der Kapelle hierher versetzt.«
»Der Kapelle?«, frage ich erstaunt.
Er nickt. »Wir befinden uns in der ehemaligen Kapelle des Klosters. War Ihnen das nicht bewusst?«
Der Bibliothekar deutet auf die hohen Decken, die schmalen Fenster, den lang gestreckten Raum, der durch die Bücherregale in viele kleine Bereiche unterteilt wird, und mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Natürlich. Wieso ist mir das nie aufgefallen?
»Soweit ich weiß, war es gar nicht so einfach, die Sanierung durchzusetzen«, fährt der Bibliothekar fort. »Es hat einige Diskussionen mit dem Denkmalschutz gegeben. Warten Sie mal …« Er geht zurück zur Theke, durchwühlt ein paar Schubladen, zieht einen Stapel kleiner Hefte heraus und drückt mir das oberste in die Hand. Sofern ich das auf den ersten Blick erkennen kann, ist es eine Infobroschüre über den Umbau des Klosters. »Die lagen hier mal ’ne Zeit lang aus, aber weil sie niemand mitgenommen hat, hab ich sie weggeräumt. Ist vom Interessensverband für denkmalgerechte Umnutzung sakraler Bauten, ganz kurzweilig eigentlich.«
»Danke«, sage ich, lächle möglichst unverbindlich und verabschiede mich hastig, bevor der Bibliothekar mich weiter in ein Gespräch über Denkmalschutz verwickelt.
An meinem Platz blättere ich in die Broschüre hinein, stelle aber schnell fest, dass es sich vor allem um kulturgeschichtliche Fakten handelt, die mich nicht sonderlich interessieren. Der Umbau der ehemaligen Klosteranlage hatte Kritik hervorgerufen, weil der religiöse Charakter verständlicherweise verloren ging. Doch es entpuppte sich als die einzige Möglichkeit, die Anlage überhaupt zu erhalten, und man hat sich große Mühe gegeben, die historische Struktur fachgerecht zu restaurieren.
Ich überspringe ein paar Seiten, die sich mit den Wandmalereien und Skulpturen in den Hauptgebäuden befassen, bis ich zu der Passage komme, die sich mit der Kapelle beschäftigt. Auch hier überfliege ich den Text, doch als ich den letzten Absatz erreiche, muss ich ihn ein zweites Mal lesen, um wirklich zu begreifen, was dort steht.
Trotz der sorgfältigen Restaurierung, durch die ein Großteil der historischen Substanz erhalten werden konnte, bemängeln Denkmalschutzexperten, dass kulturhistorisch bedeutsame Teile des alten Klosters bei der Instandsetzung ausgespart wurden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Gruft unterhalb der ehemaligen Kapelle, die aus einem ungewöhnlich weitläufigen System aus Gängen und Räumen bestehen soll. Deren Statik wurde so weit wiederhergestellt, dass keine Gefahr für die darüberliegende Bibliothek besteht; auf eine weitere Sanierung hat man aus Kostengründen verzichtet. Daher gelten manche Teile der Gruft nach wie vor als einsturzgefährdet, weshalb sie trotz ihrer Bedeutsamkeit nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Ich sehe zur Wandvertäfelung hinter der Theke und schüttle ungläubig den Kopf. Die versteckte Tür und die Treppe dahinter führen nicht einfach in alte Gewölbekeller hinunter. Sie führen in eine Gruft! Obwohl ich nicht anfällig für Grusel jedweder Art bin, kriege ich bei dem Gedanken eine Gänsehaut.
Ein Räuspern lässt mich zusammenfahren. Der Bibliothekar steht neben meinem Tisch und wirft einen demonstrativen Blick auf die Uhr. Die Bibliothek hat seit zwei Minuten geschlossen, und außer mir ist niemand mehr da.
Hastig murmle ich eine Entschuldigung, räume meine Sachen zusammen und mache mich auf den Weg zum Ausgang. Dabei fixiere ich erneut die Wandvertäfelung, versuche, den Umriss der versteckten Tür auszumachen und mir den Verlauf der Treppe in Erinnerung zu rufen. Die Sache wird immer mysteriöser. Was macht der Zirkel in einer ehemaligen Gruft? Warum werden diese Räumlichkeiten so beharrlich verschlossen gehalten? Plötzlich erscheint mir das Treffen mit Leonas morgen unendlich weit entfernt. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich wirklich den Mut aufbringen werde, ihm von dem Blut zu erzählen, aber diese Entdeckung hier könnte uns vielleicht weiterbringen. Wir müssen dringend besprechen, was unsere nächsten Schritte sind.
Und wir müssen dringend durch diese Tür.
Als ich die WG betrete, bestätigen sich all meine Befürchtungen: Mit angeschalteten Lichterketten, Papiersternen und Kerzen sieht das Wohnzimmer noch schlimmer aus als heute Morgen. Zu allem Überfluss dudeln schmalzige Weihnachtsklassiker von Frank Sinatra, Nat King Cole und Bing Crosby aus der Bluetooth-Box auf der Fensterbank. Jetzt fehlen nur noch Räuchermännchen, dann ziehe ich endgültig aus.
Mira kommt aus ihrem Zimmer, und als sie mich sieht, holt sie sofort ihr Handy raus und schaltet die Musik aus. »Hi«, sagt sie lächelnd, und wieder habe ich das Gefühl, dass es irgendwie verkrampft wirkt. Die Stille, die sich im Raum ausbreitet, ist so vollendet, dass ich das Summen einer Lichterkette neben der Eingangstür hören kann. Plötzlich wünsche ich mir die Musik zurück.
»Kannst ruhig wieder anmachen«, sage ich daher und deute auf den Lautsprecher.
»Ich dachte nur, dass du vielleicht … nach allem …« Sie sieht mich unsicher an, dann gleitet ihr Blick durch den dekorierten Raum. »Ist vielleicht ein bisschen viel geworden, oder?«
Ich deute auf die Mehrfachsteckdose in der Ecke, in der einige Lichterketten zusammenlaufen. »Solange du die Stromkosten übernimmst.«
»Klar.« Mira nickt hastig, bis ihr auffällt, dass ich grinse. »Ach so. Das war gar nicht ernst gemeint.«
»Kommt auf die Stromrechnung an«, erwidere ich immer noch grinsend. »Danke übrigens für den Adventskalender. Der hat heute Morgen mein Frühstück ersetzt.«
Ich streife meine Schuhe ab, lasse mich auf die Couch fallen und ziehe die Füße zu mir ran. Mira macht die Musik wieder an, stellt die Box leiser und setzt sich neben mich. Dann sieht sie mich unschlüssig an.
»Ist gestern irgendwas gewesen?«, fragt sie zögernd. »Du warst auf einmal weg.«
Mein Herz beginnt zu pochen. Ich war also wirklich noch mal weg! Ich will schon nachhaken, ob sie noch mehr über den gestrigen Abend weiß, doch ich schlucke die Worte wieder hinunter. Ich kann Mira nicht in die Sache mit reinziehen. Sie wird nichts von meiner Amnesie erfahren, nichts von einem geheimen Zirkel, nichts von einem mysteriösen Heilmittel, nichts von Mördern, die immer noch frei herumlaufen, und erst recht nichts davon, dass mehrere Stunden meines Lebens einfach ausgelöscht wurden.
»Ich bin bloß spazieren gegangen«, beantworte ich stattdessen ihre Frage.
»Oh, okay. Gut.«
Vermutlich hätte es ohnehin nichts gebracht, sie einzuweihen. Ihre Reaktion macht deutlich, dass sie auch nicht weiß, was geschehen ist. Offenbar bin ich einfach gegangen, ohne ihr Bescheid zu geben.
Mira wirkt immer noch angespannt. Obwohl sie direkt neben mir sitzt, habe ich das Gefühl, dass sie kilometerweit von mir entfernt ist. Ich presse die Lippen zusammen, und prompt deutet sie meine Reaktion falsch.
»Sorry. Wenn du noch Zeit für dich brauchst, dann …« Sie macht Anstalten aufzustehen, doch ich ziehe sie wieder zurück auf die Couch. Ihre Rücksichtnahme in allen Ehren, aber langsam wird es mir zu blöd.
»Könntest du damit aufhören?«, frage ich sie. »Flos Tod macht mich fertig. Aber ich kann es nicht gebrauchen, dass mich alle mit Samthandschuhen anfassen oder hinter meinem Rücken über mich reden. Wenn du ein Problem hast, mit der Schwester eines Mörders zusammenzuwohnen, sag es mir am besten direkt. Wenn nicht, dann behandle mich bitte so wie immer.«
Mira sieht mich einen Moment aus großen Augen an, und ich kann sehen, wie es in ihrem Kopf arbeitet. Dann lächelt sie, und dieses Mal kaufe ich es ihr tatsächlich ab. »Deal. Teilen wir uns ’ne große Vier-Jahreszeiten?«
»Nur, wenn ich alle Artischocken kriege.«
Eine halbe Stunde später sitzen wir mit einem riesigen Pizzakarton zwischen uns auf der Couch und gucken irgendeine Schnulze, auf die ich mich Mira zuliebe eingelassen habe. Der Plot ist unterirdisch, aber ich bin so froh über die Ablenkung, dass ich meine Prinzipien über Bord werfe und mir fest vornehme, den Film ohne meine üblichen bissigen Kommentare durchzuhalten. Als sich die beiden Hauptfiguren nach anderthalb Stunden voller Irrungen und Wirrungen schließlich in den Armen liegen, rutscht mir dennoch ein genervtes Stöhnen heraus, während Mira sich die Tränen abwischt. Angesichts meiner grundverschiedenen Einstellung gegenüber Happy Ends stößt sie mir den Ellbogen in die Rippen, und ich erwidere die Geste, woraufhin wir beide lachen müssen. Eigentlich ist also alles wie immer. Und trotzdem fühlt sich irgendwas anders an, ohne dass ich sagen könnte, was.
»Was war das eigentlich heute Vormittag zwischen dir und Leonas?«, fragt Mira und klappt den Laptop zu.
»Wieso?«
»Weil ihr ganz schön vertraut ausgesehen habt.«
»Ach, da ging es nur um Anatomie.«
»Um Anatomie … soso.« Mira verschränkt die Arme vor der Brust und grinst mich so unverschämt an, dass ich rot werde.
»Er ist mein Tutor!«, wende ich empört ein.
»M-hm.«
»Und ich hab eine Menge verpasst.«
»Schon klar.«
»Ganz egal, worauf du gerade anspielst … es ist nicht das, was du denkst. Nach so was steht mir gerade wirklich nicht der Sinn.«
»Vielleicht wäre ein bisschen Ablenkung genau das Richtige für dich.«
»Leonas ist überhaupt nicht interessiert an mir.«
»Aber du an ihm?« Ihr Grinsen wird immer unverschämter, was sich proportional auf die Farbe meines Gesichts auswirkt.
Ich nehme ein Kissen und werfe es nach ihr. »Vergiss es. Ich muss irgendwie das Semester schaffen. Da kann ich nicht noch mehr Ablenkung gebrauchen.«
»Abwarten«, kichert sie und wirft das Kissen zurück, woraufhin ich von der Couch fliehe, ihr eine gute Nacht wünsche und in mein Zimmer gehe.
Der Abend mit Mira hat mir gutgetan. Zum Glück hat sie ihre merkwürdige Befangenheit abgelegt. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass irgendetwas zwischen uns steht, und ich bin mir nicht sicher, ob es dabei wirklich nur um Flo geht. Etwas hat sich verändert, wie bei einem Suchbild, in dem sich ein Fehler versteckt, und ganz egal, wie lange ich darauf starre – ich finde ihn nicht.
Ich ziehe mich aus, doch bevor ich in meine Schlafsachen schlüpfe, fällt mein Blick auf mein Spiegelbild – und auf meinen Bauch, auf die Stelle, wo dem zerschlissenen Pullover nach zu urteilen die Verletzung hätte sein müssen. Wie schon heute früh fahre ich nachdenklich mit dem Finger über die unversehrte Haut. Was genau veranlasst den Körper eigentlich dazu, Wunden zu schließen?
Ich ziehe Hose und Schlafshirt an, gehe zu meiner Tasche und hole erneut mein Tagebuch heraus. Ich habe heute schon einen Eintrag geschrieben, aber ich merke, wie mich dieser Gedanke derart elektrisiert, dass ich ihn nicht weiter aufschieben kann. Ich habe mich in den letzten Wochen fast ausschließlich mit dem Tod beschäftigt und mit allem, was den Körper verletzt oder ihn unwiederbringlich zerstört.
Vielleicht kann es nicht schaden, mich auch um das Gegenteil zu kümmern: um die Dinge, die ihn am Leben erhalten.
Blutgerinnung und Wundheilung
Schürfwunden, Platzwunden, Stichwunden, große und kleine Verletzungen – es erscheint uns als etwas beinahe Alltägliches, dass der Körper sie repariert und vollständig verschließt. Die Wundheilung ist ein so selbstverständlicher Prozess, dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Dabei rettet sie uns in vielen Fällen das Leben.
Man teilt die Wundheilung in drei Phasen auf, die nicht unbedingt streng nacheinander, sondern – je nach Art und Größe der Verletzung – parallel verlaufen können. In der Reinigungsphase wird die Wunde von innen heraus gesäubert und der Blutfluss gestoppt. In der Granulationsphase bildet sich ein Ersatzgewebe, mit dem die Wunde vorläufig verschlossen wird. In der Epithelisierungsphase wird das Gewebe wiederaufgebaut und die Wunde mit neuer Haut bedeckt.
Die Blutgerinnung, die den Blutfluss stoppt und auf diese Weise verhindert, dass wir selbst an einer verhältnismäßig kleinen Verletzung verbluten, steht ganz am Anfang der Reinigungsphase. Wird ein Blutgefäß verletzt, zieht es sich zusammen, um so den Blutfluss und dadurch den Blutverlust zu verringern. Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten, bleiben an dem Leck haften und verschließen die Wunde dadurch oberflächlich.