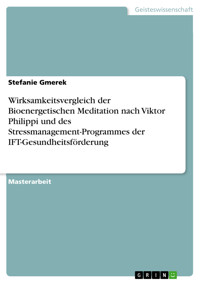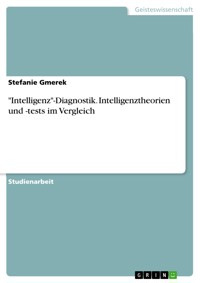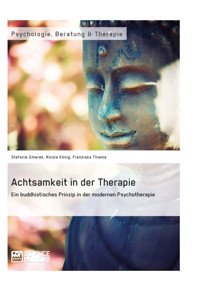
Achtsamkeit in der Therapie. Ein buddhistisches Prinzip in der modernen Psychotherapie E-Book
Stefanie Gmerek
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Achtsamkeit ist das 7. Glied des "Edlen Achtfachen Pfades" im Buddhismus. Durch das Beschreiten verschiedener Etappen auf den Gebieten der Weisheit, Sittlichkeit und Meditation soll der Mensch durch diesen Pfad zur Erleuchtung finden. Achtsamkeit ist aber nicht nur ein antikes Heilskonzept, sondern mittlerweile fester Bestandteil in der modernen Therapie. Doch welche Rolle kommt ihr dabei zu? Wie ist es durch Achtsamkeit möglich, psychisches Wohlbefinden zu erlangen, Stress abzubauen und Verhaltensstörungen oder gar Depressionen entgegen zu wirken? Dieser Band gibt einen Überblick über verschiedene, achtsamkeitsbasierte Ansätze und zeigt, wie sie bei der Therapie psychischer Probleme eingesetzt werden. Aus dem Inhalt: - Achtsamkeit im Buddhismus - Empirische Befunde zur Wirkung von Achtsamkeit - Achtsamkeit in der Psychotherapie - Krankheitsbild Depression - Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR) - Sucht- und Abhängigkeitstherapie von Drogen- und Alkohol
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Lektorat: Gina Kacher
Copyright © 2015 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: morguefile.com
Achtsamkeit in der Therapie
Ein buddhistisches Prinzip in der modernen Psychotherapie
Inhalt
Das buddhistische Konzept Achtsamkeit im Netzwerk der Copingstile von Franziska Thieme
Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Achtsamkeit
3 Stressbewältigung
4. Fragestellungen der Untersuchung
5 Methodik und Hypothesen der Untersuchung
6. Ergebnisse
7. Diskussion
Literaturverzeichnis
Tabellenanhang
Fragebögen
Achtsamkeitsbasierte Ansätze in der Psychotherapie von Abhängigkeitsstörungen von Stefanie Gmerek
Danksagung
Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Abhängigkeitsstörungen
3 Das Problem des Rückfalls
4 Das Prinzip der Achtsamkeit
5 Achtsamkeit in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Abhängigkeit
6 Achtsamkeit in der Therapie von Abhängigkeitsstörungen
7 Achtsamkeit, Spiritualität und Psychotherapie
Literaturverzeichnis
Anhang
Durch Achtsamkeit aus der Depression – Achtsamkeitsbasierte Ansätze zur Behandlung von Depressionen von Nicola König
1. Einleitung
2. Einführung in die Begrifflichkeiten
3. Achtsamkeitsbasierte Ansätze zur Bewältigung von Depressionen
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Das buddhistische Konzept Achtsamkeit im Netzwerk der Copingstile von Franziska Thieme
2008
Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele Menschen beigetragen. Ganz besonders danke ich…
Steffi, Berit, Cathrin und Nicole für die Unterstützung während des Schreibens, die vielen kraftspendenden Stunden und die anregenden Gespräche über, für und gegen Achtsamkeit,
Katja und Lydi fürs Durchackern, Dranbleiben und Dasein,
Dragutin und Michael für die nie ausgehenden Gelegenheiten, euch, anderen und mir selbst wirklich zu begegnen,
dem Raum der Stille in der Hainstraße, in dem ich jede Woche „sitzen“ konnte,
Marcus Roth für das Vertrauen, die Verbindlichkeit und die angenehme, stets neugierig-interessierte Betreuung,
Gunnar Ströhle für die Telefongespräche über Inhaltliches und Methodisches, die bereichernd und bestärkend waren,
Bernadette Sowa für die regelmäßigen Arbeitseinsätze, die Pausenzeiten (Stichwort: Espresso) und die inhaltliche Mitwirkung,
allen, die unerwähnt bleiben, sei es aus Platzmangel oder unbekannterweise,
meiner Familie, ohne die alles nichts wäre,
Zusammenfassung
Das Konzept der Achtsamkeit ist in den letzten Jahren zunehmend in das Interesse klinisch-psychologischer Forschung gerückt. Es hat seine Ursprünge im Buddhismus und beschreibt eine Haltung, in der die Aufmerksamkeit konsequent auf die Erfahrung des Augenblicks gerichtet ist. Jeder Moment wird möglichst vollständig mit all seinen Facetten wahrgenommen. Die aktuellen Gedanken, Gefühle oder körperlichen Empfindungen werden nicht weiter verarbeitet, sondern lediglich zur Kenntnis genommen. Im Buddhismus wird es als Weg gelehrt, der zu Wohlbefinden und einem von Leid befreiten Leben führt. Auch in der empirischen Erforschung findet sich eine Vielzahl von Belegen, die für die Wirksamkeit von Interventionen sprechen, in denen das Achtsamkeitskonzept vermittelt wird.
In der vorliegenden Diplomarbeit wird der Frage nachgegangen, wie sich die Forderung nach Innehalten und bloßem Wahrnehmen mit den Ergebnissen der Copingforschung, die ein aktives und problemfokussiertes Vorgehen im Umgang mit Stress empfehlen, vereinbaren lässt. Leitend ist dabei die Frage, mit welchen Bewältigungsstrategien Achtsamkeit einhergeht und ob sich Achtsame in Stresssituationen eher aktiv-problemlösender oder passiv-vermeidender Strategien bedienen. Darüber hinaus wird anhand der Bewältigungskonstrukte Vigilanz und Kognitive Vermeidung untersucht, welche Aufmerksamkeitssteuerung Achtsame in Stresssituationen aufweisen und ob sie gegenüber Bedrohungsreizen eher zu einer Aufmerksamkeitshin- oder -abwendung neigen. Außerdem wird geprüft, ob Achtsamkeit mit psychischer Gesundheit einhergeht. Regressions- und faktoranalytische Modelle geben Aufschluss darüber, wie das Achtsamkeitskonzept auf der Ebene psychologischer Konstrukte verstanden werden kann. In der Untersuchung wird angenommen, dass Achtsamkeit ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das bei jeder Person zu einem bestimmten Grad vorliegt, unabhängig davon, ob die Person spezielle Kenntnisse über das Achtsamkeitskonzept besitzt oder nicht.
Die Erhebung der Daten erfolgte anhand einer Stichprobe von Studierenden der Medizin, Psychologie und Theologie (N= 143). Der Fragebogen, der im Rahmen von Lehrveranstaltungen von diesen bearbeitet wurde, enthielt psychometrische Skalen zur Erfassung der Achtsamkeit (FFA), spezifischer Bewältigungsstrategien (COPE), der Aufmerksamkeitssteuerung in Bedrohungssituationen (ABI-R) und der individuellen psychischen Symptombelastung (SCL).
Die Ergebnisse zeigen, dass Achtsamkeit mit aktiv-problemlösenden Strategien einhergeht, während zu passiv-vermeidenden Strategien kein Zusammenhang besteht. Es finden sich bedeutsame Unterschiede zwischen Hoch- und Niedrigachtsamen in der Wahl der Bewältigungsstrategien. Dabei sind Hochachtsame charakterisiert durch einen aktiven und zugleich akzeptierenden Umgang mit Stresssituationen. Sie zeigen ein problemfokussiertes Herangehen und planen konkrete Handlungsschritte. Situationen, die zunächst nicht zu ändern sind, nehmen sie hin oder sie lenken den Blick auf das Positive. Sie geben Ziele weniger schnell auf und agieren Angst, Ärger und Frustration in Stresssituationen seltener ungesteuert aus, was für eine konsequente Verfolgung persönlicher Ziele und für die Fähigkeit zur Emotionsregulation spricht. Das Achtsamkeitskonzept ist mit dem Konstrukt der Kognitiven Vermeidung positiv, dem der Vigilanz negativ assoziiert. Demnach tendieren Achtsame gegenüber Bedrohungsreizen zur Abwendung der Aufmerksamkeit. Mit psychischer Gesundheit korreliert Achtsamkeit positiv. Die faktoranalytischen Berechnungen legen nahe, dass sich Achtsamkeit in das Netzwerk der übrigen Copingstile einreiht und keine eigenständige Dimension abbildet. Die Prüfung der Moderator- und Mediatormodelle spricht dafür, dass es sich bei Achtsamkeit – auf der Ebene psychologischer Konstrukte – um ein Persönlichkeitsmerkmal handelt, das seine Wirkung zum einen über die Copingstrategien entfaltet, zum anderen selbst die Funktion einer Bewältigungsstrategie übernimmt.
1 Einleitung
„Tue nichts, und alles ist getan.“
Lao-tse
Nichts-Tun wird im westlichen Kulturkreis oft als Passivität, als Verharren aufgefasst. Es ist jedoch etwas anderes gemeint. Bei genauerem Hinschauen enthüllt dieser kurze Vers die Essenz der zen-buddhistischen Lehre. Es gilt, das Nichts-Tun zu üben – kontinuierlich und immer wieder von Neuem. Dabei geht es nicht darum, sich von der Welt zurückzuziehen und in regungsloser Pose auf dem Meditationskissen zu verharren. Die Idee des Nichts-Tuns beinhaltet, die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind – unabhängig davon, ob sie angenehm oder unangenehm sind und gleichgültig, ob sie zum Ziel führen oder ein Hindernis darstellen. Das Wahrgenommene wird nicht umgedeutet, damit es erträglicher ist, nicht gerade gebogen, damit es besser passt, nicht festgehalten, um alles aus ihm herauszuholen. Bodhi (1994), ein Lehrer des Theravâda-Buddhismus, fordert zum Nicht-Tun derjenigen Dinge auf, mit denen der Geist die meiste Zeit beschäftigt ist: Denken und planen, bewerten, beurteilen und interpretieren. Den östlichen Weisheitslehren nach führt das ernsthafte Bemühen, diese Dinge zu lassen, zu einem glückvollen, von Leid befreitem Leben.
In der westlichen Wissenschaftslehre beschäftigt sich eine Vielzahl von Forschergruppen gleichermaßen damit, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit psychisches Wohlbefinden erhalten oder wiedererlangt werden kann. Im Bereich der Stressbewältigungsforschung werden aus den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen Handlungsempfehlungen abgeleitet, die der Maxime des Geschehenlassens widersprechen. Für den Umgang mit Stress und Belastungen erweisen sich besonders aktive und problemfokussierte Verhaltensweisen als hilfreich, während passive und vermeidende Strategien als wenig effektiv, wenn nicht sogar gesundheitsschädlich eingeschätzt werden.
Die Unvereinbarkeit dieser beiden Handlungsempfehlungen ist der Ausgangspunkt für die wissenschaftlich-psychologische Untersuchung der vorliegenden Diplomarbeit. Es wird der Frage nachgegangen, wie diejenigen Menschen Stress bewältigen, die aus der Perspektive der östlichen Lehrer das Nichts-Tun erfolgreich anwenden. Möglich ist dies, weil die Idee des Nichts-Tuns vor kurzem Eingang in die wissenschaftlich-psychologische Forschung gefunden hat – über das Konzept der Achtsamkeit. Dieses beschreibt eine Haltung, in der die Aufmerksamkeit konsequent auf die Erfahrung des Augenblicks gerichtet ist. Jeder Moment wird möglichst vollständig, mit all seinen Facetten wahrgenommen. Die aktuellen Gedanken, Gefühle oder körperlichen Empfindungen werden nicht weiter verarbeitet, sondern lediglich ohne Wertung zur Kenntnis genommen. In den letzten fünfzehn Jahren wurde – zunächst im nordamerikanischen Raum und später auch in Deutschland – eine Vielzahl von Studien zur Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Therapien veröffentlicht. Ziel dieser Interventionen ist die Entwicklung einer inneren Haltung der Achtsamkeit. Ob eine solche Haltung tatsächlich mit psychischer Gesundheit einhergeht und mit welchen Bewältigungsstrategien – aktiv-problemlösende oder passiv-vermeidende – das Konzept der Achtsamkeit verbunden ist, sind die Leitfragen der vorliegenden Untersuchung.
Die einzelnen Kapitel der vorliegenden Diplomarbeit bauen inhaltlich aufeinander auf, dennoch ist der Einstieg an verschiedenen Stellen möglich, da die wichtigsten Aussagen in regelmäßigen Abständen zusammengefasst werden. Der „rote Faden“ der Arbeit ergibt die folgende inhaltliche Gliederung: In den Kapiteln 2.1 und 2.2 wird in das Konzept der Achtsamkeit eingeführt – zum einen über die Achtsamkeitspraxis des Buddhismus sowie seine Anwendung in der Psychotherapie, zum anderen über empirische Ansätze der Definition des Konzepts. Die Kapitel 2.3 und 2.4 fassen den gegenwärtigen Stand der Forschung in Bezug auf die Wirksamkeit und die Wirkungsweise von Achtsamkeit zusammen. In den Kapitel 3.1 bis 3.3 werden psychologische Modelle zur Entstehung von Stress und Ansätze zur Klassifikation von Bewältigungsstrategien vorgestellt. Außerdem wird ein Überblick gegeben, welche Strategien in der Copingforschung als besonders wirksam identifiziert wurden. Aus den theoretischen Überlegungen ergeben sich die spezifischen Fragestellungen der vorliegenden Diplomarbeit, die in Kapitel 4 ausführlich dargestellt sind. Anhand der Kapitel 5 und 6 können der methodische Aufbau der empirischen Untersuchung, die statistischen Auswertungsprozeduren sowie die Ergebnisse nachvollzogen werden. Die Diskussion der Methodik und der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung findet in Kapitel 7 statt.