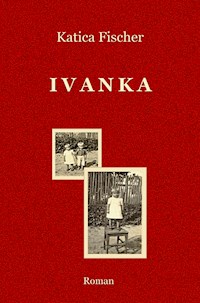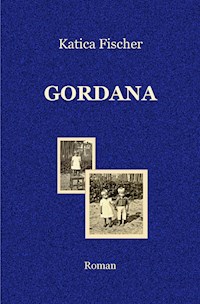Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Kalifornien - 1854. Um seinem despotischen Vater zu entkommen, bricht Eric in die Wildnis auf, mit der Absicht, ein freies Leben nach eigenen Vorstellungen führen zu wollen. Doch schon bald muss er erkennen, dass er keineswegs allein an dem Ort ist, den er sich als neue Heimat ausgesucht hat. Vielmehr muss er sich das Land mit verschiedenen Raubtieren und Indianern teilen. Dass die so genannten Wilden keineswegs seine Feinde sind, wird schnell deutlich. Allerdings braucht er ein bisschen Zeit, um zu erkennen, wie wichtig seine neuen Nachbarn und deren Schicksal für ihn selbst sind. Erics Alltag ist gespickt mit abenteuerlichen Begegnungen, die großen Eindruck auf ihn machen und oftmals dafür sorgen, dass sich sein reales Leben immer wieder neu ordnet. Auch fantastische Ausflüge in die Welt des Übersinnlichen sind ein Thema in diesem Roman, denn es gibt schließlich mehr zwischen Himmel und Erde, als man mit bloßem Auge wahrnehmen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 867
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katica Fischer
ADLERHERZ
Yden-Reihe II
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutsche Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Außer den geschichtlich dokumentierten Personen und Ereignissen sind die Charaktere und Handlungen in diesem Roman frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten der Namen oder Beschreibungen realer Menschen sind rein zufällig und nicht absichtlich entstanden.
Alle Rechte, einschließlich des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form sind vorbehalten.
Copyright © 2019 Katica Fischer
www.katica-fischer.de
Einbandgestaltung: K. Fischer
Coverfoto: clipdealer.de
Bereitstellung und Vertrieb:
Epubli (Neopubli GmbH, Berlin)
Prolog
„Du hast mir die Geschichte von Eric und seinem Leben versprochen.“ Yza sah ihren Vater erwartungsvoll an.
„Bist du nicht zu müde, Schatz?“ Bryan saß bereits in dem Sessel, der gleich neben dem Bett seiner Tochter stand. Er war sich jedoch nicht sicher, ob er tatsächlich mit dem Erzählen beginnen sollte, denn sie wirkte an diesem Abend noch erschöpfter und schwächer als am Tag zuvor. Der Krebs breitete sich immer schneller in ihrem Körper aus und raubte ihr zusehends mehr von ihrer Energie. Allein ihr Humor und ihre hartnäckige Weigerung, sich wie eine Todkranke zu verhalten oder zu wehklagen, täuschten oft darüber hinweg, dass es ihr tatsächlich miserabel ging.
„Müde ja, aber an Schlafen denke ich jetzt noch nicht.“ Sie lachte ihn offen an. „Das kann ich bald sehr ausgiebig tun. Also. Spann mich nicht so auf die Folter!“
Sie hatte recht, ermahnte er sich. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie für immer einschlafen würde. Und dann konnte er ihr nicht mehr erzählen, was er sich für sie ausgedacht hatte.
„O. K. Dann schließe die Augen und hör zu.“
1
Kalifornien – 1854
In den Wäldern nordöstlich des Sacramento-Flusses
Den Griff seiner Axt noch in der Hand haltend setzte sich Eric auf den Baumstamm, den er bis eben noch bearbeitet hatte. Dabei sah er sich schwer atmend um. Fast geschafft, dachte er zufrieden. Die Stämme, aus welchen die Wände der Blockhütte bestanden, waren so verbunden, dass noch nicht einmal ein starker Sturm sie von ihrem Platz bewegen konnte. Auch das Bretterdach war gut befestigt, und die Tür hing bereits in ihren Angeln. Jetzt fehlten nur noch die Klappläden und die dazugehörigen Riegel, damit das Fenster bei schlechtem Wetter verschlossen werden konnte. Sicher, seine neue Unterkunft war weder besonders groß noch so komfortabel wie sein Elternhaus in der Stadt. Aber es würde sein erstes, mit eigenen Händen erbautes Zuhause sein, in dem er allein zu bestimmen hatte, was zu tun oder zu lassen war.
Als Sohn eines sehr ehrgeizigen und gewinnorientierten Kaufmannes geboren, hatte Eric von klein auf lernen müssen, dass man im Leben nichts geschenkt bekam, sondern sich sein tägliches Brot verdienen musste. Er war also durchaus fähig, seinen Kopf zu gebrauchen, um Probleme und anstehende Herausforderungen zu bewältigen. Zudem besaß er geschickte Hände, die mithilfe von entsprechendem Werkzeug einiges herstellen und nahezu alles reparieren konnten, was man im Alltag benötigte. Allein seine Muskelkraft war anfangs gering gewesen, hatte sich aber im Laufe der letzten Zeit nach und nach verbessert, weil er ja tagtäglich große Gewichte bewegen musste.
Drei Monate war es nun her, dass er das Grab seiner Mutter und den Rest seiner Familie zurückgelassen hatte, um in die Wildnis aufzubrechen. Frei von den Zwängen zwischenmenschlicher Verhaltensnormen und den immerwährenden Forderungen seines Erzeugers, der einen geldgierigen Geschäftsmann aus ihm hatte machen wollen, sollte jetzt ein neues Leben für ihn beginnen. Mehr um seinem sturen Vater zu trotzen, als tatsächlich seinem eigenen Wunsch folgend, hatte er das Erbe seines Großvaters mütterlicherseits dazu benutzt, ein Stück Land zu kaufen, welches nahezu zwei Tagesreisen von Oaktown oder jeglicher anderen Ansiedlung entfernt war. Auf der Karte der Landvermesser war es immer noch ein großer quadratischer Fleck, der keinerlei Besonderheiten aufwies, und der bisher nur von ein paar einzelnen Goldsuchern inspiziert und für unbrauchbar deklariert worden war. Als er jedoch nach einem langen und ziemlich anstrengenden Ritt endlich angelangt war, hatte er voller Staunen und innerer Genugtuung feststellen dürfen, dass er sich ein kleines Stück vom Paradies gesichert hatte. Urige Mischwälder säumten eine lang gestreckte, steppenartige Ebene, die auf der einen Längsseite von einigen kleineren Anhöhen begrenzt wurde. Und hinter diesem natürlichen Wall tat sich ein weiteres kleines Tal auf, das gleichsam von unterschiedlich hohen Hügeln umgeben war. Allein auf einem dieser Erhebungen sprudelte brühheißes Wasser aus einer relativ großen Quelle und stürzte sich nach ein paar Yards als herrlich warmer Wasserfall in ein Becken aus Granit. Auf der anderen Längsseite wurde seine neue Heimat von schroffen Felsen abgeschirmt, die man zwar erklettern konnte, die jedoch nicht per Pferd zu überqueren waren. Aus dieser Steinbarriere entsprang ein kleiner Bach, der sich dann in sanften Windungen quer durch den Wiesengrund schlängelte. Sein Wasser war so klar und erfrischend, dass Eric meinte, nie zuvor etwas Köstlicheres getrunken zu haben. Eine vorläufige Behausung war bei seinem Eintreffen auch schon vorhanden gewesen. Da gab es nämlich eine mannshohe Felsenhöhle, die sich hinter einem Dornengestrüpp verbarg. Und diese war gerade groß genug, um ihn und seine Vorräte vorübergehend zu beherbergen. Also hatte er zunächst dafür gesorgt, dass seine Stute Lucie zwar grasen und aus dem Bach trinken, aber nicht weglaufen konnte. Danach hatte er sich in der Höhle hingelegt, um einen ganzen Tag hindurch zu schlafen. Geweckt durch seinen eigenen Hunger und Durst, war er schließlich aufgestanden, um sich sofort ans Werk zu machen.
Mittlerweile war Lucie in einer Koppel untergebracht, die auch einen kleinen Teil des Baches mit eingrenzte, und die zudem einen wetterfesten Unterstand aufwies. Und sein Blockhaus war auch so gut wie bezugsfertig. Der aus Natursteinen und Lehm gemauerte Kamin war endlich trocken. Und sobald er darin ein anständiges Feuer angezündet hatte, wollte er endlich das Kaninchenragout zubereiten, auf das er sich schon den ganzen Tag freute.
Nach der Fertigstellung seiner Blockhütte, die er im Hinblick auf den kommenden Winter durch eine Vorratskammer erweitert hatte, gönnte sich Eric einen ganzen Tag zum Ausruhen und brach dann bei Sonnenaufgang auf, um endlich sein gesamtes Land zu besichtigen. Dabei wollte er auch herausfinden, wo genau er die Tiere finden konnte, deren Felle er zu erbeuten hoffte, und an welchen Stellen es sinnvoll sein würde, die Fallen aufzustellen, die er mitgebracht hatte. Da er sich noch nicht auskannte, und somit weder die Tücken des Geländes noch die Gefahren einschätzen konnte, die ihm möglicherweise drohten, ließ er Lucie am kurzen Zügel gehen, stets darauf gefasst, sie schnellstmöglich wenden oder zumindest zur Ruhe bringen zu müssen. Zudem achtete er darauf, dass weder er noch sein Pferd allzu viel Lärm machten, allein aus der Sorge heraus, sie könnten anderenfalls die unliebsame Aufmerksamkeit eines Raubtieres auf sich ziehen, welches irgendwo im Dickicht versteckt sein könnte.
Dass ihm genau dies bevorstand, ahnte Eric nicht, als er gegen Mittag einem unscheinbaren Trampelpfad folgend durch einen dichten Wald ritt und dabei auf einen riesigen Baum zu hielt, hinter dem sich offenbar eine Lichtung befand. Doch sobald seine Stute den dicken Stamm der uralten Eiche umgangen hatte, fiel sein Blick zunächst auf die Überreste eines Hirsches und dann auf den Braunbären, der gleich hinter dem Kadaver hockte.
Und dann ging alles ganz schnell.
Darum bemüht, nicht von seiner Stute zu fallen, welche vor Schreck auf die Hinterbeine gestiegen war und nun wie ein Zirkuspferd herumtanzte, nahm Eric aus den Augenwinkeln heraus eine leichte Bewegung neben sich wahr. Er traute sich jedoch nicht, beiseite zu schauen, weil er sonst den Pelzriesen nicht mehr im Blick gehabt hätte, der sich nun zu seiner vollen Größe aufrichtete. Als das Raubtier dann ein wütendes Knurren hören ließ und sogleich einen weiten Satz in seine Richtung machte, langte er reflexartig nach seinem Gewehr, dessen Futteral seitlich am Sattel festgemacht war, um es hastig aus der schützenden Umhüllung zu ziehen. Gleichzeitig spürte er etwas an seinem Arm zerren, und kippte auch schon zur Seite weg, derweil der Grizzly rasend schnell heranstürmte und seine mit Klauen besetzte Pranke in die Seite der panikartig herumwirbelnden Stute versenkte, die in ihrer Todesangst keinen Fluchtweg fand.
Wir müssen Rückenwind gehabt haben, schoss es Eric durch den Sinn, während sein Pferd umkippte und damit nicht nur ihn, sondern auch seinen Angreifer unter sich begrub. Wäre es anders gewesen, Lucie hätte sich garantiert nicht vorwärtstreiben lassen. Ihre schrillen Todesschreie in den Ohren fürchtete er gleichfalls um sein Leben, während der Bär weiterhin auf den zuckenden Laib der Stute einhieb und dabei auch den Bauchgurt des Sattels zerfetzte. Doch dann wurde ihm wieder bewusst, dass er immer noch den Schaft seines Gewehres in der rechten Hand hielt. Also kämpfte er sich so weit unter dem bebenden Pferdeleib hervor, dass er den Abzug durchziehen konnte.
Der donnernde Schuss des schweren Jagdgewehres verfehlte den rasenden Grizzly, der mittlerweile im Blutrausch war und somit kaum noch Interesse für seine Umgebung aufbrachte. Er versetzte ihm aber einen gewaltigen Schrecken, sodass er zunächst einen großen Sprung zur Seite tat, wo er sich ein wenig schüttelte und dann in weiten Sätzen davonsprang.
Einmal tief durchatmend erlaubte sich Eric nun zum ersten Mal einen längeren Seitenblick. Dabei bekam er ein dunkles, mit Weiß und Ocker bemaltes Jungmännergesicht zu sehen, aus dem ihm ein paar zornig funkelnde dunkle Augen anblickten, und schluckte erschrocken. Indianer? Hier gab es Wilde? Aber … Idiot, schalt er sich sogleich selbst. Natürlich gab es hier Indianer. Das war ja schließlich mit ein Grund dafür gewesen, dass niemand hier siedeln wollte. Die Stadt und damit die so genannte Zivilisation waren viel zu weit entfernt, als dass sie irgendeinen Schutz hätten darstellen können. Andererseits sah der Kerl hier nicht wirklich gefährlich aus. Zumindest hatte er keinerlei Ähnlichkeit mit den blutrünstigen Monstern, als welche die Rothäute in den Siedlungen der Weißen dargestellt wurden.
Während er sich gemeinsam mit dem Indianerjungen von der Last der mittlerweile toten Stute befreite, beschloss Eric, dass er das Urteil seiner Mitmenschen nicht so einfach übernehmen, sondern sich ein eigenes Bild machen wollte. Hätte man ihn umbringen wollen – angeblich ließ ja eine Rothaut einen Weißen niemals ungeschoren davonkommen – hätte man ihn sicherlich nicht zuerst vor einer reißenden Bestie gerettet.
Um ein gelassen wirkendes Auftreten bemüht, stellte sich Eric hin und ließ sich von Kopf bis Fuß mustern. Dabei begutachtete er sein Gegenüber auf die gleiche Weise. Am Ende streckte er die Hand hervor, mit der Absicht, so seinen guten Willen und seine Harmlosigkeit deutlich zu machen. Allerdings hatte er die Bewegung kaum ausgeführt, da hielt der Indianer bereits sein kleines Eisenbeil in der Faust und schlug ihm mit der abgeflachten Seite auf den Schädel.
In der Abenddämmerung erwachte Eric in der Behausung der Medizinfrau der Sippe, und kam anschließend kaum noch aus dem Staunen heraus, weil sie das größte Interesse daran zu haben schien, dass er wieder auf die Beine kam. Merkwürdigerweise begegneten ihm nach dem Verlassen ihres Zeltes auch die übrigen Sippenmitglieder allgemein mit Gleichmut und herablassender Freundlichkeit. Dennoch war er sich sofort im Klaren darüber, dass er sich in einer ziemlich heiklen Situation befand. Und das lag nicht nur daran, dass sich der Indianerjunge, der ihn zuerst vor dem Bären gerettet und dann niedergeschlagen hatte, äußerst angriffslustig gebärdete, sobald man aufeinandertraf.
Am Tag nach dem Vorfall im Wald wurde Eric dem Sippenoberhaupt vorgeführt. Dort bekam er dann anhand verschiedener Zeichen und Gebärden erklärt, dass er ein wichtiges Ritual gestört hatte. Als er schließlich begriff, dass es nicht nur um eine gescheiterte Jagd ging, wusste er zunächst nicht, wie er sich rechtfertigen oder entschuldigen sollte. Der Indianerjunge, der ihn niedergeschlagen und danach aus unerklärlichen Gründen in sein Dorf gebracht hatte, hatte nämlich im Laufe seiner Reifeprüfung beweisen wollen, dass er schon ein erwachsener Mann war, auch wenn er erst vierzehn Sommer zählte. Wenn es ihm gelungen wäre, den Grizzly in seine Falle zu locken, um ihn anschließend zu töten, wäre er in den Jagdtrupp des Stammes aufgenommen worden. Die Eingliederung in diese spezielle Gemeinschaft war sozusagen eine Auszeichnung für besonders mutige Männer. Sie schützten nicht nur das Dorf und die Sippen eigenen Pferde. Sie mussten auch den Stamm jederzeit mit genügend Fleisch versorgen, was bedeutete, dass sie tagtäglich ihren Mut und ihr Können zur Schau stellen konnten und dafür von allen bewundert wurden. Falkenauge war von der Statur her ein ausgewachsener Mann, würde nun aber für ein weiteres Jahr als Junge gelten, weil seine Jagd nicht erfolgreich gewesen war.
Mit dieser Erkenntnis blitzte auch eine Idee in Erics Kopf auf, die er sofort in die Tat umsetzen wollte. Sein Angebot, dass er einen Bären suchen und eigens für den Jungen erlegen würde, rief zunächst Verblüffung und dann herablassendes Gelächter hervor. Aber er gab nicht auf. Obwohl er wusste, dass der Häuptling nicht eine Silbe seiner Sprache verstand, fuhr er fort, auf den alten Mann einzureden. Immer wieder deutete er auf seinen Brustkorb, dann auf den jungen Indianer, und schließlich auf die ungelenke Darstellung eines Bären, die er eigenhändig in den sandigen Boden geritzt hatte.
Häuptling Grauer-Bär sah und hörte sich das eine geraume Weile scheinbar gelangweilt an. Doch dann entschied er aus einer Eingebung heraus, dass sein bereits gefasstes Urteil vielleicht doch nicht das richtige war. Dieses Bleichgesicht schien weder dumm noch verantwortungslos zu sein. Der junge Mann sah auch nicht so aus, als wäre er so leichtfertig wie die restlichen Angehörigen seiner Hautfarbe. Nein, er erweckte eher den Eindruck eines selbstsicheren und sehr bedachten Menschen, der sich nicht so schnell aus der Fassung bringen ließ. Auch wenn er nicht mehr als achtzehn Sommer zählen konnte, wirkte er so, als hätte er bereits viel Lebenserfahrung angesammelt. Vielleicht konnte Falkenauge einiges von dem Fremden lernen? Auch wenn sein Sohn nicht dumm war, war er doch oft sehr unbeherrscht und aufbrausend. Man konnte diese üblen Eigenschaften zwar mit seiner Jugend und Unerfahrenheit erklären, dennoch waren sie nicht länger hinzunehmen, zumal Falkenauge selbst als Erwachsener angesehen werden wollte.
Der Häuptling musterte zunächst seinen Sohn und versuchte dabei zu ergründen, wie dieser wohl auf sein Urteil reagieren würde. Danach taxierte er den Weißen-Mann mit einem langen prüfenden Blick. Am Ende nickte er bedächtig, so als wolle er seinen Beschluss bekräftigen, und nahm dann die autoritäre Haltung eines Despoten an, damit von vorneherein deutlich zu erkennen sei, dass er nun eine wichtige Entscheidung verkünden wollte.
„Du sollst eine neue Gelegenheit bekommen“, sagte er zu Falkenauge. „Er hat den Bären nicht getötet, sondern nur verjagt. Also wirst du das Tier wieder aufspüren und töten.“
Der junge Indianer starrte den Vater zunächst sprachlos vor Staunen an, denn so etwas hatte es bisher noch nie gegeben. Doch dann begann er unvermittelt zu strahlen, weil ihm aufging, dass er entgegen der geltenden Regeln einer Initiation eine zweite Chance bekommen sollte, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Aber Grauer-Bär war noch nicht fertig.
„Ihr werdet gemeinsam gehen“, sagte der Häuptling. „Er wird dein Schatten sein. Und du wirst sein Schatten sein. Ihr werdet füreinander da sein, bis die Jagd auf die eine oder andere Weise beendet wird.“
Das Stammesoberhaupt hatte kaum zu Ende gesprochen, da wurde Falkenauge so blass wie ein gebleichtes Leintuch, denn er wusste, was das bedeutete. Der Weiße-Mann würde mit einem dünnen Lederriemen, welcher eine Länge von etwa fünf Fuß haben würde, für einen ganzen Tag und eine ganze Nacht an sein eigenes Handgelenk gebunden. Von diesem Augenblick an würde keiner von ihnen auch nur einen Schritt alleine tun können. Danach würde der Riemen durchtrennt werden, damit sie sich unabhängig voneinander bewegen konnten. Aber das symbolische Aneinandergebunden-sein würde weiter bestehen, bis das erwählte Tier erlegt und der Beweis dafür ins Dorf gebracht worden war. Versuchte man seinen Schatten also frühzeitig loszuwerden, oder gar ganz von der Jagd auszuschließen, würde die Reifeprüfung abgebrochen und niemals wieder gestattet werden. Ein Mann, der sich von kindlichem Zorn und Trotz leiten ließ, und dabei sogar die Gesetze missachtete, die schon seit Anbeginn der Zeit galten, war es wirklich nicht wert, dass man ihm Achtung oder gar wohlwollende Anerkennung entgegenbrachte!
Im Hinblick auf die drohenden Konsequenzen bezähmte der junge Indianer seine Wut und die daraus resultierende Mordlust. Dennoch brodelte es in ihm, weil er sich durch Erics Teilnahme an der Jagd nicht nur gestört, sondern im wahrsten Sinne des Wortes betrogen fühlte. Sein Erfolg würde auch stets als der Erfolg des Bleichgesichtes erwähnt werden, grollte er insgeheim. Da er jedoch keine andere Wahl hatte, wollte er nicht zeitlebens als Kind angesehen werden und somit unwiderruflich aus der Gruppe der Jäger ausgeschlossen sein, biss er die Zähne knirschend aufeinander und fügte sich.
Unterdessen erklärte man Eric die Aufgabe, die er gemeinsam mit dem Jungen bewältigen musste, so gut man es eben konnte. Doch letztlich ging man davon aus, dass er von Falkenauge lernen konnte und würde, so wie dieser von ihm.
Die beiden jungen Männer wurden also aneinandergebunden und sich selbst überlassen, wobei es allen anderen Stammesmitgliedern strengstens verboten war, irgendeine Hilfestellung zu geben. Und so trottete Eric hinter dem Indianerjungen her, während dieser zunächst seine Alltagspflichten erledigte und dann mit den Vorbereitungen für die Jagd begann. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde er schließlich in eines der Zelte gezerrt, wo man ihm einen Schlafplatz gleich neben Falkenauges Lager zuwies, und lernte dabei die ersten Worte der fremden Sprache. Dass es sich dabei um wüste Beschimpfungen und äußerst hässliche Beleidigungen handelte, sollte er allerdings erst viel später erfahren.
Bei Sonnenaufgang suchte Falkenauge ein braves Pferd aus der Herde des Stammes heraus, da er sicher sein wollte, dass sein Jagdgefährte nicht stürzte und somit den Lederriemen vorzeitig zerriss. Weil er selbst jedoch ohne Sattel ritt, dachte er gar nicht daran, dass sein Schatten vielleicht einen brauchte. Erst als er auf dem Rücken seines Ponys saß, bemerkte er den Weißen Mann, der ein wenig skeptisch das ihm zugedachte Pferd betrachtete und offenbar überlegte, wie er denn nun aufsteigen sollte, wo doch kein Steigbügel zur Verfügung stand. Ein abfälliges Grinsen auf den Lippen reichte er dem Bleichgesicht schließlich eine Hand und nickte ihm gleichzeitig aufmunternd zu. Der Weißhintern würde seine liebe Not haben, dachte er gehässig, während sich sein unwillkommener Begleiter auf das Pferd schwang. Das Reiten auf einer Pferdedecke allein erforderte nämlich weit mehr körperlichen Einsatz als mit einem Sattel. Spätestens wenn die Sonne senkrecht über dem Land stand, würde er sich nicht mehr auf dem Pony halten können, weil er sich dann sicher einen Wolf geritten hatte.
Hätte der junge Indianer gewusst, dass sein Begleiter nur dann einen Sattel benutzte, wenn er auf eine längere Erkundungstour oder auf die Jagd ging, weil er ihn allein für die Unterbringung seiner Gebrauchsgegenstände brauchte, er wäre vermutlich nicht so voller erwartungsfroher Schadenfreude gewesen. Eric hatte im Grunde bloß gezögert, weil er sich nicht sicher gewesen war, ob das Tier ihn, einen völlig Fremden, akzeptieren würde. Schließlich wusste er aus eigener, ziemlich schmerzhafter Erfahrung, dass Pferde manchmal sehr bockig reagierten, wenn ihnen ein Reiter nicht passte. Als er jedoch merkte, dass der Wallach ein vollkommen ausgeglichenes Wesen besaß, und ihn zudem auch noch zu mögen schien, entspannte er sich.
Grauer-Bär schaute den Reitern unter halb geschlossenen Lidern nach, während sie die Siedlung des Stammes verließen. Im Stillen hoffte er, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, denn die beiden jungen Männer hatten jeweils nur ein Messer und ein Eisenbeil zur Verfügung, um den Bären zur Strecke zu bringen. Sollte sich das Ganze als Fehler erweisen, waren nämlich auch seine Tage als Häuptling gezählt. Weil er sich aus Liebe zu seinem Sohn über den üblichen Ablauf der Stammesriten hinweggesetzt hatte, die im Laufe eines Jahres nur einen Versuch erlaubte, den Übergang vom Kind zum Mann zu bewältigen, würde man ihm nicht verzeihen, wenn dabei ein Leben ausgelöscht wurde. Auch wenn es das Bleichgesicht treffen sollte, würde man ihn – Grauer-Bär – für dessen Schicksal verantwortlich machen!
Falkenauge nahm die Spur des Bären an der Stelle wieder auf, an der er sie verloren hatte, nämlich dort, wo er dem Weißen-Mann zum ersten Mal in seinem Leben begegnet war. Wäre er allein gewesen, er hätte das Tier vermutlich innerhalb eines Tages, wenn nicht sogar nach wenigen Stunden wieder gestellt. So aber musste er immer wieder auf seinen Begleiter Rücksicht nehmen, der sich zwar bemühte, sein Pferd im Gleichschritt mit dem anderen Pony laufen zu lassen, der jedoch nicht immer auf gleicher Höhe bleiben konnte, weil das manchmal unwegsame Gelände dies nicht zuließ.
Sein Temperament mit aller Macht zügelnd, begann Falkenauge schließlich einige Dinge anhand von Zeichensprache und langsamer Sprechweise zu erklären, weil er mittlerweile begriffen hatte, dass sie nur gemeinsam vorankommen konnten. Dass der Weiße-Mann ihn zu verstehen schien, auch wenn er die Sprache nicht beherrschte, fand er dabei sehr interessant. Und so schlich sich ganz allmählich eine Art leichter Bewunderung für seinen Jagdgefährten bei ihm ein, auch wenn er dies zunächst nicht wahrhaben wollte.
Eric lernte tatsächlich in kürzester Zeit die wichtigsten Worte, die er zur Verständigung mit seinem Begleiter brauchte. Als sie nach zwei Tagen endlich eine ganz frische Spur des Bären entdeckten, wurde die gegenseitige Warnung und das weitere Vorgehen mit einigen knappen Sätzen, sowie entsprechende Gesten ausgedrückt und festgelegt.
Ein fast unsichtbarer Trampelpfad verriet den Weg des riesigen Pelztieres, welches sich erst durch das hochwachsende Gras der Steppe fortbewegt hatte und dann in den Wald verschwunden war. Also ließen die jungen Männer ihre Pferde zurück, die aufgrund des Gegenwindes vor dem bedrohlichen Geruch des Raubtieres scheuten, und gingen zu Fuß weiter, um so lange als möglich unentdeckt bleiben zu können. Ein Bär war verfressen und tückisch, aber er war beileibe nicht dumm. Und er kannte sein Revier wie kein anderer. Wildpferde waren in dieser Gegend zwar nicht ungewöhnlich, wagten sich jedoch nie ohne triftigen Grund in das dichte Unterholz des Waldes hinein. Und die Anwesenheit gleich zweier dieser scheuen Huftiere in seiner näheren Umgebung hätten dem Grizzly sofort klargemacht, dass da auch Menschen sein mussten.
Eric folgte Falkenauge auf dem Fuße, immer darauf bedacht, keinen unnötigen Laut zu verursachen. Auch wenn er sich bis vor wenige Wochen bloß als sogenannter Freizeit-Jäger betätigt hatte, wusste er genau, worauf es nun ankam.
So als hätten sie schon immer gemeinsam gejagt, arbeiteten der Indianer und der Weiße-Mann Hand in Hand, ohne dass es vieler Worte bedurft hätte. Und so brauchten sie nur eine gute Stunde, um eine mannshohe Grube mittels gefundener Beckenknochen eines großen Hirsches aus dem weichen Untergrund herauszuarbeiten und mit Zweigen und Blättern abzudecken. Am Ende konnte man die getarnte Falle kaum mehr vom normalen Waldboden unterscheiden. Allerdings waren die Vorbereitungen damit noch längst nicht beendet. Selbst wenn der Bär vorübergehend in eine für ihn ungünstige Angriffsposition geriet, war er immer noch eine tödliche Gefahr, der man nicht unbedingt zu nahe kommen wollte. Also ging Falkenauge daran, einen Speer herzustellen, indem er sich einen langen, geraden Ast suchte, den er von den kleineren Auswüchsen befreite.
Eric tat es ihm umgehend nach, denn auch ihm war klar, dass man sich aus der Reichweite des Raubtieres fernhalten musste, wollte man nicht von den scharfen Krallen aufgeschlitzt werden. Es war daher nur logisch, dass man eine Waffe brauchte, die man mit Schwung werfen konnte, damit sie am Ende nicht nur ihr Ziel traf, sondern auch tötete.
Sobald sie die Stäbe fertig hatten, lösten beide die Reste des durchtrennten Lederriemens von ihren Handgelenken und befestigten anschließend ihre Messer an den Spitzen ihrer Wurfgeschosse. Jeweils den Speer in der einen und das Eisenbeil in der anderen Hand haltend, machten sie sich anschließend auf den Weg, um den Bären auf sich aufmerksam zu machen.
Das war eigentlich nicht schwierig, denn der Grizzly hatte sich gerade erst mit sehr viel Mühe eine schmackhafte Wurzel ausgegraben und war allein wegen seines noch nicht gestillten Hungers gereizt. Als dann plötzlich zwei laut kreischende Störenfriede aus dem Dickicht hüpften, die mit ihrem Radau seine Mahlzeit störten, geriet er in maßlose Wut. Der Koloss warf sich also mit einem einzigen Satz herum und brüllte dabei seinen Zorn laut heraus. Gleich darauf setzte er sich in Bewegung und wurde dann immer schneller.
Die beiden jungen Männer hatten ihre liebe Not, um bei der anschließenden Verfolgungsjagd nicht selbst zur Beute zu werden. Immer wieder schauten sie sich um, um den Abstand zu dem Bären überprüfen zu können, und rannten gleichzeitig in die Richtung der vorbereiteten Falle. Dabei saß ihnen ständig die Angst im Nacken, dass der Bär doch schneller sein könnte als sie.
Als der Pelzriese schließlich mit einem schmerzvollen Stöhnen in der Fallgrube landete, verlangsamte die Jäger ihren Lauf und blieben schließlich nach Atem ringend stehen. Allerdings dauerte die Ruhepause nicht lange an, denn der Grizzly brauchte nur wenige Sekunden, um sich wieder zu fangen. Sein zorniges Grollen schallte durch den Wald, während er sich auf die Hinterbeine stellte und mit den Vorderläufen den Rand der Grube nach der bestmöglichen Stelle abtastete, an der er sich wieder hinaufziehen konnte.
Falkenauge und Eric zuckten zunächst erschrocken zurück, denn das wütende Gebrüll des Raubtieres klang sehr bedrohlich. Doch dann nahmen sie sich zusammen und gingen zur Falle zurück. Sie blieben aber in gebührenden Abstand stehen, denn das aufgebrachte Tier war bereits kurz davor, aus der Falle herauszuklettern.
Eric sah den jungen Indianer seinen Speer heben und tat es ihm augenblicklich nach. Dabei mahnte er sich selbst zur Zurückhaltung, weil er wusste, wie wichtig es für den Jungen war, dass er den Bären erlegte. Erst wenn es Falkenauge nicht gelingen sollte, sofort das Herz des Bären zu treffen, würde er eingreifen, nahm er sich vor. Blieb allerdings zu hoffen, dass der Indianerjunge gut zielen konnte, denn ein verletzter Bär war mindestens doppelt so gefährlich als sonst!
Falkenauge stellte sich unterdessen wohlüberlegt in Position und zielte sorgfältig. Er schickte seinen Speer jedoch erst in dem Augenblick ab, als das Tier, das mittlerweile außerhalb der Fallgrube angelangt war, sich auf die Hinterbeine stellte, um sich aufrecht auf seine Gegner stürzen zu können. Zudem legte der junge Jäger so viel Kraft in seinen Wurf, dass sich das scharf geschliffene Messer völlig mühelos durch die mit Pelz besetzte Haut des Bären bohrte, danach die darunter liegende Muskulatur durchschnitt, anschließend zwischen den Rippen hindurchrutschte, und am Ende im Herzen stecken blieb.
Die Zeit bis zum endgültigen Zusammenbruch des Bären kam Eric wie eine Ewigkeit vor, denn das Tier stand einen Augenblick wie zu Eis erstarrt. Dann begann es nach dem Speerschaft zu greifen und gleichzeitig stöhnend zu schwanken. Am Ende torkelte es unkontrolliert zurück und kippte schließlich mit einem gurgelnden Seufzer in die Fallgrube hinein.
Eric war von dem Schauspiel dermaßen fasziniert, dass er kaum noch auf seine Umgebung achtete. Erst als er den Blick von dem toten Grizzly löste, der nun reglos in der Grube lag, wurde ihm bewusst, dass sich der junge Indianer auf den Knien befand. Gleich darauf wurde ihm auch klar, dass es sich dabei eindeutig um eine Gebetshaltung handelte. Und so staunte er einmal mehr über die Tatsache, dass die sogenannten Wilden ihr Leben nicht nur nach klar definierten Gesetzen organisierten, sondern auch so etwas wie eine Gottheit besaßen, zu der sie aufblickten und die sie anbeteten. Die Worte von Falkenauge verstand er zwar nicht, aber die Figuren, die der Junge in die Erde kratzte, und die Zeichensprache, die er mit seinen Händen vollführte, waren ihm durchaus verständlich. Stumm und voller Ehrfurcht sah er einen Augenblick lang zu, und war am Ende versucht, sich dem Dankgebet an das allmächtige Wesen anzuschließen, das nicht nur eine gelungene Jagd ermöglicht, sondern auch zwei Menschenleben behütet hatte. Als ihm jedoch einfiel, dass Gott, laut seines irdischen Diners in der Kirche von Oaktown, kein fürsorglicher Beschützer, sondern ein rachsüchtiger Despot war, dessen einziges Interesse der absoluten Gehorsamkeit seiner Schöpfung galt, und dem es gänzlich egal schien, ob die Menschen sich untereinander vertrugen oder genug zu essen hatten, verscheuchte er diese Regung. Stattdessen konzentrierte er sich wieder auf Falkenauge, der sich mittlerweile aufgerappelt hatte, um sich seine Beute genauer anzusehen.
In diesem einzigartigen Moment wusste Eric nicht, welches Gefühl in ihm mehr überwog. Er war zutiefst erleichtert, weil die ganze Sache so gut geklappt hatte. Außerdem empfand er unbändigen Stolz über die ansehnliche Jagdbeute, obwohl er den Todesstoß nicht selbst ausgeführt hatte. Aber das stärkste Gefühl schien doch die Freude darüber zu sein, dass Falkenauge ihm nicht weiter feindlich gesonnen war.
In den folgenden Stunden hatten die Jäger alle Hände voll zu tun, bevor sie den Rückweg zur Indianersiedlung antreten konnten. Den Pelz und einige große Brocken Fleisch wollten sie als Geschenk für Geisterfrau mitnehmen. Herz, Leber und Zunge sollte der Häuptling bekommen, damit die Stärke seines Geistesbruders auf ihn überging und ihm so Gesundheit und ein langes Leben bescherte. Die Reißzähne und die scharfen Klauen des Tieres brauchte Falkenauge für seinen Mannes-Schmuck. Dafür mussten sie sich aber noch einmal gewaltig anstrengen, denn der Bär wollte diese Trophäen nicht so einfach hergeben. Den Rest des Kadavers hievten sie aus der Grube, und warfen ihn in den Wald hinein, wo er von kleineren Raubtieren gefressen werden sollte. Zu guter Letzt musste die Fallgrube wieder zugeschüttet werden, damit kein unschuldiges Tier dort hineingeriet, welches dann qualvoll verenden musste, weil kein Jäger bereitstand, um es durch einen schnellen Tod zu erlösen.
Seine Rückkehr und die offenkundig erfolgreiche Jagd riefe einiges Aufsehen hervor, was Falkenauge sichtlich genoss. Also hielt sich Eric bewusst zurück, damit der Junge seinen Triumph auskosten konnte. Nichtsdestotrotz war auch er von einer euphorischen Freude erfüllt, die ihn breit grinsen ließ.
Geisterfrau nahm das Bärenfleisch in Empfang, ganz so, wie es sich gehörte. Allerdings übergab sie es gleich darauf der Gefährtin des Häuptlings, die mit zwei anderen Indianerinnen bereitstand. Die Heilerin war erfahren, was Kräuter und ganzheitliche Medizin betraf. Doch das Kochen überließ sie lieber den anderen Frauen, weil sie sicher war, dass diese im Gegensatz zu ihr selbst ein köstliches Mahl daraus bereiteten würden, welches am Abend an die Gemeinschaft der Jäger verteilt werden sollte. Es sollte schließlich ein besonderes Fest werden, rechtfertigte sie sich.
Der Häuptling dankte der Höchsten-Macht in aller Stille dafür, dass er seine Entscheidung nicht bereuen musste. Das Bleichgesicht und der Rote-Mann hatten ganz offensichtlich viel voneinander gelernt, stellte er zufrieden fest. Und so, wie es aussah, schienen sie sogar so etwas wie Freundschaft geschlossen zu haben.
Da es Eric augenscheinlich nicht eilig hatte, zu seiner Blockhütte zurückzukehren, überließ man ihm ein kleines Lederzelt und ein paar Schlaf-Felle, damit er es ein wenig bequemer haben sollte. Unterdessen wurde die Verständigung immer besser, weil er die Indianersprache schnell begriff und somit jeden Tag mehr lernte. Schließlich nahm ihn die Medizinfrau wieder unter ihre Fittiche, um ihm die Bräuche und Stammesriten zu erklären. Im Grunde brauchte und wollte sie keinen Schüler, denn sie hatte eigentlich alle Hände voll damit zu tun, ihre Nachfolgerin auszubilden. Dennoch befasste sie sich sehr intensiv mit dem Weißen-Jäger, indem sie seine Fragen beantwortete und sogar ein paar Überlieferungen zum Besten gab, die noch nicht einmal Leute von ihrer Sippe kannten.
Warum seine Lehrerin dies alles tat, erklärte sie nicht. Doch Eric ging davon aus, dass sie wohl gemerkt haben musste, wie groß sein Interesse an der indianischen Kultur und den Menschen an sich war. Als er schließlich bei einem dieser Treffen erfuhr, dass die Indianer im Spätherbst zu ihrem Winterlager zogen, war er sehr überrascht, denn bisher hatte er es als selbstverständlich angenommen, dass sie immer im gleichen Tal lebten.
Es war Grauer-Bär, der ihm schließlich die Gründe erklärte. Die Sippe, bei der er sich augenblicklich befand, sei ja nur ein kleiner Teil des Großen-Volkes, welches in mehr oder weniger großen Familienverbänden weit über das Land verstreut lebte. Einmal im Jahr fand jedoch eine Versammlung aller Sippen statt. Wenn der Herbst ging und die kalte Jahreszeit des Winters begann, zogen alle Gemeinschaften zu einem bestimmten Berg, der ihnen heilig war. An diesem Ort der Besinnung wurden verwandtschaftliche Bande gefestigt, Neuigkeiten erzählt und erörtert, und reger Tauschhandel getätigt. Bis zum Frühlingsanfang verbrachte man die Zeit mit gemeinsamen Aktivitäten, die sich zum größten Teil in der Nähe heißer Quellen abspielten. In diesen vier Mondzyklen bezeugten die einzelnen Sippen dem heiligen Berg immer wieder ihre Verehrung, indem sie verschiedene Tänze und Rituale zelebrierten. Außerdem diente das Winterlager nicht zuletzt dazu, die eigene Gemeinschaft durch frisches Blut aufzufrischen, indem man neue Mitglieder anwarb oder eigene Leute gehen ließ, damit sie sich in eine andere Gruppe einfügen konnten.
Nach dieser Unterhaltung, die überwiegend durch Gebärdensprache und in den Boden geritzten Zeichnungen vonstattengegangen war, verstand Eric endlich auch die rege Betriebsamkeit der Frauen, die ständig an irgendwelchen Kleidungsstücken arbeiteten, denn diese waren für den Handel im Winterlager bestimmt. Dafür würde man Dinge eintauschen, die man nicht selbst herstellen konnte. Eines dieser begehrten Dinge war das Salz, welches von einer anderen Sippe in einer weit entfernten Gegend vom Grund eines Salzsees aufgesammelt und mitgebracht wurde. Eine andere Sache waren die Eisenteile, die eigentlich vom Weißen-Mann stammten und seit einiger Zeit immer mehr die Steinwerkzeuge ersetzten, und die man nur bekam, wenn man genügend Pelzen oder Ponys dafür hergab.
2
Die Zeit schien wie im Flug zu vergehen. Eric wusste mittlerweile, wie man einen Bogen samt Pfeilen herstellte und erfolgreich gebrauchte. Zudem hatte er sich von den Frauen einiges über die Konservierung ihrer Wintervorräte abgeguckt, was ihm bisher nicht bekannt gewesen war. Er wollte seinen Gastgebern jedoch nicht länger zur Last fallen, sondern zu seiner eigenen Hütte zurück, weil er sich ebenfalls für den Winter vorbereiten musste. Da er aber kein eigenes Pferd mehr hatte, wollte er sich jetzt eines von seinen neuen Freunden kaufen.
Die Indianer hatten eine große Auswahl anzubieten, und verlangten auch nicht viel für ein Pony. Eric sollte ihnen bloß seine beiden Messer mit den scharf geschliffenen Stahlklinge überlassen. Als er jedoch seine Entscheidung kundtat, verzichteten sie laut lachend auf den ausgehandelten Kaufpreis, denn er hatte sich ihrer Meinung nach das verrückteste und ungebärdigste Tier ausgesucht, welches überhaupt in ihrer Herde zu finden war. Der fuchsfarbene Hengst war außergewöhnlich schön und temperamentvoll, ließ jedoch keinen Menschen an sich heran. Er wurde von den Indianern nur zu Zuchtzwecken in der Herde geduldet, weil er jedem seiner Nachkommen außer große Intelligenz und einem guten Charakter auch äußerste Zähigkeit und Genügsamkeit vererbte.
Dass Eric unbedingt den ‚Verrückten‘ haben wollte, ohne auf ihre Warnungen zu hören, bestätigte die Indianer in ihrer Annahme, der Weiße-Mann hätte keine Ahnung von Pferden. Man half ihm zwar, das widerspenstige Tier einzufangen, ließ ihn aber mit der schwierigen Aufgabe der Zähmung völlig allein.
Das Tier war nicht nur völlig durchgedreht, sondern schien auch bösartig zu sein, denn es biss und trat, sobald man auch nur in seine Nähe kam. Dennoch ließ sich Eric nicht entmutigen. Mit unendlicher Geduld und Konsequenz gewöhnte er den Hengst zuerst an seine ständige Anwesenheit. Dadurch bescherte er den Indianern ein immer neues Schauspiel, welches sie sich nicht ein einziges Mal entgehen ließen. Für sie war es ja nicht nur interessant, der Vorgehensweise des Bleichgesichtes zuzusehen, sondern auch amüsant, die Reaktionen des Hengstes zu beobachten.
Eric brauchte einige Tage, bis sich das Tier von ihm anfassen ließ. Danach dauerte es noch ein paar weitere Tage, bis er davon ausging, dass er nun endlich eine leichte Decke auf dessen Rücken legen könnte, um zu sehen, wie es reagieren würde.
Der Hengst legte zwar die Ohren an, blieb aber stocksteif stehen, als sein neuer Herr an ihn herantrat. Nur das leichte Zittern seiner Flanken verriet, wie aufgeregt er wirklich war, während er den Menschen und das Ding in seinen Händen keine Sekunde aus den Augen ließ.
Unterdessen redete Eric beruhigend auf das Tier ein. Gleichzeitig hielt er ihm die dicke Filzmatte vor die weit aufgeblähten Nüstern, damit es den Geruch aufnehmen und erkennen konnte, dass es sich um einen ungefährlichen Gegenstand handelte. Danach trat er an die Seite des Pferdes, um von hier aus die Decke auf dessen Rücken zu legen.
Kaum war dies geschehen, ruckte der Kopf des Hengstes herum, wobei seine großen intelligenten Augen zwischen dem menschlichen Gesicht und der Decke hin und her wanderten. Dann, ohne jede Vorwarnung, reagierte der Vierbeiner. Ohne dass sein Herr es verhindern konnte, schnappte das Pferd mit den Zähnen nach einem Zipfel der Filzmatte und zerrte sich diese vom Rücken herunter. Danach warf es sich das Teil vor die Vorderfüße und setzte anschließend einen seiner Hufen darauf. Gleich darauf ruckte der wohlgeformte Kopf wieder nach hinten, was im ersten Moment tatsächlich so wirkte, als wolle sich das Tier vergewissern, dass der Mensch auch genau gesehen hatte, was da vor sich gegangen war.
Für einen Atemzug völlig perplex, weil er mit solch einem Verhalten nicht gerechnet hatte, schnaubte Eric im nächsten Moment hörbar, um seinen Unmut deutlich zu machen. Auch wenn er sich innerlich ein Lachen verkneifen musste, stellte er sich jetzt mit todernstem Gesicht in Augenhöhe mit dem Pferd auf. Anschließend bückte er sich und klopfte mit einigen festen Schlägen gegen das Vorderbein des Hengstes, dessen Huf immer noch auf der Filzmatte stand. Als das Pony daraufhin reflexartig das Bein anhob, zog er die Filzmatte sofort weg und hob sie dann auf. Gleich im Anschluss wiederholte er die vorangegangene Prozedur, ungeachtet der laut johlenden Menschen, die sich wie immer eingefunden hatten, um sein Tun zu beobachten.
Eric brauchte mehrere Anläufe, doch dann wurde es dem Hengst schließlich zu dumm, sodass er die Filzmatte endlich dort ließ, wo sein Herr sie hingelegt hatte, nämlich auf seinem Rücken. Zur Belohnung bekam er einen kleinen Apfel, den er sogleich mit sichtlichem Genuss verschlang.
Mit solcher Verfahrensweise arbeitete sich Eric langsam voran. Nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld erreichte er letztlich sein Ziel. Als dann das Zaumzeug angelegt werden sollte, rastete das Tier jedoch vollkommen aus und trat wie angestochen um sich.
Eric konnte sich dieses Verhalten zunächst nicht erklären, denn der Hengst ließ sich mittlerweile von ihm aufsatteln und führen, wie ein treuer Hund. Aber sobald er auch nur in die Nähe des Kopfes kam, wich das Tier voller Panik zurück. Also überlegte er einen Augenblick und band den Hengst schließlich an einem Strauch fest, um anschließend mit gezielten Schritten zum Zelt der Medizinfrau zu marschieren.
Nachdem der Weiße-Mann der Heilerin erklärt hatte, was er von ihr brauchte, nickte sie bloß. Gleich darauf stellte sie die gewünschte Kräutermischung zusammen und zerstampfte alles zu einem feinen Pulver. Dieses vermengte sie anschließend in einer flachen Holzschüssel mit Wasser zu einem zähflüssigen Brei. Am Ende überreichte sie ihm das Gefäß und wünschte ihm Glück.
Auf dem Rückweg zu seinem Pferd riss Eric einige Büschel Gras aus und bedeckte damit das Gebräu in der Schüssel. Zudem legte er noch einen überreifen Apfel darauf, damit der intensive Duft der Frucht den Geruch der beruhigenden Kräuter überdecken sollte.
Da der Hengst seit Stunden nichts zu fressen bekommen hatte, schlang er natürlich alles in Windeseile hinunter, sodass man anschließend nur noch abwarten musste, bis die Medizin von Geisterfrau seine volle Wirkung entfaltete.
Während das Pferd eine Weile später in die Knie ging, um sich gleich darauf auf die Seite zu legen und die schönen großen Augen zu schließen, begann Eric mit seiner Arbeit. Mit einigen sicheren Griffen packte er den edlen Pferdekopf und schob das weiche Pferdemaul an den Seiten auseinander, damit er die starken Zähne begutachten konnte, die jetzt nach und nach sichtbar wurden. Als er kurz darauf seinen Verdacht bestätigt fand, ließ er das Tier gleich wieder los und stürmte erneut zum Zelt der Heilerin.
Eric brauchte nichts zu erklären, denn Geisterfrau schien genau zu wissen, warum er schon wieder da war. Und so kehrte er nur einige Augenblicke später mit ihr im Schlepptau zurück. Gemeinsam machten sie sich sogleich daran, den schief gewachsenen Backenzahn herauszuziehen, der ein unangenehmes Stechen auslöste, sobald man von außen an die Wange des Tieres drückte. Das war nämlich der einzige Grund dafür, warum der Hengst seit dem ersten Versuch, ihm ein Halfter anlegen zu wollen, jegliche Annäherung von menschlicher Seite vereitelt hatte, denn er wollte sich verständlicherweise vor neuerlichen Schmerzen schützen.
Nachdem der Übeltäter entfernt war, versorgte Geisterfrau die blutende Lücke mit einer Paste aus blutstillenden Kräutern und klopfte anschließend anerkennend auf Erics Schulter.
„Du bist ein wahrer Pferdemann“, sagte sie ernst.
Damit hatte er seinen Stammesnamen weg. Niemand rief ihn mehr bei seinem alten Namen, denn ab sofort war er für alle nur noch der Pferdemann, der im Geist verrückter Pferde forschen und sie wieder normal werden lassen konnte.
Da sich der Hengst nach gebührender Erholungspause widerstandslos aufzäumen ließ, sammelte sein Herr seine Sachen zusammen und verabschiedete sich. Er war viel länger weggeblieben als ursprünglich geplant, und musste sich nun beeilen, damit sein Arbeitspensum bis zum Wintereinbruch erledigt werden konnte.
*
Es wurde ein harter Winter für Eric, wobei ihm die Kälte weit weniger zusetzte als die absolute Einsamkeit, die er in seinem selbst gewählten Exil durchstehen musste. Allein die Ausflüge in die Natur, bei welchen er eine große Anzahl wertvoller Pelze erbeutete, entschädigten ihn ein wenig für die Düsternis seiner Blockhütte. Die dicken Holzwände hielten die Wärme im Inneren, doch die winzige Fensteröffnung ließ kaum Sonnenlicht herein. Als die Tage dann endlich wieder ein wenig länger wurden, brachte er die Felle nach Oaktown zum Laden seines Vaters. Dort erhielt er vom diesem zwar kein freundliches Wort, dafür aber eine ansehnliche Summe für seine Lieferung. Anschließend kaufte er Bohnen, Mehl sowie ein paar metallener Gerätschaften, und machte sich dann umgehend wieder davon, weil er die Stadt so schnell als möglich hinter sich lassen wollte. Allein die Tatsache, dass er seine Schwester nicht angetroffen hatte, tat ihm leid, denn sie war die einzige Person, die er von Herzen liebte und darum wirklich vermisste. Allerdings verflog seine sentimentale Anwandlung sehr schnell, sobald ihm einfiel, wie kühl und abweisend sie sich immer gab, sobald er in ihre Nähe kam.
*
Das Frühjahr ging bereits zur Neige, als Eric entschied, dass ein Besuch bei den Indianern eine hervorragende Idee sei. Also packte er ein paar Dinge zusammen, die er gegen andere Sachen eintauschen wollte. Danach sattelte er seinen Hengst, der mittlerweile den Namen Boy statt Verrückter trug, und ritt los.
Im Indianerdorf wurde Eric sogleich wie ein lang vermisster Freund begrüßt. Er hatte jedoch vom ersten Augenblick an nur Augen für eine Frau, die neu in der Gemeinschaft war, und die ihm so wunderschön und begehrenswert erschien, dass er kaum fähig war, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.
„Sie heißt Kleine-Eule“, verriet Falkenauge, sobald ihm aufging, was den Weißen-Mann bewegte. „Sie ist die Tochter meiner Mutter und wurde geboren, lange bevor meine Mutter sich mit Grauer-Bär zusammengetan hat. Sie ist vorletzten Winter mit einem Mann gegangen, der sie nicht gut behandelt hat. Darum hat sie beschlossen, dass sie nicht länger bei ihm bleiben, sondern mit uns zurückkommen will. Wenn du willst, bringe ich dich in ihr Zelt. Könnte mir vorstellen, dass du ihr gefällst.“
„Hm, nein … Danke. Wirklich …“ Eric war es peinlich, dass seine Gedanken so deutlich zu erkennen waren. Als er dann auch noch das wissende Grinsen auf den Lippen seines jungen Indianerfreundes entdeckte, fühlte er noch mehr Hitze in seine Wangen schießen.
„Sie würde dich bestimmt nicht im Regen stehen lassen“, versuchte Falkenauge es erneut, nachdem er einen gleichsam interessierten Blick von Kleine-Eule aufgefangen hatte. „Wäre vielleicht ganz interessant für dich.“ Ja, dachte er, die beiden würden bestimmt viel Spaß aneinander haben. Kleine-Eule war nämlich noch nie abgeneigt gewesen, einen jungen Mann in die Geheimnisse der körperlichen Liebe einzuweihen, weil sie selbst die größte Freude daran hatte, aus einem unwissenden Jungen einen erfahrenen Liebhaber zu machen. Dabei war sie beileibe keine Ausnahme. Hohe-Weide – seine eigene Lehrmeisterin und Geliebte – war zwar schon seit zehn Sommern die Gefährtin eines anderen Mannes, aber trotzdem nicht abgeneigt, hin und wieder in das Zelt des jüngsten Jägers zu kommen.
Eric stand wie festgenagelt auf der Stelle, nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen. Zum einen wünschte er sich mehr als alles andere, die schöne Frau aus der Nähe betrachten und sie vielleicht sogar anfassen zu können. Zum anderen wollte er sofort wieder auf sein Pferd steigen und umgehend das Dorf verlassen, weil ihm die Intensität seines Verlangens nicht normal erschien. Erst als Falkenauge ihn kurz entschlossen am Arm packte und einfach mitzog, unternahm er einen halbherzigen Abwehrversuch, der erwartungsgemäß keinen Erfolg brachte. Also gab er sich geschlagen und gehorchte nur noch. Allerdings wurde er immer aufgeregter, je näher sie Kleine-Eule kamen, sodass die folgenden Minuten wie ein böiger Wind an ihm vorbeirauschten, der jegliches Geräusch mit sich nahm und nur ein leichtes Summen in den Ohren hinterließ. Er sah zwar Falkenauge ein paar Worte mit dessen Halbschwester wechselte, verstand jedoch nicht eine Silbe davon. Erst als sich sein Freund mit einem vielsagenden Grinsen verabschiedete und sogleich davonmachte, durchfuhr ihn ein heißer Schrecken, weil er nicht wusste, was er als Nächstes tun sollte.
Wie er in das Zelt von Kleine-Eule hineingekommen war, wusste Eric später nicht mehr zu sagen. Ebenso wenig konnte er sich erklären, wie es dazu kommen konnte, dass er am helllichten Tag seine gesamte Kleidung abgelegt und sich in hemmungsloser Leidenschaft mit der bis dato völlig fremden Frau vereinigt hatte, während rings herum die anderen ihrem täglichen Geschäft nachgegangen waren und garantiert mitbekommen hatten, was er da tat. Sicher, Kleine-Eule war ihm willig entgegengekommen und hatte ihm ein Erlebnis beschert, dass er Zeitlebens nicht mehr vergessen würde. Dennoch plagte ihn das schlechte Gewissen, sobald sein körperliches Verlangen befriedigt war. Auch wenn er die Lehren des christlichen Priesters nicht wirklich akzeptieren wollte, hielt er außereheliche Wollust für Sünde.
„Ich will, dass du meine Frau wirst“, erklärte er, sobald er wieder vollkommen bekleidet war. Als Kleine-Eule daraufhin sichtlich verwundert die Augenbrauen hob, beeilte er sich, eine glaubhafte Erklärung abzugeben: „Ich … Du bist eine wunderschöne und großartige Frau. Und ich habe … Ich hätte gern, dass du mit mir kommst.“
„Nein.“ Weil er beim Klang dieses einzelnen Wortes wie unter einem Hieb zusammenfuhr, stand sie auf und legte ihm die Arme um den Hals. Anschließend küsste sie ihn leicht auf die Stirn, bevor sie fortfuhr: „Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du willst. In meinem Zelt wird immer ein Platz für dich sein. Aber mit dir gehen will ich nicht, denn ich kann dir nicht mehr bieten als einen warmen Schlafplatz und meinen Körper. Du bist jung. Du brauchst eine Frau, die dir Kinder schenkt.“
Er wollte protestieren, kam jedoch gar nicht erst dazu, auch nur eine Silbe vorzubringen, denn sie ließ es nicht zu. Seinen Mund mit ihren Lippen verschließend, zog sie ihn erneut aus, und ließ ihn dann ein weiteres Mal vergessen, dass es außerhalb der Zeltwände immer noch heller Tag war.
„Sie ist nicht die Frau, die zu dir gehört“, erklärte Geisterfrau, sobald Eric sie fragte, welche Bedingungen er erfüllen müsse, damit man ihm Kleine-Eule zur Frau gab.
„Woher willst du das wissen?“, fuhr er ärgerlich auf.
„Weil sie ein unsteter Zugvogel ist. Und weil es so auf der Tafel der Gefährten geschrieben steht“, beschied ihm die Medizinfrau im ungnädigen Tonfall. „Kleine-Eule ist ein guter Mensch. Aber sie ist nicht die, mit der du dein Leben teilen sollst. Nimm sie dir, solange sie es dir erlaubt. Mach dir eine schöne Zeit mit ihr. Lerne, was du von ihr lernen kannst, und lass sie dann gehen. Du wirst sehen, sobald du sie besser kennengelernt hast, wird ihre Faszination auf dich nachlassen, sodass du froh sein wirst, wenn sie dich wieder freigibt.“
„Das wird nie passieren!“ Er hatte kaum ausgesprochen, da warf sich Eric herum und stürmte aus dem Zelt der Medizinfrau. Sie wollte ihm also nicht helfen, grollte er im Stillen. Auch gut. Würde eben die Zeit für ihn arbeiten. Wenn Kleine-Eule erkannte, dass er sich durch nichts und niemanden entmutigen ließ, würde sie ihre Meinung schon noch ändern. Beseelt von diesem Gedanken, und beflügelt von seiner nicht erlöschenden Hoffnung, genoss er für einige Monate ein Leben voller Glück und Harmonie an der Seite seiner indianischen Gefährtin. Doch dann wurde er von einem Tag auf den anderen wieder ein einsamer Mann, weil Kleine-Eule dem Ruf eines älteren Jägers folgte und in dessen Zelt umzog, um seine zweite Frau zu werden.
Zutiefst enttäuscht machte sich Eric noch am selben Tag auf, um zu seiner Blockhütte zurückzukehren. Dort grübelte er den ganzen Winter über darüber nach, warum Kleine-Eule ihn so abrupt hatte fallen lassen, besser gesagt, was genau er falsch gemacht und womit er sie von sich getrieben hatte. Am Ende wurde ihm klar, dass nichts und niemand etwas dafür konnte, wenn aus Zuneigung Gleichgültigkeit wurde, sodass er sich nicht länger mit Selbstvorwürfen quälte. Dennoch fühlte er sich zutiefst deprimiert und suchte Trost in den einsamen Ritten, die ihn querfeldein durch dick verschneites Gelände führten.
*
Als der Frühling Einzug hielt, verzichtete Eric auf einen Besuch bei seinen indianischen Freunden, allein aus dem Wunsch heraus, Kleine-Eule nicht begegnen zu müssen. Nein, er hegte keinerlei Groll gegen sie. Aber zuschauen, wie sie einen anderen um die Mitte fasste, um ihn in das gemeinsame Zelt zu ziehen, nein, das würde er nicht ertragen können. Noch nicht.
Und so verging die Zeit.
Aus Tagen wurden Wochen.
Aus Wochen wurden Monate.
Der Sommer ging, Herbst und Winter kamen, ohne dass Falkenauge oder einer der anderen Indianer seinen Weg gekreuzt hätten. Selbst als der nächste Frühling anbrach, dachte Eric noch nicht daran, seinen Freunden einen Besuch abzustatten. Stattdessen ritt er ein paar Mal in die Stadt, erledigte dort seine Geschäfte, und füllte dabei nach und nach eine große Holzkiste mit allerlei nützlichen Gerätschaften, die er irgendwann als Tauschobjekte verwenden wollte.
3
Der Morgen begann mit einem spektakulären Sonnenaufgang. Und da es nach seiner Rechnung ein Sonntag sein musste, beschloss Eric nach dem Frühstück, dass er sich einen Tag des Nichtstuns verdient hatte. Also sattelte er sein Pferd und ritt ohne ein bestimmtes Ziel los. Dem Hengst überlassend, wo er langgehen sollte, ließ er ihn am langen Zügel laufen und hing dabei seinen eigenen Gedanken nach. Dabei merkte er zunächst gar nicht, dass er allmählich in einen Schlaf ähnlichen Zustand abdriftete. Immer noch den Rücken seines Hengstes zwischen den Schenkeln spürend, fühlte er sich gleichzeitig seltsam losgelöst und frei. Die ungewohnte Leichtigkeit, die er dabei empfand, verwirrte ihn zwar ein bisschen, machte ihn aber auch irgendwie kribbelig. Als er schließlich erkannte, dass er gerade einen sogenannten Tagtraum erlebte, ließ er sich bereitwillig darauf ein, insgeheim überzeugt, dass er schon wach werden würde, wenn Gefahr drohen sollte. Und so ließ er sich weiter aufwärts treiben. Sich um sich selbst drehend, meinte er immer höher zu steigen, bis er sich plötzlich eingefangen und festgesetzt fand. Allerdings war dies keine unangenehme Erfahrung, sondern eine Tatsache, über die er gar nicht weiter nachdachte. Was in diesen einzigartigen Moment zählte, war allein die sinnliche Wonne, die ihm gerade geschenkt wurde.
Seine Arme verharrten reglos in der Haltung, in der sie sich gerade befanden, während sich sein Leib in ständiger Bewegung befand. Er wusste, er hatte sich nicht willentlich bewegt, dennoch gab es da plötzlich eine Veränderung. Allein darum öffnete er die Augen, um zu sehen, wo genau er sich befand. Doch hatte er kaum die Lider gehoben, da presste er sie sogleich wieder zusammen, innerlich starr vor Schreck, weil seine Umgebung völlig anders war, als erwartet. Die Augen fest zusammengekniffen, versuchte er zu ergründen, ob er nun träumte oder nicht, und konnte sich doch nicht entscheiden, weil die Empfindungen seines Körpers immer noch dieselben waren, wie kurz zuvor.
Endlich, nachdem sich sein Herzschlag einigermaßen normalisiert hatte, wagte er es erneut die Lider zu heben. Vorsichtig, als könne ihn bereits der erste Lichtstrahl erblinden lassen, hob er erst ein und gleich darauf auch das andere, nur um den gleichen Anblick vorzufinden, den er schon beim ersten Mal wahrgenommen hatte. Vor und über ihm spannte sich ein strahlend blauer Himmel, aus dessen Mitte eine gleißend helle Sonne heiße Strahlen in alle Himmelsrichtungen sandte.
Während er so immer weiter hinauf glitt, irrte sein Blick zunächst ziellos umher, um sich schließlich nach unten zu richten. Als er jedoch realisierte, dass er sich mindestens an die fünfhundert Fuß über dem Erdboden in der Schwebe befand, kniff er wiederum die Lider zusammen, nur um sie im nächsten Augenblick wieder weit aufzureißen, damit ihm nicht das kleinste Detail entging.
Unter ihm lag jetzt eine Landschaft, die so schön war, dass es ihm buchstäblich den Atem verschlug. Prachtvolle Wälder hoben sich in herben Kontrast zu den Wiesen und Feldern ab, die in verschiedenen Grün-und Gelbschattierungen miteinander wetteiferten. Silbrig schimmernde Fluss-Schlangen wanden sich zwischen sanft ansteigenden Hügeln hindurch und durchschnitten schroffe Felsenformationen, um hier und da in große und kleine Teiche und Seen zu münden, oder in irgendeinem geheimnisvollen Erdloch zu versinken. Er sah große und kleine Tiere, die sich auf weiten Steppen tummelten. Als ihm jedoch klar wurde, dass er selbst Mäuse ausmachen konnte, die sich zwischen den hohen Grashalmen duckten, um nicht entdeckt zu werden, begann er sich zu wundern. Zudem wurde ihm nun auch bewusst, dass irgendetwas sanft an seinen Seiten vorbeistrich, sodass er interessiert hinsah, nur um wiederum den Atem anzuhalten.
Da, wo sein rechter Arm hätte sein sollen, gab es nur ein mit Federn bewachsenes Gebilde, an welchem der Wind zupfte. Ein Blick auf die andere Seite seines Körpers bescherte ihm die gleiche Wahrnehmung. Doch trotz dieser unerklärlichen und eigentlich gruseligen Erfahrung fand er es nicht erschreckend, dass seine Arme plötzlich verschwunden waren. Auch seine Beine vermisste er nicht ein einziges Mal, obwohl er an ihrer Stelle bloß zwei mit Federn bewachsene dünne Stelzen mit langen Krallen daran vorfand. Allein sein Rumpf, der ebenfalls über und über mit Federn bedeckt war, schien irgendwie außer Kontrolle, denn er zuckte und schaukelte unaufhörlich hin und her. Nichtsdestotrotz schien er völlig mühelos durch die Luft zu gleiten, getragen von einer warmen Thermik, ohne sich dabei selbst anstrengen zu müssen.
Die Bahn seines mittlerweile sinkenden Gleitfluges befand sich jetzt auf gleicher Höhe wie die obersten Gipfel eines Felsmassivs. Und eines dieser Grate kam nun mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zu. Er wusste, er musste jetzt irgendwie stehen bleiben, oder umkehren. Die Frage war nur, wie! Erst die aufsteigende Panik, besser gesagt, die Angst vor einem schmerzhaften Aufprall, veranlassten ihn endlich, willentlich die mit Federn besetzten Schwingen zu bewegen, die seine Arme ersetzten. Und im selben Augenblick, in dem er dies tat, veränderte sich auch seine Flugbahn. Die Steinbarriere verschwand in einem steilen Winkel aus seinem Blickfeld. Allerdings war er noch längst nicht außer Gefahr, denn nun raste eine andere Felswand auf ihn zu. Also bewegte er wiederum seine Flügel, veränderte dadurch die Flugbahn seines Körpers, und atmete schließlich erleichtert auf, weil er sich nun erneut über der offenen Fläche der Feld-und Wiesenlandschaft befand. Doch nur einen Atemzug später kroch die Angst in ihm hoch, weil er sich nicht mehr sicher war, ob er tatsächlich bloß einen Traum erlebte. Es schien alles so real! Aber … Wie, um alles in der Welt, sollte er diese Situation meistern, fragte er sich jetzt. Wie steuerte man einen Körper, der einem nicht vertraut war? Besser gesagt, wie sollte er auf den Erdboden zurückkommen? Er konnte ja schließlich nicht auf immer und ewig in der Luft bleiben!
Während er noch über sein Problem nachdachte, geriet er in eine kühlere, wesentlich ruhigere Luftschicht, sodass sein Gleitflug jäh unterbrochen wurde. Im nächsten Moment wie ein Stein abwärts fallend, weil er sich nicht bewegte, sah er den Boden auf sich zu rasen und versuchte dann in letzter Sekunde seine Flugbahn zu ändern. Allerdings konnte er den unkontrollierten Aufprall bloß ein wenig abfangen, aber nicht verhindern. Und so kullerte er am Ende wie ein mit Federn besetzter Ball über den Boden, bis ihn ein Busch stoppte.
Überglücklich, weil er noch einmal davongekommen war, stellte er sich auf seine Füße und schüttelte sich, um das Gras loszuwerden, welches sich in seinen Federn verfangen hatte. Doch dann konzentrierte er sich erneut auf die Problematik seiner misslichen Lage. Er steckte momentan im Körper eines Vogels, das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Wie das passieren konnte, war jetzt nicht wichtig. Viel wichtiger war, was er jetzt machen sollte!
Geleitet durch eine langsam wieder aufsteigende Erinnerung, begann er sich schließlich bewusst zu bewegen, und schaffte es dann tatsächlich, sich wieder in die Luft zu erheben. Dabei wurde er immer sicherer. Gleichzeitig fühlte er euphorische Freude in sich aufwallen, weil das Gefühl der scheinbaren Schwerelosigkeit so schön war.
Zufrieden mit seinem Können und der Situation im Allgemeinen, dehnte er seinen Flug aus, denn die Landschaft unter ihm hatte viele High Lights zu bieten. Eine Gestalt zwischen den Bäumen unter ihm fesselte schließlich seine Aufmerksamkeit. Es handelte sich offenbar um ein großes Tier, welches sich dort zwischen den Stämmen bewegte. Weil es sich aber immer wieder vollständig in den tiefen Schatten der großen Holzgewächse verlor, war alsbald auch das Interesse an ihm verflogen.
Er zog noch ein paar enge Kreise über der betreffenden Stelle, und setzte dann seinen Flug fort. Dabei erinnerten ihn die wärmenden Strahlen der Sonne wieder an das unbändige Gefühl der Freiheit und Freude. Also schloss er die Augen und überließ sich der Führung des Windes. In einem Anfall kindlichen Spieltriebes zog er schließlich die Flügel eng an den Körper, und ließ sich einfach fallen. Sich immer wieder überschlagend, purzelte er durch die unterschiedlich temperierten Luftmassen, und genoss das Gefühl der Ungebundenheit. Doch dann veranlasste ihn der unerwartete Schreckensschrei eines Menschen die Lider wieder zu öffnen. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, die Flug-, besser gesagt, die Fallrichtung seines Körpers zu beeinflussen. Er sah gerade noch die Äste eines Baumes auf sich zu rasen, als ihn einer davon auch schon streifte. Der heftige Schmerz in seiner Flanke raubte ihm zunächst den Atem, und eine Sekunde später auch die Sinne.
Die vom Alter gebeugte Gestalt der Greisin stand zunächst wie erstarrt. Sie hatte den Flug des Adlers beobachtet, der anfangs seine Kreise hoch am frühsommerlichen Himmel gezogen hatte. Als er dann plötzlich Richtung Erde absackte, hatte sie gemeint, er hätte eine Beute erspäht und würde sich diese holen wollen. Dass er dann aber mit leeren Fängen wieder aufgestiegen und anschließend wie toll durch die Lüfte geschossen war, hatte sie mit Befremden aufgenommen. Den unkontrollierten Absturz des großen Raubvogels hatte sie denn auch atem-und bewegungslos verfolgt, nicht fähig, zu verstehen, was genau da vor sich ging. Kurz bevor er in die Baumkrone gekracht war, hatte sie geschrien, um ihn aufzuschrecken. Allerdings war das vergeblich gewesen. Das Tier schien zwar kurzzeitig zur Besinnung gekommen zu sein, war aber offenkundig nicht mehr in der Lage gewesen, rechtzeitig und richtig zu reagieren.
So schnell die alten Beine laufen konnten, trugen sie Geisterfrau vorwärts. Dabei kümmerte es sie nicht, dass dornige Sträucher ihre Haut aufrissen und Brennnesseln rote Striemen darauf hinterließen. Beseelt von dem Wunsch, den Adler zu finden, der vom Himmel gefallen war, strebte sie dem alten Baum entgegen, unter dessen ausladender Krone sie das abgestürzte Tier vermutete. Als sie schließlich ihrem Ziel nahekam, verlangsamte sie ihren Schritt, um mit den Augen die nähere Umgebung abzusuchen.
Endlich entdeckte die Greisin den Adler – und stand mit einem Mal stocksteif. Als würde sie mit aller Macht festgehalten, fühlte sie sich unfähig, auch nur einen einzigen Schritt weiterzugehen. Gefangen in dieser eigentümlichen Starre konnte sie dem großen Vogel nur zusehen, während er sich mühsam in eine bestimmte Richtung schleppte. Sein Zustand war erbärmlich, stellte sie voller Mitleid fest. Beide Flügel schienen gebrochen zu sein, denn sie hingen kraftlos an seinem gerupft wirkenden Körper herunter. Der hinkend hopsende Adler zog sie hinter sich her, wie zwei lästige Anhängsel, wobei er eine breite Blutspur hinterließ. Offenbar hatte das Tier weit größere Verletzungen, als sie zunächst angenommen hatte. Aber, obwohl er wahrscheinlich sehr starke Schmerzen litt, schien er unbeirrt ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Dabei kümmerte ihn selbst die Anwesenheit eines Menschen nicht, den er doch sonst mied, weil er ihn fürchtete. Der edle Kopf war weit nach vorne gestreckt, und drehte sich mal hierhin, mal dorthin, so als würde er etwas Bestimmtes suchen. Dann, ganz plötzlich, blieb er stehen und beäugte das hüfthohe Farnkraut vor sich. Gleich darauf stieß er einen langen klagenden Ton aus und machte er einen gewaltigen Satz in das undurchdringlich erscheinende Grün, welches ihn sogleich verschluckte.