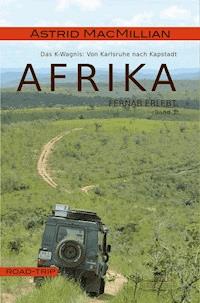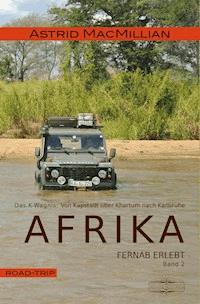
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Afrika fernab erlebt
- Sprache: Deutsch
Das K-Wagnis: Von Kapstadt über Khartum nach Karlsruhe Astrid MacMillian und ihr Ehemann Loyal verwirklichen ihren Traum: Sie reisen ein Jahr lang durch Afrika. Die sprachbegabte Gymnasiallehrerin und der sportbegeisterte Ingenieur kappen ihren komfortablen Alltag in Karlsruhe und fahren im August 2012 los: In ihrer Stella, einem eigens umgebauten Land Rover, geht es immer der Küste entlang durch 30 afrikanische Länder. In diesem persönlichen Reisebericht lässt uns Astrid MacMillian teilhaben an ihrer Leidenschaft für diesen Kontinent, an ihren Reisevorbereitungen, ihren Begegnungen, an ihren Gedanken zu Land und Leuten und ihren Freuden und Nöten während dieser turbulenten Zeit auf Rädern. Man staunt beim Lesen, lacht, kann es kaum glauben, fühlt mit. Hautnah erlebt man, wie vielfältig die Welt, ihre Landschaften, Menschen und Kulturen sind. In Band 2 geht es durch Ost- und Nordostafrika – vom südafrikanischen Kapstadt aus immer nordwärts bis nach Khartum und schließlich wieder zurück ins heimatliche Karlsruhe. … mit über 50 Farbfotos, … mit großer Karte zum Nachverfolgen der Tour, … zum Schmökern UND Erfahren, … für Afrikainteressierte und als Reisevorbereitung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AFRIKA
FERNAB ERLEBT
Das K-Wagnis:
Von Kapstadt über Khartum nach Karlsruhe
Band 2
road-trip
Alle Informationen und Angaben dieses Werkes wurden von der Autorin sorgfältig recherchiert und vom Verlag gewissenhaft geprüft. Dennoch können sachliche und inhaltliche Fehler nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben erfolgen deshalb ohne Gewähr. Weder Verlag noch Autorin haften für inhaltliche und sachliche Richtigkeit. Die im Buch wiedergegebenen Aussagen spiegeln die Meinung der Autorin wider und müssen nicht zwingend mit den Ansichten des Verlags übereinstimmen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2016 Der Kleine Buch Verlag, Karlsruhe
Projektmanagement & Lektorat: Tatjana Weiß
Korrektorat, Karten, Satz & Layout: Beatrice Hildebrand
E-Book Konvertierung & Formatierung: Angela Hahn
Kartengrundlage: © Central Intelligence Agency; www.cia.gov
Umschlaggestaltung: Sonia Lauinger
Umschlagabbildung: Astrid MacMillian
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
E-Book ISBN: 978-3-7650-1304-1
Dieses Buch ist auch als Printausgabe erschienen:
ISBN: 978-3-7650-8905-3
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Für Malaika
Überblick über beide Bände
Band 1
Afrika fernab erlebt
Das K-Wagnis: Von Karlsruhe nach Kapstadt
Wie alles begann
Europa
Nordwestafrika
Westafrika
Zentralafrika
Südliches Afrika
Die westafrikanische Küste – eine Bilanz
Ostafrika, wir kommen!
BAND 2
Afrika fernab erlebt
Das K-Wagnis: Von Kapstadt über Khartum nach Karlsruhe
Was bisher geschah
Ostafrika
Nordostafrika
Afrika – eine Bilanz
Rückkehr nach Europa
Rückblick und Ausblick
Wenn wir immerfort ankommen und abreisen,
sind wir doch gleichzeitig fest verankert.
Denn das Ziel ist niemals ein Ort,
sondern immer eine neue Art und Weise,
die Dinge zu sehen.
Henry Miller
Was bisher geschah
Im Sommer 2012 machte ich mich mit meinem amerikanischen Mann Loyal in unserem Land Rover, den wir Stella tauften, von Karlsruhe aus auf den Weg nach Afrika. Da ich als Lehrerin ein Sabbatjahr beantragt und mein Mann seinen Job als Ingenieur gekündigt hatte, hatten wir ein Jahr Zeit, um den afrikanischen Kontinent (fast) zu umrunden. Inzwischen liegen 20 afrikanische Länder und über 30 000 gefahrene Kilometer hinter uns. Schon in Marokko erlebten wir unglaubliche Gastfreundschaft, als uns Rachid, den wir auf einem Campingplatz in Salé kennengelernt hatten, zu sich nach Hause einlud. In Guinea-Bissau blieben wir bei einer Familie, deren Hütte nur hundert Meter vom kilometerlangen Sandstrand entfernt war. Dort fanden wir Paule, einen afrikanischen Mischlingshund, den wir adoptierten und mit uns nahmen. In Nigeria waren wir emotional überwältigt, als uns unser Gastgeber Ikwen Land in seinem Dorf vermachte und gleich mit Ideen für den Hausbau überraschte, und im Süden Angolas blieben wir bei einem Stamm über Nacht, der bis heute weitgehend unabhängig von der Zivilisation lebt. Da wir keine gemeinsame Sprache sprachen, verständigten wir uns mit Händen und Füßen.
Unser Ziel war es, uns während der Tour besonders intensiv auf die einheimischen Kulturen einzulassen. Wir übernachteten deshalb bewusst nicht in Hotels, auf Campingplätzen oder in der Wildnis, sondern knüpften überall Kontakte zur einheimischen Bevölkerung: In ländlichen Gebieten fragten wir den Dorfchef, ob wir in unserem Land Rover die Nacht neben seiner Hütte verbringen dürften, in Städten blieben wir meist bei Freunden oder Familie oder Bekannten von Freunden. Die vielen dadurch zustandegekommenen Begegnungen mit Einheimischen ermöglichten uns einen tieferen Einblick in die afrikanischen Kulturen. Dies war spannend und aufregend, wir erlebten wahnsinnig herzliche Gastfreundschaft und wurden in mehrere Familien regelrecht aufgenommen. Wir (er-)lebten immer den Alltag der Einheimischen, der sich von unserem eigenen völlig unterschied und uns nicht nur zeigte, wie anders als in Deutschland man den Tag verbringen kann, sondern wir erfuhren auch, wie anders Menschen in afrikanischen Kulturen handeln und denken.
Zwei Monate lang begleitete uns Sani, ein nigrischer Freund, mit dem ich schon in früheren Jahren zusammen gereist war. Als traditioneller Heiler und in Westafrika Weitgereister kannte er sich bestens mit den Verhaltensweisen der einzelnen afrikanischen Stämme aus und sprach auch mehr als zehn der einheimischen Sprachen. Er schärfte unseren Blick für kleine Details, erklärte uns und diskutierte mit uns während der langen Autofahrten afrikanische Traditionen und Verhaltensweisen, war sozusagen der »Afrikaspezialist« unseres kleinen deutsch-amerikanisch-nigrischen Reiseteams. Das gemeinsame Reisen war nicht immer leicht, da er nicht nur keine gemeinsame Sprache mit Loyal hatte, sondern auch streng gläubiger Muslim war, der alle Gebete pünktlich einhielt, was auf solch einer Reise nicht immer leicht zu realisieren war.
Die Begegnung mit den fremden Kulturen war aber nicht nur aufregend und inspirierend, sondern gleichzeitig auch wahnsinnig anstrengend und brachte mich an die Grenzen des für mich Möglichen. In Kamerun war ich kurz davor, die Tour abzubrechen, weil ich dringend Ruhe brauchte und das Gefühl hatte, über meine eigenen Grenzen hinausgegangen zu sein. Viele Diskussionen mit Grenzbeamten und Straßenpolizisten ließen mich verzweifeln, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ungerecht und willkürlich behandelt zu werden. Ich fand einfach keinen wirklichen Zugang zu den afrikanischen Kulturen beziehungsweise fühlte mich zu deutsch, um mich darauf einlassen zu können. Mir wurde bewusst, dass die von mir selbst gewählte Art zu reisen mir wenig Freiraum ließ, zur Ruhe zu kommen und das Erlebte zu reflektieren und zu verarbeiten – wurden wir doch in jedem Dorf, sobald wir eintrafen, von den Bewohnern beobachtet und auf Schritt und Tritt verfolgt.
Auch die Erfahrung, dass ich mit meinem erlernten Verhalten (zum Beispiel meiner Art der Höflichkeit) nicht weiterkam, musste ich erst einmal verdauen. Ich brauchte einige Tage, bis ich mich wieder berappelte und zur Weiterreise in den Land Rover stieg. Motiviert hat mich unter anderem Paule. Er war in Kamerun erst wenige Monate alt, hatte deshalb noch nicht alle für die Einreise nach Europa notwendigen Impfungen und hätte in Kamerun bleiben müssen, wenn wir die Tour dort abgebrochen hätten.
Wir reisten weiter gen Süden und schon in der Republik Kongo holten mich die Zweifel an der Reise wieder ein: Durch eine zerstörte Brücke von der geplanten Route abgebracht, fanden wir uns plötzlich mitten im Busch wieder, wo wir mit dem Beil Bäume fällen mussten, um weiterzukommen. Das Gebiet, in dem wir uns befanden, war nur wenig besiedelt und wir konnten deshalb nicht auf Hilfe hoffen. Es gab Minuten, in denen ich meinen Plan und die ganze Reise verfluchte. Doch auch hier hatten wir einen Schutzengel, kamen mit ein paar blauen Flecken und Muskelkater davon und schafften es schließlich bis Südafrika, wo wir die westliche Lebensweise nutzten, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und uns physisch und psychisch zu erholen. Loyal hatte in den ersten Monaten über zehn Kilogramm abgenommen und brauchte eigentlich eine Reisepause. Ich war von mir selbst und meinem meiner eigenen Meinung nach zu wenig vorhandenen Durchhaltevermögen enttäuscht. Südafrika war darum ein bisschen wie »Urlaub« vom Reisen. Wir genossen die Infrastruktur, kauften fast täglich in Supermärkten ein, bummelten durch die Straßen und nutzten das stabile Stromnetz, um Kontakt mit unseren Freunden in Deutschland aufzunehmen. Es war angenehm, dass alles so »normal« war, wie wir es aus Deutschland gewöhnt waren. Wir ruhten uns richtig aus und bald schon hatte mich das Abenteuerfieber wieder erfasst und ich hatte genug von Supermarktessen, Hostels etc. Ich wollte und will endlich weiter. Nach fast drei Wochen in Südafrika brechen wir auf, um nun das »Abenteuer Ostafrika« zu wagen und uns über Mosambik, Malawi und weitere spannende Länder auf den Weg bis in die sudanesische Hauptstadt Khartum zu machen.
OSTAFRIKA
Mosambik
Ankunft in Mosambik: Hunde müssen draußen bleiben!
Die Ausreise aus Swasiland, und damit aus der namibisch-südafrikanischen-swasiländischen Zollunion, ist völlig unkompliziert, abgesehen davon, dass die Immigrationsbeamtin die ganze Zeit telefoniert und sich nicht davon abhalten lässt, den Ausreisestempel mitten auf mein Sambiavisum zu klatschen. Mal sehen, was die Beamten an der Grenze zu Sambia sagen werden!
Auch auf mosambikanischer Seite geht alles zügig. Der Zollbeamte ist höflich und »kann sogar super Englisch!«, wie sich Loyal freut. Mosambik ist nach Guinea-Bissau und Angola das dritte portugiesischsprachige Land auf unserer Reise und deshalb sind wir überrascht, dass Englisch gesprochen wird. Schnell haben wir den Papierkram erledigt, dürfen fahren und steuern auf das große Tor zu. Dort stehen wieder Polizisten und der »Chef« bedeutet Loyal, den Motor abzustellen. Ich seufze innerlich. Der Mann schaut in unser Auto und sieht unseren Hund (so wie der Zollbeamte zuvor auch). »Der Hund bleibt hier!«, sagt er laut und deutlich auf Portugiesisch.
»Wie bitte?« Loyal versteht erst nicht, begreift dann aber, was der Mann meint. »Wir haben alle Papiere!«, sagt er zu mir. »Oh nein, es geht wieder los. Der will doch nur Geld!« Ich bin genervt, weil wir das in Westafrika an fast allen Grenzen so erlebt haben.
Wir holen Paules Papiere, aber der Polizist meint: »Der Hund bleibt hier, ihr könnt fahren!«
»Der Hund gehört zu uns und ohne ihn fahren wir nirgends hin!«, regt sich Loyal auf.
Ich übersetze und füge hinzu: »Gibt es hier einen Platz, wo wir übernachten können?«
»Übernachten? Das geht hier gar nicht!«, brüskiert sich der Chef, während ich ihm ein Gesundheitszeugnis nach dem anderen unter die Nase halte. »Ihr müsst auf den Veterinär warten«, bringt er schließlich hervor.
»Und wann kommt der?«, will ich wissen.
»Vielleicht morgen oder übermorgen – ich weiß es nicht!«. Der Mann pokert und ich habe keine Lust, ihm Geld zu geben.
»Wo können wir den Wagen zwecks Übernachtung parken?«, frage ich ihn eiskalt.
Er schaut mich an und sieht meinen entschlossenen Blick. »Ihr könnt fahren!«, meint er.
»Wohin? Dort hinten, unter die Bäume?«, frage ich erneut und zeige auf das Immigrationsbüro. So wie er kann ich schon lange. Doch der Mann hat mich schon stehengelassen. Das Tor wird geöffnet und wir dürfen fahren.
Mosambikanische Gastfreundschaft
Da wir das Land in der Regenzeit bereisen, ist es in Mosambik sehr schwül und tropisch heiß. Nach den mit 12 bis 15 Grad sehr kühlen Tagen in Swasiland müssen wir uns erst wieder an dieses Klima gewöhnen. Obwohl es schon Abend ist, als wir in der Hauptstadt Maputo ankommen, ist es mindestens noch 25 Grad warm und sehr drückend. Doch nicht nur das feuchtheiße Klima lässt die Stadtluft stickig erscheinen, sondern auch der Smog, der nicht nur durch den Verkehr ausgelöst wird, sondern gleichzeitig von vielen kleinen Müllfeuern am Straßenrand, deren Rauch die Luft verpestet.
In Maputo wohnen wir bei Familie Palminha, von der wir sehr herzlich aufgenommen werden. Nelson, ein Freund von mir, den ich in Spanien kennengelernt habe und der jetzt in England lebt, kommt aus Mosambik und plant selbst seit Jahren, eine Tour im Land Rover um den afrikanischen Kontinent herum zu machen. »In Mosambik könnt ihr bei meiner Familie wohnen!«, hat er mir schon vor über einem Jahr angekündigt.
In Mosambiks Hauptstadt Maputo wohnen wir im siebten Stock eines Hochhauses und haben einen guten Blick auf die geschichtsträchtige Stadt.
Anfang März habe ich dann einen Namen und eine Adresse und Telefonnummer in Maputo zugeschickt bekommen. »Und er hat wirklich auch Platz für unseren Landy?«, fragte ich nach.
»Natürlich. Gar kein Problem!«
Zwei Tage vor unserer Einreise nach Mosambik informieren wir Nelson über unsere nahende Ankunft in Maputo. »Alles klar, ich sage Francisco Bescheid!«, schreibt er mir zurück, ohne zu erklären, wer dieser genau ist.
Es wird schon dunkel, als wir endlich das zehnstöckige Hochhaus finden, in dem Francisco und seine Familie wohnen. Im Treppenhaus treffe ich einen Mann und frage ihn nach Francisco. »Das bin ich!«, antwortet er mir. »Bist du allein?«, will er sofort wissen. Es ist düster im Treppenhaus und ich spüre meinen Argwohn. Will mich der Typ vielleicht überfallen? »Komm mit in meine Wohnung!«, fordert er mich auf und bringt mich ein Stockwerk höher. Ich trete erst ein, als ich eine Frau und Kinder in der Wohnung erblicke. Es stellt sich heraus, dass es tatsächlich der von mir gesuchte Francisco ist, der von meinem Freund Nelson allerdings nur weiß, dass »zwei Deutsche irgendwann vorbeikommen werden«. Ich werde sehr herzlich begrüßt und gemeinsam gehen wir zurück zu Loyal, der im Landy sitzend auf der Straße wartet. »Hier könnt ihr parken«, meint Francisco. Wir sind skeptisch. Mitten in Maputo sollen wir unseren vollgepackten Landy über Nacht auf der Straße lassen? Glücklicherweise gibt es Aufpasser – drei alte Männer –, die die ganze Nacht vorm Haus sitzen werden. Francisco parkt sein Auto hinter unserem. »So, jetzt kann niemand den Wagen klauen!«, verkündet er freudestrahlend. Wir sind etwas beruhigt.
Die Familie ist überwältigend gastfreundlich: Das schönste Zimmer wird gleich für uns vorbereitet und ein Abendessen wird für uns gekocht. Am nächsten Tag zeigt uns Sonito, der 28-jährige Sohn der Familie, die Stadt. Am zweiten und letzten Tag bereiten wir einen großen Salat mit Käse und Brot fürs Abendessen vor und kaufen ein paar Dosen Bier. Die Familie freut sich und isst alles bis auf den letzten Rest Salatsoße auf. Wir freuen uns, dass das deutsche Essen so gut ankommt, wenngleich eine der Töchter meint: »Bier und Brot – das passt ja überhaupt nicht zusammen!« Außerdem haben wir einen großen Kuchen für Sonito gekauft, weil er am nächsten Tag Geburtstag hat. Er freut sich so sehr, dass ihm die Tränen in den Augen stehen. Gerührt nimmt er uns in die Arme. Irmao, die Mama der Familie, schenkt mir einen mosambikanischen Rock, den sie ganz neu gekauft hat. Die Gastfreundschaft der Familie erinnert mich sehr an Marokko. Afrika, here we are again! Ich bin glücklich. Wir werden die Familie Palminha sehr vermissen.
Religionsfreiheit
Da es kurz vor Ostern ist, unterhalten wir uns beim Abendessen mit der Familie über Religion. »Feiert ihr Ostern?«, wollen wir wissen.
»Naja«, meint Sonito, »wir Kinder schon. Unsere Eltern eher nicht.« Wir wundern uns. »Unsere Eltern sind Moslems«, schiebt er die Erklärung hinterher. Wir erfahren, dass die ganze Familie zuvor muslimisch war. Allerdings wollten die Kinder Christen werden.
»Wieso das?«, will Loyal wissen.
»Hmm, als ich 21 war, bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen und die wollte gerne, dass ich in die Kirche gehe.«
»Mir gefällt’s auch besser in der Kirche«, erzählt uns der 13-jährige Mauro, dessen Taufe an Ostern kurz bevorsteht.
Für die Eltern ist der Religionswechsel der Kinder kein Problem. »Jeder soll das machen, was ihm gefällt«, meint Irmao, die Mutter der fünf Kinder, lachend. Gelebte Toleranz. Ich überlege, was meine Eltern sagen würden, wenn ich als Jugendliche oder auch jetzt zum Islam konvertieren würde. Ich glaube, meine Eltern wären schockiert.
»Reich« sein in Mosambik
Familie Palminha gehört zu den »reicheren« Mosambikanern. Nicht nur dass die Wohnung, in der sie wohnen, im Zentrum der Hauptstadt liegt und sowohl der Vater als auch der Sohn ein Auto (sogar einen Mercedes) fahren; gleichzeitig sind alle Kinder (auch die Mädchen) an der Universität gewesen und haben eine gute Ausbildung. Sonito ist Innenarchitekt und entwirft amerikanische Küchen für die mosambikanische Oberschicht. Tagsüber sind alle beschäftigt. Alle haben Jobs. Die zwei Kinder der Schwestern, die geschieden und deshalb wieder bei ihren Eltern eingezogen sind, gehen tagsüber in den Kindergarten. In Afrika ist es üblich, dass Kinder so lange bei ihren Eltern leben, bis sie selbst verheiratet sind und eine Familie gründen beziehungsweise wieder zurückkommen, falls die Ehe scheitert.
Geduscht wird sitzend in der Badewanne, indem mit einem Becher Wasser aus einem Eimer geschöpft wird. Fließend Wasser gibt es keines. Für besondere Gelegenheiten und Gäste wird warmes Wasser im Eimer bereitgestellt, das vorher auf dem Gaskocher erwärmt wurde. Weil zur Zeit das Gas leer und kein Geld vorhanden ist, um neues zu kaufen beziehungsweise das vorhandene Geld nicht für Gas ausgegeben wird, muss auf eine warme Dusche ebenso verzichtet werden wie auf frisch gekochtes Essen. Irmao bringt Essen deshalb aus der Stadt mit, das dann nur noch in der Mikrowelle erwärmt werden muss.
Irmao (Mitte, mit weißer Kappe) ist Inhaberin einer typischen mosambikanischen Garküche, der afrikanischen Kantine für Angestellte. Da es zu Hause kein Gas gibt, bringt sie täglich Essen mit nach Hause.
Auf unserer Matratze ist noch die Schutzhülle aus Plastik, obwohl die Matratze schon recht alt ist. Sie macht beim Hinlegen komische Geräusche. Die Wände sind schmutzig, an vielen Stellen bröckelt die Farbe. Ganz anders als bei »reichen« Deutschen oder anderen »Westlern«. Trotzdem bevorzuge ich die Gastfreundschaft der Menschen hier, die mit mir, einer Unbekannten, alles teilen. In Deutschland (oder auch bei Weißen in Südafrika) würde mir in einer vergleichbaren Situation wahrscheinlich nur der Weg zum nächsten Hostel gezeigt werden. Wie können wir es im »reichen« Deutschland schaffen, offener und gastfreundlicher zu werden und weniger Angst davor zu haben, dass uns jemand etwas klauen will oder etwas dreckig machen wird?
Ich nehme mir jedenfalls fest vor, dass es auch bei mir für jeden immer etwas zu essen und ein warmes Bett geben soll. Dass ich neu gekaufte Kleidung weiterverschenken werde, bezweifle ich aber.
Loyal hängt durch
Wir verlassen Maputo und machen uns auf den langen Weg in den Norden Mosambiks. Mehr als 2000 Kilometer liegen vor uns. Die erste Nacht verbringen wir am Zavala-Strand, einem der letzten wirklich recht einsamen Strände in Mosambik. Die Piste dorthin ist nur mit einem Geländewagen befahrbar und in der großen Lodge, bei der wir ankommen, scheinen wir die einzigen Gäste zu sein. Es ist schon dunkel, müde gehen wir bald schlafen. Am nächsten Morgen überrascht uns ein kilometerlanger, riesiger Sandstrand und klares, warmes Meerwasser. Das Paradies! Da es sogar Strom gibt und wir somit unseren Rechner zum Schreiben von neuen Blogeinträgen nutzen können, beschließen wir, ein paar Tage zu bleiben.
Loyal ist nicht gut drauf. Seit wir Südafrika verlassen haben, hat er keine Lust mehr zu reisen. Zu angenehm war die dortige westliche Atmosphäre, als dass er sich wieder auf Korruption und schwierige Reisetage einstellen will. Außerdem leidet er wie auch in Westafrika unter dem schwülheißen Klima. Er ist mit nichts zu begeistern: Weder mit der Herzlichkeit der Einwohner Mosambiks, die uns offen und freundlich begegnen, noch mit der beeindruckenden Landschaft oder dem tollen Strand. Auch der Zwei-Kilo-Fisch, den wir direkt am Strand von Fischern abkaufen, kann seine Laune nicht heben. Er hat genug vom Reisen und will nur noch »nach Hause«. Wir erörtern die Möglichkeit nach Deutschland zu fliegen, aber diese Idee scheitert zum Teil schon daran, dass wir dort zur Zeit eigentlich kein »Zuhause« haben, da wir unsere Wohnung ja aufgegeben und unser Hab und Gut eingelagert haben.
Am Zavala-Strand verkaufen die Fischer direkt am Strand ihre frisch gefangene Ware. Ich ergattere ein zwei Kilogramm schweres Exemplar.
Ich bin über Loyals schlechte Laune frustriert. In Namibia und Südafrika habe ich neue Energie getankt und freue mich jetzt ganz besonders auf die Länder der Ostküste. Alles scheint hier leichter: die Grenzübergänge, die Essensbeschaffung … einfach alles. Hoffentlich geht es Loyal bald besser und er kann die Reise wieder genießen.
Wiedersehen mit Richard
»Ich glaube, das hinter uns ist Richard«, meint Loyal zu mir, als wir uns wieder auf der Hauptstraße Richtung Norden befinden.
»Meinst du wirklich?« Ich drehe mich um und versuche, das Gesicht des Fahrers hinter uns zu erkennen. Richard ist jener Engländer, den wir an der kongolesischen Grenze getroffen haben. Da er in den afrikanischen Botschaften keine Visa für die Demokratische Republik Kongo und Angola bekommen konnte, flog er von Brazzaville aus nach London zurück, um knapp vier Wochen später mit beiden Visa im Pass zurückzukehren. Nun hat er uns tatsächlich wieder eingeholt.
Wir halten am Straßenrand und es gibt ein großes Hallo. Schnell tauschen wir ein paar Erlebnisse aus und geben uns gegenseitig Tipps. Richard fährt sehr viel schneller als wir. In wenigen Tagen will er schon in Nairobi sein. »Habt ihr den afrikanischen Fahrradfahrer gesehen, der mit einem Mountainbike unterwegs ist?«, will er von uns wissen. »Er verkauft Putzmittel in den Dörfern, die er als Medizin ausgibt. Richtig gefährlich ist das, aber er hat scheinbar Erfolg!« Nein, den haben wir noch nicht gesehen, auch wenn uns Richard neugierig gemacht hat. »Wie macht ihr das mit dem Äthiopienvisum?«, fragt er uns zum Abschied noch.
»Wir beantragen es wieder in Deutschland.« Richard erzählt, dass er im Juni zur Hochzeit seiner Tochter von Nairobi aus heimfliegen will. Dann kann er das Visum auch wieder persönlich in England beantragen. Mal sehen, ob wir uns irgendwo nochmal treffen werden!
Hinterhältiges Schlagloch
Immer wieder werden wir gefragt, wer denn bei uns Auto fahre. Dabei schauen die Fragenden irgendwie meistens Loyal an. Unsere Antwort lautet: Zu zwei Dritteln Loyal und zu einem ich. Das Ungleichgewicht liegt zum einen daran, dass Loyal total gern fährt und das eigentlich sein Highlight der Reise ist. Und zum anderen bin ich es, die die Reiseführer rauf und runter liest, die Übernachtungsplätze kennt, Spezialwege im Vorfeld herausgesucht hat usw. Kurz gesagt: Ich bin gewissermaßen die Navigatrice und das Sprachrohr, da Westafrika ja weitgehend frankophon ist und hier in Mosambik Portugiesisch gesprochen wird. Also muss meist ich mit den Polizisten diskutieren oder Einheimische nach dem Weg fragen.
Zurzeit ist Loyal so mies drauf, dass ihn nur noch das Fahren etwas aufheitern kann, weshalb ich ihn meistens ans Steuer lasse. Wenn wir mehrere Tage hintereinander von morgens bis abends unterwegs sind, wechseln wir uns tageweise mit dem Fahren ab.
Die Straßen in Mosambik sind teilweise in einem katastrophalen Zustand. Wir haben aber Glück, dass es nicht geregnet hat, sonst wäre hier kein Durchkommen mehr.
Wie es der Zufall will (und es ist interessanterweise immer so), verändert sich an »meinem« Tag die Straße nach nur wenigen Kilometern von einer gut geteerten zu einer zwar geteerten, aber mit Schlaglöchern übersäten Strecke. Das touristische Einzugsgebiet der Südafrikaner ist sichtbar zu Ende. Wieder kommen wir nur sehr langsam voran. Zwischenzeitlich kommen immer wieder ein paar Kilometer gute Straße und ich atme auf. 100 Stundenkilometer sind offiziell erlaubt, ich fahre vielleicht 70.
Und dann kommt es, dieses fiese Schlagloch, das keiner von uns beiden vorhergesehen hat. Ich bremse, wir rutschen, sind wenige Meter vor dem Loch, als wir beide etwa gleichzeitig erkennen, dass es kein Schlagloch, sondern ein Krater ist, durch den man unmöglich mit mehr als Schritttempo hindurchfahren kann. Dachten wir jedenfalls, denn ich belehre uns eines Besseren, indem ich mit voll durchgetretener Bremse hineinbrettere und danach fliege. Ja! Der Motor geht aus. Alles ist still, als wir zum Stehen kommen. Mein Herz hämmert. Ich zittere leicht. Wow. Wir haben uns nicht überschlagen. Uns geht es gut. Und unserem Landy? Loyal steigt aus und inspiziert unser Auto. Scheint alles noch dran zu sein. Stella hat wohl keinen Schaden genommen. Unglaublich! Ich steige aus und drücke Loyal die Schlüssel in die Hand. Mir reicht’s für heute. Die Stunde bis zum Sonnenuntergang fährt Loyal nun sehr langsam. Zu tief sitzt der Schreck. Zum Glück ist alles nochmal gut gegangen!
Ich will unterrichten!
Wie in Westafrika fragen wir in Mosambik abends wieder häufig bei alleinstehenden Hütten nach einem Übernachtungsplatz. Da wir in einem christlich geprägten Gebiet unterwegs sind und auf unserer bisherigen Reise die Erfahrung gemacht haben, dass uns bei Christen nur selten Wasser angeboten wird, versuchen wir schon vorzusorgen und immer genügend »Waschwasser« dabei zu haben, um unser Geschirr und eventuell uns selbst waschen zu können. Glücklicherweise gibt es hier »öffentliche Wasserpumpen« am Straßenrand, an denen wir unsere Vorräte auffüllen können.
Wir sind glücklich, wenn wir an Wasserpumpen am Straßenrand unsere Plastikflaschen auffüllen können. Neues Koch- und Waschwasser!
Heute erblicken wir eine Pumpe auf einem Schulhof. Ohrenbetäubender Lärm tönt aus dem Schulgebäude. Es wirkt, als sei bisher kein Lehrer anwesend. Einige Schüler schauen aus dem Fenster. Ich fülle unsere Flaschen und denke nach. Schaue immer mal wieder zum Gebäude hinüber. »Ich glaube, da ist grad kein Lehrer da!«, rufe ich Loyal entgegen, als ich mit dem Wasser zurück zum Landy komme. »Am liebsten würde ich jetzt da reingehen und unterrichten!«
Loyal schaut mich entsetzt an. »Das ist nicht dein Ernst!«, meint er. »Du hast ständig Alpträume von deiner Schule und nun willst du hier unterrichten!«
Ja, genau das ist es, was ich will: unterrichten. Mir würde schon etwas einfallen. Ich bin regelrecht enttäuscht, als wir einsteigen und weiterfahren. Der Unterricht war so greifbar nah!
»Ich verstehe dich nicht«, meint Loyal bei der Weiterfahrt zu mir. »Sobald du Schüler siehst, strahlst du und sobald du eine Schule siehst, willst du am liebsten, dass ich anhalte und du da reinmarschieren und loslegen kannst. Warum freust du dich dann nicht wieder auf deinen Job in Deutschland?«
Loyal hat Recht mit seiner Frage. Die nächsten Tage denke ich viel darüber nach. Anfangs erinnere ich mich nur an schreckliche Erlebnisse, Kämpfe mit Schülern und Eltern. In Deutschland ist man als Lehrer aus Sicht der Schüler irgendwie weniger Mensch als vielmehr das schreckliche Wesen »Lehrer«. Nach etwa zwei Tagen beginne ich, mich auch an gute Erlebnisse zu erinnern. Richtig schöne Dinge, die mir von Schülern, Eltern und Kollegen gesagt wurden. Viele meiner Schüler fehlen mir. Auch Kollegen fehlen mir. Das Unterrichten selbst fehlt mir. Mir einzugestehen, dass mir Einiges an meiner Schule fehlt, ist etwas ganz Neues für mich. Über ein halbes Jahr habe ich dafür gebraucht. Der Anblick der Schulen hier, wo alles fehlt, häufig sogar Tische und Stühle und – am allerschlimmsten – die Lehrer, führt mir immer wieder vor Augen, welche Möglichkeiten wir in Deutschland haben. Es bleibt zu hoffen, dass ich mir, zurück im Alltag, irgendwie den Blick für das Positive bewahren kann, weniger schlecht träume (naja, in Deutschland bekomme ich in der Schulzeit sowieso zu wenig Schlaf, da bleibt keine Zeit für Alpträume) und trotz allem ich selbst bleiben kann.
Wild campen am Strand
Auf der Karte habe ich uns einen idyllischen Strand in Mosambiks Norden herausgesucht: Praça Pebane – das soll unser neues Ziel sein.
Aufgrund der langen und heftigen Regenzeit in diesem Jahr ist die Straße schlecht und von Schlaglöchern übersät. Wir brauchen ewig, bis wir es endlich nach Pebane schaffen und dann ist die Hauptstraße an die Küste gesperrt, weil sie unbefahrbar ist. Auf Schleichwegen finden wir trotzdem einen Weg zum Strand und schlagen unser Lager direkt in den Dünen auf. Hier lässt es sich aushalten. Die Hitze ist mit der kühlen Meeresbrise erträglich. Der Strand ist bis auf wenige Fischer, die morgens mit ihrem Fang heimkehren, menschenleer.
Am Strand von Pebane bringen die Fischer morgens ihren Fang an Land.
Mosambik ist ungefährlich – so sagt es der Reiseführer und die Einheimischen, die wir gefragt haben. Wir bleiben mehrere Tage, entspannen unter einem großen Baum, der uns Schatten spendet. Leider ist das Meerwasser nicht sehr sauber, weil in der Gegend viele Sümpfe sind, deren Schlamm bei Flut ins Meer gespült wird. Ich lese mehrere Bücher und bin glücklich. Loyal kämpft weiterhin gegen seine schlechte Laune – er kann diesem Paradies nichts abgewinnen. Außerdem hat er einen Insektenstich an der rechten Hand, der juckt und sich zu entzünden scheint. Das macht die Gesamtsituation für Loyal nicht besser.
Loyal ist nicht gut drauf. Er möchte die Reise abbrechen beziehungsweise unterbrechen. Stundenlang denkt er darüber nach, wie es weitergehen könnte. Paule versucht ihn aufzumuntern.
So beschließen wir nach nur drei Tagen weiterzufahren und Loyals Glück in den Bergen zu suchen, da dort die Temperaturen niedriger sind und seine Laune hoffentlich heben werden. Auf geht’s!
Wir fahren einige Kilometer am Strand Richtung Norden. Der Sand ist so hart, dass der Landy keine Probleme hat voranzukommen. Als allerdings die Flut kommt, verlassen wir die Küste und machen uns auf den Weg in Mosambiks Berge.
»Ein Funke und alles fliegt hier in die Luft!«
Mosambik ist ein großes Land. Wir fahren also mehrere Tage einfach nur durch die Gegend – immer gen Norden. Allein bis Pebane sind es über 2 000 Kilometer. Die Landschaft ist grün und fruchtbar. Die Erde sandig und sehr rötlich. Wir sehen viele angelegte Gemüse- und Sonnenblumenfelder.
Ich habe viel über Minengebiete in Mosambik gelesen. Während des Unabhängigkeitskrieges (1964–74) und während des Bürgerkriegs, der in den 70er-Jahren zwischen der regierenden FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) und der von Rhodesien (heutiges Simbabwe) gegründeten RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) ausbrach, wurden im ganzen Land zwischen 500 000 und 1.500 000 Minen gelegt. Wie der Krieg in Angola kann auch der Bürgerkrieg in Mosambik als Stellvertreterkrieg während des Kalten Kriegs bezeichnet werden, da die marxistische FRELIMO von der Sowjetunion und die RENAMO erst von der weißen Regierung in Rhodesien, danach von der weißen Regierung in Südafrika und auch den USA unterstützt wurde. Erst nach Ende des Kalten Kriegs beziehungsweise nach dem Zusammenbruch des Apartheitregimes Anfang der 90er-Jahre kam es zur Annäherung zwischen den verfeindeten Gruppen.
Noch heute, etwa 20 Jahre nach Kriegsende, gibt es viele Minengebiete. Mosambik gehört zu den am schlimmsten von Landminen betroffenen Ländern der Welt, in dem zehntausende Tonnen an Landminen ausgebracht wurden. Von Unfällen am stärksten betroffen ist die einheimische Bevölkerung, da die Menschen beim Versuch, neue Felder anzulegen, auf bisher unentdeckte Minen treten. Touristische Orte und touristisch erschlossene Strände sind dagegen weitgehend minenfrei. Die Rebellen legten damals vor allem Minen rund um Schulen und Krankenhäuser, um die Zivilbevölkerung zu treffen. Im Reiseführer wird davor gewarnt, in »touristisch unerschlossenere Gebiete« zu fahren. Wir halten die Augen offen, sehen auf unserer Reise allerdings nur ein einziges Mal am Straßenrand abgesteckte und gekennzeichnete Minenfelder. Ein Team in blauen Anzügen ist dabei, die Minen zu entschärfen.
Wir selbst kommen völlig unvorbereitet in eine andere, sehr gefährliche Situation. Als wir auf der Hauptstraße in den Norden des Landes unterwegs sind, sehen wir plötzlich von Weitem mitten auf der Straße ein Feuerwehrfahrzeug stehen und wundern uns noch, dass es so etwas in Mosambik überhaupt gibt. Wir haben in Westafrika nie eine Feuerwehr gesehen – weder ein Gebäude noch Feuerwehrmänner im Einsatz. Gleichzeitig sehen wir Rauch aufsteigen. Vielleicht ein Unfall? Ein Brand? Wir wundern uns über die wenigen Schaulustigen, haben bei allen anderen Unfällen, die wir auf Afrikas Straßen bisher gesehen haben, doch immer sehr viele Anwohner um die Unfallstelle herumgestanden, um alles hautnah mitzubekommen beziehungsweise um die Verunglückten zu beklauen. Leider ist dies eine traurige Tatsache auf diesem Kontinent. Viele Einheimische beklagen, dass bei Unfällen weniger die Erste Hilfe im Vordergrund steht, als vielmehr die Frage, wie man selbst davon profitieren kann, indem man den Verunglückten Geld, Schmuck und anderes klaut.
Wir kommen näher und just in dem Moment, in dem wir vorbeifahren, erkennen wir, was passiert ist. Das Blut gefriert uns in den Adern. Eine Erdgasleitung ist kaputt gegangen und etwa zwei Meter neben unserem Wagen steigt Erdgas in dicken Wolken aus dem Loch, das Arbeiter gegraben haben. Nebendran sind zwei Männer dabei, mit Schaufeln ein weiteres Loch zu graben – wahrscheinlich um an die Pipeline zu kommen und die undichte Stelle zu reparieren. »Ein Funke und alles fliegt hier in die Luft!«, sagt Loyal geschockt, als wir vorbei sind. Einen Kilometer weiter atmen wir erleichtert auf. »In Deutschland würde man die Bewohner in der Gegend evakuieren und die Straße sperren!«, meint Loyal. Wir werden das Erlebnis nicht so schnell vergessen.
Radfahrer leben in Mosambik gefährlich
Die Mosambikaner bebauen ihr Land wie die Weltmeister. Wir sind begeistert zu sehen, was sie aus ihrem Land machen. Überall sind Felder angelegt: Direkt neben dem Strand genauso wie mitten in den Bergen an steilen Hängen. Das haben wir in Westafrika in der Art nicht gesehen. Tagsüber wirken die Dörfer regelrecht verwaist – alle Bewohner sind scheinbar unterwegs, arbeiten.
Mosambik erscheint uns außerdem als das Land der Fahrradfahrer. Im Norden kommen uns kaum Autos, dagegen umso mehr Fahrräder entgegen. Die Straße gehört den Radfahrern. Wir fahren entsprechend langsam, um keinen Unfall zu provozieren. Außerdem müssen wir oft gezwungenermaßen auf die Bremse treten, weil die »Straßen« sehr schlecht erhalten und deshalb nur für Radfahrer gut befahrbar sind.
Was uns auch auffällt: Die Radfahrer haben eine riesige Angst vor Autofahrern. Sehen sie uns von Weitem, fahren sie ungebremst rechts und links der Straße in den Busch. Dabei kippen nicht wenige um, und verlieren ihre »Fracht« auf dem Gepäckträger, wo nicht nur Taschen und Koffer festgezurrt sind, sondern häufig auch Menschen sitzen. Immer wieder, wenn wir nicht weiter wissen und einen Radfahrer nach dem Weg fragen wollen, passiert es, dass der Radfahrer mit Todesangst in den Augen losprescht und auf dem Rad davonheizt. Manchmal sogar querfeldein, direkt durchs Maisfeld. Wir sind irritiert, auch wenn wir die Vorsicht verstehen, haben wir doch schon zu oft miterlebt, dass einheimische Fahrer ohne Rücksicht alles über den Haufen fahren, was sich auf der Straße befindet. Mehrfach habe ich auf dieser Reise und auf Reisen in den Jahren zuvor mitbekommen, dass Menschen angefahren, Kinder überfahren und Tiere totgefahren wurden. Nicht umsonst sieht man hier in Mosambik immer mal wieder das Hinweisschild: Bitte teile die Straße mit anderen möglichen Benutzern!
Moskitonetze in Mosambik
Im Gegensatz zu den meisten westafrikanischen Ländern sehen wir in Mosambik auf dem Land vielerorts Moskitonetze draußen vor den Häusern hängen. Wir erleben selbst mit, dass die Leute nachts draußen unter diesen Netzen schlafen, weil es im Haus zu heiß ist. Wir fragen uns, wieso es in Mosambik im Gegensatz zu vielen westafrikanischen Ländern eine höhere Akzeptanz von Moskitonetzen gibt.
Afrikanische Toilette
Im Nordwesten des Landes wird es bergiger und damit kühler. Wir sehen viele Teeplantagen, die sehr gepflegt wirken. Im Vergleich zur mosambikanischen Küste ist das angebotene Nahrungsmittelsortiment auf dem Markt anders: Aßen wir in den letzten Tagen viele Früchte, Papayas und Fisch, gibt es hier nun vor allem Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse und Avocados. Unsere letzte Nacht in Mosambik verbringen wir in einem sehr kleinen Dorf nur wenige Kilometer vor der Grenze zu Malawi.
Wie in Westafrika übernachten wir auch in Ostafrika bei Einheimischen. Die Bauweise der Hütten erinnert uns an Guinea.
Bei Einheimischen zu übernachten heißt für uns, unser Auto neben dem Haus zu parken, unseren Campingtisch hinter dem Landy aufzubauen und unser Essen vorzubereiten, dabei gleichzeitig das Abendunterhaltungsprogramm für die Einheimischen zu sein, da alle Einwohner des Dorfs uns bei unseren Aktivitäten beobachten, und danach im Auto zu schlafen. Und – fast hätte ich es vergessen – uns zu waschen (falls uns eine Eimerdusche angeboten wird beziehungsweise wenn wir selbst genug Waschwasser dabei haben) und aufs afrikanische Klo zu gehen.
Afrikanische Toilette heißt entweder: Irgendwo in den Busch gehen, um sich dort zu erleichtern (das ist dann der Fall, wenn die Familie keine Latrine gebaut hat, was immer noch für viele Familien auf dem Land zutrifft) oder zur Latrine, dem Plumpsklo zu gehen, das sich meist in einem kleinen Verschlag befindet und aus einem mehr oder weniger großen Loch im Boden besteht. Vor- und Nachteile der Lochgröße: Bei kleinen Löchern muss man sehr genau zielen, bei großen Löchern besteht die Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren und hineinzufallen. Toilettenpapier ist auf dem Land eigentlich nie vorhanden, es bleibt also die Möglichkeit, selbst welches griffbereit in der Tasche zu haben, große Blätter (im Busch meist irgendwo greifbar) oder aber bereit gestelltes Wasser und abgekaute Maiskolben zu verwenden.
Es ist etwa 19 Uhr und stockdunkel, weil es in den meisten afrikanischen Ländern schon gegen 18 Uhr dunkel wird. Die letzten Bissen des Abendessens sind vertilgt und ich spüre, dass ich unbedingt noch einmal das stille Örtchen aufsuchen müsste. Licht gibt es nicht, weil Elektrizität in Afrika Luxus und meist nur in größeren Städten vorhanden ist. Mit meiner kleinen Kurbellampe (besser als jede Taschenlampe!) mache ich mich auf den Weg zum Plumpsklo, unsere kleine Rolle Toilettenpapier gut versteckt in meiner Hose, da es mir unangenehm ist, den Einheimischen offen zu zeigen, dass mir ihre eventuell auf der Toilette vorhandenen abgekauten Maiskolben oder Bananenblätter nicht »gut genug« sind.
Ich komme in den Innenhof, der Familienvater schießt hilfsbereit auf mich zu, ich bringe mein »Anliegen« möglichst nebensächlich hervor. Eine Frau wird gerufen, sie führt mich zum Bretterverschlag, schaltet eine dort stehende Lampe (ähnliche Größe wie meine Kurbellampe) an, die sie neben dem Loch auf dem Boden abstellt. Sie bedeutet mir, dass ich unsere Kurbellampe schonen und vor dem Eingang lassen soll. Dann verlässt sie mich. Ich bereite alles vor, das heißt, ich ziehe meine Hosenbeine bis über die Knie (damit nichts auf den mehr als feuchten Boden hängt) und stelle mich breitbeinig über das in diesem Fall sehr kleine Loch im Boden. Hinter mir raschelt es, ich sehe mehrere Kakerlaken in Richtung meines Fußes springen, weiche automatisch aus und finde nur gerade so das Gleichgewicht wieder. Um das Loch besser erkennen zu können, ziehe ich die Lampe näher heran, die prompt ausgeht. Nun ist es stockdunkel. Trotzdem versuche ich, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, die Position ist gefunden, ich kann mich entspannen. In diesem Moment merke ich, wie der Boden unter meinem rechten Fuß wegbricht, ich höre Erde in die Tiefe (ins Loch) fallen, ziehe schnell meinen Fuß nach hinten, aber auch dort bricht er ein. Ich verliere das Gleichgewicht, gerate kurz in Panik – zu anschaulich war der Film Slumdog Millionaire –, lasse mich nach vorn (ins Dunkel) fallen und versuche dann irgendwie aus dem Häuschen herauszuhüpfen, meine Jeans in den Kniekehlen. Mühsam finde ich im Dunkeln (ich bin auch noch nachtblind!) unsere Kurbellampe, hüpfe nun mit Licht wieder zurück ins Häuschen und entdecke nicht nur tatsächlich zwei Löcher im Boden, sondern auch eine Batterie auf dem Boden (die erklärt, wieso das Licht der Lampe so plötzlich ausging).
In diesem Moment sehe ich, wie die Batterie ins Rollen gerät und – wie könnte es anders sein? – auf dem Weg zum Loch ist. Blitzartig wird mir bewusst, dass diese Batterie die einzige der Familie, wenn nicht gar des ganzen Dorfes sein wird und ich unmöglich erklären kann, dass mir diese tatsächlich in die Latrine gefallen ist. Ungeachtet der unzähligen Kakerlaken und anderen Kriechtiere mache ich einen weiteren Satz nach vorne, um die Batterie zu retten, bringe dadurch den Boden allerdings noch mehr ins Rutschen. Ich ergattere die Batterie, stopfe sie in die Lampe, verliere dabei fast meine Klopapierrolle, die, wie gesagt, in der Hose hängt (beziehungsweise hing). Gerade so kann ich sie noch halten.
Zurück bei Loyal kann er mir die Geschichte kaum glauben, verzichtet aber auf den nächtlichen Klobesuch und erzählt mir dann am nächsten Morgen: »Du hattest Recht. Da sind nun tatsächlich zwei Löcher im Boden!« Ich beschließe, mir die Ergebnisse meines Klogangs nicht näher zu Gemüte zu führen und warte, bis wir weiterfahren, wo ich mich dann bei der nächsten Gelegenheit wieder in den Busch schlagen kann!