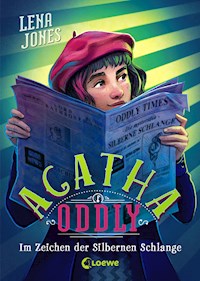
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Agatha Oddly
- Sprache: Deutsch
+ Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebtes Thema: Detektive + Mit effektvollen Illustrationen + Endlich! Agatha ist nun das jüngste Mitglied der Torwächter-Gilde und fest entschlossen, allen ihr Können zu beweisen. Als eine Assistentin der Nationalgalerie plötzlich verschwindet, beginnt Agatha deshalb sofort mit ihren Nachforschungen. Doch bald kommt sie einer Verschwörung auf die Spur, die größer ist, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Ihr Weg führt sie dabei quer durch London (und unter London hindurch!) zu einer silbernen Schlange – und damit gefährlich nahe an das Zentrum des Bösen heran … Hier kommt Agatha, die Meisterdetektivin mit messerscharfem Verstand! Eine starke Mädchenheldin, die jedes Rätsel lösen kann! London, knifflige Rätsel und eine clevere Detektivin – auch der dritte Band der Krimi-Reihe für Leser ab 10 Jahren und Fans von Ruby Redfort verspricht Spannung pur! Die mitreißende Detektivgeschichte spielt im heutigen London. Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Eine Zufallsbegegnung
2. Der Anfang
3. Vorstellungsrunde
4. Alle Wege führen ins Nichts
5. In Luft aufgelöst
6. In der Sackgasse
7. Eine Nachricht aus dem Jenseits
8. Ein größeres Rätsel
9. Ein Mangel an Bleifarbe
10. Rathbone Mansion
11. Eine verwickelte Situation
12. Eine Schlange im Gras
13. Zurück zu Altbewährtem
14. Über dem Krähennest
15. Das wahre Gesicht des Arthur Fitzwilliam
16. Lügen und Geheimnisse
17. Schokoladenkuchen zum Frühstück
18. Unwahrscheinlich vertraut
19. Die Silberne Schlange
20. Unerwarteter Besuch
Danksagung
Für die Schüler der Corpus Christi Primary School in Brixton, Südlondon – die coolsten Agatha-Fans überhaupt.
Du stehst jetzt schon seit mindestens zehn Minuten vor diesem Bild.«
Liam taucht an meiner Seite auf. Er legt den Kopf schief und betrachtet Vincent van Goghs Fünfzehn Sonnenblumen.
Es ist ein Dienstag im November und wir sind mit der ganzen Klasse auf einem Schulausflug in der National Gallery.
»So, wie du es anstarrst, könnte man meinen, dass sich da drin noch ein zweites Bild verbirgt«, sagt Liam. »Du weißt schon – eins von denen, die man nur sieht, wenn man lange genug draufschaut.«
»Es ist einfach nur mein Lieblingsbild, das ist alles«, antworte ich lächelnd.
»Das merkt man.«
»Mum hat es auch geliebt. Immer wenn wir in der Nähe waren, haben wir es uns zusammen angesehen.«
»Wie oft warst du denn schon hier, um in seiner unermesslichen Schönheit zu schwelgen?« Den letzten Teil sagt er mit einem theatralischen Tonfall und macht dabei eine weit ausholende Bewegung, als würde er ein schmalziges Gedicht vortragen.
Ich lache. »Ziemlich oft!« Etwas ernster füge ich hinzu: »Aber heute sieht es irgendwie anders aus.«
»Inwiefern?«
Ich zeige auf die Vase, auf der in blauer Schrift »Vincent« steht. »Hier ist die Farbe so wie sonst auch, aber die Blumen«, ich deute auf die gelben Blüten, »wirken blasser und klarer, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Weniger orangebraun?«, schlägt Liam vor.
»Genau!« Ich strahle ihn an. Niemand versteht mich so gut wie Liam.
Er zuckt mit den Schultern. »Vielleicht haben sie es ja reinigen lassen.«
»Das könnte natürlich sein … obwohl ich mich frage, ob es nicht eher etwas mit diesem Raum zu tun hat. Normalerweise hängt das Bild woanders, aber wegen der Van-Gogh-Ausstellung haben sie es hierhergebracht. Kann sein, dass das Licht hier irgendwie anders ist.«
Brianna erscheint an meiner anderen Seite. Ihre Haare haben immer noch diesen gedeckten Braunton. Ich weiß, dass ihr Blau viel lieber wäre, aber unser Rektor, Dr. Hargrave, hat ihr verboten, sich die Haare in einer »unnatürlichen« Farbe zu färben. Dafür hat Brianna sie sich jetzt bis auf ein kleines Büschel oben auf dem Kopf rundum abrasiert. Ein harter und krasser Kontrast zu ihrem zarten Gesicht. Komischerweise steht ihr der Look trotzdem irgendwie. Ziemlich gut sogar.
»Können wir endlich nach Hause?«, fragt sie, während sie ihre Fingernägel betrachtet. Sie sind schwarz lackiert, mit einem Muster aus hellgrünen Totenschädeln.
»Glaub nicht«, erwidert Liam. »Wir haben ja erst einen Raum gesehen.«
Brianna geht in die Hocke und fängt an, in der vorderen Tasche meines Rucksacks, der auf dem Boden steht, herumzuwühlen.
»Hey, was machst du da?«, frage ich.
»Ich suche nach deiner Schwarzlichtlampe. Hast du sie dabei?«
»Müsste da drin sein«, antworte ich. »Wozu brauchst du sie?«
»Meine Nägel leuchten angeblich im Dunkeln«, sagt sie.
Ich krame die Lampe hervor. Sie ist kaum größer als ein Kugelschreiber. »Bitte sehr.«
»Danke.« Brianna leuchtet damit auf ihre Nägel und wir bewundern die giftgrün leuchtenden Totenschädel.
»Äh … dürfte ich mal eure Aufmerksamkeit haben?« Mrs Shelley, unsere Kunstlehrerin, versucht, sich Gehör zu verschaffen. Wir drehen uns zu ihr um.
Mrs Shelley wirkt wie die verblichene Aquarellversion eines echten Menschen. Ihre gesamte Garderobe scheint nur aus Braun- und Grautönen zu bestehen und selbst ihre Haarfarbe lässt sich am ehesten als ein undefinierbares Braungrau beschreiben. Ich frage mich, was Agatha Christies Poirot wohl von ihr halten würde. In meiner Vorstellung nickt mein Lieblingsdetektiv weise und sagt mit seinem belgischen Akzent: »Non, mam’selle, wirklich stille Wasser gibt es nicht.« Vielleicht hätte er sogar recht – wer weiß, welche Untiefen unsere Kunstlehrerin vor uns verbirgt.
»Äh … Leute …«, beharrt sie mit ihrer leisen Mäuschenstimme, »können wir jetzt bitte weitergehen?«
Ich sehe mich um. Die anderen aus unserer Klasse sind offenbar schon seit einer ganzen Weile mit dem Betrachten der Kunstwerke fertig. Sie haben sich in Grüppchen rund um die Bänke und vor den Fenstern versammelt und unterhalten sich Kaugummi kauend. Eine Gruppe frisiert sich gegenseitig die Haare, andere sitzen auf dem Boden, zeigen einander irgendwas auf ihren Handys und lachen laut. Niemand achtet auf Mrs Shelley.
Brianna hat schon wieder das Interesse verloren. Gelangweilt richtet sie meine Schwarzlichtlampe auf das Landschaftsgemälde an der benachbarten Wand. Dann lässt sie sie langsam von einem Bild zum nächsten wandern, bis sie bei den Sonnenblumen ankommt. Bis jetzt war der Lichtstrahl unsichtbar, aber plötzlich fällt er auf etwas, das eigentlich nicht da sein sollte.
Ich gehe näher ran. »Guckt mal«, sage ich und zeige auf ein kleines Symbol unter van Goghs Signatur.
Liam runzelt die Stirn. »Sieht wie ein A aus.«
»Weil es ein A ist«, antworte ich. »Aber was hat es hier zu suchen?« Ich mache ein Foto davon, solange die Schwarzlichtlampe darauf gerichtet ist. Der Buchstabe ist aufwendig verschnörkelt.
»Vielleicht war das jemand vom Museum«, überlegt Liam. »So als eine Art Diebstahlschutz?«
»Glaubst du ernsthaft, dafür würden sie auf einem unbezahlbaren Gemälde rumkritzeln?«, frage ich.
Brianna zuckt mit den Schultern. »Ist doch unsichtbare Tinte.«
Plötzlich schallt ein lautes Klatschen durch den Raum. Umgehend herrscht Ruhe und sämtliche Köpfe drehen sich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen ist.
Ein großer, schlanker Mann mit dunklem, leicht ergrautem Haar, braunen Augen und einem teuer aussehenden marineblauen Anzug baut sich vor uns auf. Lord Rathbone, der Vater meiner Erzfeindin Sarah. Sie steht an seiner Seite. Ihr selbstgefälliges Lächeln lässt sie noch arroganter und hochnäsiger wirken als sonst.
Normalerweise gehe ich liebend gern in die National Gallery, und auf die Van-Gogh-Ausstellung habe ich mich seit Monaten gefreut. Aber dann musste ich erfahren, dass Sarahs Vater ein Mäzen des Museums ist und wir diesen Ausflug ganz allein ihm zu verdanken haben. Das hat mir die Sache so gehörig versalzen, als hätte jemand eine ganze Flasche Speisewürze in meine Lieblingssuppe gekippt.
Lord Rathbone lächelt uns an. Ich zucke unwillkürlich zusammen, als vor meinem inneren Auge das Bild einer fleischfressenden Pflanze auftaucht. Mit dem Grinsen kann er locker kleine Tiere fangen.
»Bitte erweist eurer Lehrerin die Güte, ihr aufmerksam zu lauschen«, mahnt er. »Schließlich sind wir doch alle hier, um etwas zu lernen.« Seine Stimme hat den schmierigen Tonfall von jemandem, der es gewohnt ist, dass alles nach seiner Pfeife tanzt.
Brianna lehnt sich zu mir herüber und raunt: »Puh, der ist ja noch herablassender als seine Tochter.«
Ich nicke und erwidere ebenso leise: »Jetzt wissen wir wenigstens, von wem sie das hat.«
»Ich krieg echt Gänsehaut von dem Typen.«
»Ja, ich auch«, stimme ich ihr zu.
Mrs Shelley räuspert sich und sagt … etwas.
»Wie bitte, Mrs S.?«, fragt ein Junge.
»Ich kann sie nicht hören!«, ruft jemand anders. »Ihr?«
Liam flüstert mir von der anderen Seite ins Ohr: »Sie sagt, dass es Zeit ist, in den nächsten Raum weiterzugehen.«
»Woher weißt du das?«, frage ich.
»Ich kann Lippenlesen. Ich dachte, das könnte sich irgendwann mal als nützlich erweisen.«
Lord Rathbone klatscht erneut in die Hände und donnert: »Ruhe!« Sein Gesicht hat einen interessanten Rotton angenommen, den ich mir gern genauer ansehen würde. In dem Hexadezimalcode, mit dem Farbtöne für den Computer präzise angegeben werden, würde ich auf Nummer #9A0000 tippen. Aber um das mit Gewissheit bestimmen zu können, müsste ich sehr viel näher an ihn heran, als dass es noch als Höflichkeitsabstand durchgehen könnte.
»Ich dulde ein derart ungehöriges Benehmen nicht!«, brüllt er nun. »Erweist eurer Lehrerin gefälligst etwas Respekt!«
Schlagartig herrscht Stille. Er nickt Mrs Shelley zu, woraufhin diese ebenfalls rot anläuft.
»Äh … ja, vielen Dank, Lord Rathbone. Nun hört mir bitte genau zu. Wir gehen weiter in den nächsten Raum und ich möchte, dass ihr nach dem Gemälde Ausschau haltet, das wir im Unterricht besprochen haben. Wie ihr wisst, war Schlafzimmer in Arles eins von van Goghs Lieblingsbildern. Denkt daran, was wir besprochen haben – die verzerrte Perspektive und das Fehlen jeglicher Schatten –, und vergleicht diesen Stil mit den japanischen Drucken, die wir uns angesehen haben und an denen sich der Künstler orientiert hat. Wie gut ist ihm das eurer Meinung nach gelungen? Und vergesst nicht, euch Notizen zu machen, damit wir das nächstes Mal im Unterricht diskutieren können.«
Gehorsam trotten wir weiter in den nächsten Teil der Ausstellung. Brianna, Liam und ich bleiben wie immer zusammen.
Irgendwann beugt sich Brianna vor und fragt: »Was hat sie gesagt? Irgendwas mit einem japanischen Kuckuck?«
Liam lacht. »Weißt du nicht mehr? Wir haben uns doch diese Drucke angesehen und besprochen, wie van Gogh versucht hat, in seinen Bildern einen ähnlichen Effekt zu erzielen.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich höre in Kunst eigentlich nie zu. Ich meine, die Bilder und das alles sind schon cool, aber Mrs S. ist so langweilig, dass ich jedes Mal abschalte.«
»Wusstest du, dass sie in Wahrheit eine Lady ist?«, frage ich Brianna.
»Habe ich etwa behauptet, sie wäre ein Kerl?«
»Agatha meint die weibliche Form von ›Lord‹«, stellt Liam klar.
»Im Ernst?«, erwidert Brianna. »Sie ist aber nicht annähernd so arrogant wie die Rathbones.«
Wieder lacht Liam. »Niemand ist annähernd so arrogant wie die Rathbones.«
»Psst!«, warne ich. Sarah und ihr Dad stolzieren im Saal auf und ab wie Gefängniswärter auf Patrouille.
Die Menschentraube vor Schlafzimmer in Arles ist so groß, dass wir nicht mal in die Nähe des Bildes kommen. Eine Weile stehen wir am Ende der Gruppe und quatschen, aber nachdem ich sechs, sieben Minuten lang nichts als Hinterköpfe betrachtet habe, werde ich langsam unruhig.
»Ich gehe zurück und gucke mir noch mal die Sonnenblumen an«, sage ich zu meinen Freunden. »Ich komme einfach nicht drauf, was dieses A zu bedeuten hat. Gebt ihr mir Deckung?«
»Und wie sollen wir das machen?«, fragt Brianna.
»Behauptet einfach, ich wäre auf dem Klo«, schlage ich vor. Ich halte nach den Rathbones Ausschau und als ich sehe, dass sie gerade in ein Gespräch mit unserer Kunstlehrerin vertieft sind, schleiche ich davon und kehre in den vorherigen Raum zurück, der jetzt schön leer ist. Wobei: nicht ganz. Ein Junge steht vor den Sonnenblumen. Er blickt hoch, als ich auf ihn zugehe.
»Ich liebe dieses Werk«, sagt er, als seien wir alte Freunde.
»Mhm, ich auch«, erwidere ich.
»Ich gehe immer bei den Sonnenblumen vorbei, wenn ich in der Gallery bin.«
»Mhm, ich auch.« Ich muss mir ganz dringend etwas Neues einfallen lassen. »Das ist eins meiner Lieblingsbilder«, ergänze ich, während ich ihn verstohlen in Augenschein nehme.
Ich merke, dass er mich lächelnd beobachtet, und werde rot. »Und, stehst du auch auf van Gogh?«, frage ich schnell.
»Ich mag Kunst ganz allgemein«, antwortet er. »Ich befasse mich seit Jahren damit. Wusstest du, dass es mehrere Versionen der Sonnenblumen gibt? Vincent hat sie ursprünglich für seinen Freund und Künstlerkollegen Paul Gauguin gemalt. Er wollte sie als eine Art Wandfries in Gauguins Zimmer im Gelben Haus in Arles aufhängen.«
Ehrlich gesagt wusste ich das tatsächlich, aber bevor ich ihm das sagen kann, geht der Junge bereits zum nächsten Gemälde weiter: Weizenfeld mit Zypressen.
»Sieh dir nur mal dieses Impasto an!«, schwärmt er.
Das bedeutet, dass mehrere Farbschichten übereinander aufgetragen wurden, um einem Bild eine beinahe reliefartige Struktur zu verleihen. Und weil ich das weiß, kann ich zumindest nicken. Van Gogh soll einer der ersten Künstler gewesen sein, die diese Technik angewandt haben.
»Man kann die Bewegung der Bäume und Wolken förmlich spüren, findest du nicht auch?«, fragt er.
»Ja, total«, antworte ich. Endlich ein Mensch, der meine Liebe zu van Goghs Werken teilt! Ich bin bisher noch nie jemandem begegnet, der weiß, was »Impasto« heißt.
»Ich muss mich immer zwingen, meine Hände hinter dem Rücken zu halten«, sagt er. »Die Versuchung, den Finger auszustrecken und darüberzustreichen, ist einfach zu groß.« Er blickt sich um. Seine Hand schwebt nur wenige Zentimeter vor dem Bild in der Luft. »Sollen wir?«
»Nein!«, rufe ich entsetzt.
Er lacht. »Keine Sorge, das würde ich niemals tun. Wer weiß, wie brüchig die Farbe nach all den Jahren ist? Ich möchte nicht unbedingt als die Person in die Geschichte eingehen, die eins von van Goghs Meisterwerken zerstört hat. Ich heiße übrigens Arthur.«
»Wie der Freund von Hercule Poirot!«, platzt es aus mir heraus.
Er lächelt und verbeugt sich. »Captain Arthur Hastings, stets zu Diensten.«
»Du kennst die Bücher?«, frage ich aufgeregt.
»Ob ich sie kenne? Ich habe mein gesamtes Leben nach den Glaubenssätzen Hercule Poirots ausgerichtet. Ich tue gerne so, als hätten meine Eltern mich nach seinem Freund benannt – auch wenn es in Wirklichkeit irgendein langweiliger Großonkel oder so war.«
»Also, das kann ich toppen.« Ich grinse. »Ich bin nach der Autorin höchstpersönlich benannt worden. Ich heiße Agatha.« Wir strahlen einander an. »Und … arbeitest du hier?«, frage ich nach einer Weile.
»Schön wär’s! Nein, ich mache ein Praktikum in einer Druckerei hier in der Nähe. In der Mittagspause oder wenn es für mich nichts zu tun gibt, komme ich her. Ich darf die Maschinen nicht bedienen und wenn viel los ist, kann ich mich einfach rausschleichen, ohne dass jemand etwas mitbekommt.« Er wendet sich wieder dem Weizenfeld mit Zypressen zu und schüttelt ergriffen den Kopf. »Das handwerkliche Geschick, außergewöhnlich.«
»Ja, das ist es wirklich«, stimme ich ihm zu.
Einen Moment lang stehen wir schweigend nebeneinander. Es hat etwas Ehrfurchteinflößendes, einem berühmten Gemälde so nahe zu kommen.
»Na ja, ich gehe dann wohl besser mal zu den anderen zurück«, sage ich schließlich.
Er nickt. »In der Druckerei vermissen sie mich wahrscheinlich auch schon. Sie sehen es nicht gern, wenn ich auf eigene Faust losziehe.«
Wir verabschieden uns mit einem kurzen Winken und ich schleiche zurück in den anderen Raum. Obwohl es toll war, mit Arthur zu reden, hätte ich mir das A gern noch etwas genauer angesehen. Es erinnert mich an die erste der drei Aufgaben, die ich für meine Gildeprüfung absolvieren musste – damals war ein schlichtes A auch mein einziger Anhaltspunkt.
Dieser Teil der Ausstellung ist wie leer gefegt, was mir die Gelegenheit gibt, mir in Ruhe eines meiner anderen Lieblingsgemälde anzusehen: die Sternennacht mit ihrem gelben Mond und dem wirbelnden Himmel. Dann widme ich mich dem Schlafzimmer in Arles. Ich bewundere die leuchtenden Farben und die schnörkellose Einfachheit, mit der Bett, Stuhl und Tür dargestellt sind. Irgendwo habe ich gelernt, dass die Wände und die Tür ursprünglich lila waren und die Farbe erst im Lauf der Jahre zu ihrem heutigen Blau verblichen ist. Gleich daneben hängt Das gelbe Haus – ein Bild des Hauses in Arles, in dem sich das Schlafzimmer befunden hat. Zu guter Letzt schließe ich mich Mrs Shelley und den anderen wieder an, die bereits zum nächsten Gemälde weitergezogen sind.
»Da bist du ja!«, zischt Brianna. »Was hast du denn so ewig gemacht? Mrs S. wollte wissen, wo du steckst, und wir mussten behaupten, du hättest Durchfall.«
»Durchfall?!«, wiederhole ich entsetzt.
Dann bemerke ich das spitzbübische Funkeln in ihren Augen. Das war bloß ein Witz. Sie lacht.
»Genau genommen«, Liam rückt seine Brille zurecht, »hat niemand gemerkt, dass du weg warst.«
»Wieder ein Tag in Unsichtbarkeit«, seufze ich.
»Willst du ernsthaft, dass der Haufen da dir Beachtung schenkt?«, fragt Brianna.
Guter Punkt. Unter den Schülern von St. Regis herrscht eine ziemliche Rivalität. Die meisten von ihnen führen ein außerordentlich privilegiertes Leben – jedenfalls finanziell. Ihre Familien besitzen allesamt Anwesen, wenn nicht gar ganze Inseln. Ich dagegen bin nur dank eines Stipendiums hier und wohne in einem kleinen Häuschen im Park, weil mein Vater dort als leitender Gärtner angestellt ist. Unterm Strich bin ich damit wohl immer noch ziemlich privilegiert, nur halt nicht unter diesen Standards. Trotzdem würde ich für kein Geld der Welt mit einem von ihnen tauschen wollen.
Eine Reihe von Minibussen bringt uns zurück zur Schule. Auf der Fahrt erzähle ich Liam und Brianna von meiner Begegnung mit Arthur.
»Groß, blond und eingebildet?«, fasst Liam zusammen. »Bist du sicher, dass er nicht auf unsere Schule geht?«
Ich verdrehe die Augen. »Er war nett, Liam. Und kein bisschen eingebildet. Er weiß einfach nur viel – das ist alles.«
»Wenn du meinst«, sagt er.
Brianna stimmt einen Singsang an, demzufolge Liam bloß eifersüchtig ist, weil er in mich verliebt ist und mit mir auf einem Baum sitzen und mich K-Ü-S-S-E-N will. Wir ignorieren sie. So bringt man sie am ehesten dazu, damit aufzuhören. Ihr wird schnell langweilig, wenn niemand auf sie reagiert.
Wir kommen zur Anwesenheitskontrolle nach St. Regis zurück, dann ist der Tag rum und wir dürfen nach Hause.
»Warum müssen wir nach jedem Ausflug immer erst wieder hierher zurückfahren?«, mault Brianna. Sie winkt zum Abschied und läuft auf einen roten Sportwagen zu – das Auto ihres Bruders. Er lässt den Motor aufheulen, als hätte er es eilig. Immerhin ist er hier: So sprunghaft und unzuverlässig, wie er ist, hat er Brianna schon oft genug versetzt. Aber da ihre Eltern so gut wie nie zu Hause sind, ist er mehr oder weniger die einzige Familie, die sie hat.
Ich begleite Liam zur Bushaltestelle. Ich trage meinen wunderschönen roten Wollmantel, den Dad mir zum Geburtstag geschenkt hat, und meine heiß geliebte und perfekt dazu passende Baskenmütze. Dadurch ist mein Kopf schön warm, nur leider liegen meine Ohren frei und kriegen den eisigen Wind ab, der durch die Straße fegt. Ich ziehe die Mütze so gut es geht über meine brennenden Ohren und schiebe die behandschuhten Hände in meine Manteltaschen. Es ist bereits dunkel und das orangefarbene Licht der Straßenlaternen spiegelt sich in den Pfützen.
»Hast du was von den Torwächtern gehört?«, fragt Liam.
»Nur neue Hausaufgaben. Ein richtiger Fall ist weit und breit nicht in Sicht«, antworte ich.
Die Torwächtergilde ist eine Geheimorganisation zur Verbrechensbekämpfung, für die ich seit Kurzem als Agentin tätig bin. Ich bin ihr neuestes und jüngstes Mitglied: Agentin Codebrecher (okay, den Namen habe ich mir ausgedacht, aber vielleicht setzt er sich ja noch durch).
»Keine Ahnung, warum Professor D’Oliveira meinte, ich würde bald meinen ersten Fall kriegen«, brumme ich. »Seitdem haben weder sie noch Sofia sich bei mir gemeldet.«
Professor D’Oliveira ist ein hohes Tier in der Gilde. Sie hat mir das zweitjüngste Mitglied aller Zeiten, Sofia Solokov, als Mentorin zugeteilt. Die letzten vier Male, die ich im Hauptquartier war, lag immer bloß ein Ordner mit neuen Hausaufgaben für mich bereit: Codes, die ich knacken sollte, oder irgendwelche neuen Regeln und Richtlinien, die es zu lernen galt (als wäre das 3051 Seiten dicke Regelwerk noch nicht genug).
Wir erreichen die Bushaltestelle und Liam zieht sich umgehend ins Wartehäuschen zurück. Bibbernd reibt er sich die Arme. Im Licht der Straßenlaterne kann ich seinen Atem als kleine Wölkchen aufsteigen sehen.
»Sie lassen bestimmt bald von sich hören«, versichert er. »Wie du den Museumsmord und die Sache mit dem vergifteten Wasser aufgeklärt hast, hat sie eindeutig beeindruckt.«
»Wenn du das sagst.« Ich ziehe die Schultern hoch. »Manchmal habe ich Angst, dass sie mich einfach vergessen.«
»Dich vergessen? Agatha Oddly, das Wunderkind der Verbrechensbekämpfung?«, entgegnet er mit gespieltem Entsetzen. »Niemals!«
Ich lache. Liam ist ein Meister darin, mich aufzumuntern.
»Abgesehen davon«, fährt er fort, »seit wann wartest du, bis dir ein Fall zugeteilt wird?«
»Auch wieder wahr … Vielleicht sollte ich ins Hauptquartier gehen und fragen, ob sie was für mich haben. Was, wenn Professor D’Oliveira erwartet, dass ich selbst die Initiative ergreife?«
Liam nickt. »Ich finde, das ist ein guter Plan. Und wenn das auch nicht hilft, können wir immer noch die Frau da drüben unter die Lupe nehmen.« Er zeigt auf eine Frau mittleren Alters auf der anderen Straßenseite, die gerade in einer Plastiktüte wühlt. »Sieht ziemlich verdächtig aus, meinst du nicht?« Noch während er das sagt, holt die Frau eine Banane aus ihrer Tüte, schält sie und beißt hinein. »Da sind eindeutig finstere Machenschaften im Gange«, meint er. »Könnte das was für Agentur Oddlow sein?«
Ich lache. Seit ich zur echten Detektivin aufgestiegen bin, haben wir das ziemlich vernachlässigt. Rückblickend kommt mir die ganze Sache mit der Agentur Oddlow, deren Motto (»Kein Fall ist uns zu sonderbar«) von einem meiner vielen fiesen Spitznamen inspiriert ist, zunehmend wie ein Spiel vor. Ich schätze, wir haben uns ziemlich verändert – seitdem sind wir ganz schön erwachsen geworden.
Liams Bus kommt und er steigt ein. Ich winke seiner Silhouette, die durch das beschlagene Glas des Fensters seltsam verzerrt wirkt, zu und mache mich auf den Heimweg. Ich will nur kurz zu Hause vorbeischauen, um meine Schultasche abzusetzen und mir etwas Bequemeres anzuziehen, bevor ich zum Gildehauptquartier gehe.
Zum Hyde Park, wo unser kleines Cottage steht, ist es nicht weit. Ich schlage ein zügiges Tempo an. Die Botschaften, an denen ich vorbeikomme, sind hell erleuchtet. Dafür ist im Park kaum jemand unterwegs, nur ein paar Leute, die ihre Hunde spazieren führen. Sie alle haben den Mantelkragen hochgeschlagen und sich die Wollmützen tief ins Gesicht gezogen, um dem kalten Wind, der vom Serpentine herweht, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Selbst ihre Hunde scheinen gedämpfter Stimmung zu sein.
Als ich durch die Tür des Groundskeeper’s Cottage trete, kommt unser Kater angelaufen und streicht um meine Beine, wodurch er mich prompt ins Stolpern bringt.
Lachend rapple ich mich wieder auf. »Hallo, Oliver, alter Junge! Hast du mich vermisst?«
»Mau!«
»Was du wirklich vermisst, ist dein Abendessen, hab ich recht?« Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. Halb fünf. »Ist noch ein bisschen früh, oder?«
Oliver ist wenig begeistert, als ich die Tür zur Treppe aufmache und nach oben in mein Zimmer laufe. Ich kann sein klägliches Maunzen bis oben hören. »Tut mir leid!«, rufe ich. »Du wirst bloß fett, wenn du jetzt auch noch zwischen den Mahlzeiten etwas frisst.«
Ich brauche keine fünf Minuten, um meine Schuluniform gegen schwarze Jeans, einen schwarzen Pulli und meine Doc Martens einzutauschen. Nach kurzem Zögern ziehe ich eine wasserfeste dunkelblaue Kapuzenjacke darüber. Nicht unbedingt mein Stil, aber was muss, das muss – gleich im Tunnel wird es feucht und schmutzig. Weitere fünf Minuten später habe ich meine Sachen gepackt: eine helle Stirnlampe, Handschuhe sowie mein Notizbuch und einen Stift, die ich alle zu meinen Trainingsklamotten in den Rucksack stecke. Meinen Gildeschlüssel trage ich sowieso immer an einer Kette um den Hals. Der Schlüssel ist mein wertvollster Besitz. Er hat früher meiner Mutter gehört, die ebenfalls Gildeagentin war, und ich kann mir damit Zutritt zu unterirdischen Gängen und Tunneln in ganz London verschaffen.
Unten schreibe ich eine kurze Nachricht für Dad.
Ich befestige den Zettel mit einem Magneten am Kühlschrank, während Oliver mir wieder um die Füße streicht und lautstark um Futter bettelt. Schließlich lasse ich mich erweichen (immerhin hat Mum ihn damals angeschleppt, weshalb es mir schwerfällt, ihm gegenüber hart zu bleiben). Ich löffle eine kleine Portion Futter in seine Schüssel.
»Bitte sehr, leckerer Stinkefisch«, sage ich und stelle den Napf auf den Boden. Dann mache ich mich im Joggingtempo auf den Weg zu dem verschlossenen Gitter am Rand des Serpentine – so ist die Nachricht, die ich Dad hinterlassen habe, nicht mal gelogen.
Zeit, in den Untergrund zurückzukehren.
Ich schließe das Gitter mit meinem Schlüssel auf und zwänge mich hindurch. Der Geruch, der mir entgegenschlägt, erinnert an eine Mischung aus Seetang und vergammeltem Kohl – was immer noch besser ist als der Gestank der Algen damals. Ich setze meine Stirnlampe auf und schalte sie an. Strahlend helles Licht durchschneidet die Dunkelheit und beleuchtet die unebenen Wände. Ich hasse diesen Einstieg in das Tunnelnetzwerk, das unter weiten Teilen Londons verläuft, aber für mich ist es nun mal der nächstgelegene Zugang. Die Decke ist so niedrig, dass ich nur in geduckter Haltung laufen kann. Immerhin bin ich aus Erfahrung klug geworden und schütze meine Hände inzwischen mit Handschuhen. Damit ich notfalls beide frei habe, benutze ich außerdem eine Stirnlampe anstelle einer gewöhnlichen Taschenlampe.
Ich husche so schnell ich kann durch den engen Tunnel. Je früher ich die Höhle am Ende erreiche, desto besser. Durch die Enge und Dunkelheit scheint es trotzdem, als würde ich kaum von der Stelle kommen, und bald macht sich in meinem Magen das ungute Gefühl breit, dass ich hier nie wieder rausfinde. Ein paarmal muss ich anhalten, um meine verkrampfte Wadenmuskulatur zu massieren. Dabei wird mir meine Situation einmal mehr bewusst: Ich befinde mich tief unter der Erde und niemand weiß, dass ich hier bin. Nur mit Mühe gelingt es mir, meine Atmung zu kontrollieren und mich auf mein Ziel zu konzentrieren.
Schließlich kann ich vor mir das Ende des Tunnels sehen. Ich lege einen Zahn zu. Als ich in die weitläufige Höhle hinaustrete, seufze ich erleichtert auf und recke und strecke mich ausgiebig, um meine schmerzenden Beine und den verspannten Nacken zu lockern. Dann laufe ich zu der großen Eisentür hinüber, die sich nahezu unsichtbar in die sie umgebende Ziegelmauer einfügt. Sie lässt sich wie immer problemlos aufschließen, und im nächsten Moment stehe ich auf dem Fußabtreter, der den flauschigen roten Teppich vor dem Schmutz der Höhle schützen soll. Er heißt mich mit großen Lettern WILLKOMMEN. Vor mir erstreckt sich das Hauptquartier der Torwächtergilde.
Professor D’Oliveiras Büro ist eines von vielen in einem langen Korridor. Ich komme an unzähligen Türen vorbei und an jeder hängt ein Schild mit einem anderen Namen. Nicht zum ersten Mal fällt mir auf, wie viele Menschen eigentlich für diese Organisation arbeiten. Sie alle sind ganz offensichtlich ein wichtiger Bestandteil der Gilde – und ich habe bisher nicht mal einen Bruchteil all dieser Agenten und Verwaltungsmitarbeiter kennengelernt. Im Vergleich dazu komme ich mir ziemlich klein und unbedeutend vor. Wahrlich kein schönes Gefühl.
Schließlich erreiche ich die Tür mit der Aufschrift PROFESSOR D. D’OLIVEIRA. Ich klopfe an und von drinnen schallt mir ein knappes »Herein!« entgegen.
Die »arme alte Dame« (ihre Worte, nicht meine) blickt von einem Dokument auf ihrem Schreibtisch auf und zieht die Augenbrauen hoch. »Agatha? Ich hatte nicht erwartet, dich heute zu sehen …?« Das etwas stärkere Durchklingen ihres karibischen Akzents ist der einzige Hinweis darauf, dass sie überrascht ist. Sie ist wirklich gut darin, ihre wahren Gefühle zu verbergen.
»Ich weiß«, murmle ich, »aber ich würde gern mit Ihnen reden.« Es ist merkwürdig, wie sehr mein Selbstbewusstsein zusammenschrumpft, wenn ich ihr gegenüberstehe. Für so ein zierliches Persönchen hat sie eine enorme Ausstrahlung. Schwierig, sich davon nicht … einschüchtern zu lassen.
»Setz dich.« Sie deutet auf einen der geschwungenen Holzstühle vor ihrem Schreibtisch und ich nehme darauf Platz.
»Danke – ich wollte bloß …« Ich zögere.
»Du wolltest bloß fragen, wann wir dir endlich deinen heiß ersehnten ersten Fall geben?«
Ich nicke. »Es ist … Ich habe das Gefühl …« Ich hole tief Luft. »Ich habe London jetzt schon zweimal gerettet und trotzdem traut mir die Gilde anscheinend nicht zu, einen eigenen Fall zu lösen.«
Sie mustert mich eindringlich. Ich kann ihren Gesichtsausdruck nicht deuten. Nervös blicke ich auf meine Hände. Mein violetter Nagellack könnte mal wieder eine Auffrischung gebrauchen.
Zu guter Letzt lehnt sich Professor D’Oliveira in ihrem grünen Ledersessel zurück und faltet die Hände im Schoß. »Du bist noch sehr jung, Agatha …«
»Aber ich bin mehr als fähig!«
Sie hebt eine Hand. »Bitte lass mich ausreden. Was ich sagen wollte: Trotz deines Alters und deiner relativen Unerfahrenheit wurde mir der Vorschlag unterbreitet, dass du bei einem meiner Fälle aushelfen könntest. Wir sind gerade allgemein etwas unterbesetzt.«
Bitte, bitte sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es sich wegen meines kindischen Gejammers anders überlegt haben …
»Im Ernst?« Ich halte den Atem an.
Sie nickt. »Ich wollte eigentlich Sofia Solokov dafür einteilen, aber einer unserer Agenten ist krankgeschrieben, weshalb sie dessen Fälle übernehmen muss. Dadurch hat sie keine Zeit mehr für diesen Fall.« Sie wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Dein neuer Partner ist zurzeit nicht im Haus. Bitte komm morgen Vormittag um neun Uhr dreißig wieder, dann stelle ich euch einander vor.«
Neuer Partner?
Ich bin dermaßen vor den Kopf gestoßen, dass mir Tränen in die Augen steigen. »Mein … Partner?«, stammle ich. »Mir war nicht klar, dass ich mit jemandem zusammenarbeiten muss.«
»Darauf wollte ich hinaus, als ich sagte, dass du noch sehr jung und unerfahren bist. Es ist für deine Ausbildung sicher von Vorteil, wenn du lernst, im Team zu arbeiten.«
Ich werde rot. »Ach so, klar. Verstehe …« Gerade als ich aufstehen will, kommt mir Mum in den Sinn. Sie war selbst Agentin der Gilde und ich weiß, dass sie nicht bei einem gewöhnlichen Fahrradunfall ums Leben gekommen ist, wie die Polizei mir und Dad vor sieben Jahren weismachen wollte. »Professor?«
Sie hat sich bereits wieder ihren Unterlagen zugewandt. »Hmm?«
»Haben Sie noch etwas gehört? Über die Akte meiner Mum, meine ich?«
Sie sieht vom Schreibtisch auf. »Nein, Agatha, ich fürchte nicht. Ich hatte wirklich gehofft, inzwischen ein paar Antworten zu haben. Der Gedanke, dass die Gilde in ihrem Inneren derart angreifbar ist, dass eine Akte spurlos verschwinden kann, beunruhigt mich zutiefst. Es ist kein schönes Gefühl, auf einmal so vielen Menschen zu misstrauen …« Sie verstummt abrupt, als hätte sie zu viel gesagt. »Aber ich habe einen meiner vertrauenswürdigsten Agenten darauf angesetzt und sobald wir etwas Neues herausfinden, bist du eine der Ersten, die es erfährt. Versprochen.«
»Danke«, sage ich. »Auf Wiedersehen, Professor.«
»Auf Wiedersehen, Agatha. Bis morgen um neun Uhr dreißig.«
»Ja, bis dann.«
Aus dem Bürotrakt laufe ich weiter zum Hauptkorridor. Von hier führen Tunnel in alle Teile Londons. Ich sehe auf meine Uhr. Erst Viertel vor fünf. Da ich gestern nicht beim Kampftraining war, beschließe ich, es kurzerhand heute nachzuholen. Ich mache mich auf den Weg zum Dojo meines Lehrmeisters (oder besser: Shifu) Mr Zhang.
Es ist nicht weit bis nach Soho, daher jogge ich das kurze Stück durch den Tunnel. So kann ich mich schon mal ein bisschen aufwärmen und mache gleichzeitig wahr, was ich Dad gegenüber behauptet habe. Unterwegs denke ich an jenen Tag zurück, als ich offiziell in die Gilde aufgenommen wurde und dann feststellen musste, dass die Akte meiner Mutter aus dem Archiv verschwunden war. Ich hatte gehofft, endlich ein paar Antworten zu kriegen, wenn ich nur herausfinden würde, in welcher Angelegenheit meine Mutter vor ihrem Tod ermittelt hat. Doch ohne Akte keine Informationen …
Wütend wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht und konzentriere mich auf meine Atmung. Das Gefühl, wie Herz und Lunge im Einklang Sauerstoff durch meinen Körper pumpen, verleiht mir Kraft. Ich finde es heraus, denke ich im Takt meiner Schritte.
Zurück an der Oberfläche begrüßt mich Mr Zhangs Enkelin am Eingang zum Schwarzen Bambus, dem Restaurant, das die beiden gemeinsam führen.
»Hi, Agatha!«
»Hallo, Bai! Hat dein Großvater gerade Zeit? Ich hatte gehofft, etwas trainieren zu können.«
»Er ist unten. Hast du deinen Gi dabei?« Damit meint sie meinen weißen Trainingsanzug.
Ich halte meinen Rucksack hoch. »Aber immer.«
In dem kleinen Hinterzimmer ziehe ich mich um und lege meine Sachen ordentlich gefaltet auf einen Stuhl. An der Wand hängt das chinesische Symbol für ein Gericht namens Biangbiangnudeln. Ich betrachte es einen Augenblick. Es ist berühmt dafür, dass selbst die meisten Chinesen Schwierigkeiten haben, es zu schreiben. Selbst mit meinem nahezu fotografischen Gedächtnis gelingt es mir nicht, mir jeden Schwung und Bogen der Schriftzeichen einzuprägen.
»Shifu.«
Wir verneigen uns voreinander, dann nickt Mr Zhang und fordert mich auf: »Zeig mir die neue Schrittfolge, die ich dir beigebracht habe.«
Ich konzentriere mich darauf, meinen Schwerpunkt möglichst tief zu halten, während ich herumwirbele und die Luft abwechselnd mit Schlägen und Tritten traktiere.
»Gut«, lobt er. »Sehr gut. Du machst ausgezeichnete Fortschritte. Weiter so, dann wird aus dir noch eine echte Meisterin.«
»Danke, Shifu.« Ich deute eine Verbeugung an.
Er lässt mich mehrere Bewegungsabläufe durchgehen, dann machen wir mit dem Boxsack weiter.
»Konzentration!«, bellt er. »Wenn du abgelenkt bist, verlierst du das nötige Gleichgewicht zwischen Körper und Geist.«
»Jawohl, Shifu.«
Wir setzen das Training fort, bis ich völlig außer Atem bin. Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Es ist schon nach halb sechs. Wenn ich wie versprochen um sechs zu Hause sein will, muss ich mich beeilen. Ich bedanke mich bei Mr Zhang, renne nach oben, um mich umzuziehen, und verabschiede mich im Vorbeilaufen von ihm und Bai.
Ich jogge den gesamten Weg nach Hause. Es ist erstaunlich, wie viel fitter ich bin, seit ich regelmäßig trainiere. Die Strecke ist echt schön – in den Schaufenstern der Oxford Street leuchtet bereits die Weihnachtsdeko und ich muss mich zwingen, nicht immer wieder stehen zu bleiben, um mir die vielen liebevollen Details anzusehen.
Gleichgewicht und Konzentration, rufe ich mir mit Mr Zhangs Stimme ins Gedächtnis.
Ich frage mich, wer wohl mein neuer Partner bei der Gilde wird. Was, wenn er oder sie genauso herrisch und voreingenommen ist wie Sofia?
Zu Hause folge ich einer Spur aus schlammverkrusteten Gegenständen – Stiefeln, Fleecejacke, Gartenhandschuhen – in die Küche, wo Dad bereits begonnen hat, unser Abendessen zu kochen. Oliver kommt angelaufen, als hätte er mich ewig nicht mehr gesehen, und streicht laut schnurrend um meine Beine.
»Hi, Dad!«
»Hi, Aggie. Wie war’s?«
»Erfrischend!« Ich bibbere. »Macht es dir nichts aus, bei dem Wetter draußen zu arbeiten?«
»Ach, du kennst mich doch, mich stört die Kälte nicht. Und als es dunkel geworden ist, haben wir uns eh in die Gewächshäuser zurückgezogen. Was dagegen, wenn es wieder Omeletts gibt?«
»Nee, kein Problem. Soll ich übernehmen?«, biete ich an.
»Nein, nein, ich mach das schon. Geh du ruhig duschen.«
»Okay. Soll ich im Wohnzimmer das Feuer anmachen?«
»Gute Idee«, meint Dad. »Dann können wir drüben essen, wo es schön warm und gemütlich ist.«
Nachdem ich geduscht habe, begleitet mich Oliver ins Wohnzimmer und leistet mir Gesellschaft, während ich in unserem kleinen Kamin ein Feuer entfache. Das hat mir Dad beigebracht. Ich lege zerknülltes Zeitungspapier in den Kamin, zünde es an und warte, bis die Flamme groß genug ist. Dabei muss man die Kamintür unbedingt offen lassen. Als das Papier brennt, lege ich etwas Holz nach – aber nur ein paar kleine Stücke. Wenn man zu viele oder zu große Scheite nimmt, riskiert man, das Feuer gleich wieder zu ersticken. Erst wenn die Flamme schön gleichmäßig brennt, kann man die Kamintür zumachen.
»Bitte sehr«, sage ich zu Oliver, während ich es mir mit einer flauschigen Decke auf dem Sofa gemütlich mache. »Gleich viel besser, oder?«
Sein Schnurren legt noch einige Dezibel zu. Mit einem Satz springt er auf meinen Schoß, wo er mehrere Runden dreht, bis er die optimale Position gefunden hat und sich genüsslich zusammenrollt. Sein ganzer Körper vibriert wohlig. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es Puls und Blutdruck senken kann, wenn man ein Haustier streichelt. Vermutlich bin ich noch ein bisschen zu jung, um mir deswegen Gedanken zu machen, aber es hat definitiv etwas Beruhigendes, Olivers weiches Fell zu kraulen.
Dad kommt mit dem Essen dazu. Ich halte mir den Teller unter das Kinn, damit ich nicht versehentlich etwas von meinem frischen, heißen Omelett auf Oliver fallen lasse. Meins ist mit Cheddar und Baked Beans gefüllt, meine Lieblingskombination.
»Wie war eigentlich euer Ausflug?«, erkundigt sich Dad.
»Ganz interessant.«
Er zieht eine Augenbraue hoch. »Ich dachte, du fändest deine Kunstlehrerin – Mrs Sheldon … Shelby …? – langweilig?«
»Shelley.«
»Wie der Dichter?«
»Jepp. Und sie ist langweilig. Aber die Gemälde waren fantastisch und ich habe einen Jungen kennengelernt, der einfach alles darüber wusste.«
»Was? Doch sicher nicht mehr als du?«
»Vielleicht ein bisschen.« Ich grinse. »Aber etwas war seltsam … Die Sonnenblumen sind für die Van-Gogh-Ausstellung umgehängt worden und sahen an ihrem neuen Platz ganz anders aus.«
Dad nimmt einen Schluck Wasser. »Inwiefern?«
»Blasser … oder heller.« Ich seufze. »Schwer zu erklären. Jedenfalls hat Arthur darüber kein Wort verloren.«
»Arthur? Ist das der junge Mann?«
Ich nicke. »Er liebt das Gemälde auch. Schon interessant, wie sehr sich ein Bild allein dadurch verändern kann, dass es an einen neuen Platz gehängt wird, oder?«
Dad nickt aufmerksam.
»Und, was machen die Stecklinge?«, frage ich.
»Die gedeihen hervorragend, danke. Heute haben wir die Eibe eingetopft. Die wird langsam ziemlich buschig.«
»Eibe.« Ich schließe die Augen und konsultiere mein mentales Ablagesystem. »Taxus baccata. Vorwiegend auf Friedhöfen zu finden, damit sie nicht versehentlich von Weidevieh gefressen wird. Giftig.«
»Sehr gut. Obwohl in letzter Zeit viel darüber debattiert wird, was der wahre Grund für das hohe Vorkommen auf Friedhöfen ist …«
Ich schalte ab. Eine fürchterliche Angewohnheit, ich weiß, aber ich schaffe es einfach nicht, Dads Gartenbauvorträgen lange zu folgen. Meine Gedanken kreisen bereits wieder um morgen Vormittag und meinen geheimnisvollen neuen Partner. Schlimmer als Sofia kann er oder sie auch nicht sein, versuche ich, mich zu beruhigen. Trotzdem macht mich die Aussicht, mit jemandem zusammenarbeiten zu müssen, den ich nicht kenne, reichlich nervös. So hatte ich mir meinen ersten Fall nicht vorgestellt.
»Das ist jedenfalls der aktuelle Stand der Dinge in der Debatte um die Europäische Eibe«, schließt Dad gut gelaunt.
»Cool.« Ich kratze den letzten Rest Omelett von meinem Teller und lege die Gabel weg. »Hör mal, ich muss noch Hausaufgaben machen …«
Mehr brauche ich nicht zu sagen. »Kein Problem, ich kümmere mich um den Abwasch«, verkündet Dad und fügt dann mit einem fürchterlichen französischen Akzent hinzu: »Die kleinön grauön Zellön fangön an zu rostön, wenn man sie nischt regelmäßig trainiert.«
»Wirfst du mal wieder mit falschen Poirot-Zitaten um dich?«
»Hey! Warum sollst du allein den ganzen Spaß haben?« Touché.
»Danke fürs Essen – und fürs Spülen.« Ich stehe auf und drücke ihm einen Kuss auf die Wange, dann steige ich in mein Dachbodenzimmer hinauf.
![Agatha Oddly. Das Verbrechen wartet nicht [Band 1] - Lena Jones - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d525a2d44e7b97f058e74022cb9264f/w200_u90.jpg)
![Agatha Oddly. Die London-Verschwörung [Band 2] - Lena Jones - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/17124f731c69daad345eb40f7c1830f7/w200_u90.jpg)
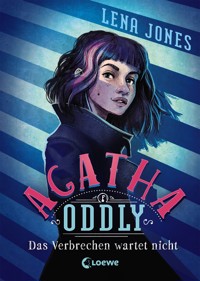
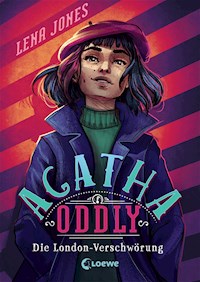














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










