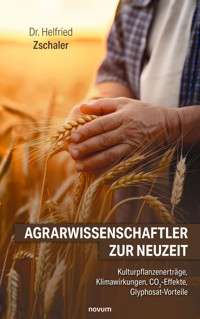
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Winterweizenertrag ist von der Stickstoffdüngung und von der Niederschlagssumme in den vorrangig ertragsbildenden Monaten Mai und Juni abhängig. Eine über das Ertragsmaximum hinausgehende Stickstoffdüngung und Niederschläge führen zu Ertragsminderungen. Der Klimawandel ergibt bei hohen Temperaturen im Mai/Juni von mehr als 15 Grad Ertragsreduzierungen mit verringerten monetären Erlösen. Die erhöhten CO2-Emissionen der letzten 25 Jahre sowie der züchterische Fortschritt führten bisher zu Ertragssteigerungen von 50 % bei Winterweizen in Deutschland. Der Autor untermauert seine Darlegungen und Schlussfolgerungen, die anhand mehrerer Studien vorgestellt werden, zum besseren Verständnis mit zahlreichen Daten und Abbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-516-3
ISBN e-book: 978-3-99130-517-0
Lektorat: CB
Umschlagfoto: Vadym Terelyuk | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Dr. Helfried Zschaler
www.novumverlag.com
Dr. Helfried Zschaler
Ex-post und ex-ante Abschätzung des Winterweizenertrages in Abhängigkeit von Stickstoffdüngung, vom Niederschlagsniveau und von Temperaturen in Deutschland
Ex-post and ex-ante estimates of winter wheat yields in dependency on nitrogen fertilizing and precipitation level as well as temperatures in Germany
Zusammenfassung
Ziel: Das Ziel des Beitrages besteht erstens darin, Informationen zum Einfluss der N-Düngung auf die Ertragsbildung in Abhängigkeit von den Niederschlagsniveaus abzubilden sowie die Folgen der Überdüngung auf die Ökologie zu dokumentieren. Zweitens soll der Einfluss der Temperatur auf die Ertragsbildung, den Deckungsbeitrag und die N-Düngung aufgezeigt werden.
Material und Methoden: 249 Parzellen-Versuche wurden von 2012 bis 2022 zur Stickstoffdüngung in Winterweizen und in ganz Deutschland unter Einbeziehung der regionalen Jahreswitterung (Mai + Juni + 1. Dekade Juli Niederschlagssummen und Temperaturen) durchgeführt. Neben Daten zur N-Steigerung aus eigenen Versuchen wurden von den Landwirtschaftskammern Daten bereitgestellt. Ex-post Regressionsmodelle für den Ertrag in Abhängigkeit von N-Düngung und den Niederschlagssummen werden aufgestellt. Der Deckungsbeitrag wird in Abhängigkeit von den Erträgen, N-Düngungen und den Niederschlagssummen berechnet.
Ergebnisse: Bei einer 190 mm Niederschlagssumme im Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli und bei einer N-Düngung von 200 kg N/ha beträgt das Ertragsmaximum 92 dt/ha. Bei einer 140 mm Niederschlagssumme und bei einer N-Düngung von 175 kg/ha liegt das Ertragsmaximum bei 77 dt/ha. Bei einer Niederschlagssumme von 90 mm und bei einer N-Düngung von 160 kg N/ha erreicht das Ertragsmaximum 66 dt/ha. Über das Ertragsmaximum hinausgehende N-Düngungen führen in allen Niederschlagsbereichen zu signifikanten Ertragsverlusten.
Bei einer Niederschlagssumme von 220 mm und bei einer Mai/Juni-Temperatur von 10 Grad werden ein Ertrag von 114 dt/ha, ein Deckungsbeitrag von 889 €/ha und eine N-Düngung von 210 kg/ha erreicht.
Bei einer Niederschlagssumme von 50 mm und bei einer Mai/Juni-Temperatur von 18 Grad werden ein Ertrag von 45 dt/ha, ein Deckungsbeitrag von –75 €/ha und eine N-Düngung von 85 kg/ha erzielt.
Fazit: Die maximalen Erträge, N-Düngungen und Deckungsbeiträge stehen in signifikanter positiver Korrelation zur Niederschlagssumme von Mai, Juni und erster Dekade im Juli.
Die Erträge, Deckungsbeiträge und N-Düngungen stehen in signifikanter negativer Korrelation zu den Mai/Juni-Temperaturen.
***
Summary
Aim: The aim of the article is firstly to provide information on the influence of N fertilization on yield formation as a function of precipitation levels and to document the consequences of over-fertilization on ecology. And secondly, to show the influence of temperature on yield formation, contribution margin and N fertilization.
Material and methods: 249 plot trials were carried out from 2012 to 2022 on nitrogen fertilization in winter wheat and throughout Germany, taking into account the regional annual weather conditions (May+ June+ 1st decade of July precipitation totals and temperatures). In addition to data on N increase from our own trials, data was also provided by the chambers of agriculture. Ex-post regression models for yield as a function of N fertilization and precipitation totals were set up. The contribution margin is calculated as a function of yields, N fertilization and precipitation totals.
Results: With a precipitation sum of 190 mm in May+ June+ 1st decade of July and an N fertilization of 200 kg N/ha, the maximum yield is 92 dt/ha. With a precipitation total of 140 mm and an N fertilization of 175 kg per ha, the maximum yield is 77 dt/ha. With 90 mm of precipitation and N fertilization of 160 kg N/ha, the maximum yield is 66 dt/ha. N fertilization beyond the maximum yield.
N fertilization beyond the maximum yield leads to significant yield losses in all precipitation ranges.
With a total rainfall of 220 mm and a May/June temperature of 10 degrees, a yield of 114 dt/ha, a contribution margin of 889 €/ha and an N fertilisation of 210 kg/ha.
With a rainfall total of 50 mm and a May/June temperature of 18 degrees, a yield of 45 dt/ha, a contribution margin of –75 €/ha and an N fertilisation of 85 kg/ha are achieved.
Conclusions: The maximum yields, N fertilisation and contribution margins are significantly positively correlated with the total rainfall in May+ June+ 1st decade of July.
The yields, cover crops and N fertilisation are significantly negatively correlated with the May/June temperatures.
Keywords
Winter wheat yield; N fertilisation; precipitation; temperatures;
Keywords
Winter wheat yield; N fertilisation; precipitation; temperatures; climate change; contribution margin; ecology
***
Stichwörter
Winterweizenertrag; N-Düngung; Niederschläge; Temperaturen
1Einleitung
Lawrence (2010) zeigte in einer Studie, dass der Weizen weltweit die größte Bedeutung für die Nahrungsmittelerzeugung hat.
Winterweizen ist in Deutschland 2023 mit 2,89 Millionen ha die Kultur mit dem größten Anbauumfang und der höchsten Bedeutung für die Nahrungsmittelproduktion.
Winterweizen hatte 2020 in Deutschland eine jährliche Nettofestlegung von 788 kg CO2/ha und ist damit klimapositiv zu bewerten (BROEKER, 2020).
Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat ist teilweise noch zu hoch.
Der Stickstoffüberschuss darf nicht mehr als 50 kg/ha betragen. Dieser Wert ist für Deutschland ab 2020 verbindlich (BMUB, 2016).
Zur erforderlichen Entlastung des Grundwassers mit Nitrat in den „roten Gebieten“ (mit mehr als 50 mg Nitrat/l Grundwasser) sind nach AWATER-ESPER (2019) und TAUBE (2021) bei der Düngebedarfsermittlung 20 % abzuziehen.
Das Ziel des Beitrages besteht hauptsächlich darin, Informationen über den Einfluss der N-Düngung, der Niederschlagsniveaus auf die Ertragsbildung und die Einkommenssituation in der landwirtschaftlichen Praxis bereitzustellen sowie die Folgen der Überdüngung auf die Ökologie aufzuzeigen. Des Weiteren soll der Klimawandel dokumentiert werden.
2Material und Methoden
249 Parzellen-Versuche von 2012 bis 2022 wurden mit N-Düngern in den unten beschriebenen Bundesländern unter Einbeziehung der regionalen Jahreswitterung mit Brot- und A-Weizensorten in vollrandomisierten einfaktoriellen Blockanlagen durchgeführt, mit Parzellen-Mähdreschern geerntet, auf 86 % Trockensubstanz berechnet und mit einfaktoriellen Regressionsanalysen ausgewertet. Die Versuche mit 55 bis 75 Bodenpunkten beinhalteten enge Fruchtfolgen (meist 3-jährige mit Wintergerste, Winterraps oder Zuckerrüben). Die Versuchsfelder wurden auch mit Kali und Phosphor entsprechend den Nährstoffuntersuchungen gedüngt und nach Schadensschwellen (Bekämpfungsrichtwerten) mit Herbiziden gegen Unkräuter, Halmstabilisatoren sowie Fungiziden (gegen pilzliche Schaderreger) behandelt. Daten zur N-Steigerung mit 0 bis max. 240 kg N pro ha (ZSCHALER et al., 2019) wurden auch von Landwirtschaftskammern – Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen und Bayern (zum Teil mit mehreren Versuchen pro Jahr und auf unterschiedlichen Standorten) – sowie vom Sortenversuchswesen in Deutschland bereitgestellt.
Die mit der frei programmierbaren Software SAS (Statistical Analyse System, USA) berechneten Niederschläge ergaben nur für die Monate Mai und Juni und die erste Dekade im Juli eine positive Korrelation zum Ertrag.
Der multiple Interkorrelations-Koeffizient der Niederschläge in den vorliegenden Versuchen vom Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli aller Standorte lag im Mittel bei 0,85, bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p <0,1. In diesem Beitrag wurden deshalb die Niederschläge von Mai und Juni sowie aus der ersten Dekade im Juli addiert.
Die Einteilung in die nachstehend aufgeführten Niederschlagsbereiche erfolgte nach den meteorologischen Daten der Versuchsbetriebe und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes.
Das atlantische Niederschlagsniveau mit 190 mm hat einen durchschnittlichen Niederschlag im Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli.
Das mittlere Niederschlagsniveau beinhaltet hat einen durchschnittlichen Niederschlag von 140 mm in diesem Zeitraum.
Das niedrige Niederschlagsniveau mit 90 mm hat einen durchschnittlichen Niederschlag im Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli.
Die Niederschlagsniveaus unterscheiden sich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0,05 signifikant voneinander.
Weitere Definitionen: Die N-Bilanz ist die N-Düngung in kg/ha und Nmin und N-Vorfrucht und N-Rest-organisch minus N-Entzug durch das Korn und Stroh (Ertrag mal 2,5 bei einem Rohproteingehalt von 14 % in kg/ha). Die Leistung in €/ha ist der Ertrag in dt/ha mal 23 €/dt (top agrar 2023). Der Deckungsbeitrag in €/ha ist die Leistung minus der Produktionskosten in €/ha.
Der Ertragskoeffizient ist die Ertragsdifferenz (höchster – niedrigster Wert der Analysen) geteilt durch die Temperaturdifferenz (höchster – niedrigster Wert) gibt an, um wie viel sich der Ertrag bei einer Temperaturabsenkung von 1 Grad erhöht.
Alle Mittelwerte der Optimalerträge sind gerundet.
Die Entwicklungsstadien des Winterweizens wurden nach ZADOKS et al. (1974) benannt.
3 Ex-post Abschätzung der Versuchsergebnisse
3.1 Hohes atlantisches Niederschlagsniveau
Bei 190 mm durchschnittlichem Niederschlag im Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli erhöht sich zunächst der Ertrag mit zunehmendem N-Aufwand und es wird ein Ertragsmaximum von 92 dt/ha bei einer N-Düngung von 220 kg N/ha erreicht (Abbildung 1). Die N-Bilanz beträgt –10 kg/ha. Bei einer weiteren Steigerung der N-Düngung auf 240 kg N/ha sinkt der Ertrag mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0,1 signifikant gegenüber dem Ertragsmaximum ab und führt auch zur Grundwasserbelastung. Der N-Bilanzüberschuss beträgt bei einer N-Düngung von 240 kg N/ha und einem Nmin von 35 kg/ha + 44 kg/ha. Der N-Bilanz-Überschuss führt zu stärkeren klimaschädlichen N2O-Emmisionen und zur Klimabelastung (FLESSA, 2019).
3.2 Mittleres Niederschlagsniveau
Bei 140 mm Niederschlag erhöht sich zunächst der Ertrag mit zunehmendem N-Aufwand und das Ertragsmaximum beträgt 77 dt/ha bei einer N-Düngung von 185 kg/ha (Abbildung 2). Die N-Bilanz beträgt –4 kg/ha.
Eine weitere Steigerung der N-Düngung auf 210 kg N/ha und mehr bringt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0,1 signifikant gegenüber dem Ertragsmaximum eine Ertragsdepression sowie eine Grundwasserbelastung. Die N-Bilanz beträgt bei einer N-Düngung von 210 kg N/ha und einem Nmin von 35 kg/ha 52 kg/ha und liegt damit etwas über dem Grenzwert von 50 kg/ha. Der N-Bilanz-Überschuss führt zu stärkeren klimaschädlichen N2O-Emmisionen und zur Klimabelastung (FLESSA, 2019).
3.3 Geringes Niederschlagsniveau
Bei 90 mm Niederschlag im Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli und bei häufig auftretender Vorsommertrockenheit erhöht sich zunächst der Ertrag mit zunehmendem N-Aufwand und das Ertragsmaximum beträgt 66 dt/ha bei einer N-Düngung von 150 kg N/ha (Abbildung 3). Die N-Bilanz liegt bei +2 kg/ha. Höhere N-Düngungen, z. B. 200 kg/ha, können durch die zu geringen Niederschläge mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0,1 signifikant gegenüber dem Ertragsoptimum nicht in einen Ertrag umgesetzt werden und führen zu einer Grundwasserbelastung. Die N-Bilanz beträgt bei einer N-Düngung, z. B. 200 kg/ha und einem Nmin von 35 kg/ha, + 69 kg/ha und liegt damit über dem Grenzwert von 50 kg/ha. Der N-Bilanz-Überschuss führt zu stärkeren klimaschädlichen N2O-Emmisionen und zur Klimabelastung (FLESSA, 2019).
Darüber hinaus begrenzt eine kürzere Vegetationsperiode (längere Vegetationsruhe) die Ertragsbildung und resultiert auch in früheren Ernteterminen.
Die Optimalerträge unterscheiden sich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p< 0,05 signifikant in den einzelnen Niederschlagsniveaus voneinander.
3.4 Deutschlandweiter Ertrag in Abhängigkeit vom Niederschlag
Aus der Excel-Datenbank (ZSCHALER, 2023a) wurden der Ertrag in Abhängigkeit von den Niederschlägen berechnet. (Abb. 4). Der maximale Ertrag wird mit 114 dt/ha bei einem Niederschlag von 220 mm erreicht. Minimal beträgt der Ertrag 45 dt/ha bei einem niedrigen Niederschlag von 50 mm. „Wenn der Niederschlag infolge des Klimawandels mit mehr als 340 mm vorhanden ist, dann führt dies zu signifikanten Ertragsreduzierungen“
3.5 Ex-post Empfehlungen für die landwirtschaftliche N-Dünge-Praxis
Das Problem besteht nun darin, dass zu Vegetationsbeginn die N-Düngung nicht sicher vorausgesagt werden kann. Das führt häufig zu Fehleinschätzungen bei der Bemessung der Stickstoffdüngung. Die Weizenbestände kommen in der Regel gut ernährt aus dem Winter und der gute Ernährungszustand soll erhalten werden. Wenn nun die Niederschläge ausbleiben, geraten die Pflanzen in einen Wassermangel, der die generative Entwicklung (Kornbildung) behindert (Schulzke, 2014). Die Folge ist eine geringe TKM. Alle ausgewerteten Versuche bestätigen diesen physiologischen Zusammenhang.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Höhe der N-Gaben an die ökologischen Rahmenbedingungen wie das Niederschlagsniveau bzw. an die voraussichtlich zu erreichende Ertragserwartung anzupassen.
DETER (2015) fand in Auswertung der unterschiedlichen Düngestrategien des Institutes für Pflanzenernährung und Umweltforschung Hanninghof auf zwölf Standorten heraus, dass bei einer gesplitteten N-Gabe (3 x) gegenüber der einmaligen Gabe zu Vegetationsbeginn der Ertrag sich um 3 % erhöht und der N-Überschuss sich von 51 kg N/ha bei der einmaligen Gabe auf 21 kg N/ha bei einer gesplitteten N-Gabe verringert.
Auch die N-Teilgaben kann der Landwirt neuerdings per Handy oder Tablet in seine Online-Schlagkartei eingeben und gemäß Düngeverordnung dokumentieren (SCHULZE-HARLING, 2021).
Aus der Literatur ergeben sich Hinweise, dass der Einsatz des gebräuchlichen Nitrifikations-Hemmers DMPP meistens zu Ertragserhöhungen und zu geringeren Umweltbelastungen führt (Wissenschaftliche Dienste, 2016).
Eine eigene Niederschlagsmesseinrichtung für die Bemessung der N-Gaben ist zu empfehlen. Für eine vorausschauende N-Düngung ist die Nutzung der mittelfristigen regionalen Wetterprognose hilfreich.
Treten Schwefelmangelsymptome oder nach der Smin-Methode ermittelte geringe Werte auf, sind Gaben von schwefelhaltigen N-Düngern sowie weiteren Makro- und Mikronährstoffen (z. B. der Blatt-Flüssigdünger: YaraVita GETREIDE PLUS, der auch gegen Trockenstress wirkt [top agrar, 2021]) erforderlich, damit die N-Düngung vor allem bei hohem Ertragsniveau wirken kann.
Die Aufteilung der N-Mengen kann nach folgendem Schema durchgeführt werden: Für das atlantische Niederschlagsniveau der westlichen Bundesländer mit Niederschlägen von 190 mm im Mai, Juni und in der ersten Dekade im Juli und mit einer N-Düngung von 220 kg N/ha* sind dies minus Nmin als Düngeempfehlung:
N-Gabe: Stadium 23: Beginn der Hauptbestockung zur Bestockungsförderung [40 kg N/ha].N-Gabe: Stadium 30: Schossbeginn zur Triebstärkung [50 kg N/ha], da hier die höchste N-Aufnahme stattfindet.N-Gabe: Stadium 39: Fahnenblatt voll entwickelt zur Tausendkorngewicht-Bildung [60 kg N/ha]. Das Fahnenblatt macht 40 bis 70 % des Ertrages aus.N-Gabe: Stadium 49: zur Proteinbildung [35 kg N/ha].Nach der neuen Düngeverordnung sind der aktuelle Nmin-Wert aus der Frühjahrsmessung, die Stickstoffnachlieferung aus der organischen Düngung der Vorjahre, z. B. 12 kg/ha, die Stickstoffnachlieferung aus der Vorfrucht, z. B. 10 kg/ha bei Winterraps, vom Stickstoffbedarfswert abzuziehen.3.6 Ex-post und ex-ante Deckungsbeitragsberechnungen
Der Deckungsbetrag ist die monetäre Leistung (Ertrag in dt/ha mal 23 €/dt [top agrar 5/2023]) in €/ha minus der Produktionskosten (PK) in €/ha.
Die PK in €/ha betragen für das Niederschlagsniveau von 190 mm 1625 €/ha. Sie beinhalten: Kosten für Bodenbearbeitung, Bestellung, Saatgut, Düngung, Pflanzenschutz, Mähdrusch und Lohn.
Tabelle 1: Niederschlagsniveaus, Erträge, Produktionskosten, Temperaturen und Abschätzungen
Niederschlagsniveau
[mm Mai + Juni+1. Dek. Juli]
Ertrag [dt/ha]
ProduktionsKosten
[€/ha]
Temperatur
Im Mai/Juni [Grad Celsius]
Abschätzung
Sehr hohes atlantisches, Klimawandel
220
114
1733
10
ex-ante
Hohes atlantisches
190
92
1625
11,5
ex-post
Mittleres
140
77
1571
13,5
ex-post
niedrigeres
90
66
1394
15
ex-post
Dürre
50
45
1027
18
ex-ante
Niederschlags- Niveau
Mai+ Juni+
1. Dek.
Juli [mm]
Ertrag [dt/ha]
N-Düng. [kg/ha]
Leistung
[€/ha]
DB
[€/ha]
Mai/Juni Temperatur
[Grad]
Abschätzung
Sehr hohes atlantisches, Klimawandel
240
114
210
2622
889
10
ex-ante
Atlantisches
190
92
185
2116
491
11,5
ex-post
Mittleres
140
77
154
1771
200
13,5
ex-post
Geringes
90
66
132
1518
124
15
ex-post
Dürre, Klimawandel
50
45
85
1035
-75
18
ex-ante
Tabelle 2: Niederschlagsniveaus, Erträge, Praxis-N-Düngungen, Leistungen, Deckungsbeiträge (DB), Temperaturen und Abschätzung
3.7 Ex-post und ex-ante Abschätzung des Temperatureinflusses auf den Ertrag und Deckungsbeitrag bei Winterweizen
3.7.1 Ertrag
Es ergeben sich folgende Werte für den Ertrag in dt/ha zur Temperatur in Grad Celsius: Der Ertragsbildungskoeffizient beträgt 8 dt/ha bei einer Temperaturabsenkung von einem Grad Celsius bei den vorrangig ertragsbildenden Monaten Mai und Juni. Der Ertragsbildungskoeffizient liegt bei –8 dt/ha bei einer Temperaturerhöhung von einem Grad Celsius.
3.7.2 Deckungsbeitrag
Der Deckungsbeitrag entspricht der Leistung minus der Produktionskosten.
Der Deckungsbeitragskoeffizient beträgt bei einer Temperaturabsenkung von einem Grad Celsius 96 €/ha. Er liegt bei einer Temperaturerhöhung von einem Grad Celsius bei –96 €/ha.
4 Ex-ante Abschätzungen eines eventuellen Klimawandels
A) Wenn überwiegende Tiefdruckgebiete im Zeitraum Mai bis zur ersten Dekade im Juli zu stärkeren Niederschlägen führen, dann kann sich der Ertrag z. B. auf 114 dt/ha, bei 210 kg/ha N-Düngung, steigern. Der Deckungsbeitrag erhöht sich durch den Ertrag von 114 dt/ha auf 889 €/ha.
Wenn durch den Klimawandel bedingt, die Niederschlagssummen in den ertragsbildeten Monaten Mai+ Juni+ 1. Dekade Juli mehr als 340 mm betragen, dann führt das zunehmend zu signifikanten Ertragsreduzierungen.
Das gegenwärtige Sortenspektrum reicht aus, um die Produktion zu sichern. Da dabei mit einem stärkeren Befall mit Schadpilzen (Fußkrankheit, Blatt- und Ährenkrankheiten) zu rechnen ist, muss die Fungizidanwendung bei anfälligen Sorten gemäß den Bekämpfungsrichtwerten erhöht werden. Die mehrfache Anwendung von Halmstabilisatoren ist zwingend erforderlich, um Ernteverluste durch Lagern zu vermeiden.





























