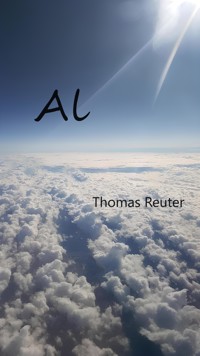
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1.Ich kann nichts wirklich gut. 2.Ich bin einsam. 3.Ich habe meinen Glauben verloren. Christian Beyer ist Mitte 50 und zieht ein ernüchterndes Lebensfazit. Ende der achtziger Jahre tritt er wie selbstverständlich in die Fußstapfen seines Vaters, eines oppositionellen und beliebten evangelischen Pfarrers im Dresdner Umland, doch noch während des Theologiestudiums in Leipzig wird ihm klar, dass er weder über Leidenschaft noch ausreichend Begabung für diesen Beruf verfügt. Er ist bestenfalls Mittelmaß. Anders als seine Schwester Lydia, Liebling ihres Vaters. Nun, zehn Jahre vor dem Ruhestand, steht Christian vor den Trümmern seines Lebens – allein, desillusioniert, gestrandet in einer Gemeinde am Rande des Leipziger Tagebaus. Um Kraft für die letzten Dienstjahre zu schöpfen, reist er nach Rom und trifft dort auf Al, einen undurchsichtigen Mann, der sich ihm aufzudrängen und bei der Bewältigung seiner Probleme helfen zu wollen scheint. Al weiß erstaunlich viel über Christian, und dieser fragt sich zunehmend, was Al, der Fremde, im Schilde führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Reuter
Al
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Al
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ende
Impressum neobooks
Al
1
Ich verlasse den Boden, auf dem mein Schreibtisch steht und das weiße Lesepult. Das Flugzeug streckt neugierig die Nase in den Himmel, wo um alles in der Welt liegt Treusen? Das spießige, konservative, abgestumpfte Treusen.
Rom wird mir helfen, wer sonst? Seltsam, dass ich Mitte fünfzig werden musste, ehe ich erstmals nach Rom reise. Sollte man eher getan haben. Hab ich aber nicht. Hab genügend antike Säulen in diversen Bildbänden gesehen, das reicht für drei Leben. Und der Prunk im Vatikan kann mir gestohlen bleiben. Ich bin Lutheraner. Rom als letzte Chance – eine Bankrotterklärung.
Einfach nur atmen, ein und aus, ein und aus, keine Gedanken zulassen. Ich schwebe zwischen Himmel und Erde, zwischen Dorfweiher und Petersplatz. Ich schließe die Augen, das Flugzeug summt behaglich vor sich hin, ab und zu raschelt eine Stewardess vorbei. So stelle ich mir das Paradies vor. Aber irgendwann muss ich runter, wie immer.
Ciampino Airport. Es funktioniert, ein kleines Wunder. Zu Hause im Fünfhundert-Seelen-Nest Treusen klicke ich dreimal auf meine Tastatur, und fünf Wochen später steht auf dem Römer Flughafen ein mir völlig fremder Mann, der ein Pappschild mit der etwas ungelenken Aufschrift „Signore Beyer“ vor seinem imposanten Bauch hält. Dass so was klappt, erstaunt mich immer wieder. Obwohl man sich irgendwie auch dran gewöhnt. Wir nutzen selbstverständlich Dinge, von denen wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie sie funktionieren. Computer, Fernseher oder einfach nur Strom. Wieso bitteschön leuchtet meine Wohnzimmerlampe auf, wenn ich den Schalter neben der Tür drücke? Wie kommt der Tagesschau-Sprecher auf meine Mattscheibe? Genügt wirklich eine lange Reihe von Einsen und Nullen, damit dieser massige Italiener sich zur richtigen Zeit auf den Weg macht, um mich abzuholen?
Er weiß sogar, wohin ich will. Dabei habe ich die Adresse des Hotels säuberlich auf einen Zettel geschrieben, der nun ungenutzt in meiner Jackentasche stecken bleibt. Das Internet macht uns stumm. Klick, Schild, Auto. Ein Kopfnicken zur Begrüßung und eins zur Verabschiedung, mehr nicht.
Dreißig Minuten Stadtverkehr, jetzt weiß ich wieder, warum ich im Leipziger Land wohne. Links, rechts, bremsen, anfahren, rot, grün, fluchen, brummeln. Ich versteh kein Wort, Fremdsprachen sind nicht mein Ding, ich konnte mir noch nie Vokabeln merken. In einer Weltstadt wie Rom werden sie ja wohl Deutsch verstehen. Bin ja nicht der erste Touri hier.
Das Hotel ist traumhaft gelegen, bei dem Preis kann man das aber auch erwarten. Der Vatikan ist um die Ecke, trotzdem ist es erstaunlich ruhig. An der Rezeption probiere ich meine drei Brocken Italienisch. „Bunn Tschorno, Sinnora.“ Die schwarzhaarige rassige Dame hinterm Tresen lächelt freundlich, aber das hätte sie auch getan, wenn ich „Die Kartoffeln haben im Preis aber ordentlich angezogen.“ gesagt hätte.
Hübsches kleines Appartement mit Wohnzimmer und Bad. Naja, keine Wanne, aber immerhin eine ausreichend große Dusche. Wasserkocher neben dem Fernseher, ein kleiner Korb mit Tütchen. Tee, Trockenmilch, Zucker, und was ist das? Aha, Espresso. Die Italiener trinken ja keinen Kaffee. Im Bad Shampoo und ´ne Art flüssige Seife, in einer Schublade liegt ein Fön. Den brauch ich nicht.
Ich gucke in alle Schränke, inspiziere jede Ecke, brüh mir einen Kaffee auf, also einen Espresso. Muss der so schmecken? Keine Ahnung. Ich öffne das Fenster, stelle die winzige Tasse auf den Sims, hole ein Kissen, lege es neben die Tasse, lehne mich drauf und schaue mir Rom an. Also, was man so sieht von hier aus. Unter mir Rasen mit paar Büschen, dahinter eine schmale Straße, gegenüber ein Brunnen, ein kleiner Park mit paar Bänken. Hoffentlich gibt’s da keinen Radau am Abend. Obdachlose und so. Bin ich von Treusen nicht gewöhnt. Außerdem hab ich einen leichten Schlaf.
In der nächsten halben Stunde quetschen sich Dutzende kleine Fiats durch die enge Straße. Sie hupen pausenlos, parken kreuz und quer, alles belegt, die Seitenspiegel eingeklappt oder abgebrochen, der Leerlauf eingelegt. Einer ist zugeparkt, also schiebt er den kleinen Fiat vor seinem kleinen Fiat und den kleinen Fiat hinter seinem kleinen Fiat so lange hin und her, bis er mit seinem kleinen Fiat rauskommt. Eine halbe Minute später parkt ein neuer kleiner Fiat ein. Wer um alles in der Welt braucht eine Luxuskarosse, wenn er in der Großstadt lebt? Klein ist das neue groß, und über eine Delle regt man sich erst gar nicht auf.
Es wird dämmrig. Ich nehme meinen Rucksack und gehe runter in einen Späti, die gibt es hier scheinbar an jeder Ecke. An der Theke steht ein Algerier oder Tunesier oder so und diskutiert laut mit einem anderen Algerier oder Tunesier oder so. Sie werden auch nicht leiser, als ich eintrete. Ob ich besser wieder gehen sollte, ich will keinen Stress. Einer der beiden spricht mich an, ich zucke die Schultern. „English man?“
„Nein, deutsch man.“
„Ah, tedesco.“ Er wittert wohl ein gutes Geschäft, denn er kommt blitzschnell hinter der Theke hervor, packt mich an der Schulter und führt mich zu den Regalen, von denen er glaubt, dass da Sachen drinliegen, die den Deutschen schmecken. Er hat gar nicht so unrecht. Seine Hand auf meiner Schulter ist mir furchtbar unangenehm, aber ich wage sie nicht abzustreifen. Zehn Minuten später bin ich wieder auf meinem Zimmer, in meinem Rucksack ein Tetrapack Wasser, eine Flasche Wein, französischer, wie ich jetzt merke, dazu zwei Packungen mit Sandwiches, eine Tüte Erdnüsse und eine Tafel Schokolade. Alles total überteuert, aber ich bin froh, ohne Blessuren davon gekommen zu sein. Außerdem hab ich Hunger und lasse es mir schmecken. Ausgiebig duschen, dann fernsehen. Gott sei Dank, es gibt deutsche Programme. Der Sonntagabend ist gerettet.
Italienische Hotels sollen nachts ja so laut sein. Die Italiener kommen nicht zur Ruhe, gackern bis drei, natürlich so rücksichtslos, dass alle anderen Gäste wach gehalten werden. Aber kein Mucks. Ok, die Stadt schläft nicht, aber im Hotel ist es still. Es haben wohl keine Italiener eingecheckt.
Ich bin nicht oft in Hotels, aber was ich am meisten daran liebe, ist das Frühstück. Obwohl ich regelmäßig enttäuscht werde. Letztlich immer derselbe Papps. Zwei Sorten Wurst, zwei Sorten Käse, gekochte Eier, drei Sorten Marmelade, drei Sorten Saft, vier Sorten Joghurt, paar Bananen und Apfelsinen. Bei dem Preis hier könnte man durchaus bisschen mehr auffahren. Ok, hat man auch. Zum Einheitssortiment gibt es außerdem Schoko- und Mandelkuchen, Spiegeleier, gebratenen Bauchspeck, fetttriefende Würstchen und Bruschetta. Das weiß ich, weil es dran steht. Die Treusener sagen dazu Tomatensalat.
Trotz der ordentlichen Auswahl fülle ich meinen Teller mit denselben Leckereien wie in einem billigen Hotel: Weißbrot mit Butter, eine Scheibe Fleischwurst, eine Ecke Camembert, ein warmes Ei, Kirschkonfitüre und Honig im Minipack, Himbeerjoghurt mit Cornflakes, Kaffee und Orangensaft. Das schmeckt mir halt, ist jahrzehntelang erprobt. Reichlich freie Tische gibt es, klar, die Italiener schlafen noch. Italiener nerven in der Nacht, Deutsche beim Frühstück. Immer aufgedreht, immer mit dem falschen westdeutschen Dialekt. Ruhrpott oder Friesland oder Schwaben. Nichts Vertrautes. Links eine plärrige Familie, er in Shorts, mitten im Herbst, dicke Waden mit hundert Mückenstichen, sie im ärmellosen, geblümten Hängerchen, Winkefleisch mit blau-lila Flecken. Guten Appetit. Zwei Teenager, die noch am wenigsten Radau verursachen, sondern die Fresse einhängen. Also steuere nach rechts. Ich bin froh, dass ich allein reise.
Ich suche mir einen Tisch am Fenster, Blick auf den Petersdom. Genüsslich arrangiere ich mein Frühstück vor mir, Kaffee nordöstlich, Saft nordwestlich vom Teller, strecke die Füße unter dem Tisch, drehe den Henkel der Kaffeetasse akkurat neunzig Grad nach rechts, gähne ausgiebig, nippe am Orangensaft, wickle die Butter aus.
„Entschuldigung, darf ich mich zu Ihnen setzen?“ Ich bin perplex, hab wohl den Mund offen stehen. Mann meines Alters, deutlich schlanker als ich, kaum größer, kurze schwarze Haare, Jeans und brauner Pullover, in der linken Hand der Teller, in der rechten ein Glas mit irgendwas. Er steht leicht nach vorn gebeugt, wartet auf meine Erlaubnis, legt den Kopf schief, als ich nicht gleich reagiere. Was soll das? Ringsum leere Tische, er soll mich in Ruhe frühstücken lassen.
„Ääh“, erwidere ich.
„Oh Verzeihung, wenn Sie lieber ungestört sein wollen, suche ich mir natürlich einen anderen Platz.“ Und schon dreht er sich entschuldigend lächelnd weg. Jetzt nicht rückfällig werden, Christian, zieh die Sache durch! Lass dein schlechtes Gewissen gar nicht erst Morgenluft schnuppern.
„Tut mir leid, aber ich würde doch gern allein… Hat nichts mit Ihnen zu tun.“
„Kein Problem.“ Er dreht sich nochmal kurz zu mir um. „Mein Fehler.“
Rasch entfernt er sich, geht zu einem Tisch in der hinteren Ecke, setzt sich mit dem Rücken zu mir. Das Frühstück ist mir verleidet. Mensch Christian. Du bist ein herzloser Egoist, ein Einzelgänger, eine Spaßbremse. Willst immer deine Ruhe, fühlst dich immer gleich gestört. Vielleicht wäre es ja ein nettes Geplauder geworden. Was war das überhaupt für ein Dialekt? Kann ich nicht zuordnen. Wäre ein gelungener Gesprächseinstieg gewesen: „Man hört Ihnen gar nicht an, woher Sie kommen.“
Na toll, mal wieder ein schlechtes Gewissen. Du willst allein sein, also sag das auch. Ist doch nichts dabei. Du würdest dich niemals aufdrängen. Wenn jemand an einem Tisch sitzt, gilt dieser Tisch als belegt. Außerdem: Wer hat denn diese unangenehme Situation verursacht? Du ja sicher nicht. Steh zu dem, was du möchtest. Mit Mitte Fünfzig solltest du das langsam gelernt haben.
Das begleitet mich mein Leben lang. Nichts leichter, als mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Schuld daran ist meine Mutter, die das natürlich nie zugegeben hätte. „Christian, deine Schuhe stehen wieder kreuz und quer. Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester.“ und „Eine Drei in Mathe? Ich weiß, dass du das besser kannst. Aber meine Meinung interessiert dich ja anscheinend nicht.“ und „Musst du denn so ein teures Zimmer in Leipzig nehmen? Studienjahre sind keine Herrenjahre. Naja, du wirst schon wissen, wofür du unser Geld ausgibst.“ und und und
Schluss damit, ich bin nicht mehr in Nayda und auch nicht in Treusen, sondern in Rom. Mutter ist tot, ich brauch mich nicht mehr an ihr abarbeiten. Ich bin erwachsen und tu, wonach mir ist. Heute ist Kultur angesagt. Anschauen, was alle anschauen. Mitreden, worüber alle reden.
Colosseum also. Ich hab mein Ticket im Internet vorbestellt, gut gemacht, Christian. Kombi mit dem Forum. Los geht´s, auf ins Getümmel. Quer über irgendeine Piazza, Metrostation Ottaviano, klappt alles mit Hilfe meines Stadtplans. Ich komme wirklich gut zurecht. Sechs Stationen bis Hauptbahnhof, also Termini, dann von der roten in die blaue Linie umsteigen, nochmal zwei Stationen bis Colosseo. Treppe hoch, wow, da steht das Ding tatsächlich. Riesig und trutzig. Touristenmassen, wie erwartet. Ich bin einer von ihnen, aber ich will nicht nur Selfies mit Grinsegesicht schießen. Ich bin ein ernsthafter Touri. Riesenschlange am Schalter. Sogar für die vorbestellten Eintrittskarten muss ich zwanzig Minuten anstehen. Und dann: Das Colosseum erst in anderthalb Stunden. Italienische Organisation. Bitte gehen Sie zunächst ins Forum. Naja, die Reihenfolge ist eigentlich egal. Oktober, und trotzdem ist es noch drückend warm. Werden wohl an die dreißig Grad sein. Ich hasse Hitze, schwitze wie ein Elch, sagt man wohl, warum eigentlich, werde schnell träge. Die ansteigende Pflasterstraße nimmt kein Ende. Junge Afrikaner, Neger sagt man nicht mal mehr in Treusen, verkaufen völlig überteuerte Wasserflaschen. Tropfen perlen daran herab. Wie halten sie diese Dinger kühl? Wieder zwanzig Minuten anstehen, diesmal wenigstens unter Bäumen. Dann endlich rein, ein freier Blick über freies Gelände. Wenn all die Säulen und Trümmer nicht hier rumstünden und -lägen, wär´s richtig schön. Aha, hier soll Kaiser Augustus gewohnt haben. Und der Bogen dort soll von Titus stammen. Irgendwie sprechen mich die uralten Bruchstücke nicht an, keine Resonanz. Und dabei bin ich mit Kaiser Augustus groß geworden. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war.“ Was für schöne Sprache, alle Achtung, Herr Luther. Ein Gebot ging aus. Die Welt wurde geschätzt. Quirinius arbeitete als Landpfleger. Der Beruf würde mir sicher auch Spaß machen. Das Land pflegen. Ich liebe diese Worte, habe den Text tausendmal gelesen, dreißigmal ausgelegt, als Kind zehn Mal im Krippenspiel in der Naydaer Kirche aufgesagt. Aber hier, bei knapp dreißig Grad im Schatten, hilft mir das nicht weiter. Keine Weihnachtsstimmung, kein wohliges Gefühl, kein Hauch der Geschichte. Augustus kann nicht hier gelebt haben, denn die Weihnachtsgeschichte spielt in einer sächsischen Dorfkirche.
Wie lang sich anderthalb Stunden ziehen können… Wieder anstehen, diesmal vierzig Minuten. Wieder die Afrikaner mit ihrem eisgekühlten Wasser. Meine Flasche ist schon halbleer, hab natürlich zu wenig mit. Anfängerfehler. Der Wasserverkauf scheint illegal zu sein. Warum sonst versteckt der Typ seine Flaschen hinter einer kleinen Mauer, sobald ein Carabinieri auftaucht? Ehrlich währt am längsten, so bin ich erzogen. Obwohl mir da immer stärkere Zweifel kommen. Klar, mir geht es gut, aber die richtig großen Sprünge kann ich nicht machen. Keine Villa, kein Porsche, keine Yacht. Naja, für paar Tage Rom reicht es immerhin.
Die Schlange brät in der Sonne, Sprachengewirr flirrt durch die Luft. Ich betrachte den überdimensionierten Granatapfel oder so, natürlich nur von hinten, denn ich werde die Schlange um nichts in der Welt verlassen. Ich ziehe den Reiseführer aus dem Rucksack und schnall mir den bei der Gelegenheit auf den Bauch. Taschendiebe lauern überall, besonders von Südeuropa hört man sowas ständig. Ein Kunstwerk von Giuseppe Carla, aha. Kunstwerk? Ein Granatapfel halt, nur riesengroß und aus Bronze oder Messing, mehr nicht. Wer in Treusen wird schon mal einen Granatapfel probiert haben? Da steht man eher auf Kartoffeln, Möhren und Rotkraut. Wenn man zu Rotkraut Rotkohl sagt, wird man skeptisch angeschaut. Ein Fremder?
Granatäpfel sind überbewertet, finde ich. Lassen sich nur im Waschbecken öffnen, sonst sieht die Küchenplatte aus wie nach einem Massaker. Und dann: Tausende kleine rote Kerne, die man alle mitessen muss. Trotzdem wurde das Ding sogar im Studium thematisiert. Kann mich sogar noch daran erinnern, weil Professor Walther einen mithatte. Eine kleine Sensation, denn wo um alles in der Welt konnte man in der DDR einen Granatapfel auftreiben? Der Granatapfel wurde schon von König Salomo oder so für sein Aroma geschätzt. Irgendjemand muss mal die Kerne gezählt haben und kam auf 613. Genauso viele, wie es Gesetze im Alten Testament gibt. So hab ich mir das gemerkt. Zahlen lernen ist mir schon immer leicht gefallen. Ach ja, und der Granatapfel ist auch ein Symbol für Fruchtbarkeit und Sexualität, klar, der Gedanke kommt einem unweigerlich, wenn man so ein Ding aufbricht.
In meinem Leben ist schon lange nichts mehr aufgebrochen. Die letzten Träume und Illusionen haben sich mit der Scheidung von Anna verflüchtigt. Sieben Jahre ist das her. Seitdem trockne ich langsam aus. Gedanklich, sexuell, religiös. Deshalb der Versuch mit Rom. Nicht wegen der Sexualität, da werden mir die Katholiken kaum helfen können. Obwohl, mal sehen, was sich so ergibt… Meine Gedanken brauchen frische Luft, und mein Glaube einen neuen Impuls. Na toll, und den sucht der Protestant ausgerechnet
„Go on, please.“ Ich werde von hinten geschubst, hab schon eine ordentliche Lücke reißen lassen. Hinein ins kühle Innere des Rundbaus, was für eine Wohltat. Rucksack abgeben, Ticket vorzeigen, Treppen hoch, zwei Etagen. Dann auf den Rang hinaustreten und wirklich beeindruckt sein. Was für ein Panorama! Natürlich drängelt sich alles an der Brüstung. Die Älteren schießen Fotos vom Innenraum, die Jüngeren platzieren sich selbst zwischen Smartphone und Sehenswürdigkeit. Dafür stehen sie auch gern mit dem Rücken zum wirklich Wichtigen, wie blöd kann man sein. Egal, was sich hinter ihnen befindet, sie grinsen ins Objektiv. Man sieht die wildesten Grimassen und dümmliches Lächeln, denn niemand geht davon aus, beim Selfie machen beobachtet zu werden.
So, ich bin wegen des Colosseums hier und nicht um mich über infantile Jugendliche aufzuregen. Ich kämpfe mich ziemlich rabiat an die Brüstung vor. Hier kennt mich ja keiner. Das also ist einer der meist besuchten Orte der Welt. Riesig, zumindest für damalige Zeiten. Bis zu 80 000 Menschen sollen hier gesessen und gejohlt haben, sagt mein Reiseführer. Alle Schichten, unten die Großkopferten, oben das Volk. Sogar Sonnensegel hat es gegeben. Schade, dass das Ding nicht mehr komplett ist. Ob man es wieder herrichten sollte, so wie die Frauenkirche?
Die unterirdischen Gänge sind freigelegt. Da mussten bestimmt die Gladiatoren und die Löwen und Hunde auf ihrem Weg in die Arena durch. Und Christen? „Quo vadis?“ hab ich mal gelesen, aber ob das wirklich historisch ist?
Ich nehme mir Zeit, gebe meinen hart erkämpften Platz an der Brüstung nicht wieder her, klicke fünfzigmal auf den Auslöser, lasse das Colosseum auf mich wirken, trotz der nervigen Touristenmassen. Irgendeine Bewegung lässt mich nach links blicken, zielgerichtet in ein Gesicht mitten im Gedränge. Der Typ vom Frühstück schaut zu mir rüber, lächelt kurz und verschwindet. Mein unmerkliches Nicken wird er nicht mehr wahrgenommen haben. Ich bin erst einen Tag in Rom und werde schon gegrüßt, wow.
Häkchen hinters Colosseum, ich kann mitreden. In Treusen wird bloß niemand danach fragen. Irgendwie bin ich aber auch froh, den Massen entronnen zu sein. Und dabei ist nicht mal Hauptsaison.
Am Nachmittag Pizza aus der Hand, holländisches Bier. Dann mit der Metro zurück. Ottaviano, kurzer Fußmarsch, Hotel. Gleich aufs Bett, das Straßenpflaster ermüdet, wenn man sonst fast immer mit dem Auto unterwegs ist. War alles in allem ein schöner, zumindest ein interessanter Tag. Ich hab Bilder im Kopf, wenn ich künftig von Paulus oder Augustus oder der Christenverfolgung erzähle. Ok, mit meinem Glauben hatte das nichts zu tun, aber bisschen Kultur ab und an schadet ja auch nicht.
Es ist schon dunkel, als ich nochmal aufbreche. Nur mal schnell zum Petersplatz rüber. Ich hab gehört, der soll im Schein der Laternen besonders eindrucksvoll sein. Und um diese Zeit auch ziemlich leer. Es ist immer noch warm, aber inzwischen erträglich. Bevor ich rausgehe, blättere ich bisschen im Resieführer. Also gehe ich nicht an irgendeiner Mauer lang, sondern am Passetto di Borgo, dem Fluchtweg zwischen Vatikan und Engelsburg. Hat schon viel erlebt, dieser Tunnel. Schicksale über Schicksale. Verurteilte, Verfolgte, Leute, die besser mal eine Zeitlang untertauchen sollten. Heute schlendern Touristen am Passetto entlang. Ist das eine Weiterentwicklung?
Auf dem Petersplatz herrscht eine bezaubernde Atmosphäre, da kann man nicht meckern. Ziemlich weitläufig, und dann noch diese relative Ruhe nach all der Geschwätzigkeit des Tages. Im Hintergrund thront der Petersdom, größte Kirche der Welt, glaube ich, gebaut über dem angeblichen Grab von Petrus. Und Symbol für die Trennung der Lutheraner von der katholischen Kirche. Ablass. Sündenfreiheit gegen Geld. Von deinen Moneten bauen wir diese wundervolle Kirche, die Gott rühmt und uns gleich noch mit. In diesem Augenblick rückt mir Luther wieder näher. Ausgerechnet am Petersplatz. Sollte sich meine Reise auszahlen?
2
Ich an seiner Stelle würde heute nicht zum Frühstück kommen. Oder sehr früh oder sehr spät. Mir wär das peinlich. Ich würde mir nicht begegnen wollen.
Aber nein, da sitzt er vor seinem Tablett und blättert in einer Zeitung. Derselbe braune Pullover wie gestern. So platziert, dass ich auf dem Weg zum Buffet an ihm vorbei muss. Er schiebt mir das schlechte Gewissen zu. Funktioniert natürlich. Danke, Mama. Eigentlich hat er Recht, ich habe überreagiert. Was wäre denn zu befürchten gewesen, wenn er sich zu mir gesetzt hätte? Im schlimmsten Fall ein nettes Schwätzchen. Ich hätte jemanden kennen lernen können, einfach so. Aber dann hätte er sich jeden Morgen zu mir gesetzt, und das will ich nicht. Zu viel Nähe. Ich muss zu dem stehen, was ich möchte. Anna hat mir immer mal wieder vorgeworfen, ich sei zu ungesellig. So bin ich nun mal, hab ich geantwortet. Du bist gern unter Leuten, Anna. Die Menschen sind halt verschieden. Die Menschen können sich ändern, hat sie erwidert. Dann ändere du dich erstmal. Typisch für dich, immer gleich den Spieß umzudrehen. Ja nicht über sich selbst nachdenken. Ich hab ja nicht angefangen. Klar, weil du ja auch kein Problem siehst. Und du siehst überall Probleme. Das größte Problem bist du. Du wohl eher.
Gazetta dello Sport. So heißt die Zeitung, wie ich entziffere. Dann stiere ich konzentriert zum Buffet, kümmere mich im Vorübergehen mit aller Hingabe um einen Knopf an meinem Hemd. Was für ein würdeloses Spiel. Wie gehabt Weißbrot mit Butter, eine Scheibe Fleischwurst, eine Ecke Camembert, ein warmes Ei, Kirschkonfitüre und Honig im Minipack, Himbeerjoghurt mit Cornflakes, Kaffee und Orangensaft, dann auf dem Rückweg wieder an ihm vorbei. Ich blicke nur ganz kurz zu ihm, ich Idiot, er schaut sofort auf, lächelt zurückhaltend. Und schon sitze ich in der Falle und beginne zu plappern.
„Na, gestern auch im Colosseum?“ Du liebe Zeit, eines meiner Studienfächer war Rhetorik. Er faltet die Zeitung zusammen, ohne hinzuschauen.
„Ja, beeindruckend, was?“ Ich nicke. Einfach macht er es mir nicht.
„Und? Was Neues im Sport?“ Direkt mit Bildung überzeuge ich nicht. Er muss denken, ich bin einer dieser dumpfen Touristen.
„Empoli hat gegen Inter gewonnen. War so nicht zu erwarten, was?“
Ich weiß weder, was Empoli, noch was Inter ist. Sport interessiert mich nicht. „Äh, wegen gestern beim Frühstück.“
Er winkt ab. „Nein, nein, mein Fehler. Ich hab mich aufgedrängt.“
„Sie haben doch nur nett gefragt. Ich hätte ja auch ein bisschen entgegenkommender sein können. Man ist ja auch im Urlaub, um Leute kennen zu lernen.“ Oh, hoffentlich interpretiert er das nicht falsch. Doch.
„Sie können sich gern zu mir setzen, wenn Sie möchten.“ Und er lädt mich mit einer Handbewegung an seinen Tisch ein. Gut gemacht, Christian. Mit deiner blöden Relativiererei hast du nun genau das Gegenteil von dem erreicht, was du eigentlich wolltest.
„Aber nur kurz. Und nur heute.“ Ich lächle ziemlich einfältig, stelle mein Tablett ab und setze mich ihm gegenüber. Und wie weiter? Jetzt bloß kein Schweigen. Ich bestreiche eine Weißbrotscheibe, als gelte es, eine Kochshow zu gewinnen. Sag was, Fremder!
„Sie sind zum ersten Mal in Rom?“ Er hat eine angenehme, warme Stimme und spricht völlig akzentfrei, trotz der italienischen Zeitung.
„Ja, hat sich nie ergeben. Wollte aber schon immer mal. Und Sie?“ Langsam, konzentrieren. Baue vernünftige Sätze. Du kannst das.
„Ach, ich bin dauernd unterwegs, weltweit. Besonders in Europa und Amerika. In Rom muss ich ständig vorbeischauen. Die Leitung unserer Zweigstelle hier ist ziemlich selbstbewusst und muss immer mal zur Ordnung gerufen werden.“ Er lacht kurz und hell auf. Ob er als Chef nachsichtig oder streng ist?
„Sie arbeiten für ein weltweit agierendes Unternehmen?“ Bis jetzt habe ich es nicht bereut, mich zu ihm gesetzt zu haben. Es sei denn, er lässt mich auflaufen.
„Ich habe es gegründet.“ Mir fällt fast ein Stück Toast aus dem Mund. Jetzt wirke nicht debil, Christian! Er lacht freundlich. „Aber ich habe die Verantwortung abgegeben. Heute schaue ich nur noch nach dem Rechten, versuche, die gröbsten Fehler auszubügeln. Ehrlich gesagt, die Mitarbeiter bringen mir zwar Ehrfurcht und Respekt entgegen, aber letztlich halten sie sich kaum an das, was ich von ihnen erwarte.“
Also ist er doch eher nachsichtig. Gedanken jagen durch meinen Kopf. Welches deutsche Unternehmen agiert weltweit? Wir sind ja pfiffige Erfinder. Maschinenbau? Informationstechnik? Lebensmittelindustrie? Pharmazie? Verlagswesen? Er scheint mir anzusehen, dass ich mehr wissen möchte, winkt mit der Hand ab und sagt: „Jetzt sind Sie aber dran.“ Und kurz darauf: „Aber wenn Sie nichts erzählen möchten, ist das auch ok.“
Was hab ich schon zu erzählen? Ich sitze am Tisch des Gründers eines Firmenimperiums. Er muss in Geld schwimmen. Aber man sieht ihm seinen Reichtum nicht an. Ist das nicht sogar eine Swatch an seinem Handgelenk? Kein Schmuck, er wirkt irgendwie, wie soll ich sagen, zeitlos. Auch keine Bodyguards weit und breit. Nur paar Familien und ältere Paare verteilen sich im Frühstücksraum. Er verwirrt mich. Was er sagt und wie er auftritt passt nicht zusammen. Vielleicht nimmt er mich nur auf den Arm und ist Malermeister in Magdeburg oder Zahnarzt in Braunschweig? Soll ich ihn auch anflunkern? Nein, das verstößt gegen meinen Ethos.
„Im Augenblick bin ich einfach nur Tourist. Und wenn es nach mir ginge, könnte das auch mein Beruf sein.“ Er lacht, und ich freue mich darüber.
„Ja, kann ich verstehen. Die Welt ist zu schön, um nur einmal oder zweimal im Jahr ein neues Eckchen kennen zu lernen. Darf ich fragen, in welcher Region in Deutschland Sie leben?“ Ok, er hat verstanden, dass ich nichts über meinen Beruf erzählen möchte. Ich muss erst zur Ruhe kommen, schauen, was Rom mir an Antworten anbietet.
„Hören Sie es nicht an meinem Dialekt?“
„Ich vermute: Sachsen.“ Ich nicke. Treffer. Und ich habe gedacht, ich spreche Hochdeutsch mit ihm.
„Und Sie klingen, als kämen Sie aus der Hannoveraner Ecke. Ich höre keinen Dialekt heraus.“
Er lacht wieder. Er lacht überhaupt sehr viel. „Nein, nein. Eigentlich wohne ich in Frankreich. Aber ich bin kaum dort.“
Frankreich? Das überrascht mich. „Dann sicher im Elsass oder in Lothringen, stimmt´s? Oder weshalb sprechen Sie ein derart gutes Deutsch?“
„Sprachen sind mein Hobby“, erwidert er und schaut auf seine Swatch. „Entschuldigung, ich muss los. Danke für das nette Gespräch. Vielleicht sieht man sich ja wieder irgendwo in der Stadt?“ Er stellt Teller und Tasse aufs Tablett, schiebt sich im Stuhl nach hinten, erhebt sich, nickt mir freundlich zu und steuert Richtung Geschirrablage. Das alles ging sehr schnell, ich hätte gern länger mit ihm geschwatzt.
„Ja, vielleicht“, antworte ich, aber das kann er schon nicht mehr hören. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffens in der Stadt ist nicht sehr groß, denn ehrlich gesagt – ich weiß noch gar nicht, was ich heute machen werde. Ich habe mir bewusst kein Programm zusammengestellt. Ok, das Colosseum wollte ich sehen. Aber das ist abgehakt. Der Petersdom ist erst morgen dran. Ansonsten – freie Zeit, Flair erleben, die Stadt auf mich wirken lassen, mal schauen, was hinter der nächsten Ecke wartet. Vielleicht hat sich Gott ja eine Überraschung für mich ausgedacht. Oder einfach aufs Bett legen und an die Decke schauen. Mal sehen, wonach mir in einer halben Stunde ist.
3
Rumliegen kann ich auch in Treusen. Also doch noch paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Ich muss ja nichts abarbeiten, wenn ich keine Lust mehr habe, ist halt finito.
Sportschuhe und Rucksack, aus dem links und rechts zwei Flaschen Wasser ragen. Wie jeder andere der hunderttausend Touris in dieser Stadt. Egal, im Urlaub spielt Eitelkeit keine Rolle. Rom sieht mich nur dieses eine Mal und wird mich ertragen. Nur an die allerorts zu bestaunenden Männershorts werde ich mich nie gewöhnen. Kaum einer hat schöne Waden. Zu dick, zu knochig, zu wulstig, zu sehnig, zu behaart. Ich könnte sowas nie tragen. Ein Ergebnis meiner Erziehung.
Es ist schon wieder viel zu warm für einen Mitteleuropäer. Quer über die Piazza del Irgendwas mit von allen Seiten heranbrausenden Straßenbahnen. An diesen Lärm würde ich mich nie gewöhnen. Da lobe ich mir mein beschauliches Treusen ohne eine einzige Ampel. Nein, natürlich nicht. Ich hasse Treusen, allerdings würde ich das niemals vor Publikum zugeben.
Wie gestern mit der roten Linie, diesmal bis Barberini, dann immer schön die Via del Wasweißich entlang. Verkehr, Geschäfte, Pizzerias. Hupen, Schreien, dröhnende Musik aus offenen Autofenstern. Die Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Endlich, links runter, und dann hört man schon das Rauschen. Solange das Gequassel der Touris es nicht übertönt. Fast unvermittelt dann der Trevi-Brunnen, direkt hinter einem Palast. Ich hatte mit viel Kitsch gerechnet, aber das hier übersteigt meine Befürchtungen bei weitem. Trotzdem, irgendwie beeindrucken mich die Ausmaße dieses Kitsches. Nicht etwa rund, wie vermutet. Sicher fünfzig Meter breit, entlang der gesamten Fassade. Sprudelnde Gischt, dazwischen Felsenlandschaften, Neptune und Meergeister. Wie man es halt kennt aus dem Barock. Oder Rokoko? Wo kommt eigentlich das Wasser her? Direkt aus dem Palazzo? Hilf, Reiseführer. Aha, Ende eines Aquädukts, Wasser aus den Sabiner Bergen. Eine Sabine gab es in meiner Schulklasse. Ist jetzt Heilpraktikerin, glaube ich.
Am Rand des Brunnens stehen etwa fünftausend Asiaten und schießen Selfies mit Fabelwesen und aus dem Wasser auftauchenden halben Pferden. Die Handystöcke verhaken sich. Sieht aus, als würden sie fechten. Ich kämpfe mich da nicht durch, schaue mir den Brunnen und das glasklare Wasser lieber aus der Entfernung und von der Seite an. Üppige Formen, Geschmackssache halt. Am gelungenstgen finde ich die nachgebildeten Felsformationen. Natürlich fotografiere ich auch. Macht man so. Also: Trevi-Brunnen, zehn Minuten. Nächstes Häkchen.
Moment, ich muss ja noch Geld werfen. Also krame ich ein Zwei-Euro-Stück aus dem Portemonnaie und stelle fest, dass ich doch ziemlich weit weg stehe vom Wasser. Werfen konnte ich noch nie gut, aber was soll´s. War ja klar. Ich verfehle den kompletten Brunnen. Mein Geldstück trifft irgendeinen Chinesen am Kopf, der wendet sich erschrocken um und schaut in Hunderte Gesichter. Dann verzieht er den Mund und reibt sich den Hinterkopf. Ein anderer neben ihm bückt sich blitzschnell, hebt meine Münze auf und steckt sie ein. Na toll. Entwicklungshilfe für Asien.
Touristen nerven. Gut, dass ich keiner bin. Richtung Norden. Das Rauschen wird leiser. Wieder eine der üblichen mit Fiats und Motorrollern verstopften Straßen, Via di Propaganda, lese ich auf einem Straßenschild. Klingt nach DDR. Eine Straße der Propaganda gab´s bestimmt auch in Berlin oder Leipzig oder Neubrandenburg. Es werden wieder mehr Touris, ich nähere mich meinem nächsten Etappenziel. Der Blick öffnet sich. Unten ein Brunnen, oben eine Kirche, nämlich die … blätter, blätter … nämlich die Trinità dei Monti, und vom Brunnen zur Kirche führt die Spanische Treppe hinauf. In der Mitte des Aufstiegs teilt sie sich und schließt oben einen kleinen Vorplatz mit Balustrade ein. Wieder so ein Hotspot. Hübsch, aber ich hatte sie mir imposanter vorgestellt. Eine Freitreppe halt, viel kleiner als in Sanssouci. Moment mal, ich bin in Rom, und eine spanische Treppe führt zu einer französischen Kirche empor. Also noch mal her mit dem Reiseführer, es ginge sicher auch mit dem Smartphone, aber so bin ich´s halt gewohnt. Aha, Ludwig der Zwölfte, wer immer das ist, dem Namen nach sicher ein französischer König, wahrscheinlich der Nachfolger von Ludwig dem Elften und der Vorgänger von Ludwig dem Dreizehnten, hat den Auftrag zum Bau der Kirche gegeben, und die Treppe ist nach dem spanischen Platz benannt, an dem die spanische Botschaft gelegen ist. Na, es ergibt doch alles einen Sinn. Auch wenn ich es morgen wieder vergessen haben werde.
Zwei Ordner in neongrünen Leibchen stiefeln umher und scheuchen Touristen, die sich für einen Imbiss auf einer Stufe niedergelassen haben, hoch. Ja, richtig so. Allerdings stören sie den Gesamteindruck. Auf jedem Foto von der Treppe sticht das quietschende Grün ihrer Uniform sofort ins Auge.
Erst geht´s ein gutes Stück treppauf, vierzig Stufen bestimmt, dann die Teilung. Wie in meiner polytechnischen Schule. Ich gehe links hoch, schaue oben von der Aussichtsplattform hinab zum Brunnen, gehe links runter und schaue von unten hinauf zur Kirche. Sehr schön. Häkchen. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe, will mich nicht mehr durch Gruppen von Amerikanern, Holländern und Japanern arbeiten. Ich erhoffe mir von Rom anderes als Lärm und Hektik. Laut meinem Stadtplan liegen dort oben Gärten und Parks, jedenfalls sieht es sehr grün aus auf dem Papier. Also nochmal hoch, durchschnaufen, nochmal runtergucken, und dann nach links.
Zwei Minuten, und es gibt nur noch mich und paar Einheimische. Die Touristenführer mit den bunten Schirmchen muten es ihren Gästen nicht zu, hier hoch zu kraxeln. Bloß gut, nichts fehlt mir weniger als Scharen von Touris. Rechts die Villa Medici. Den Namen hab ich irgendwann schon mal gehört, wahrscheinlich während des Studiums in Kirchengeschichte. Nicht viel los hier. Aha, geschlossen wegen Bauarbeiten. Auch gut, viel mehr könnte ich ohnehin nicht aufnehmen. Mein Speicher für diesen Dienstag ist jetzt schon voll.
Nach paar hundert Metern rechts ein Pfeil mit der Aufschrift „Esposizione / Exposition / Ausstellung“. Sie rechnen also hier oben doch mit Touristen, sogar mit deutschen. Ich biege ab, dem Pfeil nach, mitten ins Grün hinein. Ein Paradiesgarten, kein Mensch weit und breit, nur ein einziger Ausstellungsbesucher, nämlich meine Weniugkeit. Ich schlendere an einer Pergola entlang mit, tja, was ist das, Bougainvillea, Hortensie, Clematis? Anna wüsste das sofort. Sie hatte ein Händchen für den Garten, brachte an jedem Fenster einen Blumenkasten mit Petunien, glaube ich, an. Weiß, rosa, lila. Mein jetziges Haus wirkt ungepflegt und trostlos. Wie ich. Nana, Christian, nicht sentimental werden. Genieß den Tag.
Wo ist die Ausstellung? Doch nicht etwa diese im Garten verstreuten kubistischen Betonklötze auf improvisierten Podesten? Kugel, Würfel auf der Spitze, eine Art Schlauch, irgendwas mit Loch drin. Das wird es wohl sein, was anderes gibt es nicht. Kein Wunder, dass ich der einzige Besucher bin. Eine Säule ist umgekippt und liegt halb im Gebüsch. Bestimmt ist auch das gewollt und hohe Kunst.
Ich hab keinen Sensus für so was.
Im hinteren Teil des Paradieses stehen Bäume. Orangen, paar Pinien und das dort sind wohl Mispeln. Genau so einen Baum gab´s in unserem Garten in Nayda. Meine Mutter hatte einmal Marmelade aus den Früchten gemacht, aber irgendwie war das nicht der Renner. Das erste Glas hat mein Vater tapfer geleert, die anderen haben wir großzügig verschenkt. Hier und da steht eine Bank, gute Idee. Ich lasse mich auf einer nieder, direkt unter einem Kakibaum, ja, das ist sicher ein Kakibaum. Er hängt voller leuchtend gelber Früchte. Wenn die Schlange kommt und mir eine Kaki anbietet, werde ich zugreifen.
Die Bank steht perfekt, man blickt in den Garten hinein. Ich scheine wirklich allein zu sein. Wie aus dem Nichts fliegt ein Schwarm grüner Papageien vorüber. Fast zu kitschig, um wahr zu sein. So, Christian, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, die Arbeit kann beginnen. Rom als letzte Chance. Du wolltest dir die großen Fragen stellen, du wolltest reinen Tisch machen. Also los. Besser werden die Umstände nicht.
Ich trinke einen langen Zug Wasser aus einer meiner Flaschen, hole einen kleinen Notizblock und einen Fineliner aus dem Rucksack und schreibe:
Du kannst nichts wirklich gut.
Ich lasse den Satz wirken, dann streiche ich DU KANNST durch und schreibe ICH KANN darüber. Ich muss lachen. Nicht einmal einen einfachen Satz aufschreiben gelingt mir auf Anhieb. Ich reiße die Seite aus, zerknülle sie, werfe sie in den neben der Bank wartenden Abfalleimer und versuch es nochmal.
Ich kann nichts wirklich gut.
Mein Vater war Pfarrer in der DDR, ein richtig begabter. Obwohl die Staatsführung die Kirche austrocknen wollte, hat er die Leute um sich geschart. Er hatte eine klare politische Meinung, hat aber immer von seinem Glauben her argumentiert. Das hatte Kraft. Er pflegte zu sagen: „Ich arbeite für ein Unternehmen, das seit zweitausend Jahren am Start ist.“ Jeder wusste, dass er eigentlich meinte: „Der Sozialismus wird die Kirche nicht unterwerfen und auslöschen.“ Die Gottesdienste waren gar nicht sein Hauptaugenmerk, eher die Gesprächskreise und Diskussionsrunden an den Abenden der Wochentage. Wir hatten eigentlich immer Besuch, Leute mit Profil und klangvollen Namen. Bestimmt waren auch eine Menge Stasi-Spitzel dabei, aber die haben meinen Vater nicht drangekriegt. Er war klug, er konnte so reden und schreiben, dass alles Wichtige zwischen den Zeilen zu hören und zu lesen war. Beim Einkaufen sprach er mit den vietnamesischen Gastarbeiter, mit denen sonst keiner redete. Er sah damals, in den Sechzigern und Siebzigern, schon darauf, dass ausreichend Frauen in den Gremien mitarbeiteten. Er war für viele eine Ikone, er hat mich beeindruckt und geprägt. Ich wollte immer so sein wie er.
Aber das war mein Verhängnis. Ich hab nicht das Zeug dazu, aber das hab ich viel zu spät kapiert. Ich bin ein sehr mittelmäßiger Pfarrer. Unteres Mittelmaß, um ehrlich zu sein. Anfangs hab ich das mit Enthusiasmus kaschieren können, aber im Laufe der Zeit wurde es immer deutlicher. Natürlich sagt mir das niemand ins Gesicht. Aber sie loben und hofieren mich nicht, wie sie es damals mit meinem Vater getan haben.
Beispiel gefällig? Ich habe in den letzten beiden Tagen große Kunst gesehen, aber sie bringt nichts zum Klingen in mir. Im Forum Romanum liegen Trümmer, das Colosseum ist stark beschädigt, der Trevi-Brunnen kitschig, die Spanische Treppe anstrengend zu laufen. Und hier krieg ich nicht mal mit, was denn eigentlich die Ausstellung ist. Das bleibt übrig von meinem Sight-Seeing. Ich lasse mich nicht berauschen, nicht begeistern. Ich sehe die Idee hinter einem Kunstwerk nicht. Mich interessieren weder die Rokoko-Figuren im Brunnen noch diese modernen Bildhauerwerke im Paradiesgarten. Keine Ahnung, ob die Säule versehentlich umgefallen ist oder absichtlich da rumliegt. Ich bin ein Kunstbanause. Klassische Musik langweilt mich, Pop im Radio nervt. Während des Weihnachtsoratoriums schaue ich auf die Uhr und hoffe, dass die ätzenden Rezitative endlich vorbei sind. Ich war noch nie in den Alten Meistern im Zwinger, ich geh auch nicht ins Theater. Sport ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Die Redewendung stammt aus der Offenbarung des Johannes, wenigstens das weiß ich. Ich kenne Bayern München, aber nicht einen Spielernamen. Doch, Effenberg. Aber der spielt, glaube ich, nicht mehr. Ach ja, Beckenbauer, der mit dem Lockenkopf. Von den zwanzig oder so Bundesligavereinen bekomme ich vielleicht fünf zusammen. Bayern München, ok, dann noch Borussia Dortmund, Borussia Köln, Schalke, FC Hertha, Chemie Leipzig und Hansa Rostock. Sieben sogar. Ich selber treibe keinen Sport. Schon dieser Ausdruck: Sport TREIBEN. Ich lass mich nicht treiben, auch nicht vom Sport. Fitnessstudio? Vergeudete Zeit. Die Folge ist, dass ich mir in den letzten zehn Jahren ein beeindruckendes kleines Bäuchlein angefuttert habe. Aber ich bin Mitte Fünfzig, was soll´s? Immerhin schaue ich mir ab und zu mal Sport im Fernsehen an. Dart im Spartenkanal. Das beruhigt. Dicke Männer mit Halbglatze werfen kleine Pfeile auf eine schwarze Scheibe, die dabei fröhlich piept. Und das Rechnen nimmt mir der Moderator ab, obwohl ich manchmal schneller bin als er. Ich schaue zu, nicke weg, wache auf und schaue weiter. Nichts verpasst.
Ok, frag ich doch mal anders: Was kann ich wirklich gut? Ich finde, dass ich lustig bin, jedenfalls manchmal. Aber kaum jemand lacht über meinen Humor. Wahrscheinlich gleite ich zu schnell in Ironie oder sogar Sarkasmus ab.
Weiter. Ich kann einigermaßen repräsentieren. Auf die Treffen mit dem Bürgermeister freue ich mich, dort fühle ich mich wertgeschätzt. Ich mache einen leichten Diener und plaudere bei festem Händedruck „Vielen Dank für die Einladung, Herr Doktor Brenner“. Und er antwortet „Schön, Sie zu sehen, Herr Pfarrer Beyer.“ Wir kennen die Spielregeln und schmeicheln uns gegenseitig, gut so.
Zahlen kann ich mir gut merken, Telefonnummern, Geburtstage und so. In Kopfrechnen bin ich fix. Hilft mir nur nicht viel auf der Kanzel. Höchstens beim Dart gucken.
Was ich am allerbesten kann: Dösen. Langeweile schreckt mich nicht. Einen freien Nachmittag kann ich locker auf meinem Sofa verbringen. Zeitung lesen, Kaffee trinken, Koch-Shows oder Tier-Dokus schauen. Am liebsten bunt Vermischtes ohne hohen Anspruch. Es muss sich ganz leicht weg sehen. Ja, ich gebe zu: Die Probleme der Leute interessieren mich nicht wirklich. Ich bin ein lausiger Seelsorger, aber das hat sich Gott sei Dank wohl inzwischen rumgesprochen. Niemand kommt mit seinem Kummer zu mir, bloß gut.
Und nicht nur mit der Seelsorge hab ich meine Probleme. Jede Gremiensitzung ist mir ein Graus, zumal ich sie ja meistens auch noch vorbereiten und leiten muss. Ebenso verabscheue ich Exegesen und das Verfassen von Predigten. Ich arbeite seit neun Jahren in Treusen, mein Pulver hatte ich schon nach neun Monaten verschossen. Vor ein paar Jahren habe ich das Internet als Fundgrube entdeckt. Man muss das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden. Kluge Köpfe haben sich schlaue Gedanken über Bibeltexte gemacht und Schlussfolgerungen in rhetorisch ausgefeilter Weise niedergeschrieben. Anfangs habe ich mir nur Ideen aus dem Netz geholt, aber zunehmend übernahm ich ganze Passagen. Und seit einem halben Jahr bearbeite ich die vorgefertigten Predigten nur noch marginal. Ich beginne mit „Ihr lieben Treusener“ und schiebe ab und zu einen Bezug zu unserem Dorf oder zu aktuellen Ereignissen ein. Das klingt authentisch. Ich hoffe nur, dass mir niemand auf die Schliche kommt. Aber selbst wenn – die fundierte Predigt aus dem Internet wird den Leuten lieber sein als meine eigenen Ergüsse. Eine Win-Win-Situation. Meine letzte Exegese datiert aus dem Jahr 2011, und in den hebräischen und griechischen Urtext habe ich in Treusen noch nie geschaut. Die meisten sprechen ja nicht mal englisch. Ich übrigens auch nicht.
Ich drucke Internet-Predigten aus, nutze jede Woche dieselben Gebete (ich bezeichne das wahlweise als Tradition oder als Ritus), überlasse die Liedauswahl Frau Liebermann, die jeden Sonntag treu die Orgel spielt, mehr schlecht als recht. Aber darüber muss ich mich mit meinen vorgestanzten Texten wirklich nicht aufregen. Die Vorbereitungszeit für die Gottesdienste hat sich auf zwei Stunden reduziert. Früher hab ich mindestens zwei Tage dran gesessen.
Ok, also das kann ich richtig gut: sarkastisch sein, repräsentieren, kopfrechnen, dösen. Klingt nach einem hochbegabten Pfarrer. Nur noch zehn Jahre, also Zähne zusammenbeißen. Mit dem Ruhestand wird alles besser. Dann muss ich nicht mal mehr lustig sein oder repräsentieren. Dann brauch ich nur noch dösen. Ein immerwährendes Dart-Spiel, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Luft ist raus, zehn Jahre zu früh. Deshalb bin ich in Rom. Deshalb sitze ich auf dieser Bank oberhalb der Spanischen Treppe und versuche, ehrlich gegen mich selbst zu sein. In meinem Notizblock steht, dass ich nichts wirklich gut kann, zumindest nichts wirklich Wichtiges. Ich schreibe dazu:
PS zu 1: Ich habe den falschen Beruf gewählt.
Aber das ist erst der Anfang, ich arbeite mich vor. Es wird deutlich schlimmer kommen.
Ich schaue mich um, immer noch niemand, der die Ausstellung, wenn es sie denn überhaupt gibt, sehen möchte. Die Sonne scheint durch die Zweige des Kaki-Baumes. Hier lässt es sich aushalten. Schade, dass keine Dartscheibe am Stamm hängt. Bienen oder Wespen surren durch die Luft. Der Papageienschwarm fliegt mal hierhin, mal dahin. Sie tun so, als hätten sie ein Ziel. Alle fünfzig Papageien sitzen entweder auf dem einen oder auf dem anderen Baum. Fünfundzwanzig hier und fünfundzwanzig da geht nicht. Und wer gibt das Aufbruchssignal? Ist vielleicht ein knallroter dabei, auf den alle hören? Eher nicht, der wäre schnell zum Außenseiter gestempelt. Neunundvierzig grüne Papageien auf diesem Baum, ein roter auf jenem. Ich fühle mich oft wie der rote und versuche, stolz auf meinem eigenen Baum zu sitzen. Aber in Wirklichkeit will ich einfach nur zu den grünen rüber.
Sei mutig, greif zum Stift und notiere.
Ich bin einsam.
Dösen ist ok, zu zweit dösen ist schöner. Ich will nicht sagen, dass Anna mir fehlt. Dafür ist zu viel passiert. Mir fehlt jemand zum Reden. Mir fehlt jemand, mit dem ich Dinge gemeinsam erleben und mich noch jahrelang drüber austauschen kann. „Weißt du noch, diese grünen Papageien …“ oder „Mein Gott, hier sieht es ja aus wie im Forum.“
Ich befürchte, dass ich eigenbrötlerisch werde, wenn ich es nicht schon bin. Gut, dass ich eine Haushälterin habe, die zweimal pro Woche kommt und die viel zu große Dienstwohnung in Schuss hält. Sie ist über sechzig und zieht den linken Fuß nach, da gibt es keinen Anlass für Gerede. Ihr Name ist Frau Weinert, und so nenne ich sie auch. Nicht zu vertraulich werden, in Treusen spricht sich alles in Windeseile rum.
Auf die Idee mit der Haushalthilfe hat mich eine Kirchvorsteherin gebracht. Hatte sie etwa eine Verwahrlosung im Anfangsstadium bemerkt? Jedenfalls war der Vorschlag klasse, auch wenn ich mich erst an den Gedanken gewöhnen musste, eine fremde Person in meine Wohnung zu lassen, die ihre Nase in alle Schubladen und Schränke stecken würde. Aber die Vorteile überwiegen. Außerdem, Geld hab ich, kein Problem. Und ich muss mich nicht mehr ums Fenster putzen und Gardinen waschen kümmern. Wenn Frau Weinert wirbelt, ziehe ich mich ins Amtszimmer zurück und gebe vor, an meiner nächsten Predigt zu arbeiten. In Wirklichkeit spiele ich Mahjong auf dem Laptop oder löse Kreuzworträtsel.
Die zehn Jahre muss ich noch irgendwie rumkriegen. Ein Stellenwechsel kommt nicht mehr in Frage, auch wenn ich beim Gespräch mit dem Superintendenten den Eindruck hatte, er würde mir das nahelegen. Ich bin Mitte Fünfzig, ich fang nicht nochmal von vorn an. Das mache ich erst mit Mitte Sechzig. Sobald ich pensioniert bin, ziehe ich nach Leipzig, such mir eine attraktive Frau und lasse ganz viel Luft in meine Lungen. Auf diesen Tag lebe ich hin, den Tag, an dem ich meiner Berufsbezeichnung ein i.R. hinzufügen kann.
Aber zehn Jahre sind eine elend lange Zeit. Zehnmal Weihnachten, zehnmal Ostern, zehn Mal Erntedank, zehnmal Jubelkonfirmation. Und am schlimmsten: vierhundert Gottesdienste mit vierhundert Predigten. Zehn Jahre… Die Bandscheibe zwickt, beim Treppensteigen sticht mir der Schmerz in die Knie, und mir entfallen immer wieder Wörter, wie zum Beispiel, na. Aber mein größtes Problem kann nur Rom lösen.
Ein plauderndes Pärchen betritt das Paradies. Adam und Eva. Er, Typ Versicherungsvertreter, maßgeschneiderter blauer italienischer Anzug, weißes Hemd, die beiden oberen Knöpfe geöffnet, gestikuliert und redet auf sie, Typ schüchterne Studentin, schwarzes Shirt und geblümter Rock bis knapp übers Knie, ein. Sie bleiben vor einem der Betonklötze stehen, als ob es da irgendwas zu sehen gäbe. Er redet und redet, und sie tut, als würde es sie interessieren. Vielleicht ist er ja der Künstler, der den Beton angerührt hat. Oder ihr Kunstprofessor. Wer sonst könnte einer Kugel auf einem Podest etwas abgewinnen? Als er mich wahrnimmt, dämpft er seine Stimme und nickt mir zu. Sie lächelt sogar in meine Richtung. Ich nicke und lächle zurück. Sie werden doch jetzt nicht an jedem der dreiundzwanzig Betondinger Halt machen. Was soll´s? Sie nehmen keine Notiz von mir, und sie reden italienisch, vermute ich, so dass ich ohnehin nichts verstehe.
Zurück zu Punkt 1. Ich bin kein begnadeter Liebhaber, das ist leider so. Ich sprühe nicht vor Leidenschaft, und ich hab auch keine Ahnung, was ich machen muss, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Ich hab eher Angst, was Falsches zu tun und dann belehrt zu werden. Anna hätte sich vielleicht mehr Abwechslung im Bett gewünscht. Wir haben nie drüber gesprochen. Als guter Protestant bevorzuge ich natürlich die Missionarsstellung. Ich weiß nicht, ob Anna jemals einen Orgasmus hatte. Paarmal habe ich nachgefragt, und ihre Antwort war stets: „Es ist doch auch so schön.“ Was immer das heißt.
Meine Libido hat mit den Jahren kontinuierlich nachgelassen. Als Jugendlicher hab ich fast jeden Tag onaniert, sogar als Theologiestudent noch. Mit Anna gab´s anfangs zweimal pro Woche Sex, später nur noch zweimal im Monat. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr das genügt. Mir selbst hat nie was gefehlt.
Nun lebe ich seit sieben Jahren allein. Manchmal erwache ich mit klebriger Schlafanzughose und schlechtem Gewissen, manchmal schaue ich mir auf dem Rechner einen Porno an und hole mir dabei einen runter, auch mit schlechtem Gewissen. Wichtig ist: Gardinen zu. Wäre ja oberpeinlich, wenn der Pfarrer beim Wichsen beobachtet würde.
Ich brauche keinen regelmäßigen Sex mehr. Meine katholischen Kollegen müssen das ja auch irgendwie hinkriegen. Was ich vermisse, ist jemand, der in der Wohnung Betriebsamkeit und Fröhlichkeit verbreitet, der ruft: „Essen ist fertig.“ oder „Zeit für einen Kaffee?“ Also, es könnte letztlich sogar ein Mann, ein guter Freund, sein. Haha, völlig undenkbar in Treusen. Würde es auch ein Hund oder eine Katze tun? Nein, ganz so weit sind meine Ansprüche noch nicht gesunken. Außerdem, um ehrlich zu sein: Ich werde gerne bedient.
Anna stammte aus dem Erzgebirge und ging trotzdem noch vor der Hochzeit mit mir ins Bett beziehungsweise auf die Matratze in meiner Studentenbude. Sie hatte Textiltechnik studiert und ihre praktische Ausbildung bei ESDA in Thalheim absolviert. ESDA - Erzgebirgische Strümpfe für Damen. Die waren, na, weltberühmt wäre übertrieben. Aber die meisten Strumpfhosen gingen in den Westen, und im Osten wurden sie als Bückware gehandelt und dienten als Währung. Strumpfhose gegen Blumenkohl, Strumpfhose gegen Queen-LP, Strumpfhose gegen Ketchup.
ESDA fertigte ab Ende der Fünfziger seine Strumpfhosen aus Dederon, das war ein echter Fortschritt. Weiß ich von Anna. Dederon – knittert nicht, trocknet schnell. Erfunden von ostdeutschen Textiltechnikern. Naja, erfunden. Modifiziert. In den USA gab´s die Polyamidfaser schon seit den Dreißigern als Nylon. Und im Westen wenige Jahre danach als Perlon. Aber Dederon war DDR-Lebensgefühl. Berufsmäntel, Einkaufsbeutel, die abscheulichen ärmellosen Kittelschürzen für die Hausfrau und eben Strumpfhosen. Als Junge am Beginn der Pubertät hab ich die Verpackungen mit dem Aufdruck der unfassbar langen, wohlgeformten Beine gesammelt, mich in mein Zimmer zurückgezogen und mir beim Anschauen einen runtergeholt. Die Oberkörper und Gesichter waren nie abgebildet, die hab ich mir dazu gedacht. Meistens mussten Mitschülerinnen herhalten, obwohl deren Beine bei weitem nicht annähernd so schön waren.
Dederon hat die ersten fünfundzwanzig Jahre meines Lebens begleitet, in Form der geblümten Schürze meiner Mutter. Die trug sie tags, und ich bin fest davon überzeugt, auch nachts. Und der legendäre Faltbeutel war immer zur Hand, falls es unerwartet in irgendeinem Geschäft irgendeine Köstlichkeit zu kaufen gäbe.
Anna hat mir erklärt, dass im Wort Dederon das Kürzel DDR steckt und dass die Faser, das hab ich mir wörtlich gemerkt, weil ich es so absurd fand, hergestellt wurde im VEB Chemiefaserkombinat „Wilhelm Pieck“ in Rudolstadt und im VEB Chemiefaserwerk „Herbert Warnke“ in Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. DDR-Sprech eben.
Wilhelm Pieck, klar, erster DDR-Staatsratsvorsitzender. Oh Mann, diese Wortungetüme. Aber Herbert Warnke? Smartphone raus, nachschauen. Ist gerade wichtig, außerdem hab ich Zeit. Und ausreichend mobile Daten, so nennt man das, glaube ich. Aha, langjähriger Vorsitzender des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Als ob die Gewerkschaft in der DDR frei gewesen wäre. Und Mitglied des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. So viel Zeit muss sein. Ich könnte auch gleich noch
„Scusi?“
Ich schrecke hoch. Direkt vor mir stehen zwei Touristen, viel zu nahe. Ein Mann und eine Frau. Er: kariertes kurzärmliges Hemd, Shorts, kleiner Rucksack. Sie: karierte kurzärmlige Bluse, Shorts, kleiner Rucksack. Ganz klar: Ehepaar, weil Partnerlook. Wollte Anna auch immer gern.
Ich scheine ziemlich blöd dreinzuschauen. „Excuse me, we wanna vistit the Spanish Steps. You know where it is?“ Der Mann beugt sich leicht vor und schaut mich erwartungsvoll an. Für irgendwas hat er sich entschuldigt. Aber er spricht viel zu schnell. Ich schaue weiterhin blöd.
„Scalinata di Trinita dei Monti“, ergänzt die Frau, was mir auch nicht weiterhilft. Du liebe Zeit, Christian, bist du wieder mal schwer von Begriff. Anna hätte längst erraten, was die beiden wollen.
Der Mann lächelt, hält den linken Unterarm schräg nach unten und klettert mit den Fingern der rechten Hand daran empor. „Stairway“, und seine Frau wieder: „Scala, Escalier, Treppe.“ Da klingelt es. Spanish – spanisch. Jetzt ist es klar, Gott sei Dank. Ich kann die Peinlichkeit beenden.
„Ah“, sage ich, „Spanische Treppe, spanish steps.“ Der Mann grinst zufrieden, die Frau nickt heftig. Ich weise in die Richtung, aus der ich gekommen bin. „Da, da. There. Zwanzig Minuten, twenty minuten.“
„Thanks a lot“, sagt der Mann. Seine Frau muss ihn natürlich übertrumpfen. „Danke tausend.“ Ich winke ab, weiß aber nicht, was ich erwidern soll. Die beiden verbeugen sich leicht, drehen sich weg, lachen – über mich, das Sprachgenie? – und verschwinden endlich. Ich lasse Menschen nicht gern so nah an mich ran. Wie gesagt, falscher Beruf.
Die Konzentration ist weg, ich schaffe es nicht mehr zurück in meine Gedankenwelt. Naja, bin eigentlich ziemlich weit gekommen mit meiner Selbsteinschätzung. Ich stehe auf und drehe eine quietschgelbe Kaki vom Baum. Die reife Frucht füllt meine ganze Hand. Nochmal kurz setzen. Ich reibe die Kaki an meinem karierten Hemd blank, rieche an ihr, beiße hinein. Die Haut ist etwas ledern, aber das Fleisch ist unglaublich weich und süß. Wie eine Verheißung. Gott hat unendlich viele Ideen, aber er hat seine Erfindungen nach einem ausgeklügelten Plan über die ganze Erde verteilt. Jedes Volk bekam wohl die Früchte, die es verdient. Die Italiener Granatapfel und Kaki. Wir Deutschen Pflaumen und Rotkohl, immer etwas säuerlich, immer etwas fade.
Gott. Das ist mein drittes Problem, mein derzeit größtes. Ich bin zu ihm nach Hause gefahren. Hoffentlich ist er da.
Eine einzige Kaki macht pappesatt. Dabei wollte ich auf dem Rückweg noch Pizza essen oder ein belegtes Cimbatta oder so. Bockwurst und Hering gibt´s dann wieder nächste Woche in Treusen.
Es ist immer noch sehr warm, aber hier oben weht ein wundervoll kühles Lüftchen. Wer hat jetzt noch mal diese Betonklötze geschaffen? Bernini? Ich muss lachen, dieser Witz ist mir echt gelungen. Schade, dass ich ihn niemandem erzählen kann.
Leicht fällt es mir nicht, dieses kleine Paradies zu verlassen. Hundert Meter die Straße entlang, und plötzlich weitet sich der Blick zur Linken. Wow. Die ewige Stadt liegt mir zu Füßen, weit unter mir. Moment, Stadtplan, aha, die Piazza del Popolo in flirrender Hitze. Ein riesiger Platz, null Schatten. Keine Menschemseele unterwegs. In der Ferne die Kuppel des Petersdomes, tausend andere Türme und Spitzen und Obelisken. Was ist das da hinten? Ein riesiges weißes Gebäude, das muss doch berühmt sein. Ich schau später mal in den Reiseführer, und morgen geh ich vielleicht hin. Vielleicht.
Sogar das Treppabsteigen treibt den Schweiß auf die Stirn. Bei jeder Stufe nach unten klettert die Temperatur um ein Grad nach oben. Auf der Piazza sind es 250 Grad Celsius. Man sieht doch ein paar Leute, aber alle drücken sich an den Seiten des Platzes entlang, von Baumschatten zu Baumschatten.





























