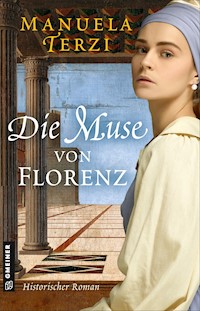Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Nach langem Flehen seines Förderers Cosimo de’ Medici kehrt der berühmte Bildhauer Donatello nach Florenz zurück. Behütet im Hause Donatellos aufgewachsen, weiß Alegra nicht, welch grausames Schicksal ihren Vater vor Jahren wirklich ereilt hat. Die junge Frau begehrt gegen ihr einsames, zurückgezogenes Leben auf und Donatello erkennt, dass sein lang gehütetes Geheimnis ans Licht zu kommen droht. Als Alegra auf einem ihrer Spaziergänge Fabrizio begegnet und sich in ihn verliebt, ahnt sie nicht, wer er wirklich ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuela Terzi
Alegra – Das Mündel der Medici
Historischer Roman
Zum Buch
Florenz 1434 Nach langem Flehen von Cosimo de’ Medici kehrt der berühmte Bildhauer Donatello in seine Geburtsstadt zurück. Doch kaum hat er Florenz erreicht, erkennt er, dass die Stadt nicht mehr dieselbe ist – die Menschen sind von dunklen Gedanken beseelt. Macht und Gier, Intrigen und Gewalt sind die Drahtzieher hinter den Mauern der prachtvollen Palazzi und Geschlechtertürme am Arno.Auch Alegra, sein Mündel, hat sich verändert. Aus dem »Lapislazulimädchen«, dem verängstigten Kind mit den auffallend blauen Augen, ist eine willensstarke junge Frau geworden. Bislang wusste niemand von der Existenz des Mädchens, das in Donatellos Haus wohnt. Doch mit seiner Heimkehr wächst in Alegra der Wunsch nach Veränderung. Bei einem Spaziergang begegnet sie Fabrizio – und verliebt sich in ihn. Sie ahnt nicht, dass er der Anführer der Fanciulli ist, jener Gruppe Halbwüchsiger, mit der sie ein düsteres Geheimnis verbindet, das ihr den Schlaf raubt. Nach dramatischen Entwicklungen am Ufer des Arno droht Alegra alles zu verlieren, was ihr lieb ist.
Autorin Manuela Terzi verfasst romantische und spannende Romane mit historischem Hintergrund. Auf ihren Reisen quer durch Italien schreibt sie am liebsten vor Ort, um die Atmosphäre intensiv aufzunehmen. Hier entstehen Szenen voller Leidenschaft und Tiefe, sodass es ihr schwerfällt, ihre Figuren am Ende einer Geschichte ziehen zu lassen. Oft übernehmen die Charaktere die Führung, während sich die freiberufliche Autorin bei Besuchen in Museen, Archiven und inmitten dem Centro Storico inspirieren lässt.
Impressum
Am Ende des Buches findet sich ein Glossar mit der Erklärung der wichtigsten Begriffe.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © Master1305 / shutterstock.com und Arnold Paul https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Florence_Santa_Maria_del_Fiore_front_and_tower.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Gauffier_-_Portrait_of_Dr._Thomas_Penrose_-_Google_Art_Project.jpg
ISBN 978-3-8392-7616-7
Prolog
1422
Ein unheilvolles Grollen dröhnte durch die Gassen der Stadt. Es lag etwas in der Luft, das spürte Alegra. Das kleine Mädchen lehnte an einer Hausmauer und starrte konzentriert auf einen Punkt auf dem Boden, dann sah es besorgt nach oben. Die Wolken ballten sich zu schwarzen Ungeheuern mit hungrigen Mäulern, und der Wind fegte spürbar kühl über den Boden. Alegra lauschte durch die offenen Fenster ins Innere ihres Zuhauses, wo ihr Vater mit Tante Lucrezia ungewohnt laut sprach. Wann kam er endlich auf die Gasse hinaus, um zu sehen, was sie gezeichnet hatte? Hoffentlich bald, denn der Regen würde nicht lange auf sich warten lassen. Ängstlich sah sie auf ihre Zeichnung, die sie mit bloßen Fingern in den Staub auf dem Boden gemalt hatte. Was, wenn der Regenguss sie fortwischte und zerstörte? »Papa?«, rief sie durch das offene Portal des Palazzo, auf dessen terrakottafarbenen Bodenfliesen sich das spärliche Licht des Innenhofes spiegelte.
Im Inneren des Hauses stieg die Hektik. Schwere Truhen wurden geöffnet und hastig wieder verriegelt. Alegra hörte es am Klicken der großen Schlösser, mit denen die Truhen gesichert waren.
»Begreif doch, Lucrezia, ich muss fort.«
»Geh zur signoria und erklär es ihnen, Lorenzo. Du hast viele Freunde im Rat.«
Tante Lucrezia schien besorgt. Die sonst so besonnene Frau, die sich seit dem Tod der Mutter um Alegra und ihren Vater kümmerte, schien einer Ohnmacht nah. Alegra verstand die Aufregung nicht, obwohl auch sie enttäuscht war. Als bullettaio war ihr Vater gefragt. Ein gebildeter Mann, der für die unzähligen Florentiner, die des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren, eine wichtige Unterstützung bot. In letzter Zeit war er allerdings viel auf Reisen gewesen, erst vor wenigen Tagen war er endlich zurückgekehrt. Nun begriff sie, warum ihre Tante so aufgelöst war. Offenbar musste er wieder fort. Niedergeschlagen schüttelte sie den Kopf. Erwachsene muss man nicht verstehen. Wenn sie groß war, würde sie anders sein.
Mit einem Lächeln auf den Lippen hüpfte sie über den steinernen Vorsprung des Portals und sah sich nach etwas um, mit dem sie ihr Kunstwerk abdecken konnte. Vielleicht übersah der liebe Gott dieses Fleckchen und sie konnte ihrem Vater später zeigen, was sie geschaffen hatte. Sie blickte auf das grelle Rot und lächelte. Da hörte sie einen polternd tobenden Pulk, der in die Gasse bog und sich rasch dem Palazzo näherte. Instinktiv schrak Alegra zurück, als sie die wütenden Gesichter der jungen Männer sah, beinahe selbst noch Kinder. Sie schrien nach ihrem Vater, der seinerseits nach Alegra rief. »Sofort ins Haus mit dir, Kind!«
Ungewohnt harsch klangen seine Worte, und in Alegra regte sich ein Widerstand, den sie sich nicht erklären konnte. Ihr Blick wanderte zwischen der Zeichnung am Boden und den näherkommenden Männern hin und her. Sie sprang auf und lief in die nächste abzweigende Gasse, wo sie mit klopfendem Herzen stehen blieb. Sie verstand nicht, was geschah. In ihrem Innersten begriff sie jedoch, ihr behütetes Leben würde nun ein Ende finden. Aus dem Schutz der Ecke beobachtete sie, wie ihr Vater die jungen Männer voller Furcht ansah und die Tore verschloss, um den Eindringlingen den Zutritt zu verwehren.
»Du entgehst deiner gerechten Strafe nicht, Nocentini! Öffne, bevor wir dich holen!« Die schmale Gasse quoll über vor Menschen aller Größen und Haarfarben. Wie eine einzige Stimme riefen sie ihren Vater, der inzwischen auch die Fenster im Piano nobile verriegelt hatte.
Alegras kleines Herz klopfte ohrenbetäubend. Sie fürchtete, sich dadurch zu verraten. Längst wusste sie, ihrem Vater drohte Gefahr. Darum war er verspätet nach Hause gekommen, auf leisen Sohlen, was nicht einmal Tante Lucrezia mit ihrem leichten Schlaf gemerkt hatte. All die Lügen, mit denen er sich in den letzten Wochen aus der Stadt verabschiedet hatte. Die knappen Besuche, die immer länger währenden Reisen. Tränen stiegen in ihr hoch, legten sich schwer auf ihre Brust.
»Sei tapfer, mein kleines Mädchen.« – Diese Worte hatte ihr Vater abends zu ihr gesagt und mit ihr gemeinsam gebetet. Sie solle in der Nähe des Hauses spielen, mit niemandem sprechen und nicht antworten, warum ihr Vater fern der Stadt geweilt hatte, wenn jemand nach ihm fragte. Seine Hand hatte so schwer auf ihrer Schulter geruht, und sie war mit dem Kopf gegen den Bettpfosten gestoßen. »Meine geliebte Alegra, ich wünsche dir …« Weiter hatte er nicht gesprochen, die Stimme hatte ihm versagt und er hatte sich nicht seiner Tränen geschämt. Warum hatte sie ihn gestern nicht nochmals umarmt und ihn geküsst, ihm gesagt, dass sie ihn liebhatte?
Sie erschrak. Mit einem dicken Baumstamm versuchten die Halbwüchsigen nun, das Tor gewaltsam zu öffnen. Sie johlten und reckten ihre geballten Fäuste gen Himmel. Und nach wenigen Stößen gab der Riegel nach, schon strömten alle in den Palazzo. Wo sich sonst Liebe und Demut versammelten, schwappte nun eine Welle des Zorns hindurch. Verdreckt und übelriechend liefen die Burschen barfuß oder mit zerlöcherten Schuhsohlen über die blank geputzten Treppen. Trotz der verschlossenen Fenster hörte Alegra die Hilferufe ihrer Tante, die dumpfen Schreie ihres Vaters, wie er um Gnade flehte, um Schutz für seine Familie. Alegra starrte wie gebannt auf das offene Tor. Sollte sie versuchen zu fliehen, Zuflucht im Keller suchen, wo niemand ein Kind vermuten würde? Unsicher machte sie einen Schritt, doch dann schrak sie zurück und presste ihre Hände auf ihren Mund. »Papa …«, flüsterte sie erstickt und sah sich panisch um.
In dem Pulk aus Geschrei und Hasstiraden erhaschte sie zwischen den vielen Füßen, Händen und Körpern einen Blick auf ihren Vater. Sie schleiften ihn mehr, als dass er getragen wurde. Als sich die Burschen formiert hatten und unter lautem Gegröle die Gasse durchquerten, fiel ihr etwas auf, das die letzten unter ihnen hinter sich herzogen. Tatsächlich, sie hatten ihren Vater blutig geschlagen und ihm ein Seil um den Hals gebunden. Wahrscheinlich hatte er versucht, sich zu wehren, zu verteidigen, aber die Meute wollte Rache. Fassungslos starrte Alegra dem Gefolge nach, dem sich immer mehr Florentiner anschlossen. Niemand achtete auf das Mädchen in der Seitengasse, das hemmungslos zu weinen anfing.
Zitternd trat Alegra aus dem Schutz der Gasse und der nebenan liegenden Palazzi. Der Regen hatte zugenommen und der Himmel verdunkelte sich. Schritt für Schritt näherte sie sich ihrem Zuhause, fürchtete zugleich, einer der Männer würde sich umdrehen und sie entdecken. Und dann erstarrte sie. Über ihr Bild zog sich eine breite Blutspur.
Zögernd betrat Alegra den Palazzo, in dem die geliebten Skulpturen und das feine Geschirr zerschlagen am Boden lagen. Die Burschen hatten alles wahllos aus den Schränken gerissen, blindlings gewütet und voller Hass den Wohlstand der Familie Nocentini vernichtet. »Tante Lucrezia?«, rief sie bange in das stille Haus. Im grellen Licht eines Blitzes erkannte sie die Silhouette ihrer Tante, die reglos auf dem Boden lag. Laut krachender Donner ließ sie aufschreien. Hatte ihre Tante versucht, sich den Eindringlingen zu widersetzen? »Tante Lucrezia, du musst doch auf mich aufpassen. Nicht schlafen, komm, wir müssen Papa helfen!«, flehte sie und zerrte unaufhörlich an dem leblosen Körper der Frau, die sie mit starren Augen ansah.
So rasch ihre Füße sie trugen, lief Alegra ins oberste Stockwerk und durchsuchte das Arbeitszimmer ihres Vaters. Sein Notizbuch, einige Unterlagen, die am Boden lagen, ein paar Florentiner, Mutters Ring. Was ihr in die Hände fiel, packte sie in einen Beutel. Sie schluckte heftig. Obwohl sie so unerfahren war, war sie entschlossen, für ihren Vater um Gerechtigkeit zu bitten. Aber wo und bei wem? Wer mochte einem Kind zuhören? Einem Kind, das weder verstand, was sein Vater getan hatte, noch, warum man ihn aus dem Palazzo gezerrt hatte.
Alegra, die Blitz und Donner fürchtete wie der Teufel das Weihwasser, stahl sich unbemerkt aus dem Palazzo und schluckte erneut. Inzwischen hatte der trockene Boden einen Teil des Blutes begierig aufgesogen und ihre Zeichnung mit sich genommen. Verschwunden wie ihr Vater. Beherzt folgte sie der blutigen Spur, während der Regen die Gassen durchspülte, und begann zu laufen, aus Angst, ihren Vater nie mehr wiederzusehen.
*
Müde schloss Donatello die Tür der bottega und neigte sein Gesicht in den Regen. Vielleicht hätte er nicht die ganze Nacht in seiner Künstlerwerkstatt an der Statue arbeiten sollen, doch wie immer waren Zeit und Ort für ihn bedeutungslos, wenn er sich in seinen Werken verlor. Er bekreuzigte sich, als er den Zug der fanciulli bemerkte, die an ihm vorbeizogen. Wieder hatten die Burschen eine schuldige Seele geholt, sie sorgten für Gerechtigkeit und verhinderten mit ihrem Tun, dass das Volk unter der Rache Gottes litt. Obwohl ihnen die Durchführung der Zweiten Hinrichtung oblag und ihr Handeln deshalb rechtmäßig war, hatte Donatello Mitleid mit dem offenkundig gequälten Mann, dessen Kopf hin und her schwang, während sie ihn über den Boden schleiften. Einige der Jungen erkannten ihn. Sie nickten ihm zu und holten hastig auf, um nicht den Anschluss zu verlieren. Unschlüssig, ob er sich in die Gruppe der gläubigen Florentiner einreihen sollte, die den fanciulli folgten, wo er bereits den letzten fanciulli-Zug versäumt hatte, blieb er stehen und starrte auf die Blutspur, die sich mit dem Ockergelb des Bodens zu einem matten Orangeton vermischte. In Gedanken versunken folgte er nun doch dem Zug, der inzwischen die Porta al Prato verlassen hatte und sich entlang des Arno zum Ponte Vecchio bewegte.
»Donato, mein Freund. Wie ich höre, gibt es bald wieder ein Kunstwerk von dir zu bestaunen«, sprach ihn jemand von der Seite an.
»Pippo, was für eine Freude, dich zu sehen.« Er lächelte und nickte, was der begnadete Architekt und Bildhauer wohlwollend registrierte. »Sofern mich meine Kunden nicht verärgern, weißt du sehr wohl, dass ich durchaus gewillt bin, meine Arbeiten freizugeben.« Er knurrte.
Filippo Brunelleschi verstand ihn nur zu gut, denn er beließ es dabei und deutete mit dem Kopf zur Brücke, auf die sie zuliefen. »Ein hartes Urteil für Nocentini, der den machtgierigen Familien wohl seit Langem ein Dorn im Auge war.«
Auch Donatello ahnte, was nun bevorstand. Nachdem der beinahe besinnungslose Mann durch alle Viertel von Florenz gezerrt worden war, kam nun die eigentliche Hinrichtung. Schon verteilten sich die Florentiner rund um die Brücke, die beide Ufer des Arno miteinander verband, und zeigten mit offenen Mündern auf den toten Nocentini, dessen Leichnam über den Rand der Brüstung ragte. Gleich würde man den Leichnam dem Gericht des Flusses übergeben. Donatello seufzte und schickte ein Gebet für die Seele Nocentinis in den Himmel. Wie viele hatten in den letzten Monaten durch die Hand der fanciulli den Tod gefunden? Es war mühselig mitzuzählen, denn die intrigenfreudigen Patrizier versuchten seit jeher, sich zu übervorteilen und zu bekriegen. Warum sollte es innerhalb der dicken Stadtmauern von Florenz anders sein?
Pippo wartete abseits der Menge und war in ein Gespräch mit Mitgliedern der Arte della Lana versunken. Die Wollhändler klagten über die steigenden Preise, und so geriet für sie das Schauspiel rund um die fanciulli zur Nebensache. Ihr Groll drang bis an Donatellos Ohren. Er schüttelte den Kopf. Was brachten die Wehklagen und Streitigkeiten?
Inmitten des immer lauter werdenden Klagens und Flehens um Sündenerlass durch Gott sehnte er sich plötzlich nach der Ruhe in seiner bottega, um dort ungestört weiterzuarbeiten. Und da sah er es: das kleine Mädchen, das ihm bis zur Hüfte reichte. Es verharrte inmitten der Florentiner, die beteten und Gerechtigkeit forderten. Da schrie die Menge kollektiv auf, und wenig später hörte er das Aufschlagen des leblosen Körpers auf der Wasseroberfläche. Schon stoben alle auseinander und eilten an die Uferränder, um den letzten Weg der fanciulli mit ebensolchem Eifer zu begleiten wie bisher. Niemand achtete auf das kleine Wesen mit diesen leuchtend blauen Augen. Manch einer hätte es sogar überrannt, wäre Donatello nicht rasch an dessen Seite gesprungen, um es zu beschützen. »Was tust du hier?«, fragte er verhalten und wischte dem Mädchen die tropfnassen Strähnen aus dem Gesicht, denn inzwischen hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet. Entsetzt wich er zurück. Nocentinis Tochter! Er sah sich um und suchte unter den wenigen Menschen, die auf dem Ponte Vecchio ausharrten und auf den davontreibenden Körper starrten, nach Lorenzos Schwester.
Das Kind verharrte vor der Brücke und blickte auf seinen toten Vater. Donatello schluckte schwer. Die Burschen waren befugt, Recht zu sprechen. Es traf keinen Unschuldigen, und doch fühlte er sich mitschuldig, als er neben der Kleinen wartete und nicht wusste, was er tun sollte. Weiter unten am Fluss warteten einige der fanciulli bereits darauf, den Toten aus dem Wasser zu ziehen und ihn am nächsten Baum aufzuhängen. Als Verräter zu richten. Vor diesem Anblick wollte er die unschuldige Kinderseele bewahren. Das Mädchen hatte mehr als genug gesehen. Bilder, die es niemals vergessen würde, und doch betete er, dass das Mädchen es tat. Vergessen. Ohne weiter darüber nachzudenken, fasste er nach der Hand des Kindes und zog es vom Brückengeländer fort.
Es wehrte sich heftig, umklammerte mit seinen kraftlosen Händen den Steinpfeiler, krallte seine Fingernägel in das vom Regen rutschige Mauerwerk, bis sie abbrachen. Donatello bemerkte die blutigen Fingerkuppen des Mädchens und überlegte verzweifelt, wie es hieß. Alessandra? Alexia? Es fiel ihm nicht ein, und so hob er das kreischende Bündel hoch, presste es an seine Brust und eilte fort. »Beruhige dich, Kleines, ich bringe dich in Sicherheit, hörst du?« Während er durch die Gassen eilte, hämmerten tausend Fragen durch sein Hirn. Was tust du? Willst du dich dem Willen Gottes widersetzen? Was kann dieses junge Ding dafür?
Währenddessen kroch ihm das nasse Wetter unter das Wams und er meinte, das Kind zittern zu spüren. Hatte es Angst vor ihm? Sollte er umkehren? Aber wohin das Mädchen bringen? Jeglicher Protest schien erlahmt, denn die zarten Arme hingen plötzlich schlaff um seinen Hals. Das Mädchen hob den Kopf und sah ihn mit diesen durchdringend leuchtenden Augen an. »Ich will nach Hause.«
Donatellos sprödes Herz, das niemandem gehörte, brach.
»Der Tod ist allgegenwärtig.« Mit einem unterdrückten Seufzer redete er beruhigend auf das fremde Kind ein, bis sie sein Haus erreicht hatten. Dort sah er sich um, ob ihm jemand gefolgt war, und setzte das zitternde Wesen ab. »Hier bist du in Sicherheit, aber du musst mir etwas versprechen.«
Das Mädchen blickte ihn mit großen Augen an. »Was denn?«
»Bleib in meinem Heim und verlasse es nie. Hüte dich vor diesen Menschen, die für ein paar Florentiner …« Er brach ab und lächelte, als die Kleine ihre Scheu verlor und ihn an der Hand nahm.
»Hast du etwas zu essen? Ich habe solchen Hunger.«
Trotz dieser Worte las er einen unendlichen Schmerz in den Augen des Kindes. Er lächelte und ging voran ins Haus. »Komm mit, mein Lapislazulimädchen«, sagte er und schloss die Tür. »Mutter, wir haben einen Gast. Trag Brot und Wein auf.« Als das Kind ihn verwirrt ansah, lächelte er und strich ihm über das nasse Haar. »Der Wein ist für mich. Jetzt ziehen wir trockene Sachen an und danach essen wir.«
Kapitel 1
1434
Der Morgen war kaum angebrochen, doch Alegra war schon voller Eifer. Mit konzentriertem Blick wog sie kostbare Pigmente in ihrer Hand ab und zögerte, dann vermengte sie das feine Pulver und vermischte es mit einem Pinsel, bis sich eine festere Konsistenz entwickelte. Sie neigte ihren Kopf und lächelte beim Betrachten des Bildes vor ihr. Noch muteten die Gesichter vage an, noch verbargen sie sich in dunklen Schatten, aber bald würde sie ihnen Augen und Nase verleihen, Güte in die bleichen Wangen reiben und jeden Betrachter vergessen machen, dass dies nur ein Gemälde ist – dem Lauf der Zeit hoffnungslos ergeben. Immer wieder merkte sie, dass die Kraft der Farben nachließ und es ihr nicht gelang, das Leuchten festzuhalten. Wie sehr sehnte sie sich danach, Freude und Demut auf die Leinwand zu bringen, und doch wähnte sie sich erst am Anfang. Sie hob den Kopf und beugte sich sachte zur Seite. Ihr Nacken schmerzte von dem ständigen Kauern auf dem Boden in ihrer Kammer, die seit einiger Zeit mehr einem Arbeitsraum in der bottega ähnelte als einer Schlafstatt. Als Frau durfte sie eigentlich nicht malen, aber dank Donatellos Gesellen Nico bekam sie hin und wieder Farben und Pinsel, Reste von Leinwand. Längst hatte er erkannt, was für ein Talent sie besaß, das jedoch im Stillen bleiben musste. Verborgen, obwohl Alegra in der Wahl ihrer Farben brillant war und so manches Jünglein in der bottega neidvoll erblassen würde angesichts ihrer Bilder.
Jäh legte sich ein Schatten auf ihr Gesicht. Nico, der ihr alles brachte, war heute nicht gekommen. Hatte er die Lust verloren, sie zu unterstützen? Bedächtig zog sie sich an der Bettkante hoch und trat ans Fenster. Die Sonne kletterte stetig höher. Bald würde sie über dem Geschlechterturm gegenüber ihre Wärme verteilen. Verhalten knurrte in diesem Moment Alegras Magen. Wie immer war sie zeitig aufgestanden und hatte keinen Appetit verspürt. Zumindest nicht auf ein trockenes Stück Brot, das ihr in Erinnerung rief, dass sie allein essen musste. Orsa, Donatellos Mutter, hatte der Tod vor einigen Jahren zu sich geholt. Die gute Seele hatte sich aufopfernd um sie gekümmert und sie mit der Zeit geliebt, als wäre sie ihr eigen Fleisch und Blut. Die Erinnerung daran ließ Alegra lächeln. Mit dem Tod der gläubigen Frau war es in Donatellos Haus noch stiller geworden. Bis heute hielt sich Alegra an das, was Donatello einst von ihr verlangt hatte: »Bleib im Haus und geh nicht nach draußen. Halte dich fern von Menschen, die dir Böses wünschen.« Die Welt da draußen zog an ihr vorüber, ohne dass sie etwas davon mitbekam. Nur wenn Nico kam, erfuhr sie von dem, was in den Gassen von Florenz vor sich ging. Welcher Patrizier seinen Reichtum mehrte, wer sich wehrte, in seinem Viertel bleiben zu müssen. Auf leisen Sohlen, als müsse sie aufpassen, niemanden zu wecken, schlich Alegra durch das stille Haus nahe der Opera, wo sich die Arbeiter und Steinmetze trafen.
»Im Schatten der Santa Maria del Fiore müssen wir demütig und dankerfüllt sein«, hatte Orsa zu sagen gepflegt. Nach dem Tod ihres Mannes hatte Donatello seine Mutter in seinem bescheidenen Haus aufgenommen und ihr die Führung des Haushalts überlassen. Und die Aufzucht eines kleinen verängstigten Mädchens, das er eines lieben Tages allein und verloren auf dem Ponte Vecchio aufgelesen hatte.
Unvermittelt flog die Tür des Hauses auf. »Alegra! Wo bist du?«
Sie lief aus ihrer Kammer. Nico! Der sonst so zurückhaltende Junge hastete die Treppe hinauf und blieb atemlos vor ihr stehen. »Er kommt …«
Alegra schüttelte lächelnd den Kopf und bemerkte enttäuscht, dass er nichts bei sich trug. Keine neuen Pigmente, auch nicht die Leinwand, um die sie ihn so eindringlich gebeten hatte. Nico kannte nur ein Thema. Wer immer in der Stadt war, es interessierte sie nicht. Die Medici waren so reich und engagiert, dass öfter mal Könige oder sogar Kaiser aus fernen Ländern nach Florenz reisten.
Aufgebracht schlug er die Hände zusammen und zeigte nach draußen, wo von der Piazza del Duomo her laute Stimmen erschallten. Sie erschrak und wich zurück, sah Nico ängstlich an.
Der lachte nur und boxte sie in die Seite. »Du wirst staunen, wenn du Donatello siehst. Er hat nach dir gefragt.«
Alegras Herz schlug schneller. Hatte er Donatello gesagt? Er war auf dem Weg hierher? So lange schon hatte sie ihn nicht mehr gesehen, obwohl sie in seinem Haus lebte und Nicos Einkäufe für sie von dem Geld bezahlte, das Donatello ihr zur Verfügung gestellt hatte. Donatello! Ob er sie erkannte – und sie ihn nach all den Jahren, die er in Padua gearbeitet hatte? Nicos Aufgeregtheit war auf sie übergesprungen wie ein Feuer. Sie ließ den Jungen stehen und rannte in ihre Kammer. Sah an sich hinab, an dem schmutzigen Kleid, das bunter als ihre Bilder schien, weil sie darin auf dem Boden herumrutschte, versunken in ihre Welt aus Farben und Licht. »Nico, geh und halte ihn auf!«, rief sie über den Flur. »Ich muss …« Da hörte sie seine Stimme.
Donatello war zu Hause. Plötzlich fühlte sie sich wieder wie das kleine Mädchen, das die Arme ängstlich um seinen Hals gelegt hatte, um an seiner vom Regen nassen Brust Schutz zu suchen. Etwas in ihrem Inneren ließ sie frösteln, bald verschwammen diese Erinnerungen, die sie nachts in ihren Träumen quälten.
»Alegra?«
Unsicher verharrte sie am Treppenabsatz. Sollte sie ihm entgegenfliegen, in seine Arme, wie sie es als Kind immer getan hatte? Aber nun war sie ein Mädchen von sechzehn Jahren, eine junge Frau, und sie war sich bewusst, dass man sie anders wahrnahm und an ihrem Verhalten messen würde. Außerdem …
»Alegra, bist du da?« Donatellos Stimme verriet Unmut.
Hastig drängte sie alle Bedenken beiseite und eilte die Treppe hinunter, während der Saum des Kleides um ihre nackten Fesseln schlug. Sie sah in diese vertrauten dunklen Augen und schon schmiegte sie sich an ihn, wie sie es von klein auf nicht anders kannte. »Du warst so lange weg«, flüsterte sie in seinen dichten Bart und atmete erleichtert aus. Endlich war sie nicht mehr länger allein in dem großen Haus.
*
Alles Bangen und Zögern wich von ihm, als das Fuhrwerk die Porta San Gallo passierte und Donatello die vertrauten Straßenzüge seiner Geburtsstadt vor sich sah. Zu lange war er der Heimat ferngeblieben, hatte sich hinter Aufträgen in Padua und Siena versteckt, ohne an das zu denken, was ihn in Florenz erwartete. Er schluckte heftig und holte tief Luft, denn ein bestimmter Mensch würde ihn nicht wie früher liebevoll und freudig empfangen. Seit dem Tod seiner Mutter verspürte er oftmals ein Unbehagen, das er der Trauer zuschob. Er wollte nicht nachdenken, nicht jetzt, wo ihm die Florentiner, kaum dass ihn jemand erkannt hatte, einen jubelnden Empfang bereiteten.
»Donatello ist zurück! Der maestro ist da!«
Diese Nachricht verbreitete sich rasch in den engen Gassen, in denen er schon als Kind gespielt hatte. In jener Stadt, in der sein Freund und Mäzen Cosimo de’ Medici herrschte, als wäre er ein König. Und doch wusste er zu gut, dass Cosimo alles andere als verschwenderisch mit seinen Florentinern umging. An vielen Ecken erkannte Donatello von Weitem das vertraute steinerne Emblem der Medici, deren Ruf bis über die Stadtmauern von Florenz schallte. Kopfschüttelnd blickte er nach oben, wo er weiter südlich die Umrisse der sich im Bau befindlichen Kuppel der Santa Maria del Fiore im gleißenden Sonnenlicht sah. War er so lange fortgewesen? Ihm selbst schien es so kurz gewesen zu sein, wenngleich er viele Nächte durchgearbeitet hatte, Hand in Hand mit seinem Freund Michelozzo, dem Bildhauer und Architekten. Schließlich hatte Donatello sich erweichen lassen. Zu lange hatte ihn Cosimo gebeten, über die Rückkehr in das Herz der Toskana nachzudenken. Zunächst hatten seine Worte mehr wie ein Flehen geklungen, später waren sie drängender geworden, beinahe befehlender Natur. Nun, er war zurückgekehrt. Was auch immer ihn dazu bewegt hatte, er wollte nicht länger darüber nachdenken.
Inzwischen herrschte ein regelrechtes Gedränge in den Gassen. Jeder schien ihn begrüßen zu wollen, und selbst angesehene Patrizier schoben sich durch die Menge. Arbeitsreiche Wochen erwarteten ihn auch hier. Er reckte den Kopf und hielt Ausschau nach den beiden Menschen, die ihm etwas bedeuteten: Cosimo und Alegra. Ersterer würde ihn in seinem prachtvollen Palazzo empfangen wollen und Alegra – nun, das folgsame Kind hielt sich an die Regeln, über die sie nie wieder gesprochen hatten. Angesichts der Informationen, die ihm in den letzten Wochen über die zunehmenden Unruhen innerhalb der Stadtmauern zu Ohren gekommen waren, schien es ihm weiterhin sinnvoll, das Kind von der Außenwelt fernzuhalten. Dabei wusste er genau, was der wahre Grund für diese Abschottung war: Er käme in Erklärungsnot, wer das Mädchen sei und woher es stamme. Warum er nicht früher von ihm berichtet habe und … Fragen über Fragen. Schon jetzt war er es leid, die Erkundigung nach seinem Befinden nach der beschwerlichen Reise zu beantworten. Und dies bedurfte nur weniger Worte.
»Maestro Donatello! Ihr seid es wirklich!«
Eine helle Stimme riss ihn aus seinen Gedanken und sein Gesicht erhellte sich, als er seinen Gesellen inmitten der neugierigen Schar ausmachte. »Nico!« Er reichte dem Jungen seine Hand und zog ihn auf den Wagen, wohl registrierend, wie stolz der junge Geselle nun neben ihm saß, beinahe thronte. Er schmunzelte und beugte sich zu ihm hinüber. »Erzähl mir, was gibt es Neues? Verwechselst du noch immer Marmor mit Ton?«
Nico verschränkte entrüstet seine Arme vor der Brust. »Was glaubt Ihr von mir, maestro? Ich bin einer der ältesten Gesellen, die in Eurer bottega arbeiten. Was bin ich froh, dass Ihr zurück seid. Der Alte …«, er räusperte sich, »Cosimo de’ Medici fragt seit Tagen nach Eurem Eintreffen.«
Donatello grinste und klopfte Nico wohlwollend auf die Schulter. »Das lass ihn nicht hören, den vecchio. Sonst landest du im obersten Stockwerk des Torre der signoria.« Bei den letzten Worten wurde er ernst und sah Nico eindringlich an. »Es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten heute nicht so ein imposantes Haus wie dieses.« Er zeigte auf den Palazzo, auf dessen Außenmauer sechs Kugeln im Sonnenlicht leuchteten, die letzte mit einer Lilie darin. Dieses Symbol prangte auf so vielen Gebäuden, die mit dem Geld der spendenfreudigen Familie erbaut worden waren.
Inzwischen hatten sie die Piazza della Signoria erreicht, wo Nico einen ängstlichen Blick auf den in den Himmel ragenden Turm warf. »Bist du des einen Freund, kannst du nicht auch des anderen Freund sein«, murmelte er und schüttelte bekümmert den Kopf. »Alles Verräter, Donatello. Hütet Euch, wem Ihr was anvertraut. Die Augen und Ohren von Cosimos Gegnern sind inzwischen überall.«
Donatello nickte nachdenklich. Er versuchte sich Alegra vorzustellen. Seine Anspannung wuchs, je näher sie dem Haus kamen, in dem er sein Leben lang Schlaf und Frieden fand, sofern er danach verlangte. Das Fuhrwerk kam immer langsamer voran. Der Aufruhr, den seine Heimkehr verursachte, quoll über die Piazza in die nächsten Gassen.
»Spring ab, Nico. Den Rest gehen wir zu Fuß.« Er bündelte seine Habseligkeiten und lenkte das Fuhrwerk zur Seite, wo er einem Bettler einen Florentiner in die Hand drückte. »Bring mir das Fuhrwerk zu späterer Stunde, mein Freund.«
Der Bettler starrte auf das funkelnde Geldstück in seiner schmutzigen Hand und nickte heftig. »Sí, maestro. Alles, was Ihr verlangt. Gelobt sei der Tag, an dem Ihr nach Hause gekehrt seid.«
Donatello hielt inne. Selbst der arme Mann freute sich über seine Rückkehr, und das erfüllte ihn ebenso mit Stolz wie zuvor Nico, denn zwischen den begeisterten Rufen vernahm er auch missbilligendes Zischen. Es hatte sich nichts geändert in der Stadt, dachte er und folgte dem Jungen durch die Menge.
Bevor sie die Piazza del Duomo erreichten, verlangsamte er seine Schritte. Zu groß war seine Ungeduld, die Fortschritte an der cupola zu bewundern. Ein Blick genügte und er lächelte. Sein Freund Pippo war in der Tat fleißig gewesen. Die ihm von der Opera übertragenen Aufgaben hatte er vorzüglich umgesetzt. Beim Weitergehen fiel Donatellos Blick auf ein unscheinbares Haus am Ende der Piazza. Zögernd näherte er sich.
Nico drängte ihn, sich zu beeilen, und plötzlich hielt es der Junge nicht länger aus. »Ich laufe vor und kündige Euch an. Alegra wird …« Er verstummte jäh, dann wirbelte er herum und lief davon, ohne Donatellos Erlaubnis abzuwarten.
Die Menschenmenge, die Donatello gefolgt war, verlor sich. Wohl merkten einige, dass er die letzten Meter allein gehen wollte. Endlich erreichte er die Tür seines Hauses. Von drinnen hörte er Nicos Rufe, Alegras verwundertes Murmeln. Umso erstaunter stand er nun im Haus unterhalb der Treppe und – war enttäuscht. Hatte er doch gehofft, von Alegra ebenso herzlich empfangen zu werden wie einst von seiner Mutter. Ein schweres Marmorstück legte sich auf seine Brust. Er sah sie, bemerkte Alegras Zögern, ehe sie die Stufen hinuntereilte, ihre Arme um seinen Hals schlang wie einst. Ihm stockte der Atem. Wie hochgewachsen sie war! Er spürte ihren heftigen Herzschlag, ihre Erleichterung, dass er endlich nach Hause gekommen war. Behutsam löste er sich aus der innigen Umarmung und sah auf Alegra, in deren Augen verräterische Tränen glitzerten.
»Mein Lapislazulimädchen, da bin ich wieder«, sagte er und spürte, wie ihn die Freude zu überwältigen drohte. Ihre Augen leuchteten noch stärker, als er es in Erinnerung hatte. Er hielt sie von sich und blickte verwundert auf das schmutzige Kleid, das sie trug. War sie so arm, dass sie in Lumpen herumging? Doch bevor er etwas sagen konnte, stieß Alegra einen erschrockenen Schrei aus und rannte die Treppe hinauf.
Wenig später kam sie in einem schönen Kleid in den Salon, wo sie ihm einen Krug mit gekühltem Wein auftrug.
»Verzeiht, maestro, ich war so überrascht von Eurer Wiederkehr, dass ich keine Zeit hatte, mich angemessen zu kleiden«, gestand sie zerknirscht und schenkte ihm Wein ein.
*
Befangen sah sich Donatello in den vertrauten Räumen um. Kaum etwas hatte sich verändert und doch fühlte er sich fremd, fremd in seinem eigenen Heim. Er schüttelte das Unbehagen ab und lächelte, als Alegra eifrig das Geschirr abräumte und ihm Wein nachschenkte. »Du bist sicher müde von der Reise. Soll ich dir … Euch …?« Leise brach sie ab und sah ihn fragend an.
Wie sie sich verändert hatte! Im Auftreten entschlossener, wohl gezwungenermaßen, da sie zuletzt allein gewesen war. Er schämte sich, nicht öfter nach ihrem Wohlbefinden gefragt zu haben. Sie schien ihm gut versorgt, damit hatte er es auf sich beruhen lassen. Nun, wo er die beschädigten Mauern näher inspizierte und einen leichten Geruch von Moder wahrnahm, fühlte er sich schäbig. Die Kunst war ihm das Einzige. Ihr ordnete er sich unter, ihr diente er, aber nach dem Tod seiner Mutter oblag nun ihm die Obhut über sein Mündel. Ein Mündel, das ihn noch immer betrachtete, als wäre es ein Wunder, dass er heimgekehrt war.
»Es wird sich nichts verändern, Alegra«, begann er zögerlich, unschlüssig, was sie von ihm erwartete. »Hast du einen Wunsch? Fehlt es dir an … Kleidung, an Geld, an …?« Sein Blick glitt auf den Boden, wo sich bunte Farbsprenkel verteilt hatten. Dann erinnerte er sich an Alegras schmutziges Kleid. Nein, was für ein törichter Gedanke. Warum sollte ein Mädchen zum Pinsel greifen? Wie überhaupt? Tag und Nacht lebte Alegra hier im Schutz der Mauern. »Es tut mir leid, dass ich nicht früher gekommen bin«, setzte er zu einer Erklärung an und verlor mittendrin den Faden. Wofür entschuldigte er sich? Dass er sie in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt hatte, sich seit jeher keinen Gedanken gemacht hatte, ob es ihr gut ging? In der Gewissheit, dass seine Mutter sich der Sache, wie er Alegras Schicksal nannte, annahm? Und nun? Nun musste er entscheiden, wie es weitergehen sollte. Er ärgerte sich, dass er nie Vorkehrungen getroffen hatte.
»Ihr müsst Euch keine Sorgen machen, maestro. Ich habe mein Auskommen dank Euch und brauche nicht viel.« Alegra lächelte, aber er spürte deutlich, dass sie etwas belastete.
Auch ihre Ansprache. Sie gingen miteinander um wie Fremde. War das früher auch so gewesen? Er konnte sich nicht erinnern, wie sie sich vor dem Aufbruch zu seiner letzten Reise verhalten hatten. Plötzlich drängte es ihn, das erst kürzlich betretene Haus so rasch wie möglich zu verlassen und Alegras flehendem Blick zu entkommen. Er erhob sich. »Ich muss etwas erledigen … In den nächsten Tagen sollten wir uns wieder besser kennenlernen, was meinst du?«
Alegra nickte eifrig und hielt ihren Blick auf den Boden gerichtet. »Wie Ihr wünscht.«
Sie lebten hier nun wie Mann und Frau, dachte er erschrocken, sie war doch noch ein Kind, aber er war versucht, das zu verdrängen. Um seiner selbst willen. »Sei nicht so förmlich, bitte.« Unsicher streckte er den Arm aus und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Ich danke dir, dass du mamma gepflegt hast. Mit deiner Hilfe wurde sie würdig im Himmel aufgenommen, und dafür stehe ich in deiner Schuld.«
Alegra schwieg und verließ den Salon. Er hörte sie in der Küche mit Geschirr klappern und seufzte. Ein Besuch bei Cosimo würde ihn sicher auf bessere Gedanken bringen.
Wenig später trat er auf die Gasse hinaus und lächelte. Wie erquicklich es war, wieder hier zu sein. Ungeduldig setzte er sich in Bewegung, überlegte, wer wohl die besten Gesellen hatte und sich mit ihm messen wollte. Sollte er länger in Florenz bleiben, musste er sich Hilfe holen. Cosimo hatte angedeutet, dass er mehrere Aufträge für ihn habe, und auch die anderen Patrizier warteten ungeduldig darauf, sich mit einem Werk Donatellos brüsten zu können. Für einen Moment beneidete er Alegra um ihre Unwissenheit darüber, wie gierig und hasserfüllt Menschen sein konnten. Davor wollte er sie schützen wie einst auf der Brücke. Seit Jahren hatte er nicht mehr an die Übergriffe oder an die fanciulli gedacht. Warum jetzt? Während er immer wieder angehalten wurde und Grüße erwidern musste, grübelte er darüber nach. Fast überrascht war er, als er schließlich die imposanten Tore des Palazzo Medici erreichte. Sein Blick fiel zwischen den dicken Streben des Tores hindurch auf einen paradiesisch anmutenden Garten, den er sogleich betrat. In dessen Mitte ragte ein steinerner Brunnen mit anmutigen Figuren empor. Beim Anblick der sehnigen Muskeln des Kriegers auf dem Brunnen kribbelte es Donatello in den Fingern. Die Reise hatte viel zu lange gedauert. Gedankenverloren wandelte er in dem erfrischend großen Innenhof umher und bewunderte, was sein Freund in seiner Abwesenheit an kostbaren Skulpturen und Putten erworben hatte. Da hörte er eine wohlwollende Stimme vom offenen Wandelgang über ihm.
»Ich dachte wahrhaftig, ich muss dich persönlich abholen.« Cosimos Mund verzog sich zu einem Lächeln und er bedeutete ihm, hochzukommen.
»Das war in der Tat meine größte Sorge, mein Freund!«, rief Donatello schmunzelnd. Noch einmal warf er einen Blick auf das steinerne Ensemble in der Mitte des giardino und nickte wohlwollend. Florenz hatte ihn mit offenen Armen empfangen, wieder einmal kam der verlorene Sohn nach Hause.
Wie leicht und frei fühlte man sich in so einem herrlichen Palazzo, der durch seine dicken Mauern eine angenehme Kühle bot und den Trubel von draußen fernhielt. Die Diener eilten auf der weitläufigen Loggia umher, brachten Weinkelche, Trauben und köstlich duftendes Fleisch zum Tisch. Beim Anblick der Auswahl lief Donatello das Wasser im Mund zusammen. Es fiel ihm schwer, auf die ungeduldigen Fragen Cosimos zu antworten, der sich sichtlich freute, ihn endlich wieder in Florenz zu wissen.
»Du warst lange weg, zu lange …« Cosimo kniff die Augen zusammen und beobachtete die Diener, die sich ehrfürchtig vor Donatello verneigten und ihm huldigten, als wäre er der gonfaloniere.
»Die Stadt hat sich verändert«, sagte Donatello kauend und griff nach seinem frisch aufgefüllten Kelch Wein. Seine Kehle war trocken, sein Geist durstig. »Ich habe manche Gassen kaum wiedererkannt.«
Cosimo schüttelte unwirsch den Kopf und zischte. »Nein! Nicht die Stadt hat sich verändert, diese vermaledeiten Menschen. Sie sind geblendet von Gier und Neid. Die Habsucht wird unser aller Untergang, das sag ich dir.«
Donatello nickte nachdenklich und suchte Cosimos Blick. »Sie haben dir übel mitgespielt«, sagte er leise, und erst als die Diener sich zurückgezogen hatten, beugte er sich zu Cosimo und legte ihm vertraulich die Hand auf den Arm. »Es muss schrecklich gewesen sein in diesem zugigen Turm des Vergessens.« Ein Schauer glitt über seinen Rücken. Die Nachricht, dass Cosimo de’ Medici im Alberghetto unter Arrest gesetzt worden war, hatte Donatello unsagbar erschüttert. Hoch über der Piazza della Signoria hatte er in einer kalten Zelle des Alberghetto ausharren müssen, während seine Gegner die Gunst der Stunde hatten nutzen wollen.
Cosimo tat so viel für diese Stadt und das war der Dank? Auch meinte Donatello, mehr Sorgenfalten und ein gewisses Misstrauen bei seinem Freund zu entdecken, das ihm bei Cosimo fremd war.
»Nachts leuchtete der Terrakottaboden, wenn der Mond sein Licht durch das Fenster warf. Dann dachte ich, ich wäre in meinem Palazzo – und frei.« Die dunklen Erinnerungen schienen Cosimo zu überwältigen. In Gedanken versunken bemerkte er nicht das Läuten der Kirchenglocken, die zum Abendgebet mahnten. »Sie haben die Piazza gesperrt, sodass diejenigen, die uns zugeneigt sind, nicht abstimmen konnten.«
Donatello schüttelte verwirrt den Kopf. Jeder Freund Cosimos, der nicht zu den Beutelchen mit den Stimmzetteln durchgelassen worden war, bedeutete eine verlorene Stimme.
»Deine Feinde schrecken vor nichts zurück«, sagte er erschüttert.
Cosimo nickte heftig. »Ja, mein Freund, meine Freiheit habe ich mir kostspielig erkauft. Dabei hat mich mein Vater gewarnt: ›Halte dich von dem Palazzo der Regierung fern‹, hat er mir gesagt. Wieder und wieder.«
Donatello erhob sein Glas und prostete Cosimo zu. »Nun. Es ist vorbei und wir werden deinen Gegnern zeigen, dass Florenz und Cosimo de’ Medici durch ein untrennbares Band miteinander verbunden sind.« Er lächelte erleichtert, als Cosimo seinen Mund spöttisch verzog und den Trinkspruch wiederholte.
»Auf Florenz. Ich habe Großes vor, also geh nach Hause und schlaf dich aus, denn in den nächsten Jahren wirst du von Ruhm und Marmorstaub zehren.«
Donatellos Blick wanderte über den reich gedeckten Tisch zu dem feuerroten Sonnenball, der die Dächer der Stadt in ein güldenes Licht tauchte. Er dachte an das bescheidene Mahl, das ihm Alegra aufgetragen hatte, und spürte plötzlich ein unbändiges Verlangen, nach Hause zu gehen.
Kapitel 2
Mit klopfendem Herzen lauschte Alegra nach draußen. War Donatello schon munter oder schlief er, bis die Sonne gleißend leuchtete? Unschlüssig betrachtete sie ihr Kleid, das sie am Vortag so hastig ausgezogen hatte. Ein verräterisches Stück, und nun, wo sie unsicher war, ob Donatello bereits das Haus verlassen hatte oder nicht, spürte sie das unsägliche Brennen in ihren Fingern. Wie jeden Morgen wollte sie sich an einen sonnigen Platz im Haus setzen und malen. Doch wie sollte das gehen? Nun, wo Donatello zurück war und ihre eigene Zukunft nicht klar schien, wagte sie nichts zu tun, das ihn verärgern könnte. Auch Nico zuliebe musste sie schweigen und ihr Geheimnis so lange vor Donatello verbergen, wie es nur ging. Was als kleiner Zeitvertreib begonnen hatte, war ihr das Liebste, das Einzige geworden … Nie mehr malen? Der Gedanke machte ihr Angst. Solche Angst, dass ihr Herz lauter schlug als die Kirchenglocken der Santa Maria del Fiore. Ihr Blick fiel auf das unscheinbare Bündel unter ihrem Bett, in dem sie ihren kostbarsten Schatz hütete: zwei Pinsel, die ihr Nico geschenkt hatte und die ansonsten ein trauriges Schicksal ereilt hätte, sowie einige Beutelchen mit feinstem Pulver. Wie sollte sie ungestört ihr Werk vollenden, wenn sie stets in Sorge leben müsste, dabei überrascht zu werden? Rasch kniete sie nieder und legte das Bündel aufs Bett, schnürte es behutsam auf. Mit den Fingerspitzen strich sie über die weichen Borsten und schloss die Augen. Sie brauchte kein Licht, um die Bögen zwischen den Palazzi zu malen. Während sich ihre Finger streckten und imaginär über die Übergänge zwischen Mauerwerk und Bögen wischten, seufzte sie. Sie musste einen Weg finden, um zu malen. Schließlich war Donatello ein gefragter Künstler, und hatte nicht selbst Cosimo de’ Medici nach ihm verlangt, ihm neue Aufträge versprochen? Aufträge, die Donatello zwangen, außerhalb des Hauses zu arbeiten. Dann wäre sie genauso ungestört, wie sie es bisher gewesen war. Kaum gedacht, schämte sie sich. Wem hatte sie schließlich zu verdanken, dass sie nicht vor den Toren der Stadt schlafen musste, und wer weiß, welches Schicksal sie sonst ereilt hätte? Vor den Toren der Stadt … Einer Stadt, die ihr fremd und Heimat zugleich war. Einer Stadt, von der nur noch eine dunkle Erinnerung geblieben war: an enge Gassen, in die das Sonnenlicht keinen Zutritt fand, und ein Volk, das für den Wohlstand der Patrizier arbeitete. Seufzend packte sie ihre Malsachen ein und schob das Bündel zurück. Seit Orsa tot war, drangen Gerüchte nicht mehr zu ihr durch. Donatellos Mutter hatte dazu geneigt, mehr zu erzählen, als für ein Kind gut war. Doch Alegra war dankbar gewesen, wenn die Stille unterbrochen worden war. Seit Donatellos letzter Abreise waren seine Mutter und Alegra noch enger zusammengewachsen, sie hatten einander blind vertraut, und je älter Alegra geworden war, desto mehr Aufgaben hatte ihr Orsa wie selbstverständlich übertragen. Natürlich nur innerhalb der heimischen Mauern. Und Alegra hatte das nie hinterfragt.
»Alegra, bist du munter?«
Erschrocken wich sie zurück und starrte auf die Tür. Sollte sie sich schlafend stellen oder gar verstecken? Unsinn. Als sie Donatellos Schritte nun deutlich vernahm, öffnete sie beherzt die Tür ihrer Kammer. »Ich bin hellwach, maestro!«
Donatello wartete auf der Mitte der Treppe. »Ich gehe später auf den mercato. Sag mir, was ich vom Markt für dich mitbringen soll. Ich … Ich weiß nicht, was du brauchst.« Er zuckte entschuldigend mit den Schultern.
Farben und Pinsel, neue Leinwand – das hätte sie am liebsten gesagt, aber sie riss sich zusammen. Sie hoffte, dass Nico in den nächsten Tagen vorbeikommen und sich von Donatellos Heimkehr nicht davon abhalten lassen würde. Sicher würde er einen Grund finden, den maestro aufzusuchen und auch ihr etwas mitzubringen.
Sie straffte den Rücken, zog ihren Surkot zurecht und folgte Donatello, der in die Küche gegangen war. Mit dem Rücken zur Tür saß der auf viele so einschüchternd wirkende Mann und strich sanft über die Tischplatte, an deren Stirnseite Orsas Platz gewesen war.
Donatello hatte sie bemerkt und winkte sie näher. »Hat sie gelitten?« Seine Stimme klang gebrochen, bitter von Schmerz. »Ich hätte nicht weggehen sollen.«
»Nein, maestro, Eure Mutter …« Sie hielt inne.
Donatellos Augenbrauen zogen sich zusammen. »Früher hast du Donatello gesagt, ohne mein Missfallen oder meinen Zorn zu fürchten.«
Alegra schluckte und erinnerte sich an den zögerlichen und doch ersehnten Empfang. Sie lächelte und fuhr fort. »Orsa ist sanft entschlafen.« Ihr Blick wanderte über den Tisch zu der Tür, hinter der Orsas einstige Kammer lag. Wie könnte sie ihm von dem Wehklagen seiner Mutter erzählen, wie sie nach ihm gerufen hat in ihrem Fieberwahn? Warum auch immer er die Stadt verlassen hatte, gewiss hatte er seine Gründe gehabt. Auch dafür, erst jetzt wiederzukehren. Nun, wo sie seine Trauer spürte, brachte sie es nicht übers Herz, ihm noch mehr Schmerz zu bereiten. Orsa hatte ihren Sohn abgöttisch geliebt und nach dem Tod ihres Mannes war allein Donatello ihr Lebensinhalt gewesen.
Donatello drückte ihre Hand und hielt sie länger fest, als sie für geboten hielt. »Danke, Alegra. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wäre ich in ein leeres Haus zurückgekehrt. Es ist so still.« Er lachte leise, und als sie ihn überrascht ansah, schüttelte er den Kopf. »Es gab Zeiten, da habe ich mich nach dieser Stille gesehnt. Und nun, wo ich sie habe, fehlen mir die geschwätzigen Stimmen der Gesellen mehr, als ich mir eingestehen möchte.«
»Ihr … Du bist der maestro. Wirf sie hinaus. Es ist deine bottega und wenn du nach etwas verlangst, so muss es geschehen«, ereiferte sie sich und träumte laut weiter. »Du kannst alles bekommen, was du möchtest. Cosimo de’ Medici und andere Auftraggeber werden dir jeden Wunsch erfüllen. Neue Pinsel, Leinwände und Marmor …« Ihre Augen leuchteten bei dem Bild auf. »Und Lapislazuli. Wir könnten …« Erschrocken brach sie ab und räusperte sich. »Aber vorher solltest du auf den mercato gehen. Brot und Wein reichen nur noch für ein paar Tage. Du wirst sicher deine Freunde zu einem Umtrunk einladen wollen.«
Donatello lächelte amüsiert. »Ich war noch nie einkaufen. Gewiss kaufe ich halb verfaultes Gemüse. Wer hat dich bislang versorgt?«, fragte er.
Dem maestro beim Einkauf zu begegnen, würde viele Florentiner gewiss überraschen, dachte sie schmunzelnd. Wie schön wäre es, wenn …? Wenn sie ihn begleiten dürfte. Mit einem Seufzen sah sie auf und sagte: »Nico. Aber das klappt nicht immer gut. Er ist zu vertrauensvoll und blind.« Sie stand auf und suchte in den Körben und Säcken nach einem Stück, das Nicos Willkür beim Einkauf unter Beweis stellen könnte. Sie wollte nicht undankbar erscheinen. »Sie werden es nicht wagen, dich zu betrügen. Und vielleicht kann ja Nico weiterhin auf den mercato gehen und einkaufen«, sagte sie und schöpfte neue Zuversicht. Er könnte ihr neues Material vorbeibringen, ohne dass es verdächtig aussähe. Etwas von dem teuren Lapislazuli, das so intensiv leuchtete und den Himmel über den Palazzi in ihrem Bild dramatischer gestalten würde.
»Ich werde mit Nico sprechen, und nun erzähl mir, wie es dir ergangen ist. Es war sicher nicht leicht, plötzlich allein zu sein.« Er sah sie eindringlich an, sodass sich Alegra rasch setzte.
Erst sprach sie zögerlich, erzählte ihm von den stillen Nächten, in denen das kleinste Geräusch sie wachgehalten hatte. Auch von den brütend heißen Tagen, in denen sie meist in der Küche geblieben war, weil diese der kühlste Raum im ganzen Haus war. Und dann vertraute sie ihm an, was ihr die größte Sorge bereitet hatte. »Orsa sagte immer, eines Tages kommt er zurück. Sie hat aber nicht gesagt, wann eines Tagesist. Immer wieder habe ich Nico gefragt, aber auch er wusste keine Antwort. Und als er in der Tür stand und rief, du seist wieder da …« Sie zuckte mit den Schultern und lächelte zerknirscht. »Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder fürchten sollte.« Unsicher blickte sie ihn an und bemerkte erleichtert Donatellos Nicken.
»Es reichte nicht, dir Geld zu schicken – nein, lass mich erklären. Ich habe regelmäßig hundert Florentiner geschickt, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen.«
Alegra schluckte. Sie wusste nicht, ob das viel Geld war oder nicht. Es hatte jedoch gereicht, um Nico auf den Markt zu schicken, um …
»So wart ihr versorgt, Mutter und du, und ich konnte meiner Kunst frönen, mich an neuen Aufträgen erfreuen und mit Pippo reisen. Doch damit stillst du niemandes Hunger, niemandes Sehnsucht.«
Alegra fiel ihm ins Wort. »Es hat uns an nichts gemangelt, Donatello. Orsa hat nie geklagt, dass ihr etwas fehlt, und sie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich ihr das Brot vom Teller stehle.« Sie schluckte heftig und kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an. Im Gegenteil, Orsa hatte sie geliebt wie ihr eigenes Kind, sie hätte sich lieber geopfert, als Alegra leiden zu sehen. Nun waren es zu viel der Worte gewesen. Vergeblich wehrte sie sich gegen die Trauer, die sie erneut befiel. Seit Orsa gestorben war, stieg in ihr beim bloßen Gedanken an den Tod blanke Angst auf.
Donatello zögerte keine Sekunde und zog sie an sich. »Mein armes Kind, was musstest du in deinem Leben schon ertragen? Es tut mir so unendlich leid, dass ich nicht bei dir war … nicht mit dir an Mutters Krankenbett ausgeharrt habe.«
Alegra spürte seinen vertrauten Herzschlag, den aufkeimenden Zorn über seine lange Abwesenheit. Sie schloss ihre Augen. »Jetzt bist du da«, flüsterte sie und schmiegte sich an den Mann, der ihr stets Zuflucht und Schutz bot. Bis heute.
*
Mit jedem Schritt, den Donatello machte, verließ er ein Kind. Ein Wesen, das nichts mehr von diesem Kind an sich hatte. Wo war das kleine Mädchen geblieben, das sich hinter dem Rockzipfel von Donatellos Mutter versteckt gehalten hatte, wenn er abends heimgekommen war? Alegra mochte es nicht ahnen, aber sie war sehr angenehm anzusehen. Lieblich gar, hübsch, mit einem reizvollen Antlitz, dass selbst er, der nur Skulpturen hauen und niemals einen Pinsel anrühren würde, für die Ewigkeit bannen wollte. Sie wusste sich auszudrücken, sich zu behaupten und war gänzlich anders als jedes Weib, das ihm bisher begegnet war. Alegra verwirrte ihn. Mutter, ich bin dir so dankbar, dass du dich ihrer angenommen hast. Doch nun überfielen ihn Zweifel, große Zweifel. War es richtig gewesen damals, ein Kind mitzunehmen, das immer unter seiner wahren Herkunft leiden würde? Bislang hatte er den Gedanken verdrängen können, dass sie Fragen stellen würde nach ihrer Abstammung, ihrer Familie – ihrem Vater. Er lief immer schneller, konnte es nicht mehr erwarten, in die bottega zu kommen und sich in seiner Kammer einzuschließen, sich der Neugier der Florentiner zu entziehen und zu finden, was er nicht zu benennen wusste. Hatte er Angst vor Alegra? Er lachte laut auf. Das wurde ihm erst bewusst, als er die verwunderten Blicke jener bemerkte, an denen er bislang achtlos vorbeigelaufen war. Kinder, die ihm kaum bis ans Knie reichten, spielten im staubigen Boden. Ihr helles Lachen ließ ihn innehalten. Schwerfällig drehte er sich um und starrte auf ein kleines Mädchen, das abseits der Menge stand und ihn argwöhnisch betrachtete. Sein Anblick versetzte ihm einen Stich ins Herz. Hätte Alegra ein ähnliches Schicksal erfahren? Die Fußsohlen des Kindes waren verschmutzt, mit Striemen überzogen. Und dieser Blick – voller Schmerz, wie der von Alegra einst auf dem Ponte Vecchio. »Gott, was habe ich getan?«, murmelte er aufgewühlt und eilte weiter. Tauchte in den dunklen Gassen tiefer in das Herz der Stadt, die er seine Heimat nannte.
»Donatello! Wahrhaftig!«, rief jemand nach ihm. Schon verspürte er eine Hand auf seiner Schulter, die ihn zurückriss.
Ungestüm wollte er den Mann zur Seite drängen, da erkannte er das amüsierte Funkeln in den Augen seines Gegenübers. »Pippo!« Jäh durchzuckte ihn der Gedanke, dass er nach seinem Besuch bei Cosimo gleich seinen alten Freund hatte treffen wollen. Alegra, sie war schuld daran, dass ihm Filippo Brunelleschi wie ein Bettler nacheilen musste! Er unterdrückte einen Fluch und schlug Pippo herzlich auf die Schulter. »Deine cupola wirft einen so langen Schatten, dass ich dich nicht gesehen habe«, sagte er grinsend und zeigte auf die versetzten Backsteine. Viele davon hatte er selbst in seinen Händen gehalten.
»Wohin des Weges zu so früher Stunde? Der Donatello, den ich kenne, schläft, bis der Tag sich langweilt. Oder hat dich Padua wachgerüttelt?«
Donatello knurrte verhalten. Natürlich hatte man in Florenz längst von seinem Ärger mit dem Kunden gehört. Aber Pippo kannte ihn lange genug, um zu wissen, wann er zu Späßen aufgelegt war und wann nicht. »Ich komme dich heute Abend besuchen, dann sprechen wir über alles in Ruhe«, sagte Pippo und schob ihn sanft vorwärts. »Du willst in deine bottega, nur zu.«
Heute Abend? Aber – was, wenn Alegra nicht in ihrer Kammer blieb? Früher war das einfacher gewesen. Er hatte sich zu sehr auf seine Mutter verlassen, darauf vertraut, dass das Kind nicht ohne ihr Wissen im Haus herumlaufen würde. Nur Nico und sie wussten, dass es jemanden in seinem Haus gab, den es dort nicht geben dürfte.
»Passt es dir nicht? Komm doch morgen zu mir auf die Baustelle, und ich zeige dir, was wir inzwischen geschafft haben«, schlug Pippo vor und ging mit einem Gruß weiter.
Donatello blieb stehen und starrte seinem langjährigen Freund nach. Könnte er sich ihm anvertrauen? Und was würde sich dadurch ändern?
Wenig später erreichte er die bottega und trat zögernd ein. Die offenen Räume waren von eifrigen Stimmen und dem Schlagen von Hämmern und Mörsern erfüllt. Ein halbes Dutzend Burschen saß verteilt an mit Staub überzogenen Tischen, auf denen sich vereinzelt kleinere Steinquader befanden.
»Du musst den Meißel schräg ansetzen«, erklärte einer einem Kleineren, der ihn zweifelnd ansah.
»Wenn ich abrutsche, fällt der Stein zu Boden und geht kaputt«, begehrte der unwillige Lehrling auf und hielt inne, als sein Blick Richtung Tür fiel.
Donatello versuchte ein freundliches Lächeln, keinen der Burschen kannte er. Dabei war das doch seine bottega. Unbemerkt von den meisten trat er ein. Weitere Räume mit noch mehr Gesellen, Laufburschen – nichts hatte sich verändert: nur die Gesichter und vor allem die Zahl jener, die unter seinem Namen ihren Dienst verrichteten und ihm nacheiferten. Niemand schenkte ihm Beachtung. Hatte er sich so verändert? Oder befand er sich gar in der falschen bottega? Verwundert, wie unorganisiert alles vor sich ging, blieb er vor einem Marmorblock stehen. Er konnte nicht umhin, den unbearbeiteten Stein zu berühren, und erschrak, als ein Aufschrei ertönte.
»Hände weg! Den darf nur maestro Donatello anrühren!«, rief einer der Jungen empört und drängte sich durch die Schar der anderen, die ihn voller Neugier anstarrten.
Sie flüsterten, sahen sich verwundert an und verstummten, als der Junge sich vor Donatello hinstellte und ihn strafend ansah. »Mit Verlaub, Ihr habt hier nichts zu suchen. Das ist die bottega von Donatello und …«
Donatello konnte nicht anders, als zu schmunzeln. »Und wo ist er, euer maestro? Ich habe gehört, es ist nicht gut Kirschen essen mit ihm.«
Ein Raunen zog sich durch die Schar der Jungen, aber niemand wagte etwas zu sagen. Der Anführer, ein Jüngling, der ihm bis zur Schulter reichte und dessen Augen zornig aufblitzten, tauschte einen Blick mit seinem Freund. »Der maestro wird bald eintreffen. Ich rate Euch zu gehen. Er mag es nicht, wenn man seine …« Er brach erschrocken ab. »Maestro Donatello?« Er steckte zwei Finger in den Mund und ließ einen gellenden Pfiff los, der Donatello durch Mark und Bein fuhr.
Bevor Donatello wusste, was passierte, stürmte ein halbes Dutzend weiterer Jungen in die bottega. Selbst in den Fensterrahmen hatten sich einige Neugierige hochgehangelt und sahen nun gespannt in die Werkstatt. Längst war an Arbeiten nicht mehr zu denken. Ehrfürchtig blickten ihn alle an. Halbwüchsige mit staubbedeckten Haaren, wodurch sie wirkten wie Greise, halbe Kinder, die für wenige Florentiner ihren Teil dazu beitrugen, dass Künstler wie er ungestört waren.
»Wo ist Nico?«
»Nico ist auf dem mercato. Er geht immer um diese Zeit einkaufen für … für Euer Haus. Für Euch.« Der Junge wusste die Abwesenheit Nicos nicht anders zu erklären und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
An der Wärme konnte es nicht liegen, aber Donatello verspürte keine Lust, nachzufragen. Bald kam Nico. Sobald er gegangen war, würde Donatello endlich allein sein mit diesem Quader, der seine Fantasie lockte wie Holzspäne das Feuer.
»Bring dem maestro zu trinken«, befahl der Junge einem Burschen neben sich, der ihn und seinen Anführer unsicher anblickte.
»Aber Fabrizio, wir haben nichts …« Sein Blick ging ins Leere, und er verzog sich in eine Ecke, von der aus Donatello sich von ihm beobachtet vorkam.
»Ich dachte, Nico wäre für alles verantwortlich.« Donatello wusste nicht, wem er zuerst die Hölle heißmachen sollte. Nico, der tat, als hätte er alles in seiner Hand, oder diesem Fabrizio, der wie ein Despot über diese Jungen herrschte.
Doch niemand begehrte gegen den Anführer auf. Sie schienen sein Wort zu fürchten, reagierten auf jeden seiner Befehle.
»Das ist korrekt, maestro. Wenn Nico nicht hier ist, passe ich auf. Sonst wärt Ihr bald arm wie eine Kirchenmaus. Das Gesindel würde Euch die Kruste Eures Brots oder Schlimmeres stehlen.« Fabrizio räusperte sich und spuckte auf den Boden. »Keine Sorge, die Arbeit in Eurer bottega ist sehr begehrt. Viele möchten Euch dienen.«
»Tatsächlich? Vielleicht sollte ich öfter verreisen.« Donatello musterte den bunt zusammengewürfelten Haufen an ungelernten Kräften und schüttelte den Kopf. Was auch immer sie hier taten, was sie meinten zu arbeiten, ergab für ihn kaum Sinn. Ungelenk hielten sie Hammer und Meißel, sie mischten die teuersten Pigmente zusammen, als wäre es Staub. Nein, solange sie sich so ungeschickt benahmen wie Holzklötze, konnte er nicht ertragen, was in diesen Räumen passierte. Er klatschte in die Hände, und als sich alle um ihn gescharrt hatten, warf er einen Blick auf Fabrizio, der ihn mit zusammengekniffenem Mund anstarrte. »Ihr geht nach Hause, alle.« Entsetzen zeichnete sich auf den Gesichtern der Kinder ab. Viele von ihnen konnten kaum über den Tischrand sehen und sollten für ihn arbeiten? Wie auf ein lautloses Kommando wandten sich alle Fabrizio zu, der seine Arme vor der Brust verschränkt hatte. »Wir verschwinden erst, wenn Ihr uns bezahlt habt, wie Ihr es versprochen habt.« Seine Entschlossenheit ermutigte einige der älteren Burschen, auch sie verschränkten nun ihre Arme und traten neben Fabrizio. Die jüngeren sahen Donatello ängstlich an und schluckten heftig. Ihre Hände waren zerschunden und aufgerissen wie die seinen.
Bezahlt? Wie er es versprochen hatte? Was war in den Jahren seiner Abwesenheit in seiner bottega vorgegangen?
»Ich will nicht weg, ich habe Hunger«, maulte einer der Kleinsten im Hintergrund, und kaum hatte er das gesagt, hörte Donatello ein lautes Patschen. Der Junge weinte ungehalten und lief auf die Gasse hinaus. Das Klatschen der nackten Fußsohlen des Kindes wurde von einem überraschten Aufschrei Cosimos übertönt.
Donatello drehte sich ruckartig um. Am Eingang erkannte er wahrhaftig Cosimo de’ Medici, den weinenden Jungen vor sich.
»Was geht hier vor, Donatello? Kaum bist du zurück, erschreckst du kleine Kinder?« Er lachte leise und verstummte jäh, als er die Schar an Burschen jedweden Alters in der überfüllten bottega bemerkte.
Das Erscheinen eines so angesehenen und einflussreichen Patriziers, eines Medici, ließ die Kinder enger zusammenrücken. Eines nach dem anderen senkte den Kopf und murmelte einen Gruß, einige von ihnen liefen hastig aus dem Raum. Nach und nach leerte sich die inzwischen stickige bottega, bis auch Fabrizio erkannte, dass er die heutige Schlacht verloren hatte. Mit einem unergründlichen Blick bedachte er Donatello und ging, nicht ohne Cosimo die Ehre zu erweisen. An der Tür wandte er sich noch einmal um.
Donatello schauderte. Der Ausdruck von Fabrizios Augen berührte ihn, ließ ihn zweifeln an seinem Entschluss, aber bevor er ein Wort sagen konnte, wandte sich Fabrizio ab und verschwand. Donatello holte tief Luft und sah seinen Freund entschuldigend an, während er darüber grübelte, warum er sich Fabrizio gegenüber so feindselig verhalten hatte. »Eine seltsame Zusammenkunft war das, aber sag, lieber Cosimo, was führt dich zu mir? Sicher nicht ein paar Gehilfen meiner bottega, oder sollte ich sagen: Fabrizios?«
Cosimos Miene verdunkelte sich. Er vergewisserte sich, dass sie unter sich waren und niemand sie belauschte. Zur Sicherheit winkte er seinen Freund ans Ende des Raumes, behielt Fenster und Tür im Blick. »Vielleicht war es ein Fehler, dich zu mir zu rufen. Doch ich brauche einen Freund, einen Vertrauten an meiner Seite, und ich fürchte, dir wird sich nirgendwo besserer Schutz bieten als unter meinen Fittichen.« Er klopfte mit der Faust auf den Tisch und blickte Donatello eindringlich an. »Wir müssen diese Stadt vor ihrem Untergang retten, Donatello!«
*
Fabrizio schlug wütend gegen das Mauerwerk und haderte mit sich. Endlich hatte er den berühmten Donatello vor sich gehabt und was war ihm eingefallen? Er hatte nach Bezahlung getaner Arbeit verlangt. Er verfluchte sich, schimpfte sich einen Verräter gegen sich selbst.
»Fabrizio, was sollen wir jetzt tun?« – »Fabrizio, ich habe Hunger.« – »Fabrizio, ich …«
Jäh blieb er stehen und wirbelte herum, wodurch mehrere der Mitglieder seines kindlichen Gefolges gegen ihn stießen. »Fabrizio, ich habe Hunger!«, äffte er eines der Kinder nach und versetzte ihm einen unsanften Stoß, sodass es in den staubigen Boden fiel. »Hört auf mit eurem Gejammer. Wir finden etwas anderes, etwas Besseres als diese heruntergekommene bottega von diesem maestro, der …« Der … was? Es war nicht verwunderlich gewesen, dass Donatello irritiert gewesen war, was in seiner bottega vor sich ging. Sie waren weder Gesellen noch Gehilfen. Sie waren nichts. Fabrizio bereute sein schroffes Verhalten und reichte dem Kleinen versöhnlich die Hand. »Ich gebe dir von meinem Essen, Samuele, bene?«
Samuele grinste fröhlich und zeigte dabei seine krumm gewachsenen Zähne. Fabrizio ballte die Faust. Es musste einen anderen Weg geben, die Schar durchzufüttern. Aber nun galt es, einen Unterschlupf für diese Nacht zu finden. Längst versank die Herbstsonne früher und ließ ihn morgens frösteln. Er warf den Kopf zurück und zählte durch. »Zwanzig. Wo ist Gianluca?«
Die Kinder sahen sich verdutzt an. »Gianluca? Du meinst den Neuen?«