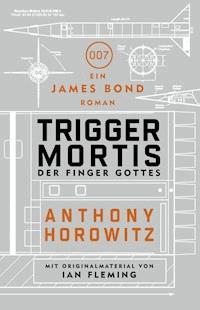8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alex Rider
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Der Bestseller ALEX RIDER – die Vorlage zur actiongeladenen TV-Serie! Der MI6 schleust Alex Rider in ein Schweizer Eliteinternat ein – eine Schule für die missratenen Söhne superreicher Eltern. Das Internat ist abgeschottet wie ein Gefängnis für Schwerverbrecher. Doch noch mehr alarmiert Alex, dass die Schüler gar nicht rebellisch, sondern schrecklich brav sind. Bei seinen Nachforschungen macht Alex eine grauenhafte Entdeckung … Band 2 der actionreichen Agenten-Reihe von Bestseller-Autor Anthony Horowitz Alex Riders Vergangenheit: eine einzige Lüge. Seine Zukunft: liegt in den Händen des MI6. Denn als jüngster Agent aller Zeiten ist er Englands stärkste Geheimwaffe! Erlebe alle Abenteuer von "Alex Rider": Band 1: Stormbreaker Band 2: Gemini-Project Band 3: Skeleton Key Band 4: Eagle Strike Band 5: Scorpia Band 6: Ark Angel Band 7: Snakehead Band 8: Crocodile Tears Band 9: Scorpia Rising Band 10: Steel Claw Vorgeschichte: Russian Roulette
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2018Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2018 Ravensburger Verlag GmbHDie englische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel Point Blancby Walker Books Ltd., 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ.Published by arrangement with Anthony HorowitzText © 2001 Stormbreaker Productions Ltd.Die deutsche Erstausgabe erschien unter dem Titel Das Gemini-Projekt2003 im Ravensburger Verlag GmbHCover © Digital Art by Larry RostantVerwendet mit freundlicher Genehmigung von Penguin Books USA.Aus dem Englischen von Antoinette GittingerAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN978-3-473-38398-6www.ravensburger.de
Michael J. Roscoe war ein vorsichtiger Mann.
Der Wagen, mit dem er jeden Morgen um sieben Uhr fünfzehn zur Arbeit gefahren wurde, war ein Mercedes mit verstärkten Stahltüren und kugelsicheren Scheiben. Sein Chauffeur, ein ehemaliger FBI-Agent, trug stets eine Beretta, eine handliche halbautomatische Pistole, bei sich und konnte auch damit umgehen. Von der Stelle, wo der Wagen vor dem Roscoe Tower auf der New Yorker Fifth Avenue hielt, bis zum Eingang waren es nur fünf Schritte, aber den ganzen Weg folgten ihm Überwachungskameras. Wenn sich die automatischen Türen hinter ihm geschlossen hatten, wachte der uniformierte Mann am Empfang – ebenfalls bewaffnet – darüber, wie er das Foyer durchquerte und in seinen privaten Lift stieg.
Der Aufzug war mit weißen Marmorwänden, einem blauen Teppich und einem silbernen Handlauf ausgestattet, besaß jedoch keine Knöpfe. Roscoe legte die Hand auf eine kleine Glasplatte. Ein Sensor las seine Fingerabdrücke, prüfte sie und setzte den Lift in Bewegung. Die Türen schlossen sich und der Aufzug fuhr ohne Unterbrechung in den sechzigsten Stock hinauf. Niemand außer Roscoe benutzte diesen Lift und niemals hielt er in einem anderen Stock an. Während er nach oben fuhr, griff der uniformierte Mann am Empfang nach dem Hörer und informierte Mr Roscoes Angestellte, dass der Chef gerade auf dem Weg zu seinem Büro sei.
Jeder, der in Roscoes Privatbüro arbeitete, war sorgfältig ausgewählt und überprüft worden. Es war unmöglich, den Chef ohne Termin zu sprechen. Allerdings konnte es drei Monate dauern, bis man einen bekam.
Wenn man reich ist, muss man vorsichtig sein. Es gibt Spinner, Kidnapper, Terroristen … verzweifelte und arme Irre. Michael J. Roscoe war der Vorsitzende von Roscoe Electronics und stand in der Rangliste der reichsten Männer der Welt an neunter oder zehnter Stelle. Und bei Gott, er war sehr vorsichtig! Seit er auf der Titelseite eines Manager-Magazins erschienen war, wusste er, dass er eine lebende Zielscheibe geworden war. In der Öffentlichkeit bewegte er sich immer schnell, hielt den Kopf gesenkt, verbarg sein markantes Gesicht hinter einer dunklen Brille. Seine Anzüge waren teuer, aber unauffällig. Ging er ins Theater oder zum Dinner, kam er immer in letzter Minute. In seinem Leben gab es Dutzende verschiedener Sicherheitssysteme. Früher hatten sie ihn gestört, doch hatte er sie schließlich zur Routine werden lassen.
Aber jeder Spion oder Sicherheitsbeamte wird einem erklären, dass gerade Routine das Ende beschleunigen kann, da der Feind die Abläufe genau studiert. Routine war es auch, die Michael J. Roscoes unerwartetes Ende herbeiführen sollte, und heute war der Tag, den der Tod sich ausgesucht hatte, um bei ihm anzuklopfen.
Natürlich war Roscoe völlig ahnungslos, als er direkt aus dem Lift in sein Privatbüro trat – ein riesiges Eckzimmer mit Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichten und Aussicht in zwei Richtungen boten – im Norden auf die Fifth Avenue und im Westen auf den Central Park. Die übrigen beiden Wände wurden eingenommen von einer Tür, einem niedrigen Bücherregal, und direkt neben dem Aufzug hing etwas verloren ein Ölgemälde. Es zeigte die Sonnenblumen von Vincent van Gogh.
Auf der Glasoberfläche seines Schreibtisches standen nur sehr wenige Gegenstände: ein Computer, ein ledergebundener Terminkalender, ein Telefon und die gerahmte Fotografie eines vierzehnjährigen Jungen. Als Roscoe sein Jackett auszog und an seinem Schreibtisch Platz nahm, betrachtete er das Bild.
Der Junge war blond, hatte blaue Augen und Sommersprossen. Genauso hatte Michael vor vierzig Jahren ausgesehen. Roscoe war jetzt vierundfünfzig. Obwohl er das ganze Jahr braun gebrannt war, zeigten sich die ersten Spuren des Alters. Sein Sohn war fast genauso groß wie er. Das Foto war im vorigen Sommer auf Long Island aufgenommen worden. Sie hatten den Tag beim Segeln verbracht und anschließend ein Barbecue am Strand gemacht. Es war einer der wenigen glücklichen Tage gewesen, die sie miteinander erlebt hatten.
Die Tür ging auf und seine Sekretärin trat ein. Helen Bosworth war Engländerin. Sie hatte vor Jahren ihre Heimat verlassen, um in New York zu arbeiten, was sie noch keine Sekunde bereut hatte. Sie arbeitete jetzt seit elf Jahren in diesem Büro und sie hatte noch nie etwas vergessen oder einen Fehler gemacht.
»Guten Morgen, Mr Roscoe«, begrüßte sie ihren Chef.
»Guten Morgen, Helen.«
Sie legte eine Mappe auf seinen Schreibtisch. »Die neuesten Zahlen aus Singapur. Eine Kostenaufstellung über das R-15-Datencenter. Um halb eins sind Sie zum Lunch mit Senator Andrews verabredet. Ich habe einen Tisch im Ivy …«
»Haben Sie London angerufen?«, unterbrach Roscoe sie.
Helen Bosworth blinzelte. Sie vergaß nie etwas, warum also fragte er?
»Ja, ich habe gestern Nachmittag in Alan Blunts Büro angerufen«, sagte sie. Zu der Zeit war es in London bereits Abend gewesen. »Mr Blunt war nicht da, aber ich habe für heute Nachmittag ein persönliches Gespräch zwischen Ihnen beiden arrangiert, wir können es in Ihr Auto durchstellen.«
»Danke, Helen.«
»Soll ich Ihnen Ihren Kaffee bringen lassen?«
»Nein danke, Helen, ich trinke heute keinen Kaffee.«
Helen Bosworth ging hinaus, ernsthaft besorgt. Keinen Kaffee? Welche Überraschung kam als Nächstes? Seit sie Mr Roscoe kannte, hatte er den Tag mit einem doppelten Espresso angefangen. War er krank? In letzter Zeit war er völlig verändert … seit Paul von dieser Schule in Südfrankreich nach Hause gekommen war. Und dann der Anruf bei Alan Blunt in London! Niemand hatte ihr je erklärt, wer er war, aber irgendwann hatte sie seinen Namen in einer Akte gelesen. Er hatte etwas mit dem britischen Geheimdienst zu tun. MI6. Was um alles in der Welt veranlasste Mr Roscoe, mit einem Mann vom Geheimdienst zu sprechen?
Helen Bosworth ging in ihr Büro zurück und versuchte sich zu beruhigen, nicht mit Kaffee – sie konnte das Zeug nicht ausstehen –, sondern mit einer Tasse Earl Grey. Irgendetwas höchst Merkwürdiges war hier im Gange und das gefiel ihr nicht. Es gefiel ihr ganz und gar nicht.
Inzwischen hatte sechzig Stockwerke tiefer ein Mann im grauen Overall mit einem ID-Sticker an der Brust die Eingangshalle betreten. Der Sticker wies ihn als Sam Green aus, Wartungsingenieur der Fahrstuhlfirma X-Press Elevators Inc. In einer Hand trug er eine Aktenmappe, in der anderen einen großen silbernen Werkzeugkasten. Beides setzte er vor dem Empfangstresen ab.
Sam Green war nicht sein richtiger Name. Sein Haar – schwarz und leicht ölig – war nicht echt, genauso wenig wie seine Brille, sein Schurrbart und seine unregelmäßigen Zähne. Er sah aus wie fünfzig, war aber in Wirklichkeit erst um die dreißig. Niemand kannte seinen richtigen Namen, denn in dem Geschäft, in dem er arbeitete, war ein Name das Letzte, was man brauchen konnte. Man kannte ihn in bestimmten Kreisen als den »Gentleman« und er war einer der höchstbezahlten, erfolgreichsten Auftragskiller der Welt. Den Spitznamen hatte ihm seine Gewohnheit eingebracht, nach jedem Auftrag den Familien seiner Opfer Blumen zu schicken.
Der Mann am Empfang musterte ihn.
»Ich soll mir den Aufzug mal anschauen«, erklärte der Gentleman in einem typischen Bronx-Slang, obwohl er noch nie mehr als eine Woche in der Bronx gewesen war.
»Was stimmt denn nicht?«, fragte der Mann am Empfang. »Ihr wart doch erst letzte Woche hier.«
»Ja, ja, stimmt schon. Aber da war’n defektes Kabel in Aufzug zwölf. Da muss’n neues rein, hatten aber keins dabei. Deshalb bin ich ja jetzt hier.« Der Gentleman griff in seine Tasche und zog ein zerknittertes Stück Papier heraus. »Wollen Sie unser Head Office anrufen?«
Hätte der Mann am Empfang X-Press Elevators Inc. angerufen, hätte er vermutlich herausgefunden, dass dort tatsächlich ein Sam Green arbeitete, der in den letzten beiden Tagen aber nicht zur Arbeit erschienen war. Das lag daran, dass der echte Sam Green auf dem Grund des Hudson Rivers ruhte – mit einem Messer im Rücken und einem zentnerschweren Betonblock an den Füßen. Aber der Mann am Empfang griff nicht zum Telefonhörer, was der Gentleman vorausgesehen hatte. Es war schließlich absolut nichts Ungewöhnliches, dass die Aufzüge nicht funktionierten. Rund um die Uhr waren irgendwelche Techniker damit beschäftigt, sie zu reparieren. Da kam es auf einen mehr oder weniger nicht an.
Der Mann am Empfang deutete ihm mit einer Handbewegung an weiterzugehen.
Der Gentleman stopfte das Papier wieder zurück in seine Hosentasche, griff nach der Aktentasche und dem Werkzeugkasten und steuerte die Aufzüge an. Im Wolkenkratzer gab es ein Dutzend öffentliche Aufzüge sowie einen dreizehnten, der Michael J. Roscoe vorbehalten war. Der Aufzug Nummer zwölf befand sich am Ende des Foyers. Als er ihn betrat, versuchte ein Lieferjunge mit einem Paket ihm zu folgen. »Sorry«, sagte der Gentleman, »außer Betrieb!« Dann schloss sich die Tür hinter ihm und er drückte den Knopf zum einundsechzigsten Stock.
Er hatte den Auftrag erst vor einer Woche übernommen und musste schnell handeln – den echten Techniker töten, dessen Identität annehmen, den Plan vom Roscoe Tower studieren und sich das komplizierte Teil, das er dafür benötigen würde, beschaffen. Seine Auftraggeber wünschten, dass er den Multimillionär so bald wie möglich beseitigte. Noch wichtiger: Es musste unbedingt wie ein Unfall aussehen. Für diesen Auftrag hatte der Gentleman zweihunderttausend Dollar verlangt, was ohne Weiteres von seinen Auftraggebern akzeptiert worden war. Das Geld sollte auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen werden; die Hälfte sofort und der Rest nach Erledigung des Auftrags.
Die Lifttür öffnete sich. Der einundsechzigste Stock wurde gewöhnlich für die Wartung benutzt. Hier waren die Wassertanks untergebracht sowie die Computer, welche die Heizung, die Klimaanlage, die Überwachungskameras und die Aufzüge im ganzen Gebäude kontrollierten. Der Gentleman setzte den Lift außer Betrieb. Dazu verwendete er den Zentralschlüssel, der einmal Sam Green gehört hatte. Dann wandte er sich den Computern zu. Er wusste ganz genau, wo sie standen. Er hätte sie mit verbundenen Augen gefunden. Dann öffnete er seine zweigeteilte Aktenmappe. Der untere Teil bestand aus einem Laptop, auf dessen Deckel Bohrer und anderes Werkzeug festgezurrt waren.
Er benötigte fünfzehn Minuten bis zum Roscoe Tower-Großrechner, um sich dort mit seinem Laptop in den inneren Schaltkreis einzuloggen. Sich am Roscoe-Sicherheitssystem vorbeizuhacken nahm etwas Zeit in Anspruch, aber schließlich hatte er es geschafft. Er tippte einen Befehl ein. Im Stockwerk darunter machte Michael J. Roscoes Privataufzug etwas, was er noch nie zuvor getan hatte. Er fuhr ein Stockwerk höher – in den einundsechzigsten Stock. Doch die Tür öffnete sich nicht. Der Gentleman hatte nicht vor einzusteigen.
Stattdessen ergriff er jetzt die Aktenmappe und den Werkzeugkasten und trug beides zu dem Aufzug zurück, mit dem er vom Foyer aus gefahren war. Er drehte den Zentralschlüssel und drückte auf den Knopf des 59. Stockwerks. Erneut setzte er den Lift außer Betrieb. Dann griff er an die Decke und drückte kräftig. Eine Falltür öffnete sich nach außen. Er schob zuerst die Aktenmappe und den Werkzeugkasten nach oben, hievte sich dann selbst hinauf und kletterte auf das Dach des Aufzugs. Er befand sich jetzt im Hauptaufzugsschacht des Roscoe Towers. Von vier Seiten war er von Trägern und Rohrleitungen umgeben, die schwarz vor Öl und Schmutz waren. Dicke Stahlkabel hingen herunter, die manchmal summten, wenn sie ihre Lasten hinauf- oder heruntertransportierten. Wenn er hinunterblickte, konnte er einen scheinbar endlosen viereckigen Tunnel erkennen, der lediglich von den Lichtstreifen der Türen erhellt wurde, die sich öffneten und wieder schlossen, wenn die anderen Aufzüge in den verschiedenen Stockwerken anhielten. Irgendwie war der Wind von draußen ins Gebäude gedrungen und wirbelte Staub auf, der ihm in den Augen brannte. Neben ihm befanden sich ein paar Aufzugstüren, die ihn, hätte er sie geöffnet, direkt in Roscoes Büro geführt hätten. Über diesen befand sich nur wenige Zentimeter über seinem Kopf und ein paar Meter nach rechts versetzt der untere Teil von Roscoes privatem Aufzug.
Der Werkzeugkasten lag griffbereit auf dem Aufzugsdach. Behutsam öffnete er ihn. Die Seiten waren gefüttert. Im Innern lag in einer besonders gut gepolsterten Mulde ein Gegenstand, der wie ein Filmprojektor aussah, silbern und mit einer dicken Glaslinse. Er nahm ihn heraus und warf dann einen Blick auf seine Armbanduhr. Acht Uhr fünfunddreißig. Er würde eine Stunde benötigen, um dieses Gerät am Boden von Roscoes Aufzug anzubringen, und noch etwas mehr Zeit, um sich zu vergewissern, dass es funktionierte. Er hatte jede Menge Zeit.
Er lächelte zufrieden vor sich hin, holte einen Schraubenzieher heraus und fing an zu arbeiten.
Um zwölf Uhr verkündete Helen Bosworth am Telefon: »Mr Roscoe, Ihr Wagen ist vorgefahren.«
»Danke, Helen.«
Roscoe hatte heute Morgen noch nicht viel getan, war ziemlich unkonzentriert bei seiner Arbeit. Wieder warf er einen Blick auf das Foto auf seinem Schreibtisch. Paul. Wie konnte eine Beziehung zwischen Vater und Sohn nur so schieflaufen? Und was war in den letzten Monaten passiert, dass sie sich noch weiter verschlechtert hatte?
Er erhob sich, schlüpfte in sein Jackett und durchquerte das Büro. Er war ja mit Senator Andrews zum Lunch verabredet. Roscoe traf sich häufig mit Politikern zum Essen. Entweder wollten sie sein Geld, seine Ideen … oder ihn. Ein so reicher Mann wie Roscoe war ein einflussreicher Freund und Politiker brauchen jeden Freund, den sie bekommen können.
Er drückte auf den Aufzugsknopf. Als die Türen leise aufglitten, machte er einen Schritt nach vorn.
Das Letzte, was Michael J. Roscoe in seinem Leben sah, war ein Aufzug mit weißen Marmorwänden, einem blauen Teppich und einem silbernen Handlauf. Sein rechter Fuß, an dem er einen der schwarzen Lederschuhe trug, die ein kleiner Schuhladen in Rom extra für ihn anfertigte, trat ins Leere und dann immer weiter … durch den Teppich hindurch.
Roscoe stürzte sechzig Stockwerke tief direkt in den Tod. Er war so überrumpelt, völlig unfähig zu begreifen, was geschehen war, dass er nicht einmal einen Schrei ausstieß. Er fiel einfach in die Dunkelheit des Aufzugschachts, prallte zweimal gegen die Wand und schlug dann auf den festen Beton des Untergeschosses, etwa zweihundert Meter tiefer.
Der Aufzug blieb, wo er war. Er sah stabil aus, war es aber keineswegs. Roscoe war in ein Hologramm getreten, das in den leeren Raum des Aufzugsschachts, in dem sich der richtige Aufzug hätte befinden sollen, projiziert worden war. Der Gentleman hatte die Aufzugstür so programmiert, dass sie sich öffnete, wenn Roscoe auf den Knopf drückte. Dann hatte er seelenruhig zugesehen, wie der Milliardär ins Nichts gestürzt war. Wenn Roscoe kurz hochgeblickt hätte, hätte er den silbernen Hologrammprojektor gesehen. Aber ein Mann, der in einen Aufzug steigt, um zum Lunch zu gehen, blickt nicht nach oben. Der Gentleman hatte das vorausgesehen. Und er täuschte sich nie.
Um halb eins meldete der Chauffeur Mr Roscoes Büro, dass der Chef nicht heruntergekommen sei. Zehn Minuten später informierte Helen Bosworth den Sicherheitsdienst, der daraufhin das Foyer des Gebäudes absuchte. Um ein Uhr riefen sie im Restaurant an, wo der Senator auf seinen Gast wartete. Aber dieser war noch nicht aufgetaucht.
Roscoes Leiche wurde erst am Tag darauf entdeckt. Inzwischen war das Verschwinden des Milliardärs zur Hauptmeldung der amerikanischen Nachrichten geworden. Ein seltsamer Unfall – zumindest sah es danach aus. Niemand konnte sich erklären, was geschehen war. Natürlich hatte der Gentleman zu diesem Zeitpunkt das Programm des Hauptrechners längst wieder umprogrammiert, den Projektor entfernt und alles ganz genau so hinterlassen, wie es vorher gewesen war, bevor er unbemerkt das Gebäude verließ.
Zwei Tage später betrat ein Mann, der absolut nicht wie ein Wartungsingenieur aussah, den JFK International Airport. Er wollte in die Schweiz fliegen. Aber zuerst ging er in einen Blumenladen und bestellte ein Dutzend schwarze Tulpen, die er an eine ganz bestimmte Adresse schicken ließ. Der Mann zahlte bar und hinterließ keinen Namen.
Der unmöglichste Zeitpunkt, sich einsam zu fühlen, ist, wenn man sich mitten in einer Menschenmenge befindet. Alex Rider ging über den Schulhof, umgeben von Hunderten von Jungen und Mädchen seines Alters. Sie alle drängten in die gleiche Richtung, trugen alle die gleiche blaugraue Uniform und hingen vermutlich alle mehr oder weniger den gleichen Gedanken nach. Die letzte Unterrichtsstunde war gerade zu Ende gegangen. Hausaufgaben und Fernsehen würden den Rest des Tages füllen. Und morgen ging alles wieder von vorne los. Warum also fühlte er sich so weit weg von allem, so als ob er die letzten Wochen des Schuljahres von der anderen Seite einer riesigen Glasscheibe betrachten würde?
Alex warf sich den Rucksack über die Schulter und steuerte den Fahrradschuppen an. Der Rucksack war schwer. Wie üblich enthielt er Schulbücher und Hausaufgaben für Französisch und Geschichte. Er hatte zwei Wochen Unterricht versäumt und musste hart arbeiten, um alles nachzuholen. Seine Lehrer hatten wenig Verständnis gezeigt. Niemand hatte ein Wort darüber verloren, aber als er schließlich ein Attest vorgelegt hatte (… starke Grippe mit Komplikationen …), hatten sie genickt, gelächelt und ihn insgeheim für ein Weichei gehalten. Andererseits wussten alle, dass Alex keine Eltern hatte und sein Onkel, bei dem er gelebt hatte, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Aber bei allem Verständnis: zwei Wochen im Bett! Selbst seine engsten Freunde mussten zugeben, dass das etwas zu viel war.
Aber Alex konnte keinem die Wahrheit sagen. Niemand durfte wissen, was wirklich geschehen war.
Alex blickte sich um, beobachtete die Schüler, die durch die Schultore strömten oder mit einem Fußball dribbelten. Manche waren mit ihrem Handy beschäftigt. Dann beobachtete er, wie sich die Lehrer in ihre Gebrauchtwagen zwängten. Zuerst hatte er gedacht, dass sich die ganze Schule während seiner Abwesenheit irgendwie verändert hatte. Aber jetzt wusste er, dass es noch schlimmer war: Er war es, der sich verändert hatte.
Alex war vierzehn, ein normaler Schüler in einer normalen Gesamtschule im Westen Londons. Oder besser gesagt: er war es gewesen. Erst vor ein paar Wochen hatte er entdeckt, dass sein Onkel ein Geheimagent gewesen war, der für MI6 gearbeitet hatte. Dieser Onkel – Ian Rider – war ermordet worden und die Leute von MI6 hatten Alex gezwungen, seinen Platz einzunehmen. Er hatte sich einem Crashkurs in SAS-Überlebenstechniken unterziehen müssen und war für einen Auftrag an die Südküste Englands entsandt, gejagt, angeschossen und fast getötet worden. Und nach Beendigung des Auftrags war er wieder in die Schule zurückgeschickt worden, als wenn nichts geschehen wäre. Aber zuerst hatte er eine Geheimhaltungsakte unterschreiben müssen. Alex lächelte, als er daran dachte. Es wäre gar nicht nötig gewesen, so etwas zu unterschreiben, es hätte ihm ja sowieso niemand geglaubt.
Aber genau diese Geheimhaltung war es, die ihm jetzt zusetzte. Wenn ihn jemand fragte, was er in den Wochen seiner Abwesenheit getan hatte, musste er antworten, dass er zu Hause im Bett gelegen hatte. Alex verspürte gar keine Lust, mit seinen Taten anzugeben, aber er hasste es auch, seine Freunde hinters Licht führen zu müssen. Es machte ihn richtig wütend. MI6 hatte ihn nicht nur in Gefahr gebracht, sondern sein ganzes Leben in einen Aktenschrank gesperrt und den Schlüssel weggeworfen.
Inzwischen war er beim Radschuppen. Jemand murmelte im Vorbeigehen »Tschüss«, und er nickte. Dann strich er sich die blonde Haarsträhne, die ihm übers Auge gefallen war, zurück. Manchmal wünschte er sich, dass er die ganze Geschichte mit MI6 einfach nur geträumt hatte. Aber gleichzeitig – das musste er zugeben – wünschte ein Teil von ihm, alles noch einmal zu erleben. Manchmal hatte er das Gefühl, dass er nicht mehr in die heile Welt der Brookland-Schule gehörte. Es hatte sich zu viel verändert. Und schließlich war alles andere verlockender als Hausaufgaben.
Er holte sein Fahrrad aus dem Schuppen, schloss es auf, lud sich den Rucksack auf den Rücken und wollte gerade losradeln. In diesem Augenblick entdeckte er den verbeulten weißen Wagen. Er hielt vor den Schultoren – bereits das zweite Mal in dieser Woche.
Jeder kannte den Mann in dem weißen Wagen.
Er war Mitte zwanzig, kahlköpfig, hatte anstelle der Schneidezähne nur zwei abgebrochene Stümpfe im Mund und fünf Metallstecker im Ohr. Niemand kannte seinen wirklichen Namen. Man nannte ihn Skoda – nach seiner Automarke.
Einige behaupteten, er heiße Jake und sei früher ebenfalls auf die Brookland-Schule gegangen. Wenn dem wirklich so war, dann war er wie ein unheilvoller Geist zurückgekehrt. Gerade noch war er da, dann auch schon wieder verschwunden. Irgendwie war er einem vorüberfahrenden Polizeiauto oder einem allzu neugierigen Lehrer immer um eine Nasenlänge voraus.
Skoda verkaufte Drogen, weiche Drogen an die jüngeren Schüler und harte an die älteren, die dumm genug waren, sie zu kaufen. Alex konnte es kaum glauben, aber Skoda vertickte seine kleinen Tütchen ganz unverfroren am helllichten Tag. Denn natürlich gab es in der Schule einen Ehrenkodex. Niemand verriet jemanden an die Polizei, nicht einmal eine Ratte wie Skoda. Und man musste Angst haben, denn wenn Skoda geschnappt wurde, könnten die Schüler, die er belieferte – Freunde, Klassenkameraden –, ebenfalls dran sein.
In der Brookland-Schule waren Drogen früher nie ein Problem gewesen, aber in letzter Zeit hatte sich das geändert. Ein paar Siebzehnjährige hatten Skodas Drogen gekauft und schnell Nachahmer gefunden. Es hatte mehrere Diebstähle gegeben und ein, zwei Fälle, in denen jüngere Schüler terrorisiert und erpresst worden waren. Das Zeug, das Skoda verkaufte, schien immer teurer zu werden, je mehr davon gekauft wurde – und es war schon beim Einstieg nicht gerade billig gewesen.
Alex beobachtete, wie ein Junge mit breiten Schultern, dunklem Haar und Pickeln zum Wagen schlenderte, auf der Fahrerseite stehen blieb, sich hinunterbeugte, dann weiterging. Plötzlich spürte er, wie Wut in ihm aufstieg. Der Junge hieß Colin und noch vor zwölf Monaten war er Alex’ bester Freund gewesen. Damals war Colin bei allen beliebt gewesen. Aber dann hatte sich alles geändert. Er war launisch und verschlossen und in der Schule immer schlechter geworden. Plötzlich wollte niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben – und das lag an den Drogen. Alex hatte sich nie viele Gedanken über Drogen gemacht. Er wusste nur, dass er selber nie welche nehmen würde. Aber es war ihm klar, dass der Mann im weißen Auto nicht nur ein paar hirnlose Schüler vergiftete, sondern allmählich die ganze Schule.
Ein Polizist auf Patrouille tauchte auf und ging auf das Tor zu. Einen Moment später war der weiße Wagen verschwunden und hinterließ nichts als eine schwarze Wolke aus seinem löchrigen Auspuff. Alex hatte sich aufs Rad geschwungen, trat in die Pedale und fuhr schnell über den Schulhof, vorbei an der Schulsekretärin, die auch gerade auf dem Heimweg war.
»Nicht so schnell, Alex!«, rief sie ihm hinterher und seufzte, als er sie nicht weiter beachtete.
Miss Bedfordshire hatte schon immer eine Schwäche für Alex gehabt, wusste allerdings nicht genau, warum. Sie war die Einzige in der Schule, die sich Gedanken darüber machte, ob hinter der angeblichen Grippe nicht noch mehr steckte.
Der weiße Skoda gab kräftig Gas, bog erst links ein, dann rechts und Alex fürchtete schon, er würde ihn aus den Augen verlieren. Aber dann schlängelte sich das weiße Auto durch das Gewirr der Seitensträßchen, die zur King’s Road hinaufführten. Er geriet in den Vier-Uhr-Berufsverkehr und blieb ungefähr zweihundert Meter weiter vorn stehen.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Durchschnittsgeschwindigkeit im Londoner Straßenverkehr wahrscheinlich niedriger als vor hundert Jahren. An einem normalen Arbeitstag überholt ein Fahrrad jedes Auto – auf jeder Strecke. Und Alex fuhr nicht irgendein Fahrrad. Er besaß immer noch seinen Condor Junior Roadracer, ein Rad, das extra für ihn hergestellt worden war. Erst vor Kurzem hatte Alex es mit einer integrierten Bremse und einem Schalthebel für die Lenkstange aufrüsten lassen, und er brauchte nur mit dem Finger zu schnipsen, um zu spüren, wie das Rad einen Gang hochschaltete und das federleichte Titaniumzahnrad sich geschmeidig unter ihm drehte.
Er holte den Wagen in dem Augenblick ein, als dieser gerade um die Ecke bog und sich in den Verkehr auf der King’s Road einfädelte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Skoda in der Stadt blieb, aber irgendwie hielt Alex es nicht für wahrscheinlich, dass er allzu weit fahren würde. Der Drogendealer hatte die Brookland-Schule nicht nur deshalb gewählt, weil er sie früher selbst besucht hatte. Sie lag sicherlich auch in seiner Nachbarschaft – nicht zu nah von zu Hause entfernt, aber auch nicht zu weit davon entfernt.
Die Ampel wurde grün und der weiße Wagen schoss vor, Richtung Westen. Alex trat langsam in die Pedale, blieb ein paar Autos zurück, für den Fall, dass Skoda zufällig in den Rückspiegel schaute. Sie gelangten zu der Ecke, die World’s End genannt wird, und plötzlich war die Straße frei. Alex musste in einen anderen Gang wechseln und kräftig treten, um das weiße Auto nicht aus den Augen zu verlieren. Der Wagen fuhr weiter, durch Parson’s Green und hinunter Richtung Putney. Alex wechselte die Spur und schnitt einem wütend hupenden Taxi den Weg ab. Es war ein milder Tag und er spürte die schweren Schulbücher in seinem Rucksack. Wie weit würden sie noch fahren? Und was würde er tun, wenn sie am Ziel waren? Alex fing an, sich zu fragen, ob das Ganze so eine gute Idee gewesen war, als der Wagen plötzlich anhielt.
Skoda war auf einen Parkplatz neben der Themse nicht weit von Putney Bridge eingebogen. Alex blieb auf der Brücke und beobachtete, wie der Drogendealer ausstieg und sich in Bewegung setzte. Die Gegend wurde gerade saniert, ein Häuserblock mit »prestigeträchtigen Wohnobjekten«, wie das Bauschild anpries, verschandelte die Londoner Skyline. Im Augenblick war das Gebäude nicht mehr als ein hässliches Skelett aus Stahlträgern und vorgefertigten Betonblöcken, auf denen es von Männern mit Schutzhelmen nur so wimmelte. Es gab Bulldozer, Betonmaschinen und über dem Ganzen einen riesigen kanariengelben Kran. Auf einem Schild war zu lesen:
Alex überlegte, ob Skoda hier vielleicht irgendwelche Geschäfte abwickelte. Der Dealer schien zunächst auf den Eingang zuzusteuern. Aber dann drehte er plötzlich ab.
Die riesige Baustelle lag zwischen der Brücke und einer Gruppe moderner Gebäude. Es gab eine Kneipe, dann ein brandneues Konferenzzentrum und schließlich ein Polizeirevier mit einem Parkplatz für die Dienstfahrzeuge. Aber direkt neben der Baustelle, in den Fluss hinausragend, befand sich ein hölzerner Landesteg, an dem zwei Kajütboote lagen und ein alter Schleppkahn aus Eisen in dem trüben Wasser vor sich hin rostete.
Alex hatte den Steg zuerst nicht bemerkt, aber Skoda schritt direkt darauf zu und kletterte an Bord des Kahns. Er öffnete eine Tür und verschwand. Lebte er etwa hier? Es war Spätnachmittag. Irgendwie konnte Alex sich nicht vorstellen, dass Skoda eine Vergnügungsfahrt auf der Themse plante.
Er setzte sich wieder aufs Rad und fuhr langsam bis zum Ende der Brücke und dann hinunter Richtung Parkplatz. Dann versteckte er das Fahrrad und seinen Rucksack und ging zu Fuß weiter. Als er sich dem Kahn näherte, verlangsamte er seine Schritte. Angst, erwischt zu werden, hatte er keine. Immerhin war das hier ein öffentlicher Platz und selbst wenn Skoda wieder auftauchte, konnte er nichts gegen Alex unternehmen. Aber er war neugierig. Was hatte der Drogendealer an Bord eines Kahns zu schaffen? Alex war sich immer noch nicht sicher, was er tun würde, aber er wollte unbedingt einen Blick ins Innere werfen. Dann würde er überlegen, was zu tun war.
Der hölzerne Steg knarrte unter seinen Füßen, als er ihn betrat. Der Kahn trug den Namen Blue Shadow, aber der verblasste Anstrich, die rostigen Eisenbeschläge und das schmutzige, ölverschmierte Deck wiesen kaum noch Spuren der Farbe Blau auf. Der Kahn war ungefähr zehn Meter lang und fast quadratisch, mit einer einzigen Kabine in der Mitte. Er lag tief im Wasser und Alex vermutete, dass sich der Großteil der Kajüte unter Deck befand. Er kniete nieder, tat so, als binde er seine Schnürsenkel und hoffte, einen kurzen Blick durch die schmalen, schrägen Fenster werfen zu können. Aber die Vorhänge waren zugezogen. Was nun?
Der Kahn war auf einer Seite des Stegs festgezurrt. Die beiden Kajütboote lagen Seite an Seite auf der anderen. Skoda wollte offensichtlich ungestört sein – aber er brauchte auch Licht. Auf der anderen Seite des Kahns war es sicher nicht nötig, die Vorhänge zuzuziehen, da es dort außer dem Fluss ja nichts gab.
Das einzige Problem bestand darin, dass Alex auf das Boot klettern musste, wenn er einen Blick durch die anderen Fenster werfen wollte. Er überlegte kurz. Das Risiko musste er eingehen. Er war in unmittelbarer Nähe der belebten Baustelle und niemand würde es wagen, ihm hier etwas zu tun.
Er setzte einen Fuß an Deck und verlagerte dann langsam sein Gewicht darauf. Er hatte Angst, dass sich der Kahn bewegte. Natürlich senkte sich das Boot unter seinem Gewicht, aber Alex hatte den Augenblick gut gewählt. Ein Polizeiboot fuhr vorbei, den Fluss hinauf, zurück in die Stadt. Der Kahn schaukelte in seinem Kielwasser, und als es wieder ruhig war, kletterte Alex an Bord und kauerte sich neben die Kabinentür.
Von drinnen hörte er Rockmusik. Alex wollte es eigentlich nicht tun, aber er wusste, dass es nur einen Weg gab, ins Innere zu schauen. Er versuchte, eine Stelle an Deck zu finden, die weniger ölverschmiert war, und legte sich flach auf den Bauch. Er hielt sich am Geländer fest, senkte Kopf und Schultern über die Bordwand hinab und schob sich dann vor, sodass er kopfunter über dem Wasser hing.
Er hatte recht. Die Vorhänge auf dieser Seite waren offen. Als er durch die schmutzige Scheibe blickte, erkannte er zwei Männer. Skoda saß auf einer Koje und rauchte eine Zigarette. Der zweite Mann war blond und hässlich. Er hatte einen schiefen Mund, einen Dreitagebart, trug ein zerrissenes Sweatshirt und Jeans und kochte auf einem kleinen Ofen gerade Kaffee. Die Musik dröhnte aus einem Radio, das auf einem Regal stand. Alex sah sich in der Kabine um. Abgesehen von zwei Kojen und der Miniküche besaß der Kahn keinerlei Möbel, sondern war von Skoda und seinem Freund in ein schwimmendes Labor verwandelt worden.
Es gab zwei metallene Arbeitsplatten, eine Spüle und eine Elektrowaage. Überall standen Reagenzgläser und Bunsenbrenner, Glaskolben und Messlöffel herum. Alles war schmutzig – offensichtlich achtete keiner der Männer auf Hygiene –, aber Alex erkannte, dass er hier das Herzstück ihrer Geschäfte vor sich hatte. Hier bereiteten sie die Drogen auf. Sie verschnitten sie, wogen sie und verpackten sie, um sie an den Schulen zu verkaufen. Es war eine unglaubliche Idee – eine Drogenfabrik auf einem Boot, und das mitten in London und nur einen Steinwurf von einem Polizeirevier entfernt. Aber gleichzeitig war es sehr clever. Wer würde hier schon danach suchen?
Plötzlich wandte sich der Blonde um und Alex schwang sich hoch und zurück an Deck. Einen Augenblick lang war er ganz benommen, denn kopfunter hängend war ihm das Blut zu Kopf gestiegen. Er atmete tief durch und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Er konnte zur Polizeiwache gehen und den Beamten erzählen, was er gesehen hatte, und die Polizei konnte dann eingreifen.
Aber irgendetwas in Alex verwarf diesen Plan. Vor ein paar Monaten, da hätte er die Sache vielleicht jemand anderem überlassen. Aber er war nicht mit dem Rad so weit gefahren, nur um die Polizei zu rufen. Er erinnerte sich an den Tag, als er das weiße Auto das erste Mal vor den Schultoren gesehen hatte, und wie Colin, sein Freund, darauf zugesteuert war. Und wieder war er wütend. Das hier war etwas, was er selbst erledigen wollte.
Was konnte er tun? Hätte der Kahn einen Stöpsel gehabt, dann hätte Alex ihn herausziehen und das Boot versenken können. Aber so einfach war die Sache natürlich nicht. Der Kahn war mit zwei dicken Seilen am Landesteg festgemacht. Alex konnte sie lösen – aber das würde auch nichts nützen. Der Kahn würde davondriften – aber hier in Putney gab es weder Wasserfälle noch Strudel. Skoda würde einfach den Motor anlassen und bequem wieder zurückfahren.
Alex sah sich um. Auf der Baustelle war gerade Feierabend. Einige der Männer gingen bereits nach Hause, und als Alex alles genauer beobachtete, sah er, wie sich weit über ihm eine Klappe öffnete und ein stämmiger Mann den Kran herunterkletterte. Alex schloss die Augen. Plötzlich schwirrte eine ganze Reihe von Bildern vor seinem inneren Auge, wie die Teile eines Puzzles.





![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
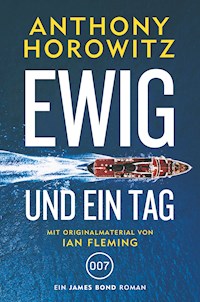

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)