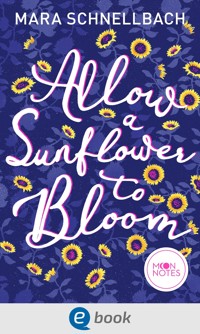
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur wer seine Wurzeln kennt, kann wachsen Eigentlich wollte Emmee nach Frankreich ziehen, Kunst studieren – und ihre Mutter suchen. Obwohl sie in einer liebevollen Pflegefamilie aufgewachsen ist, spürt sie den Wunsch, ihre Wurzeln zu finden. Doch als der Traum vom Studium platzt, landet Emmee stattdessen in einer WG in Wien. Zwischen neuen Freundschaften und ihrem geheimnisvollen Mitbewohner Casimir lebt sie sich langsam ein. Doch dann erhält sie plötzlich anonyme Nachrichten, ihr leiblicher Vater meldet sich unerwartet – und Casimir bittet sie, bei einem Treffen mit seinen reichen Eltern seine Freundin zu spielen... Allow A Sunflower To Bloom: Eine gefühlvolle Summer Romance über Herkunft und Identität - Eine Reise zu sich selbst: Berührende New Adult-Romance über eine junge Frau auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern. - Gefühlvoll: Die Beziehung zwischen Emmee und dem geheimnisvollen Casimir steckt voller Momente, die das Herz berühren. - Authentisch: Mara Schnellbach, selbst als Pflegekind aufgewachsen, erzählt eine own voice-Geschichte von der Suche nach den leiblichen Eltern. - Voll im Trend: Mit den beliebten Tropes "forced proximity", "opposites attract", "found family" und "different worlds". - Tolles Setting: Das poetisch geschriebene New Adult-Buch ist eine Liebeserklärung an die Stadt Wien und all die Menschen, die uns Wurzeln schlagen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
YOU CAN'T TRULY BLOOM WITHOUT KNOWING YOUR ROOTS.
Emmee hatte sich das Erwachsenwerden ganz anders vorgestellt: Eigentlich wollte sie nach Frankreich ziehen, Kunst studieren und ihre Mutter finden. Schon lange sucht sie nach ihren Wurzeln, denn sie ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Alles, was ihr von ihrem leiblichen Vater geblieben ist, ist die Erinnerung an eine gezeichnete Sonnenblume auf ihrem Handgelenk.
Als der Traum vom Studium platzt, landet Emmee stattdessen in einer lebhaften WG in Wien. Zwischen neuen Freundschaften und ihrem geheimnisvollen Mitbewohner Casimir beginnt sie, sich langsam einzuleben. Doch dann erhält sie plötzlich anonyme Nachrichten, ihr leiblicher Vater meldet sich unerwartet – und Casimir bittet sie, bei einem Treffen mit seinen reichen Eltern seine Freundin zu spielen ...
Eine poetische Liebeserklärung an die Kunst, die Stadt Wien und die Menschen, die uns Wurzeln schlagen lassen.
Mara Schnellbach
Allow a Sunflower to Bloom
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können
einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir
damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens.
Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de
Schau gern auf S. XXXX, dort findest du eine Auflistung der
potenziell triggernden Themen in diesem Buch. Um Spoiler zu
vermeiden, steht der Hinweis hinten im Buch.
Ich widme dieses Buch Pflegekindern.
Und wünsche jedem und jeder Einzelnen Freiheit im Kopf. Ihr seid nicht ungewollt, ungesehen oder ungenügend. Eigentlich seid ihr wirkliche Lebenskünstler und -künstlerinnen.
Was, wenn die Spiegelbilder eines Tages mehr zeigen?
Mehr als fremde Silhouetten,
Ohne das verzerrte Kummerkonstrukt.
Nur dich, restlos vertraut,
Und wer du bist und wie du dich magst.
- Mara Schnellbach
Playlist
emma – Casper
Höhenangst – Schmyt
Alles gut keine Angst – Provinz
watch – Billie Eilish
Die Sonne in deinem Zimmer – Edwin Rosen
Zu Jung – Provinz
Risse – Yukno, Betterov
femme fatale – JOPPE
this is me trying – Taylor Swift
Wasting My Young Years – London Grammar
Walzer – Provinz
Matilda – alt-J
Balancieren – Edwin Rosen
kleiner prinz – Sandra Isabel
EINETRÄNERINNTÜBERDEINGESICHT – Saiya Tiaw
Achilles – Berq
Spiegelbild – Mayberg
Healer – Hayd
Sommerregen – LoSin
The View Between Villages – Noah Kahan
Old Friend – Zaho de Sagazan, Tom Odell
Sunflower – Tamino, Angèle
Spring – Provinz
Kapitel 1
Der Schrei
Emmee
Endgültigkeit schmeckte bitter auf der Zunge, aber hatte Edvard Munch je so empfunden? Ein stummer Schrei, diese ausgedehnte Furcht, niemand, der einen hörte. Unter Wasser schrie ich, darüber zerplatzten die Schaumblasen. Wie meine Träume. Eine nach der anderen, erstaunlich widerstandslos. Das Wasser in der Badewanne kräuselte sich, als mein Atem die Oberfläche traf – kleine Wellen trieben davon. Ich atmete tief ein und wieder aus, ein Rhythmus, den ich mir selbst beigebracht hatte. Für Untergangssituationen, in denen ich dachte, ertrinken zu müssen. Wie jetzt. Wie gestern, wie letzte Woche, wie früher. Oder immer.
Meine meterhohen Träume. Endgültig in sich zusammengefallen.
Mühevoll lenkte ich meine Sinne auf etwas anderes. Die Geräusche des Hauses, die mir schnell vertraut geworden waren. Ich hörte das Knarzen der Holzdielen auf dem Flur, das Badezimmerfenster schlug gegen die Außenfassade. Madita spielte ein Stockwerk tiefer Klavier. Verbundene Melodien, und bestimmt tanzten ihre Finger dabei beständig. Ich vernahm eine Maschine. Vielleicht einen Küchenmixer oder die Bohrmaschine? Frieda wollte seit Tagen die Bücherregale in unserem Wohnzimmer aufbauen. Ich fuhr mit der Hand durch die Seife, bis der Schaum sich auflöste und das Wasser kalt wie trüb war. Das Seifenwasser lief ab, ich stieg aus der Wanne, im Abfluss gurgelte es laut. Und auch wenn ich in diesem Moment nackt und blank – nur ich selbst – war, kam ich mir fremd vor. Ich wusste nicht, woher meine dunkelbraunen Haare kamen, woher die Sommersprossen auf meiner Nase. Ich wusste nicht, wer mir die haselnussfarbigen Augen vererbt hatte. In all diesen Momenten, vor allem in den verletzlich nackten, wusste ich so wenig über mich. In den restlichen wollte ich nichts wissen. Ahnungslosigkeit war ein Mantel aus Selbstschutz. Es war nicht ehrlich, aber auch keine Lüge, es war eine Zwischendimension. Ein Raum, in dem ich nicht über alles nachdenken, nichts überdenken und nichts zerdenken musste. Ahnungslosigkeit – hin und wieder vorgetäuscht – war mein sicherer Hafen. Hier musste ich auch nicht an die geplatzten Schaumblasenträume denken.
Frisch angezogen, noch immer die rhythmische Atmung beibehaltend, lehnte ich mich ein Stück weit aus dem Badezimmerfenster. Lauer Wind strich über meine Wangen und trocknete weiter die feuchten Haare. Der August war ausgefüllter Sommer – bis obenhin. Als strömte er bald durch das offene Fenster zu mir herein. Unser Wohnhaus lag nah dem Wienerwald, zwischen Wiesen und ein paar Häusern. Maisfelder stachen in den Abendhimmel und berührten die Sterne. Es roch nach getrockneten Gräsern und Blütenstaub, außerdem nach Pizza Hawaii, und ich war mir fast sicher, dass Xavier keine Lust gehabt hatte, zu kochen. Das entlockte mir ein Lächeln. Ja, tatsächlich brachte mich das zum Schmunzeln und ließ mich daran glauben, dass nicht alles aussichtslos war. Nur ein bisschen. Seit zwei Wochen wohnten wir hier. Wir fünf. Ein wir, trotzdem noch Fremde. Aber es fühlte sich stetig vertrauter an. Und zugegeben: Ich mochte es, ich mochte diesen Altbau in Wien. Ich mochte die Landschaft, den Wald in der Nähe, die knarzenden Bodendielen. Wieder hörte ich das drillende Geräusch, und es konnte nur zu Friedas Regalaufbau gehören.
»Das hier wird dein Zuhause. Dein eigenes. Okay?« Meine Stimme klang kehlig und etwas zerrissen, aber ich musste das laut aussprechen. Eine innere Frage war nie derart echt.
Entschlossen zog ich das Fenster des Badezimmers zu, und beim Hinausgehen quoll der Dampf hinter mir auf den Flur. Mit tapsenden Schritten steuerte ich die Wendeltreppe an. Meine Untergangssituation ließ ich nach und nach auf den Stufen zurück. Unten angekommen war sie wie eine Regenwolke vorübergezogen. Oder geplatzt – wie die Träume.
In unserer Wohnung dämmerte es bereits, eine improvisierte Lampe hing schräg von der Decke und baumelte, als wäre jemand daran gestoßen. Die Stiege endete in einem offenen Wohnzimmer, unsere zwei Sofas standen wahllos in der Mitte des Raums, wir hatten uns noch nicht für einen genauen Platz entschieden. Hinter der Treppe führte ein schmaler Gang zu zwei Schlafzimmern und einem Bad. Und einer Nische mit einem Torfenster, dort befand sich Maditas Klavier. Sie spielte noch immer, dieser Klang war mir am vertrautesten.
Hinter unserem Avocadobaum in seinem rostroten Topf entdeckte ich Frieda. Sie kniete auf dem Boden, überall Werkzeug, Dübel rollten mir entgegen. Das Bücherregal stand.
»Hi«, machte ich auf mich aufmerksam.
»Oh, hi Emmee.« Frieda sah zu mir auf, und da war es, ihr klitzekleines Mundwinkellächeln. Zwei Wochen kannte ich die kleine Frau und ihr genauso kleines, aber ehrliches Lächeln. »Geht es dir gut?«, wollte sie wissen. Sie fragte das obligatorisch. Als würden wir Menschen eine subjektive Antwort darauf geben. Als wäre das nicht die perfekte Frage für Lügen. »Alles wie immer.« Alles war ein großer Begriff. Die Welt bestand aus einem Alles und einem Nichts. Und einem Dazwischen. Für mich gab es Lücken. »Du bist weit gekommen«, bemerkte ich und betrachtete das Holzregal. Sie nickte, einen glücklichen Ausdruck im Gesicht. »Irgendwer muss sich ja darum kümmern. Xaviers und meine Bücher stapeln sich sonst weiter auf dem Boden.«
»Er wird sich darüber freuen. Danke, dass du es übernommen hast.«
Frieda stand auf, fuhr sich durch die orangeroten Haarsträhnen. Sie trug graubraune Kleidung, oversized und Jahre zurückversetzt, vielleicht von ihrem Großvater. Es verlieh ihr etwas Eigenes, und ich mochte, wenn Menschen eigen waren. Sie war ein Jahr jünger als ich, neunzehn und gerade mit der Matura fertig geworden. Viel mehr wusste ich noch nicht. Das warme Licht der improvisierten Lampe erhellte das Orangerot ihrer Haare, und die Sommersprossen auf ihren Wangen schienen zu flimmern. Frieda war ein Feuermädchen in meinem Kopf, sie kam mir selbstbewusst vor, als hätte sie innere Größe. Sie war beständig wie ihr kleines Lächeln. Nur hin und wieder, da zuckte sie zusammen, flackerte wie Flammen. Aber ich kannte sie kaum, also konnte das alles eine Illusion sein. Die Alliteration Feuer Frieda ließ mich dennoch nicht los.
»Hast du schon gegessen?«, erkundigte sie sich.
»Nein, war gerade auf dem Weg in die Küche. Lust, gemeinsam zu kochen?«
»Gern.« Die Vorsicht, die ihrer Stimme beigewohnt hatte, wich einer hörbaren Erleichterung.
»Nudeln mit Soße, Reispfanne … Pizza von Xavier?«
Sie verzog das Gesicht bei meinem letzten Vorschlag. »Oh, ich würde wetten, er hat nichts übrig gelassen.«
»Habe ich nicht.« Frieda und ich drehten uns zeitgleich in Richtung Küche. Xavier lehnte am Türrahmen und schob sich einen Pizzarand in den Mund, er kaute mühsam, als wäre es zu viel für einen Bissen. »Dann werden es die Nudeln mit Soße«, entschied Frieda trocken. Ich musste schmunzeln, Xavier verzog keine Miene. Er war groß und schlaksig, trug einen Rollkragenpullover im Sommer. Sein Haar war lockig wie das seines Bruders Casimir, fast schwarz. Xavier war für mich ein Ästhetik-Mensch, und ich würde es ihm niemals verraten. Er hatte etwas stilvoll Schönes, so als hätte er der Theorie der Kunst und Natur eine eigene Harmonie verpasst. Jetzt zuckte er die Schultern und deutete zu seinem Telefon, das klingelte. »Guten Hunger«, wünschte er. Dann hob er grüßend den eingehenden Anruf ab und durchschritt das längliche Wohnzimmer. Blieb plötzlich stehen. Ich warf Frieda einen Blick zu, den sie schulterzuckend annahm. »Nein! Alles?«, vergewisserte sich Xavier bei seinem Gegenüber. »Und wohin? Auf den Sperrmüll?«
Stille. Ich kam mir fehl am Platz vor und fühlte mich ertappt, als Xavier uns von der anderen Seite des Raums flüchtig zunickte. Er marschierte weiter. »Verfluchte Scheiße. Wie schlimm ist es diesmal?«
Zwei Schritte nach oben, abermals hielt er inne. »Zum Arzt?!«
Frieda sah unserem neuen Mitbewohner bestürzt nach. »Danke, Casimir. Mhm … Ja, Hoffentlich …«
Xaviers Stimme verhallte im oberen Stockwerk, und dann hörten wir seine Zimmertür schlagen. Sein Zimmer direkt neben meinem. Ich wusste deshalb aber trotzdem nicht, welche Musik er mochte. Oder ob er trainierte, manchmal tanzte? Nie vernahm ich etwas. Was mir kein unheimliches Gefühl gab, es war, wie es war. »Ich glaube, mit Xavier habe ich bis jetzt genau fünf Sätze gewechselt. Obwohl er ständig da ist, im Gegensatz zu seinem Bruder Casimir«, überlegte Frieda neben mir laut und stieg dabei über einen Hammer hinweg.
»Nicht wahr? Er ist ziemlich still.«
»Er taut bestimmt noch auf. Ich bin auch oft ein Eisklotzmensch, geben wir uns allen Zeit. Es sind erst zwei Wochen vergangen.«
»Ich vergesse manchmal, wie wichtig das ist – Zeit geben«, murmelte ich und dachte an meine Feuergedanken, während sie von Eisklötzen sprach. Ich fing oft sofort an zu urteilen. Über stille Menschen, über laute, über kleine oder große. Rückte mir eine Meinung zurecht. Und mir wurde überdeutlich bewusst, wie falsch das war. Ich vermutete, wusste aber kaum etwas. Vielleicht hörte Xavier ununterbrochen Musik, nur über Kopfhörer, und deswegen bemerkte ich nichts davon. Eventuell trainierte oder tanzte er nachts, wenn ich schlief, deshalb waren da tagsüber keine polternden Schritte. Ich nahm mir vor, sie besser kennenzulernen. Sie alle. Jeden Mitbewohnenden. Xavier, seinen Bruder Casimir, Frieda und meine … Na ja, auch meine Schwester Madita. Wie es momentan zwischen uns stand, da fühlte ich mich, als würde ich sie nicht mehr kennen. »Emmee?«
»Oh, hm?« Ich folgte Frieda in die Küche.
»Ich habe gefragt, ob du für Fusilli oder Schmetterlingsnudeln bist?« Sie hielt zwei knisternde Packungen in die Höhe und sah mich abwartend an. »Schmetterlingsnudeln«, bestimmte ich mit einem kleinen Lächeln.
»Nur weil sie einen schöneren Namen haben?«
»Absolut.«
»Ich fang an, dich besser zu kennen«, meinte Frieda nebenbei und legte die Packungen auf der Küchenzeile ab. Vielleicht hatte sie ähnliche Gedanken wie ich. An unserem Doppelwaschbecken befüllte ich einen Topf mit ausreichend Wasser, dann stellte ich ihn auf den Gasherd und entflammte die Platte. »Wie fühlst du dich in unserer Wohngemeinschaft? Bis jetzt?«, fragte ich geradeheraus und lehnte mich mit dem Rücken an den Herd. Sie hob überrascht den Kopf, ihr Gesichtsausdruck wirkte nachdenklich. Wir waren noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem wir unsere Gedanken ungefiltert mitteilten. Denn auch das brauchte Zeit. »Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Sobald wir einander besser kennen, wird es leichter sein.« Sie kicherte leise. »Manchmal gehe ich auf Zehenspitzen herum, weil ich Angst habe, jemanden zu stören. In seinem Sein.«
Das entlockte mir ein Lachen. »Ich verstehe dich absolut. Aber so laut wie Madita in die Tasten haut, sind unsere Schritte sicher nicht störend.«
Sie nickte und holte sich ein Brett, das auf dem Küchentresen an der Wand lehnte. Unsere Küche war überfüllt, und das war keine Übertreibung. Die Regale quollen über voller Teller, Tassen, Schüsseln, bemalten Tonbechern. Drei orangegelbe Glühbirnen in Übergröße baumelten von der Decke. Es hatte seinen Charme. Der Esstisch war zu klein für uns fünf, aber solange wir uns nicht im Weg standen, würde es funktionieren. Außerdem hingen getrocknete Blumensträuße und Kräuter herum, und Friedas Vasen standen in allen Formen auf den Fensterbrettern. Jeder hatte sich an der Einrichtung beteiligt. Die Brüder waren für den Esstisch, die Stühle und den Kronleuchter in der Klaviernische verantwortlich. Woher auch immer sie den hatten. Es war gemütlich, ich würde mich nicht darüber beschweren. Ich selbst hatte die Töpferware und das Geschirr mitgebracht, Madita zusätzlich die Pflanzen. Alles, was grün war, war gut, weil es so was von lebendig ist. Ihre Worte. Für Außenstehende mochte diese Küche die absolute Vermengung sein, ich fand es allerdings toll. Es sah nach Wohnen aus. Frieda schnitt Zwiebeln mit tränenden Augen und lächelnden Lippen, und ich hackte auf getrockneten Rosmarinnadeln herum, bis sie in klitzekleinen Würfelchen vor mir lagen. »Du und deine Schwester«, fing sie plötzlich an. Schwester, dieses Wort zuckte wie eine Feuerzunge durch meinen Körper. »Wolltet ihr schon immer gemeinsam ausziehen?«
»Nein, das war spontan. Es hat sich ergeben.« Meinetwegen. Und wegen meiner Träume. Meinen verdammten, verdammten Träumen, die seit der letzten E-Mail heute Vormittag keine mehr waren. Ich wünschte, ich hätte in diesem Moment die Zwiebeln geschnitten. Dann hätte ich das Brennen meiner Augen darauf schieben können, wäre nicht so offensichtlich abgekämpft.
Sehr geehrte Frau Morel, es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen …
»Madita und ich studieren ab Oktober, und unser Vater hat zufällig die Anzeige zu dieser Wohngemeinschaft in der Zeitung gefunden. So ist es dann gekommen.«
»Ist bestimmt schön, jemanden an der Seite zu haben, den du lange kennst. Wie eine Schulter zum Anlehnen.«
»Fehlt dir so jemand?«
Ihr Lächeln wurde das erste Mal breiter, ein wenig größer. »Nein, ich mag es genau so, wie es ist.«
»Schon lustig, zwei Geschwisterpaare hier zu haben«, schob sie hinterher.
»Ja, nicht?« Ich trat wieder an das Spülbecken, um meine Hände zu waschen, obwohl es nicht nötig war. Das Wasser spülte nichts fort, auch wenn ich mir das in solchen Momenten wie diesem wünschte. Was ich fürs Händewaschen geben würde, wenn es wenigstens einen brodelnden Gedanken in mir löschen würde. »Apropos Geschwister. Das am Telefon bei Xavier, das klang nach viel. Ich hoffe, alles ist okay«, überlegte Frieda laut.
»Ja«, stimmte ich zu. »Das hat mir auch ein mulmiges Gefühl gegeben.«
»Aber immerhin hat er seinen Bruder hier. Ich meine, sie scheinen ein starkes Familienband zu haben. Er wird zurechtkommen. Außerdem wissen wir ohnehin nichts, alles könnte weniger dramatisch sein als das, was wir verstanden haben.«
Frieda blickte trotzdem besorgt drein, und ich fand, sie war ein feinfühliger Mensch. Für ihre Umgebung sensibilisiert.
»Ich werde mal an den Zimmern klopfen und fragen, wer mitessen will. Übernimmst du kurz allein?«, fragte ich.
»Oh, na klar. Bis gleich.«
Ich strich meine Hände an meiner luftigen Hose ab und hinterließ dunkle Stellen auf dem Stoff. Im Wohnzimmer atmete ich tief durch. Und beschloss, mich innerlich mehr zu festigen. Begriffe wie »Familienband« oder »Schulter zum Anlehnen« sollten mich nicht angreifen. Das waren nur Worte, das war banal, das war meine ganze Traurigkeit, aber ich durfte sie nicht zulassen. Solche Worte beherrschten mich ständig. Und ich hatte mir geschworen, sobald ich ausgezogen war, würde ich mit diesen Situationen klarkommen. Jetzt war die Zeit für eigene Entscheidungen, eigene Lebenswege. Ich wischte mir über die Augen, bis mein Blick stechend klar wurde und ich stoppte, in meinem inneren Tränensee umherzupaddeln.
Kapitel 2
Das Eismeer
Casimir
Das Haus meiner Eltern hatte viel Ähnlichkeit mit Caspar David Friedrich: Das Eismeer. Ich würde sogar behaupten, mehr mit dem früheren Titel des Gemäldes. Die Gescheiterte Hoffnung. Eine dramatisch und zerstörerisch anzusehende Szenerie einer Eislandschaft. Splitter, mitten in ihrer Explosion in der Luft eingefroren.
Und ihr Eigenheim stand dem in nichts nach. Das Haus, in welchem ich groß geworden war, ragte zentral im ersten Wiener Bezirk in die Höhe. Weißer Stein, uralt, aber sauber erhalten. Die Rundbogenfenster spiegelten die Abendsonne. Die Mauern schienen unüberwindbar. Sie waren für meinen Bruder Xavier und mich tatsächlich eine geraume Zeit unbezwingbar gewesen. Doch genau darum ging es, seit wir ausgezogen waren. Um die Zeit und wie sie die Dinge verändern konnte.
Ich rannte die Stufen nach oben zu den Flügeltüren. Schob den Schlüssel in das Schloss, er drehte sich, es klickte, glich einem Brechgeräusch. Mein Herz hatte sich an diesen Laut gewöhnt, nicht aber an das Gefühl, diesen einen Schritt über die Türschwelle zu tun. Beklemmung machte sich breit, der Eindruck, etwas stimmte nicht. Passte nicht zusammen. Ich fühlte das schon sehr lange, wenn es um mein Elternhaus ging. Es hatte irgendwann aufgehört, wie ein Zuhause zu riechen, die häusliche Wärme, die fehlte, und nach jedem Eintreten, da stand ich in meinem ganz persönlichen Eismeer.
Der Eingang war hoch gebaut, kühl und still. Hier wurde nichts überhört – auch früher nicht. Weder die Rüge unserer Eltern noch jede Ausrede unsererseits.
»Hallo, Casimir«, begrüßte mich Karla, und ich fuhr ertappt herum. »Keine Sorge, sie sind bei der Auktion im Dorotheum«, informierte sie mich sofort. Und ein klein wenig von der Eis-Empfindung schmolz.
»Bin eh gleich wieder weg«, konnte ich nur antworten. Denn eigentlich wollte ich gar nicht hier sein. Sollte es auch nicht. Sie ahnte das wahrscheinlich, sonst hätte sie mir nicht sofortige Entwarnung gegeben. Karla, die Haushälterin, wusste einiges über mich und meinen Bruder. Schätzungsweise mehr als unsere eigene Mutter.
»Holst du die Reste aus euren Zimmern?« Sie schob mir Hausschlappen zu. Der Zeit wegen lehnte ich diese ab und behielt meine Straßenschuhe an. Gut, dass mein Vater das nicht mitbekam. Er regte sich unaufhörlich über Dreck in seinem Haus auf. Ich vermutete, dass er noch nie in seinem Leben einen Besen in die Hand genommen oder sich mit einer Kehrschaufel zu Boden gebückt hatte. Allein bei dem Gedanken an die Privilegien meines Vaters und wie ich-süchtig und selbstverständlich er sie auslebte, wurde ich wütend. Spürte die Hitze meinen Hals hinaufkriechen.
»Ja, ich hole Xaviers und meine letzten Kisten«, erklärte ich Karla und stiefelte auf die steinerne Stiege zu. Früher hatte ich Angst gehabt vor den immensen Löwenköpfen, die am Geländeraufgang thronten. Heute hatte ich vor ganz anderen Dingen in diesem Haus Angst.
»Casimir?«
»Ja?«, ich drehte mich auf dem Treppenabsatz um. Karla schluckte sichtbar. Sie war seit Anfang an dabei. Irgendwann hatte ich sie gefragt, ob sie selbst Kinder hat. Ich habe Xavier und dich.
Seit dieser Antwort war es für mich in meinem eigenen Zuhause etwas wärmer geworden. Die Mittfünfziger-Frau ließ uns Brüder mehr zusammenhalten.
»Wie geht es ihm?«, wollte sie wissen.
»Überall besser als hier.« Ich musste nicht lügen, sie kannte diese Reaktion bereits. Karlas Frage war obligatorisch. Sie hatte uns erlebt und wie wir vor ein paar Wochen Kiste um Kiste gepackt hatten. Wie unsere Gesichter blass und die Haltungen erschöpft gewesen waren. Denn etwas brach über die Zeit auch in dir selbst, wenn das Heim stetig bröckelte.
Xav und du, ihr habt jetzt ein neues Zuhause, erinnerte ich mich.
»Und wie geht es dir?« Für einen Moment lag mir eine Lüge auf der Zunge, um schnell die Situation zu verlassen und nach oben in unsere Kinderzimmer zu hasten. Aber Karla sah mich noch immer an, und ich wollte sie nicht täuschen. Ich täuschte schon alle anderen Mitglieder dieses Hauses.
»Alles wird gut werden. Ich bekomme das hin.«
Wie ich wohl gerade auf sie wirkte? Sah Karla noch den kleinen Jungen, den sie früher in den Arm genommen hatte, wenn ich gestürzt war? Oder sah sie mich, wie ich heute vor ihr stand? Meine dunklen Locken wellten sich, da mussten dieselben Muttermale, dieselben grünen Augen sein, derselbe Blick wie jedes andere Mal zuvor. Vielleicht waren meine Züge etwas schmaler und hochkantiger geworden. Sieht sie mein Herumirren und die Spirale, in der ich mich befinde und kaum herauskomme?
»Es geht uns besser«, schob ich hinterher. Sie nickte, und dann sagte sie das, was schon vorhin in ihrem Blick gelauert hatte. Karla kannte uns, aber ich kannte auch sie. Und ich wusste, wenn etwas nicht stimmte.
»Sie haben den Rest weggeräumt.«
»Was?«
»Dein Vater, er hat eure Kinderzimmer räumen lassen. Es ist nichts mehr übrig.«
Ich rannte nach oben. Stieß die Tür zu meinem Kinderzimmer auf. Alles war leer.
Nach unserem Entschluss, auszuziehen oder besser gesagt zu fliehen, hatte ich Stunden damit verbracht, die Regale auszuräumen. Xavier ebenfalls, er hatte sogar jedes seiner Bücher hergeben wollen. Wir hatten Sammlungen aufgelöst und waren kurz davor gewesen, unsere gesamte Einrichtung zu versteigern.
»Es mag das Geld unserer Eltern sein, das in unseren Zimmern steckt, aber es sind unsere Habseligkeiten, Xav. Wir sollten uns selbst nicht aus Verzweiflung wegwerfen«, hatte ich mir eingestanden und dann auf Xavier eingeredet. Nicht nur Geld steckte in unseren Zimmern, es ging um unsere Erinnerungen.
Wir hatten das Überflüssige hergegeben, unsere liebsten Dinge aber in Kisten gepackt, und jetzt war trotzdem nichts mehr da.
Vater war uns wieder einmal zuvorgekommen.
»Das darf nicht wahr sein«, flüsterte ich. Schallwellen meiner Stimme schlugen durch den aufgeräumten Raum. Unsere Eltern hatten das auch mit unseren Herzen getan. Sie unerlaubt leer geräumt.
Xavier: Kommst du heute zu Hause vorbei? Wir sollten unsere letzten Kisten und Möbel in die WG zu holen. Würde dir gern helfen, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht.
Hier stand ich in meinem Zimmer, nichts war da, und alles tat weh. Noch bevor ich eine nächste Entscheidung fällen konnte, schlugen die Flügeltüren unten ins Schloss. Mir wurde bang, Kaltschweiß sammelte sich in meinen Fäusten. Ich war auf keine Konfrontation mit ihnen vorbereitet.
»… Ich hoffe, der Händler kann sich wenigstens einen Urlaub von dem Geld leisten, das du zum Fenster rausgeschmissen hast«, hörte ich meinen Vater wettern. Seine Stimme war gewetzt wie die allerschärfsten Messer. Fast war ich erleichtert, als ich auch die Stimme meiner Mutter vernahm und wie stark sie neben Vaters klang.
»Ich habe nur ersteigert, was ich für repräsentativ und passend hielt. Genau wie du es wolltest, Arnold.«
»Repräsentativ?« Vater lachte gehässig. Sie mussten unten direkt im Eingang stehen, dort, wo die Säulen die hohe Decke stützten und ihre Worte bis zu mir trugen. Mit zittrigen Knien setzte ich einen Fuß vor den anderen, bis ich am Geländer noch besser mithören konnte. Früher hatte ich mit Xavier an dieser Stelle gestanden, zu jung, und wir hatten von all dem nichts verstanden. Jetzt tat ich das.
»Bitte, das ist nicht repräsentativ, Helene. Es muss praktisch sein, hast du diese zwei Worte etwa verwechselt? Solche Summen für ein bisschen Dekor? Die Leute sollen nicht denken, wir hätten jede Menge Geld, aber dafür kein Gehirn!«
Ein Luftholen durchschnitt den Raum, ich wusste, es war Mamas Atem und wie sie gegen ihn ansetzen wollte. Die Stimme weiter erheben, für sich einstehen.
»Spar dir die Erklärungen. Solange du deinen Teil für das Ansehen der Familie leistest, bin ich zufrieden.«
Mama hatte noch nie eine Chance gegen ihn gehabt. Sie versuchte, die Stimme zu erheben, und wurde fortlaufend ausgebremst, und das fühlte sich unerträglich an. Sie ließ keinen Mucks mehr hören. Es war, als wäre sie nur ein Schatten für ihn. Etwas, das neben oder hinter ihm existierte. Er sprang mit ihr um, wie er wollte. Er sprach von seinen Träumen, von seinen Vorstellungen, von seiner Welt, was war mit der ihren? Was war mit Mamas Welt?
Was ist mit meiner Welt?
Mein Vater sah kaum jemanden außer sich selbst, und am allerwenigsten sah er seine Frau. Mama war das Dekor in seinem Leben, das er ihr absprach. Sie war nichts weiter als seine Vase, die er eines Tages ersteigert hatte. Von ihrer Familie kam der adlige Hintergrund. Von ihr kam der Unternehmensbesitz, von ihr kam ein Herz voller Liebe, und sie hatte ihm zwei Söhne geschenkt, wie er es gewollt hatte.
Dann hatte er sie beraubt und ihr all das genommen. Er hatte Xavier alles genommen. Er hatte mir alles genommen.
Nach ein paar Minuten vernahm ich meine Eltern nicht mehr unten im Eingang und wollte schnellstmöglich die Stiege hinunterhasten, um unbemerkt zu verschwinden.
Da zersprang eine Vase in tausend Splitter.
Mitten auf den Stufen blieb ich erstarrt stehen. Gegenüber im Wohnzimmer stand meine Mutter zwischen Scherben und Vater mit erhobener Hand.
»Blamier mich nie wieder«, drohte er.
»Ich verspreche es«, antwortete Mama laut und deutlich. Wie jedes Mal. In solchen Momenten hatten wir Brüder uns die kleinen Finger entgegengehalten, und Xavier war es gewesen, der geflüstert hatte: »Wir sind anders und irgendwann nicht mehr bei ihm.«
Das Erschreckendste war, wie routiniert ich meinen Körper in Bewegung setzte. Da war nicht mal Furcht. Ich stieg weiter die Stufen hinunter, überwand den ersten Schock und wusste, was zu tun war.
Vater musste in sein Arbeitszimmer verschwunden sein, und ich half meiner Mutter aus den Scherben. Sofort sah ich den Schnitt an ihrem rechten Fuß. Sie fragte nicht einmal, wieso ich hier war. Oder wie es mir ging seit unserem Auszug.
Sie war wieder der Schatten, der existierte.
»Karla wird dich zu einem Arzt bringen«, informierte ich sie und klang dabei erschreckend emotionskalt. Ich passte mich unserem Eismeer an. Ich kehrte die Scherben im Wohnzimmer zusammen, die Vase, die sie ersteigert hatte – zerbrochen.
Dann nahm ich Karla beiseite. »Bitte ruf mich an, wenn das nächste Mal etwas zu Bruch geht. Okay?«
Sie versprach es und umarmte mich fest, hielt für diese Sekunden alles zusammen. Ich sagte nichts mehr zu meiner Mutter, sie würde mich später nur dafür tadeln und wieder zu der gefühlskalten Frau werden, die sie zu uns war. Obwohl da einmal ein warmes Herz gewesen sein musste. Manchmal, da erinnerte ich mich an wärmende Umarmungen und liebevolle Blicke. Aber seitdem war jede Menge Zeit vergangen. Und die hatte uns verändert.
Ich verließ unser Elternhaus, bevor Vater mich entdecken konnte und es erneut schepperte. Als ich Xavier anrief und ihm von unseren Zimmern und Mama erzählte, blieb bei ihm ebenfalls die Desillusion aus. Die Enttäuschung war irgendwann zwischen den Jahren Akzeptanz gewichen.
Erst nachdem ich heimgefahren war und das Haus mit den grünen Fensterläden am Rand von Wien betrat, taute mein Herz auf.
Versprochen, Xavier. Wir sind anders und nicht mehr bei ihm.
Wir sind hier.
In unserem Zuhause.
Kapitel 3
All Green
Emmee
Madita saß in der Nische mit dem runden Bogen, hinter ihrem Klavier. Das zimmerhohe Fenster war geöffnet, und eine Brise spielte sacht mit ihren blonden Haarsträhnen. Sie saß mit dem Rücken zu mir, und ihre Beine hingen über den Fensterrahmen hinaus. Nach draußen hin nur Grünfläche und Madita mittendrin, wie Mary Abbott sie wohl 1954 gezeichnet hätte? Auch All Green?
»Hi, Madita«, machte ich sanft auf mich aufmerksam. Sie drehte den Kopf zu mir und sah mich an, mit einem Lächeln. Einem erkämpften, das wusste ich. Weil sie der einzige Mensch in diesem Haus war, den ich wirklich kannte. Der mir nichts vormachen konnte. Den ich nur anzusehen brauchte, und der mir vertraut vorkam. Sie schluckte kräftig.
»Hey, Emz.«
»Ist da noch Platz für mich?«
Sie nickte und rutschte auf dem weißen Fell ein Stück beiseite, damit ich mich zu ihr in die Nische setzen konnte. Wir ließen die Beine über das Sims in den angebrochenen Abend baumeln, und keine von uns hatte Angst, zu fallen.
Ich stellte mir vor, wie wir wohl in den Augen des Spaziergängers aussahen, der den Feldweg auf das Grundstück zukam. Er musste zwei junge Frauen sehen, eine blond und eine dunkelhaarig und so verschieden wie Winter und Sommer. Winzig waren wir von dort unten, umschlossen von den alten Mauern. Das Haus mit den grünen Fensterläden und überall Ranken an den Außenwänden, von denen der Putz abbröckelte, weil nichts für immer war. Ich betrachtete den weitläufigen Garten zu unseren Füßen, die Apfelbäume, die dann und wann reife Äpfel fallen ließen, deren dumpfe Geräusche den Abend begleiteten.
Meine Schwester legte scheinbar erschöpft ihren Kopf an den Fensterrahmen. Madita war überall weich, wo ich Kanten hatte. Ein herzförmiges Gesicht, das abgerundete Kinn, die Kugelaugen wie Vollmonde. Bei mir waren es eher Sicheln, hohe Wangenknochen, harte Züge. Ich hatte Sommersprossen, sie keine, und unsere Augenfarbe war vollkommen unterschiedlich. Braun gegen blassgrün. Hin und wieder dachte ich, die Farbe ihrer Augen wäre einmal stärker gewesen. Ein satteres Grün, ein Sommergrün. Das war womöglich Einbildung.
»Hast du Hunger?«, brach ich unser Schweigen.
»Kocht ihr?«
»Mhm, Frieda und ich. Es gibt Schmetterlingsnudeln.«
Das Lächeln wurde minimal echter. Es waren ihre Lieblingsnudeln, und ich hatte sie wegen unserer Kindheitserinnerungen ausgewählt.
»Ich komme gleich zu euch«, erwiderte Madita.
»Ist alles okay?«, platzte ich heraus. Sofort huschte ein Schatten über ihr Gesicht, verhärtete ihre sanften Züge für Sekunden. »Ja. Ja, klar. Es ist nur ein bisschen viel gerade.«
»Vermisst du unsere Eltern?« Sie zuckte zusammen. Mit einer solch heftigen Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Da saß sie, zusammengekauert und meinem Blick ausweichend. So war sie eigentlich nicht. Madita war direkt, sie war selbstbewusst und unabhängig. Sie sah zum Himmel, das Kinn immer erhoben. »May … Ich … Also wir können reden, weißt du? Ich bin da.«
Sie nickte in schnellen Bewegungen und blinzelte. »Ja …«, brachte sie über die Lippen. Nicht einmal ihr Spitzname schien sie daran zu erinnern, dass wir schon eine ganz lange Zeit füreinander da waren. »Seit zwei Wochen fühlt es sich komisch an zwischen uns«, begann ich wieder, in demselben vorsichtigen Tonfall.
»Tut mir leid«, entschuldigte sie sich.
»Nein, das soll es nicht. Ich will dich nur unterstützen.«
»Das tust du«, flüsterte sie. Dabei schienen wir weiter entfernt als jemals zuvor. »Kann ich dich in den Arm nehmen?«
»Okay.«
Ich zog sie in eine feste Umarmung, und das war wirklich das Vertrauteste auf diesem Planeten. Madita Estelle Winter und ich, unsere Umarmungen, seit wir klein waren. Das verschwand nicht mehr. Das blieb eine Gewohnheit, an der wir uns festhalten konnten. Und wie wir uns daran festhielten. »Es ist besser geworden«, flüsterte sie an meiner Schulter.
»Bei mir auch, May.«
»Meinst du, es wird einen Moment im Leben geben, in dem alles gut ist?«
»Allesalles? Nein. Denke ich nicht. Aber es wird Situationen geben, in denen wir ganz nah dran sind.«
Madita und ich waren nicht für diese Allesalles-Momente des Lebens gemacht, von denen oft erzählt wurde. Wenn du viel auskostest. Teile der Welt, neue Menschen, mehr Ideen, erweiterte Träume. Wir waren doch Anfang zwanzig, da sollte das Leben richtig losgehen. Da wurden wir endlich erwachsen und frei.
Bei Madita und mir war es anders. Denn wir hatten Kinderjahre übersprungen, wir hatten früher erwachsen werden müssen, wir hatten von Anfang an gekämpft. Und waren nie frei in unseren Köpfen. Das war okay. Wir hatten trotz alldem Glück gehabt. Hier, an diesem offenen Fenster zu sitzen, die Beine in die Abendluft baumelnd, der brennende Sonnenuntergang über gelben Kornfeldern – das war eine Fülle, die ich zu schätzen wusste. Natürlich, das Kämpfen und das Aufrechtstehen taten deshalb nicht weniger weh. Solche Momente wie dieser halfen allerdings, weiterzumachen.
»Es geht weiter, oder, Emz?«, fragte Madita mit leiser Stimme, die nicht zu der selbstbewussten Frau passte, die ich in ihr sah.
»Das wird es.«
Und das tat es. Es ging weiter, auch wenn wir uns in Gedanken bewegungslos fühlten. Auch wenn wir in einigen Augenblicken dachten, das war es jetzt. Ich bleibe stehen. Doch dann ging es noch ein winziges bisschen weiter.
»Also los, helfen wir Frieda beim Kochen.« Madita zog ihre Beine an, hob sie über den Fensterrahmen zurück in die Nische. Sie nickte mir zu, bestärkend. Ich nahm ihre ausgestreckte Hand, und wir drückten gleichzeitig, eine Finger-quetsch-Erinnerung. Daran, dass wir einander hatten. »Ich mags hier, ich mags wirklich«, gab sie zu, als wir das Wohnzimmer durchquerten und über das liegen gebliebene Werkzeug stiegen. Aus der Küche roch es nach geschmorten Zwiebeln und frischen Tomaten, Frieda winkte uns zu sich. Die Abendluft und Maditas Umarmung hatten meinen Kopf ausgekühlt und die brennenden Gefühle ausgeglichen. Womöglich war hier doch nicht alles schlimm und zerplatzt, und was, wenn ich an diesem Ort tatsächlich mehr ich selbst werden konnte? So sehr ich, wie ich es nie gewesen war?
»Ich mags hier auch.«
Kapitel 4
Zwölf Sonnenblumen in einer Vase
Emmee
Die Sonnenblumen wirkten unbeugsam. Intensives Gelb unter einem knallblauen Morgenhimmel, fast ein bisschen wie Van Gogh sie gemalt hatte. Nur warteten sie nicht in einer Vase auf das Verwelken, sie blühten aufrecht, am Rand des Feldes vor unserem Wohnhaus. Dort wuchsen sie schon seit unserem Einzug – zu jeder Zeit standhaft. Ich mochte, dass sie in meiner Lieblingsfarbe leuchteten und hochgewachsen waren, wie mein Durchhaltevermögen. Ich konnte wegen dieser Blumen lächeln.
Anfang August war schon die Morgenluft glühend warm. Mein Wickelkleid kitzelte meine Waden, und ich stieg die drei Stufen unseres Wohnhauses hinunter auf den Vorplatz.
Alle Mitbewohnenden schienen noch zu schlafen oder die Zeit des Liegenbleibens zu genießen, bevor im Oktober unser erstes Semester starten würde. Als Frühaufsteherin wollte ich die ruhigen Stunden nutzen, um in die Stadt zu fahren. Zu meinem Lieblingsort, zu dem einzigen Ort in dieser Stadt, an dem ich mir nicht falsch vorkam.
Ich drehte mich noch einmal zu unserem Wohnhaus um, damit ich mich versichern konnte, dass das hier real war. Dass ich tatsächlich ausgezogen war und nun mein eigenes Leben gestaltete. Und dass die Träume geplatzt waren. Ich nicht in Frankreich war, in einem Pariser Café frühstückte und auf den weitläufigen Universitätsgeländen von Vorlesung zu Vorlesung hastete. Nein, ich war noch hier.
Wir mieteten seit über zwei Wochen die obere Wohnung des Altbaus, unter uns wohnte unsere Vermieterin Frau Krehl. Sie war sicher über siebzig, immer freundlich und brachte uns in regelmäßigen Abständen Kuchen mit Schokostreuseln. Sie war grenzenlos dankbar, dass wir ihr altes Haus bewohnten und es mit Leben füllten. Das hatte sie uns bereits bei der Besichtigung wissen lassen. Irgendwann würde ich der Dame sagen, dass es hier magisch war. Und sie das schönste Haus im vierzehnten Bezirk hätte. Dass wir die glücklichsten Studierenden sein mussten. Wir bekamen die Wohnung für einen großzügigen Mietpreis, sollten dafür aber im Garten helfen und Frau Krehl hier und da im Haushalt unter die Arme greifen.
»Guten Morgen, Emmee«, vernahm ich eine Stimme hinter mir und drehte mich knirschend auf dem Kiesweg um. Und da stand sie, Frau Krehl. Graues Haar, Altersfalten, lächelnd, besonnen. Die Sonnenblumen in ihrem Rücken wie Lichtstrahlen um sie herum.
»Oh, guten Morgen!«
»Wie geht es euch, Liebes? Habt ihr euch gut eingelebt?«
»Sehr gut. Es ist wirklich schön.«
Ihr erkundigender Ausdruck wich Sanftheit.
»Und bei Ihnen?«, fragte ich hauptsächlich aus Höflichkeit, gleichzeitig interessierte es mich tatsächlich. Ich mochte fremde Geschichten. Menschen, die erzählten. Ich dachte gern über andere nach, denn dann musste ich nicht über mich selbst grübeln. Im Zuhören war ich gut, das konnte ich stundenlang, vielleicht weil mir das Erzählen schwerfiel.
»Hach ja«, seufzte sie und kam ein paar Schritte näher. Sie trug einen Weidenkorb um den Unterarm, als sie nah genug war, konnte ich die Beeren darin sehen.
»Man wird nicht jünger.« Ihr Schmunzeln hatte etwas Scherzhaftes. »Da fällt mir ein, ich könnte eine kleine Hilfe gebrauchen. Die Apfelbäume lassen ihre reifen Äpfel fallen, und mit meinem krummen Rücken kann ich sie kaum mehr aufsammeln. Vielleicht habt ihr ein Stündchen Zeit, mitzuhelfen?«
»Natürlich, wir übernehmen das«, bot ich sofort an. »Es finden sich bestimmt zwei, die Zeit haben.«
»Das ist lieb, Emmee.« Sie kam die letzten Schritte zu mir und tätschelte meinen Oberarm. Noch mehr Fältchen bildeten sich um ihre Augen. »Mach dir einen schönen Tag.«
»Das werde ich, Frau Krehl.«
Ich sah ihr nach, wie sie über die Kiessteine bis zur Wohnhaustür schlenderte und dann im Treppenhaus verschwand.
Womöglich würde sie nie erfahren, dass sie mich mit diesem Ort aus freiem Fall aufgefangen hatte. Das hier war ein Zuhause, und Frau Krehl bot uns dieses offen an. Vielleicht konnte es sich irgendwann wie mein Zuhause anfühlen.
Unsere Fahrräder standen hinter dem Haus, eines der Räder fehlte – Casimirs? Es schien, als wäre er viel unterwegs. Ich nahm mein Damenrad mit dem Weidenkorb am Lenkrad und schob es bis zum Vorplatz, dann stieg ich auf und fuhr in Richtung Bahnstation.
Der August schlich sich in mein Herz, nicht heimlich, aber geheimnisvoll. Er verriet sich nicht direkt. Mit seinen warmen Sommernachmittagen und den lauen Abenden, goldgelben Kornfeldern – endlos weit, an denen ich jetzt vorbeiradelte. Die schmale Straße war an diesem Morgen menschenleer. Wind pfiff mir durch die dunklen Haarsträhnen, und sie mussten hinter mir wie Fahnen flattern.
Ich fuhr durch die Siedlung bis zur nächstgelegenen S-Bahn-Haltestelle, schloss mein Fahrrad an und schaffte es gerade noch, in die Bim zu springen. Wien zog an mir vorbei. Die gedeckten Töne der Industrie vermischten sich mit dem grünen Erblühen des Sommers. Junge Menschen fuhren stadteinwärts, mutmaßlich zu Schulen, Ausbildungen, Arbeitsplätzen. Eine ältere Dame teilte sich mit mir die Sitzbank, ihre faltigen Hände lagen verschränkt in ihrem Schoß, den Blick hatte sie durch das Fenster gerichtet. Sie schmunzelte, seit ich neben ihr saß. Ich überlegte, ob sie schon lange in dieser Stadt war, vielleicht ihr ganzes Leben? Ob sie es immer noch liebte, hier zu sein? Ich fragte mich, was sie hier gehalten hatte oder ob sie einmal das Bedürfnis gehabt hatte, wegzugehen. War Wien ihr Traum gewesen? Würde ich später ebenfalls schmunzelnd in der Bahn sitzen?
Die Frau verabschiedete sich, und ich ließ meine endlosen Fragen mit ihr aussteigen. Fuhr bis zur nächsten Haltestelle. Ich stieg von der Bim auf den Gehweg und atmete durch. Hier kannte ich mich aus. Die letzten zwei Wochen war ich öfter hergekommen als früher. Ich hatte etwas gebraucht, was mich festhielt, an dieser Stadt hielt. Und dieser Ort schaffte das schon früher und heute mehr denn je.
Vor mir tat sich ein weitläufiger Garten auf, Apfelbäume, die reif wurden und erste Früchte mit dumpfen Geräuschen fallen ließen. Büsche, die mir ihre grüne Farbe entgegenwarfen und mich an Madita erinnerten, weil sie alles mochte, was grün war. Marmorfiguren standen am Wegrand, das Weiß leuchtete grell unter der Morgensonne, und ich blinzelte. Ein Stück weiter tat sich eine Villa vor mir auf. Die Kunstdimension Wien. Oder auch: die Villa der Künste. Verfallen, renoviert, alt und neu, ruhig und vielfältig. Einmal musste es ein Zuhause gewesen sein, inzwischen fungierte es als Museum. Für einige Sekunden holte ich tief Luft, um die überwältigenden Gefühle zu verinnerlichen. Bis ich sie mit dem nächsten Atemzug ausstieß. Die Villa, gekleidet in weißen Stein, mit der Treppe, die zu einer Veranda führte. Die Säulen schillerten blauviolett und kamen mir sonderbar surreal vor. Es war zehn Uhr, ich trat pünktlich zur Öffnungszeit mit einem Lächeln um das Gebäude herum, um auf der hinteren Gebäudeseite in das Architekturdenkmal zu kommen. Die Besuche hier gaben mir stets ein sicheres Gefühl. Meine Schritte klangen laut in der Eingangshalle, ein Echo meines Herzschlags. Die Frau am Empfang kannte mich bereits, sie lächelte mir munter entgegen, und ich bezahlte mein Ticket. Sie hieß Mona, was ich ihrem Namensschild entnommen hatte, vorgestellt hatten wir uns nie. »Verrätst du mir irgendwann, warum du immer wieder herkommst?«, fragte sie. Es war das erste Mal, dass sie es laut aussprach. Ich hatte das Interesse in ihrem Blick wahrgenommen, neben einem Glanz Schüchternheit. Heute war beides verschwunden, ihre Frage direkt und deutlich. »Ich studiere ab Oktober Kunstgeschichte. Hier ist es inspirierend und lässt mich … an meinem Vorhaben festhalten.«
»Kunst! Das hätte ich vermutet.« Sie schien erfreut darüber.
»Jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Also werde ich so lange kommen, bis das nicht mehr der Fall ist.« Meine Stimme klang zu laut in dem Raum, der nichts verschlucken wollte. »Hört sich gut an. Das mag ich.« Mona lächelte verschmitzt, sie war Mitte zwanzig, mit Grübchen und immer einer Schleife in den blonden Haaren. Ihre Fingernägel hatten oft eine neue Lackfarbe, ihre Kleidung sah aus wie eine Malerei von Paul Klee. Bunte Kastenmuster, die nicht einengend, sondern beruhigend mild wirkten. Als ich Mona hier zum ersten Mal begegnet war, hatte sie mir einiges über das Museum erzählt. Während wir durch die Innenräume der Villa geschlendert waren, die einmal einem Architekten und seinen kunstschaffenden Töchtern gehört hatte. Heute wurde das Museum von einer Stiftung der jüngsten Tochter verwaltet.
»Habt ihr schon eine Idee für neue Finanzierungsmaßnahmen?«, traute ich mich zu fragen, denn seit ich von Mona wusste, was hinter den Kulissen des Museums im Raum stand, umgab mich dieses mulmige Gefühl. Sie verzog bedrückt das Gesicht. »Leider nein«, seufzte sie. »Wir wissen noch nicht, wie oder woher wir die Spendengelder einbeziehen können. Gerade wird im Team umhergefragt, ob es eine oder mehrere Privatpersonen gibt, die eine konstante spendenbasierte Unterstützung anmelden. Aber der letzte potenzielle Kunde ist abgesprungen … wir brauchen wirklich eine Lösung.«
»Ich wünschte, ich könnte behilflich sein«, gestand ich ehrlich. Mona winkte sofort ab und schüttelte energisch den Kopf.
»Mach dir nicht zu viele Gedanken. Alles wird sich fügen. Genieß deinen Besuch, ja?«
»Okay. Aber falls ich doch aktiv werden kann, sag gern Bescheid.«
Sie nickte, und ich wollte mich abwenden, da rief hinter mir jemand erfreut: »Hey, Mona. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe!«
Der Mann trat an mir vorbei, und Mona schlug die Hände vor ihrem offenen Mund zusammen.
»Meinen Autoschlüssel! Danke! Ich habe wirklich überall gesucht.«
»Er lag draußen in der Wiese.« Sie nahm den Schlüsselbund entgegen, den der junge Mann an seinem Zeigefinger hin und her baumelte. Noch bevor er sich wieder umdrehte, erkannte ich ihn. Ordnete seine Stimme zu. Hier hatte ich ihn nicht erwartet und ehrlicherweise sonst auch nirgendwo. Was unklug war, denn wir wohnten zusammen. Es war natürlich nicht ausgeschlossen, ihm da und dort über den Weg zu laufen. Das wurde mir überdeutlich klar. In Einkaufsläden könnte er hinter mir an einem Kassenband stehen. Oder an einer Ampel, die gerade auf Rot für Fußgänger umschlug, oder in der Bahn. Oder wir begegneten uns zu Hause. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, warum mich dieser Gedanke nervös machte.
Casimir Linden drehte sich erneut um die eigene Achse und stand mir jetzt direkt gegenüber. Er konnte seine Überraschung nicht verbergen, versuchte es nicht einmal.
Er sah aus wie sein Bruder Xavier. Und dann doch ganz anders. Die dunklen Locken, die hellen Iriden, es war die Farbe von trübem Wasser, nur waren seine Blicke ungeachtet dessen stechend klar. Ich schluckte und hob die Hand.
»Hi, Casimir …«, setzte ich an.
»Hi, Emmee.«
»Hi.«
»Hi.«
Es war unangenehm, doch das wurde mir erst danach bewusst. Und ihm auch – diesmal versuchte er, es zu verstecken. Ich sah es seinem Schlucken an und der leichten Rötung seiner Wangen. In meiner Vorstellung hatte es besser geklungen. Diese Hi-Schleife von uns. Ich fixierte Mona hinter ihm, sie sah uns abwartend an, und ihre Augenbrauen waren leicht erhoben.
»Ihr kennt euch?«, erkundigte sie sich und spähte um Casimir herum zu mir.
»Ja. Wir wohnen irgendwie zusammen.«
»Irgendwie?«, wollte Mona sofort von ihm wissen.
»Ziemlich sicher wohnen wir zusammen«, stellte Casimir klar. »Erst seit kurzem. Es ist noch ungewohnt. Irgendwie eben.«
»Cool«, meinte Mona. »Casimir kann dich bestimmt herumführen, vielleicht weiß er etwas, das ich dir nicht erzählt habe.«
Mona sammelte einige Zettel zusammen und verließ mit einem Zwinkern in meine Richtung den Empfangstresen.
»Ich dachte, im Haus schlafen noch alle«, bemerkte Casimir aus dem Nichts, vielleicht war er auch ein Mensch, der gern Lücken schloss. Ich sah ihn wieder an. Er war ein kleines Stück größer als ich, also konnten sich unsere Blicke nicht auf einer Ebene begegnen.
»Dachte ich auch.« Dann versuchte ich, zu lächeln, um die Spannung aufzulösen. »Ich habe bemerkt, dass ein Fahrrad fehlt. Das war wohl deins?«
Er nickte, und ich fragte schnell weiter: »Du arbeitest hier?«
Wieder ein Nicken. »Ja, ich arbeite unten im Museumscafé, und sonst unterstütze ich im Garten oder bei Vorstellungen.«
»Oh«, machte ich nur. Weil oh. Er arbeitete hier. Casimir arbeitete an meinem sicheren Lieblingsort, und das gab mir einen unbekannten Dämpfer. Ich wusste nicht, ob ich den Gedanken daran mochte, ihn hier im Garten anzutreffen.
»Jeden Tag?«
»Nein. Montags, mittwochs, freitags und wechselnd an den Wochenenden. Und wenn ich spontan gebraucht werde.«
Das war oft.
»Und du?«, wollte er wissen. Er versteckte seine Hände in den Taschen seiner braunen Cordhose, wippte auf seinen Schuhen herum. Das Gespräch war unbeholfen fremd, und trotzdem waren wir beide ehrlich neugierig. Auf was auch immer.
»Ich bin Besucherin.«
»Du interessierst dich für Museen und Kunst?«
»Ja. Warum?«
»Nur so.«
Ein Lächeln zupfte an seinen Lippen, ein gebogenes. Eines, das mir die Spannung nahm, eines, das ich selbst hatte lächeln wollen und es doch nicht geschafft hatte.
»Das Café hat erst später Besuchende, ich kann dich also wirklich ein wenig herumführen, wenn du magst«, bot Casimir an und löste unsere Gegenüber-Position auf, indem er weiter in den Raum trat. Ich drehte mich und sah ihm nach.
»Ich arbeite noch nicht lange hier, kenne mich aber schon gut aus, der Garten ist toll.«
Ich kenne mich auch schon ziemlich gut aus … Bevor ich das aussprechen konnte, rollten ganz andere Worte über meine Zunge und verließen meinen Mund. Sie waren superseltsam.
»Können wir dabei schweigen?«
Sein Gesichtsausdruck war überrascht und verwirrt zugleich.
»Na ja … Wir … Es ist so …« Ich zog eine Grimasse. »Wenn du mich herumführst, können wir eventuell nicht reden?«
Das Lächeln kroch zurück auf seine Lippen, als wäre es dort daheim. Ja, wirklich.
Wenn Xavier ein Ästhetik-Mensch war, dann war sein Bruder ein Atmosphären-Mensch für mich. Casimir lächelte warm, er sah mich stechend an, er löste Spannungen und wippte auf Sohlen, damit die Stimmung nicht stillstehen konnte. Er versteckte seine Gesichtsausdrücke nicht. Als wäre die Welt ein Rahmen und er das Bild darin, das du ansehen und verschiedene Emotionen wahrnehmen konntest. Er hatte etwas Attraktiv-Abstraktes, auch ihm würde ich das niemals verraten.
»Noch da?«, riss er mich aus meinen Gedanken. Als wäre ich ganz woanders gewesen, und er hatte es gemerkt.
»Ja«, versicherte ich.
»Also. Die stille Führung beginnt. Hier entlang.«
Danach sprach er tatsächlich nicht mehr. Er hinterfragte meine Bitte nicht. Er wartete, bis ich zu ihm aufschloss, dann schlenderten wir nebeneinander durch die Räume der Villa bis hinaus in den umfangreichen Garten. Dessen Winkel ich bereits auswendig kannte. Durch den ich mich trotzdem führen ließ, als wäre es zum ersten Mal. Meine Wangen kribbelten unter der sonnendurchfluteten Luft, als würden sich meine Sommersprossen über die Vormittagssonne freuen. Zinnien reckten ihre Blüten der Helligkeit entgegen, sie leuchteten rosa und rot. Ich blieb bei einem Marmorsockel stehen, aus dem Blumen herauswuchsen, und strich behutsam mit den Fingern über die bunten Kelche. Erst als Casimir sich neben mich stellte, wurde mir seine Anwesenheit erneut sehr deutlich bewusst. Das Schweigen hatte mich ihn und diese Rundführung beinahe vergessen lassen.
Wir standen mitten auf dem Gartenweg, rechts und links Grünfläche, die Welt schien still an diesem Vormittag.
Ich sah Casimir beiläufig von der Seite an, und die Beiläufigkeit wich Neugierde. Es hielt an, die Blicksekunde, die es werden sollte, dehnte sich aus, und jetzt sah ich ihn schon ganze fünf Sekunden an. Er musste mein Starren spüren, denn er drehte um Zentimeter den Kopf und erwiderte es. Ein fragender Ausdruck schlich sich in seine Züge, dabei lächelte er verschmitzt, als wäre er amüsiert. Meine Wangen wurden warm.
Wir sahen uns noch immer an. Ja, und es fiel mir leicht, ihn anzusehen. Ich wollte nicht blinzeln oder weglaufen wie sonst bei fremden Menschen. Das trübe Grün seiner Augen wirkte beruhigend, ein Waldsee in den Iriden, der das Grün der Bäume spiegelte, dachte ich.
Sein Gesichtsausdruck blieb weiterhin amüsiert fragend. Casimir hatte harte Kanten, da waren diese scharfe Kieferpartie und die markanten Augenbrauen. Aber wenn er lachte, dann verrutschten die Kanten, dann wurden sie weicher, dann kam er mir zugänglicher vor. Und dabei wusste ich wenig über ihn. Weniger als über Frieda. Oder Xavier, über den wusste ich immerhin, dass er Bücher las und Pizza Hawaii mochte. Über Casimir wusste ich kaum etwas. Nur sein Alter, zwei Jahre älter als ich, also zweiundzwanzig. Außerdem, dass er selten in der Wohnung war. Ich kannte seine meistgetragenen Schuhe, sie standen neben meinen Sandaletten im Flur. Es waren Wanderschuhe, dreckig und durchgelaufen, und Madita jammerte über die Erdbrocken auf dem Boden deswegen. Ich kannte Casimirs Schuhe also besser als ihn selbst. Und ich sah ihn noch immer an. Er öffnete den Mund, er holte Luft, ich konnte die Frage in ihm erahnen, dann schloss er seinen Mund und zog weiter. Mit festen Schritten, es waren deutliche Bewegungen, die er tat, und sie passten zum Rest seines äußeren Bildes. Aber innerlich? Ob er sich auch Gedanken zu mir gemacht hatte? Führte er mich nur aus Höflichkeit herum, weil Mona es vorgeschlagen hatte? Sollte ich meine eigene Regel aussetzen und aus dem Schweigen ausbrechen? Ich sprach in diesem Garten immer so wenig wie möglich, weil ich sichere Orte nicht mit Worten beklecksen wollte. Ich wollte hier nur fühlen und nichts davon nach außen hin erklären. Es könnte leicht missverstanden werden und dann wäre die Echtheit, die es für mich hier gab, verschwunden.
Als ich weitergehen wollte, hatte Casimir sich in der Zwischenzeit auf eine Bank am Wegrand niedergelassen. Entspannt saß er auf dem Holz und hielt sein sonnengebräuntes Gesicht dem Himmel entgegen, die Augen geschlossen. Er saß nur da, schwieg, war fremd. Ich war da, und ich war mir selbst fremd. Also warum fühlte sich dieser Moment mit ihm trotz allem angenehm an?
Die Fragen nahmen kein Ende mehr.
Aus einem Instinkt heraus setzte ich mich neben ihn, mit vorsichtigen Bewegungen, um ihn nicht zu erschrecken. Das Holz der Bank wärmte meine Unterschenkel durch den dünnen Stoff meines Wickelkleides, ich ließ die Beine baumeln. Casimir atmete nicht so entspannt, wie seine Haltung ausgesehen hatte. Es waren kurze Atemzüge, als gäbe es nicht genug Raum, dabei war doch alles weitläufig hier draußen. Ich fragte mich noch immer, was er dachte. Ich wollte ihm das sagen – und so viel mehr. Dass er beruhigend auf mich wirkte. Dass ich seine Wanderschuhe voller Erde mochte. Dass ich ihm dankbar war fürs Schweigen. Und es trotzdem brechen wollte.
Aber ich traute mich nicht.
Ich war schlicht überfordert, um ihm all diese Fragen zu stellen oder ihm direkte Wahrheiten ins Gesicht zu sagen. Dafür kannten wir einander zu wenig.
Was ich an diesem Vormittag ganz sicher über ihn erfuhr, er hielt, was er versprach. Denn er schwieg die ganze Zeit. Einmal summte er, während wir durch den Garten spazierten, er wies mal hier- und mal dorthin, um auf Besonderheiten in der Architektur aufmerksam zu machen. Seine Lippen blieben dabei geschlossen.
Und dann war ich diejenige, die unsere Stille brach. Wir kamen gerade zu den Stufen vorn an der Villa, die zur Veranda und zum Vordereingang hinaufführten. Der Rundgang wäre gleich beendet. Aber die Fragen in mir waren es nicht. Ich fühlte zu viel und musste es loswerden … ich wollte. Trotz meiner Befangenheit, die ich oft als Ausrede nutzte. Die ich vorschob, um neuen Situationen auszuweichen. Trotztrotztrotzdem.
»Casimir?«
Er blieb abrupt stehen.
Er drehte sich zu mir um.
Er wartete.
Er versteckte seinen Ausdruck nicht.
»Also ich … ich mag die Erde an deinen Wanderschuhen, sie ist ein bisschen cool«, stolperten die Worte über meine Zunge und waren nicht aufzuhalten. Casimir blinzelte. Fuhr sich mit der Hand durch seine Locken, fahrig, es mussten unüberlegte Bewegungen sein. Nicht mehr fest wie seine Schritte. Dann räusperte er sich, und das löste ein Echogefühl in mir aus. Zu laut. Zu dröhnend. Zu hallend. Hatte ich tatsächlich seine Wanderschuhe und cool in einem Satz erwähnt? Das war gar nicht …
Da bemerkte ich sein Grinsen. Es war anders als der vorherige, amüsierte Anschein. Es war voller. Und es war, als wollte er es zurückhalten, dadurch wurde es immer stärker. Er senkte den Blick und schlenderte rückwärts, bis seine Fersen an die erste Stufe stießen. Seine Reaktion verwirrte mich. Schob in mir noch mehr umher, so viel, dass ich nichts begreifen konnte.
»Emmee?«, entgegnete er. Und er sprach meinen Namen verflucht französisch aus.
»Ja?«, brachte ich hervor.
Sein Lächeln ebbte nicht mehr ab, es flutete sein Gesicht. Und Casimir Linden versicherte im August, frei heraus, es schien ihm leicht über die Lippen zu kommen: »Ich mag die gelben Blumen, die du letzte Woche auf deine Tontassen gemalt hast. Sie sind ein bisschen cool.«
Er winkte, drehte sich um, jagte die Treppen nach oben und verschwand im Museum. Meine Wangen flammten, und mein Kopf war voller gelb angemalter Tontassen – den restlichen Tag über. Wahrscheinlich sogar unbeugsam wie die Sonnenblumen.
Die erste E-Mail kam auf dem Heimweg. Ich wartete an der Haltestelle, von der ich auch später genau wusste, welche es gewesen war. Ich hielt meine Handykamera auf die Stadt gerichtet, um Momente einzufangen, damit mein Leben nicht in Vergessenheit geraten würde. Der Lärmpegel war Wiens Hintergrundmusik. Ich sah mir die Fotos an, da kam die Nachricht.
Es sollte die erste Mail von mehreren sein.
Ich hielt es für Spam. Ich wollte dem Ganzen keine Beachtung schenken. Vielleicht war es wieder eine Absage aus Frankreich. Womöglich hatte auch die allerletzte Universität eine Tut-uns-leid-aber-diesmal-nicht-Nachricht für mich. Ein Stich fuhr mir durch die Brust. Mailnachrichten hatten den ganzen Frühsommer über nichts Gutes verheißen. Sie zerbrachen mich nur weiter.
Weiter. Immer weiter.
Und trotzdem würde ich jetzt die Mail lesen, konnte diese Ungewissheit kaum aushalten und würde ein letztes Mal feststellen müssen, dass keine einzige Bewerbung Erfolg gehabt hatte.
Aber diesmal war es anders. Und ich war nicht vorbereitet. Der Absender war mir fremd, ich hatte ihn noch nie gelesen. Sicher war, das kam von keiner Universität. Rémi Martin stand da. Womöglich Spam. Dann las ich die Zeilen, und mir wurde bang. Ich sah mich paranoid auf der Verkehrsinsel um, die Bim fuhr heran. Kälte durchströmte mich im Sommer. Ich kam mir beobachtet vor, aber die Personen in meiner Umgebung verfolgten nur das eigene Ziel und Leben. Die Menschen klebten an ihren Handys, einer las ein Buch, oder sie schliefen, schräg in den Bahnsitzen hängend. Ein Mädchen riss die Augen auf, als ich einstieg. Sie sprang auf und hastete in letzter Sekunde aus den Türen hinaus auf die Straße. Gehetzt sah sie sich um. Vielleicht hatte sie heute auch eine Mail bekommen, und ihr war kalt im August.
Ich las.
Verstand nichts.
Und gleichzeitig alles.
Hey E,
es gibt ein Zitat von Frida Kahlo, in dem sie darüber nachdenkt, dass sie der seltsamste Mensch auf der Welt sein muss. Aber dann stellt sie sich all die Menschen vor und erkennt, dass es auf der Welt eine Person geben muss, die sich genauso bizarr fühlt. Und ich kann nicht aufhören, ebenfalls darüber nachzudenken. Mich zu fragen, ob und wo du da draußen bist, und vielleicht hast du ja ähnliche Eingebungen. Schon möglich, dass dein Kopf ein Ozean voll umherschwappender Gedanken ist und niemand wirklich versteht, wie sich das anfühlt.
Aber ich will dir sagen: Da ist jemand wie du, ich verstehe es. Ich hoffe, du liest das und verstehst genauso.
Ich hoffe, du weißt es einfach.
PS: Vielleicht ist das hier ein sonderbar schönes Phänomen?





























