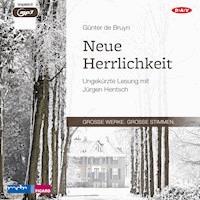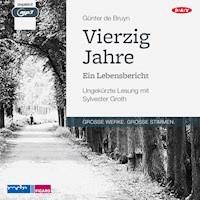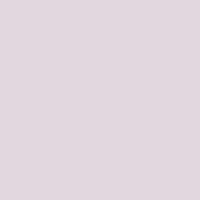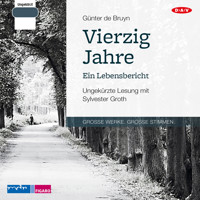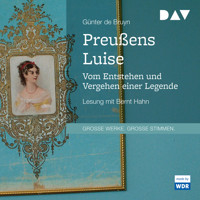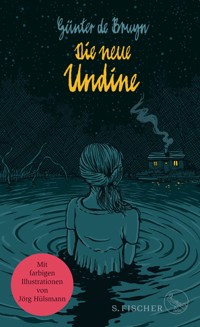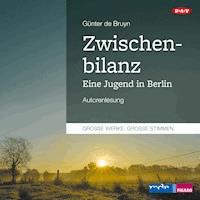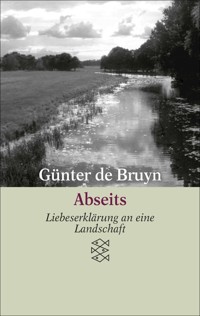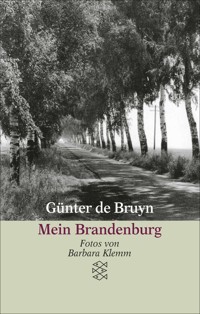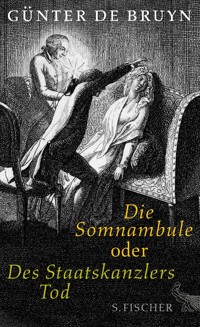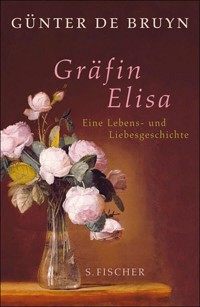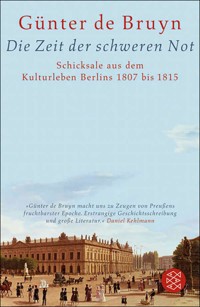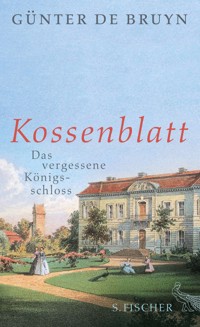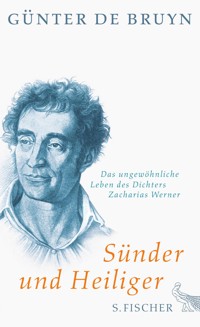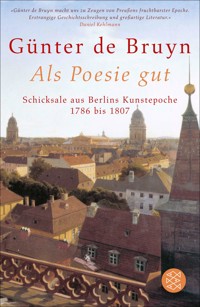
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Um 1800 erlebte die »Haupt- und Residenzstadt Berlin« eine ungewöhnliche kulturelle Blüte. Günter de Bruyns großangelegter Essay zu dieser klassischen Zeit Berlins bietet eine imponierend detailgenaue Geistesgeschichte in Porträts und Bildern und verzaubert durch seine Erzählkraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Günter de Bruyn
Als Poesie gut
Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786 bis 1807
Über dieses Buch
Berlin in den Jahren um 1800. Während anderswo in Europa Kriege toben, erlebt die Haupt- und Residenzstadt des neutralen Preußen eine erstaunliche kulturelle Blüte. In ständiger Korrespondenz mit Weimar wird die werdende Großstadt durch Frauen und Männer verschiedener Gesellschaftsschichten zu einem künstlerischen und geistigen Zentrum, in dem sich der Umbruch zum bürgerlichen Zeitalter vollzieht. De Bruyns großangelegter Essay macht diese Jahrzehnte zwischen dem Tod Friedrichs des Großen und der Katastrophe von Jena durch die Lebensgeschichten ihrer Akteure lebendig. Zwischen Schloß und Charité, Münzstraße und Köllnischem Fischmarkt erlebt der Leser die Schicksale der Schadow und Schinkel, der Tieck, Clausewitz, Kleist und Zelter. Er blickt in die Salons der Henriette Herz und der Rahel Levin und wird mit den Liebes- und Kriegsabenteuern des Prinzen Louis Ferdinand vertraut.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Eduard Gärtner, »Ein Panorama von Berlin, von der Werderschen Kirche aus gesehen, 1835«. Eigentum des Hauses Hohenzollern SKH Georg Friedrich Prinz von Preußen
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401283-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Ende und Anfang
Krieg und Frieden
Vom Lehrjungen zum Meister
Das Tor
Die Prinzessinnen
Ein Soldat, was sonst
Ein Monument der Tyrannei
Zither und Schwert
Sokrates im Havelland
Der Singemeister
Die Dachstube
Vertraute Briefe
Waldeinsamkeit
Erfahrungsseelenkunde
Die Kinder der Aufklärung
Seelenfreundschaft
Thronwechsel
Lehrer und Schüler
Der Lakai der Königin
Die Maske
Bildungsreise
Königlicher Landaufenthalt
Garnisonsleben
Goethe-Verehrung
Einfalt und Natur
Von Teetisch zu Teetisch
Von Liebe und Tod
Das Selbstbildnis
Coffée und Tobak
Minnelieder
Das Andenken der Väter
Ein Gast aus Frankreich
Schiller in Berlin
Sophie und ihre Söhne
Die Sanders
Die Luisenburg
Der Freimütige
Bittsteller Kleist
Sommerliche Schlittenfahrt
Vom Kriege
Der Kriegsgott am Klavier
Professorennöte
Franzosen-Billigkeit
In den Sümpfen der Ucker
Auf hoher See
In der Festung
Kriegsregeln
Zensur mit tödlichem Ausgang
Ende und Anfang
Zitatennachweis
Abbildungsnachweis
Bibliographie
Zeittafel
Namenregister
Ende und Anfang
Die Frauen und Männer, die die preußische Hauptstadt in den kommenden Jahrzehnten zu einem Zentrum der Kunst und Kultur machen sollten, waren in der Mehrzahl noch Kinder, als am 17. August 1786, morgens zwei Uhr und zwanzig Minuten, König Friedrich II., auch genannt der Große oder der Einzige, in Sanssouci starb. Schon wenige Stunden später, um acht Uhr morgens, versammelten sich die in Potsdam stationierten Regimenter, um sich auf den neuen König vereidigen zu lassen. Friedrichs Leichnam wurde auf einem achtspännigen Wagen zum Potsdamer Stadtschloß gefahren, wo er im gelben Audienzsaal einen Tag aufgebahrt blieb.
Die Menge, die den Leichenzug schweigend begleitet und dann dem ankommenden Thronfolger zugejubelt hatte, nahm wieder Trauermiene an, als sie das Stadtschloß betrat. Da die Anordnung des Sterbenden, ihn nicht umzukleiden, sondern nur mit einem Soldatenmantel zu bedecken, nicht befolgt worden war, sahen die Untertanen den Leichnam des Mannes, der sie (nach Rechnung der »Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen«) 46 Jahre, 2 Monate und 17 Tage regiert hatte, in den blauen Rock mit roten Aufschlägen und gelber Weste gekleidet, in die Paradeuniform des 1. Gardebataillons, dessen Chef er gewesen war. Sein Körper, dem man durch Punktion das Wasser entzogen hatte, glich dem eines Kindes. Sein spärliches Haar hatte man gepudert. Krückstock, Schärpe und Degen lagen neben ihm.
Zu den Trauernden, die an dem Toten vorbeidefilierten, gehörte auch ein Patenkind des Königs, der zehnjährige Friedrich de la Motte Fouqué, der sich noch fünfzig Jahre später in seiner »Lebensgeschichte« an Einzelheiten dieses Ereignisses erinnern konnte: an die halbhohen Brüstungen, zwischen denen die Trauernden sich bewegen mußten, an die Regelung, daß diejenigen Familien, die, wie die Fouqués, als dem König nahestehend galten, näher an den Toten herantreten und länger verweilen durften, an die zusammengepreßten Lippen des Toten, an die wie vergrößert wirkende Nase und auch an den Kammerhusaren, der, zu Häupten der Leiche stehend, mit einem Wedel aus Pfauenfedern die Fliegen vertrieb.
Noch am selben Abend erfolgte die Beisetzung, jedoch nicht, wie der König gewünscht hatte, in seinem Sanssouci, auf der Terrasse, wo auch seine Hunde begraben lagen, sondern in der Garnisonkirche, in der Gruft unter der Kanzel, wo der Sarg seines Vaters schon stand. Bis der jetzt noch unbekannte siebzehnjährige Artillerieleutnant Napoleon Bonaparte den Triumph auskosten wird, hier an Friedrichs Sarg als Sieger stehen zu können, werden noch zwanzig Jahre vergehen.
Da die Trauerfeier für den Verstorbenen erst am 9. September stattfand, hatten Dichter und Pfarrer genügend Zeit, um Trauer-Oden und Trauer-Predigten zu verfassen und, wie damals üblich, in Kleinschriften drucken zu lassen. Die Karschin, die schon die Siege Friedrichs bedichtet hatte, verglich ihn nun mit der lebenspendenden Sonne. Ihr Freund Gleim in Halberstadt nannte ihn den »Ewiglebenden«. Schubart, vom Hohenasperg her, versprach ihm auch im Himmel die Herrscherkrone. Für Trenck, der Grund gehabt hätte, Friedrich zu hassen, hatte er den »höchsten Gipfel möglichster menschlicher Größe« erklommen. Ein Pfarrer verstieg sich dazu, das Leben des Königs mit dem des Jesus von Nazareth zu vergleichen. Und alle schlossen am Ende den neuen König mit Worten, die Hoffnung auf bessere Zeiten verhießen, in ihre Lobpreisung mit ein.
Der Oberst von Massenbach dagegen, der später mit seinen Schriften noch oft Anstoß erregen sollte, machte sich über die Zukunft des preußischen Staates Sorgen: »Mein Gemüt ward tief erschüttert. Diese auf der Kraft eines einzigen Mannes ruhende, mit diesem Manne in das Grab sinkende Macht! Welch bange Ahnungen füllten meine Brust! Tränen der tiefsten Wehmut netzten meine Wangen. Zwar versprach der heitere Himmel einen schönen Tag; aber kaum war der Sarkophag in das Mausoleum getragen, als Wolken den Tag trübten; die Natur hüllte sich in Flor. Sie trauerte, weil sie ihrem edlen Werke die Unsterblichkeit nicht erteilt hatte.«
Tod Friedrichs des Großen. Kupferstich nach einem Gemälde des Potsdamer Malers Friedrich Bock
In einer Sammlung von Flugschriften aus dem Todesjahr Friedrichs findet sich auch ein zeitgenössischer handschriftlicher Beitrag, vielleicht eine Abschrift, möglicherweise aber auch das Manuskript eines Textes, der seiner kritischen Haltung wegen vom Verleger abgelehnt worden war. Ein anonym bleibender »Brenne« (gemeint ist: ein Brandenburger), »ein Greis, durch Mühseligkeit gehärtet«, trägt darin Friedrich Wilhelm II. anläßlich seiner Thronbesteigung die »Stimme des Volkes« vor. Ehrerbietig die Formen wahrend, zählt er alles auf, was in Preußen im argen liegt: die Mätressen- und Günstlingswirtschaft des neuen Königs, die der verstorbene Friedrich nicht kannte, die Arroganz der Offiziere den Zivilisten gegenüber, die grausame Behandlung der Soldaten, die Ungerechtigkeit der Gerichte, diese »Spinngewebe, die große Insekten durchlassen und nur die kleinen und ohnmächtigen fangen«, die mangelnde Toleranz der Geistlichkeit, die geringe Besoldung der Lehrer, die Armut der Bauern und als schlimmstes Übel den Krieg: »Seien Sie friedfertig! Suchen Sie nie den Krieg! … Opfern Sie nicht das Leben von Hunderttausenden auf! Gott hat sie Ihnen alle zugezählt, Ihre Untertanen. Einst wird er sie alle von Ihnen fordern.«
Stimmen wie diese mehrten sich mit den Jahren und wurden nach Ausbruch der Französischen Revolution unüberhörbar. Doch obwohl alle Einsichtigen wußten, daß der Staat reformiert werden mußte, änderte sich in den nächsten zwei Jahrzehnten, die sogar noch eine Vergrößerung Preußens brachten, nur wenig. Zwar war die Einführung des noch von Friedrich angeregten Allgemeinen Preußischen Landrechts (1794) für die Entwicklung des Rechtsstaates von großer Bedeutung, aber die Soldaten wurden noch immer geprügelt, die Bauern blieben, von Ausnahmen abgesehen, an ihre Gutsherren gebunden, die Toleranz wurde nicht beschützt, sondern beschnitten, und Kriege geführt wurden auch.
Als sich 1792 neben der österreichischen auch die preußische Armee, mit Goethe als Schlachtenbummler, über den Rhein nach Frankreich in Marsch setzte, um die Monarchie vor der Revolution zu schützen, marschierten in ihren Reihen einige der jungen Männer, die das geistige und politische Leben der nächsten Jahrzehnte beeinflussen sollten, wie Carl von Clausewitz aus Burg bei Magdeburg, dreizehnjährig, Friedrich de la Motte Fouqué aus Brandenburg an der Havel, fünfzehnjährig, und der ebenfalls minderjährige, aus Frankfurt an der Oder gebürtige Heinrich von Kleist.
Zu den Teilnehmern des Feldzuges gehörte aber auch der Kronprinz, der fünf Jahre später den Thron besteigen und als Friedrich Wilhelm III. Preußen in den Jahren seines kulturellen Glanzes regieren sollte, ohne begreifen zu können, was da geschah. Als er im Jahre 1811 eine militärische Denkschrift ablehnte und ihm dazu die ironisch gemeinten Worte: »Als Poesie gut!« einfielen, weil er Poesie mit Gefühlsüberschwang und Phantastik gleichsetzte, machte er damit deutlich, daß er vom Geist seiner Zeit, der auch das kommende Jahrhundert bestimmen sollte, kaum berührt worden war. Er war im Berlin der Aufklärung geboren und in deren Sinne erzogen worden, hatte geglaubt, noch wie sein Großonkel Friedrich der Große ohne Rücksicht auf kulturelle Veränderungen und die Stimmungen seiner Untertanen regieren zu können, und hatte deshalb auch nicht begriffen, daß nach der Revolution in Frankreich und dem kulturellen Bewußtwerden des Nationalen in Deutschland das Poetische, das in seinem Verständnis mit Politik nichts zu tun hatte, durchaus ernst zu nehmen war. Bedenkt man, daß er mit der schönen und sensiblen, vielbedichteten und vom Volk geliebten Luise, mit der er sich in den Feldzugstagen am Rhein verlobt hatte, einen Beweis für die Macht des Poetischen an der Seite hatte, scheint seine Ignoranz unbegreiflich. Sicher hat er auch nicht verstanden, was ihm der Oberst von Gneisenau, von dem die militärische Denkschrift stammte, auf deren Ablehnung zu antworten hatte: Daß nämlich allen patriotischen, religiösen und sittlichen Gefühlen Poesie zugrunde läge und somit auch »die Sicherheit der Throne« auf Poesie gegründet sei.
Wachsausguß der von Johann Eckstein abgenommenen Totenmaske Friedrichs des Großen
Krieg und Frieden
Drei Jahre nach dem Tod Friedrichs des Großen begann in Frankreich die Revolution, die mit ihren Folgeerscheinungen Europa fünfundzwanzig Jahre lang in Kriege verwickelte und einen geistigen, wirtschaftlichen, politischen und militärischen Umwälzungsprozeß in Gang setzte, dem kein Staat sich entziehen konnte, auch Preußen nicht.
Friedrichs Staat war zeitweilig der modernste Europas gewesen, doch hatte er sich schon in den letzten Lebensjahren des Königs in Teilen als veränderungsbedürftig erwiesen, und Einsichtige hatten das auch erkannt. Starrsinnig hatte der alte König am absolutistischen Regierungssystem, an der strengen Ständeordnung und dem merkantilistischen Wirtschaftssystem mit seinen staatlichen Monopolen festgehalten, und die klassizistische französische Bildung, die ihn in der Jugend kulturell geprägt hatte, blieb bis an sein Lebensende Maßstab für ihn. Die deutsche Literatur und Kunst dagegen, die sich seit der Jahrhundertmitte kräftig entwickelt hatte, war ihm so fremd geblieben wie das damit zusammenhängende Nationalbewußtsein der gebildeten jüngeren Generation. Blamiert hatte sich Friedrich sechs Jahre vor seinem Tode mit einer Schmähung der deutschen Literatur, die er kaum kannte. Auf seine 1780 in französischer Sprache veröffentlichte Schrift mit dem anmaßenden Titel »Über die deutsche Literatur, die Mängel, die man ihr vorwerfen kann, die Ursachen derselben und die Mittel, sie zu verbessern« reagierten die deutschen Autoren selbstbewußt, teils auch polemisch. Mit Recht galt Friedrich hier als inkompetent.
Bei aller Verehrung, die man Friedrich auch im Alter entgegengebracht hatte, war bei seinem Tod aber nicht nur Trauer, sondern auch Erleichterung zu spüren, weil man sich von seinem Nachfolger, Friedrich Wilhelm II., mancherlei Änderungen versprach. Doch fehlte dem wohlbeleibten Mann, der alle Welt um einen Kopf überragte, zur Durchsetzung wirklicher Reformen die nötige Charakterstärke. Er war sehr liebebedürftig und deshalb leicht zu beeinflussen, hielt sich Mätressen, zeugte uneheliche Kinder, verbrauchte in sinnlosen Feldzügen den Staatsschatz, den Friedrich angehäuft hatte, und erwies sich teilweise als ein Gegner der Aufklärung, der christliche Frömmigkeit in eigenartiger Weise mit Okkultismus verband. Er war Miträuber bei den Teilungen Polens, durch die Preußen sich kurzzeitig bis nach Warschau erstreckte. Er war aber auch ein Freund und Förderer der Künste, dem Potsdam das Marmorpalais und Berlin das Brandenburger Tor verdankte, und er schloß 1795 den Frieden von Basel, der Norddeutschland ein Friedensjahrzehnt bescherte, das man berechtigterweise auch das große Jahrzehnt der deutschen Literatur genannt hat.
Glanzzeiten Preußens kann man die elf Regierungsjahre Friedrich Wilhelms II. weder in außen- noch in innenpolitischer Hinsicht nennen, aber für die Kultur begann in diesen Jahren eine Periode, in der Preußen für Deutschland bedeutsam wurde und Berlin sich zu einem geistigen Zentrum entwickelte, das dem in Weimar gleichwertig und ihm vielfach verbunden war.
Die Koalitions-, Interventions- oder Revolutionskriege, die in Preußen meist Rheinfeldzüge hießen und von Goethe »Kampagne in Frankreich« genannt wurden, zogen sich mit Unterbrechungen von 1792 bis 1794 hin. Eine Koalition von Österreichern, Preußen und kleineren Reichsfürsten kämpfte hier, unterstützt von französischen Emigranten und gefördert durch englische Hilfsgelder, gegen die Armee des revolutionären Frankreich. Doch wurde der Krieg, da die Verbündeten sich gegenseitig mißtrauten und Preußen auch Truppen in Polen brauchte, nur halbherzig geführt.
Kein Krieg war in Preußen so unpopulär wie dieser, und zwar nicht nur bei der Bevölkerung und den Soldaten, die besonders unter ihm litten, sondern auch bei Ministern und Generälen, die fast alle noch aus der friderizianischen Schule kamen, in Österreich, dem sie nun Hilfsdienste leisten mußten, noch immer den Hauptgegner sahen und richtig erkannten, daß selbst im Falle eines Sieges für Preußen aus diesem Krieg kein Vorteil zu ziehen war. Hinzu kamen die traditionellen Sympathien für Frankreich, die trotz der Revolution noch vorhanden oder durch diese verstärkt worden waren. Goethe berichtet in seiner »Kampagne«, unter dem 26. Mai 1793, von preußischen Offizieren, die abends beim Marketender Champagner trinken und sich von den Hoboisten »Ça ira« und die Marseillaise vorspielen lassen, und Fouqué, der im Kürassierregiment »Herzog von Weimar« diente, in dem als Chef Goethes Mäzen Carl August fungierte, erzählt von einer kurz nach dem Krieg in einem westfälischen Gasthaus spielenden Szene, in der Offiziere des Regiments, veranlaßt durch die »wachsende Teilnahme für Frankreich« und »die Irrmeinung, Preußen und Frankreich seien eigentlich natürliche Verbündete«, begeistert die »Marseiller Hymne« anstimmten, wobei der Kornett Fouqué ihr Vorsänger war.
Auch der spätere Feldmarschall Hermann von Boyen, der zu dieser Zeit als junger Soldat in Polen kämpfte, weiß in seinen »Erinnerungen« von Sympathien für das revolutionäre Frankreich zu berichten, die man nicht als Widerspruch zum preußischen Patriotismus empfand. Boyen bedauert, daß sich der König durch Österreich und die französischen Emigranten zu diesem »Prinzipienkriege« habe verführen lassen, um, »wie unklugerweise angekündigt wurde«, »alle Mißbräuche, welche die Revolution abgeschafft hatte, wiederherstellen zu wollen«; und er nennt das nicht nur »eine Verhöhnung von Vernunft und Moral«, sondern auch »einen indirekten Vorwurf gegen den Entwicklungsgang des preußischen Staates, dessen große Könige ja einen bedeutenden Teil der Mißbräuche, von denen sich die Franzosen jetzt befreiten, nach und nach abgeschafft hatten«.
Ähnlich dachte auch der Leutnant Karl Friedrich von Knesebeck aus Karwe bei Neuruppin, der ein eifriges Mitglied der Halberstädter Literarischen Gesellschaft war. In seinen Briefen vom Rheinfeldzug klingt der Widerwille, mit dem dieser Krieg von ihm geführt wurde, immer wieder durch. Als seine Truppe sich über den Rhein zurückziehen muß, sieht er darin nichts als Friedenshoffnungen, und sein schlichtgereimtes Gedicht »An die Franzosen«, das er den Vereinsbrüdern nach Halberstadt sendet, preist Frankreichs Reichtum, Kraft und Mut und endet mit den Versen: »Und willig reichen wir die Hand/Dir hin zum brüderlichen Band.«
Aufruf des französischen Generals Adam Philipp Custine an die Deutschen 1792 nach der Eroberung von Mainz
Karl Friedrich Klöden, der spätere Direktor der ersten Berliner Gewerbeschule, ein Soldatenkind, in einer Berliner Kaserne geboren, hat als Sechsjähriger sowohl die franzosenfreundliche Stimmung der Soldaten als auch das vom Krieg verursachte Elend miterlebt. Er berichtet in seiner Autobiographie darüber, »daß auch in Berlin das gewaltige Ereignis« der Französischen Revolution »große Teilnahme erregte« und die »meisten jungen Männer sich offen zugunsten der Revolution« aussprachen, bis die Ermordung Ludwigs XVI. die Stimmung umschlagen ließ. Er erzählt davon, daß der Vater, ein Unteroffizier, die in der Kaserne wohnende Familie nur notdürftig ernähren konnte und daß die Armut zum Elend wurde, als es den Vater mit der Armee an den Rhein verschlug. Die Stickarbeiten der Mutter, mit denen sie vor dem Krieg ein wenig dazuverdient hatte, brachten nichts mehr ein, als der Krieg die allgemeine wirtschaftliche Lage verschlechterte. »Wie oft sind wir, zumal die Mutter, hungrig zu Bett gegangen; wie oft hat sie allein gehungert, nur um uns Kinder satt zu machen. Dazu aber kam noch, daß mein Vater sie guter Hoffnung zurückgelassen hatte. Unter solchen Umständen den Lebensmut aufrechtzuerhalten, war schwer.«
Dorothea Veit, geborene Mendelssohn, die spätere Frau Friedrich Schlegels, bekundete ihre Sympathien für das revolutionäre Frankreich, als sie in Rheinsberg preußisches Elend sah. In einem Brief an Rahel Levin beschreibt sie im September 1792 den Reichtum des vom Prinzen Heinrich bewohnten Schlößchens und setzt das Elend dagegen, das zwei Straßen weiter herrscht. »Verdammte Aristokratie! Konnte ich mir nicht erwehren auszurufen. Es ward sehr lebendig in mir, wie ein ganzes Volk mit einem Male sich gegen die schwelgenden Tyrannen auflehnen kann.« Diese ließen sich, so heißt es weiter, »Symphonien vorspielen, um das Geschrei des Elends nicht hören« zu müssen. Und da sie gerade die Oper des Prinzen besucht hatte, fiel ihr ein, daß sich mit den Kosten einer einzigen Aufführung eines der »eingefallenen Häuschen wieder aufbauen« ließe. »Ich dachte mir ganz Frankreich so, und nun verstand ich die Franzosen.«
Wenn der Gefreitenkorporal Heinrich von Kleist von seiner Stellung am Rhein her in einem Brief vom 25. Februar 1795 an seine Schwester Ulrike die Hoffnung auf einen baldigen Frieden äußert, damit »wir die Zeit, die wir hier so unmoralisch töten, mit menschenfreundlicheren Taten bezahlen« können, so kann das wohl kaum als frühe Ankündigung seines späteren Abscheus vor der »Tyrannei« des Militärs verstanden werden; wahrscheinlicher ist, daß der Heranwachsende hier nur wiedergab, was in seiner Umgebung dauernd zu hören war.
Die Truppe, die hier fern der preußischen Grenzen an Vaterlandsverteidigung nicht glauben konnte und keinen Haß auf die Franzosen spürte, war des Krieges ebenso müde wie die Minister, die den Staatsschatz schwinden sahen. Die Feldzüge kosteten den Staat mehr Geld, als er hatte. Im Gegensatz zu den Revolutionstruppen, für deren Verpflegung das von ihnen besetzte Land aufkommen mußte, verpflegten sich die preußischen Truppen, wie zu Friedrichs Zeiten, noch selbst. »Wir hatten damals«, heißt es bei Marwitz, »das Rauben und Plündern von den Franzosen noch nicht gelernt; alles wurde bar bezahlt.« Und da überdies in Polen Aufruhr herrschte, mußte schließlich auch der König, der sich lange gegen die Ratschläge seiner Minister gesträubt hatte, in den Separatfrieden mit Frankreich einwilligen, der im April 1795 zustande kam.
Um das Ausscheiden aus der Koalition, das vom Kaiser und den süd- und westdeutschen Staaten als Verrat an der antirepublikanischen Sache angesehen werden mußte, zu rechtfertigen, wurde eine mit »Berlin, den 1sten Mai 1795« datierte »Erklärung im Namen Seiner Königlichen Majestät von Preußen« herausgegeben, die mit folgenden Sätzen begann: »Seine Königliche Majestät von Preußen sehen Sich itzt in dem angenehmen Fall, Ihren Höchst- und hohen Reichs-Mitständen eine Begebenheit anzukündigen, deren frohe und glückliche Folgen das gesamte Deutsche Vaterland sehr nahe mit angehen. Der verhängnisvolle Krieg, welcher lange genug für die leidende Menschheit Tod und Verheerung in so weitem Umfang verbreitete, hat nun von Höchst Ihrer Seite sein Ziel gefunden. Ein glücklicher Friedensschluß ist zwischen seiner Majestät und der Französischen Republik am 5ten April 1795 zu Basel unterzeichnet und nachher beiderseits ratifiziert worden; derselbe gewähret den Preußischen Staaten wieder Ruhe und ungestörtes Wohlergehen, eröffnet aber auch zugleich allen Reichsständen einen gebahnten Weg, um gleichfalls zur Wohltat des Friedens zu gelangen und giebt schon augenblicklich einem großen Theil Deutschlands Schutz und Sicherheit gegen die Leiden und Zerstörungen des Krieges. Mit gerechtem Vertrauen auf die Zustimmung und den Beifall des gesamten Deutschen Reiches verweilen daher des Königs Majestät nicht, Ihre Beweggründe, Ihre Gesinnungen und Wünsche bei diesem Friedensschluß mit Offenheit darzulegen.«
Unumwunden wird in der 32 Seiten langen Erklärung zugegeben, daß es vor allem der Geldmangel ist, der es Preußen verbietet, noch länger fern seiner Grenzen Kriege zu führen, so daß es die Friedensbedingungen, die eine Neutralisierung Preußens und ganz Norddeutschlands vorsehen, trotz der Preisgabe der linksrheinischen Gebiete, als einen Glücksfall betrachten muß.
Und als solcher wurde er in Preußen auch vorwiegend empfunden. Der Maler Friedrich Georg Weitsch schuf als Allegorie auf den Baseler Frieden ein fast drei Meter hohes Gemälde mit dem Titel: »Die Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen bekränzen die Büste Friedrich Wilhelms II.«, und in Königsberg veröffentlichte Immanuel Kant, der sich mit wachsendem Alter immer mehr für politische Vorgänge interessierte, seinen vieldiskutierten Traktat »Zum ewigen Frieden«, in dem er, teilweise in ironischen Formen – schon der Titel ist doppeldeutig –, theoretische Gründlichkeit mit politischer Aktualität verband.
Der Krieg, der damit für Preußen, nicht aber für Österreich, endete, war ein neuartiger gewesen, für den Goethe mit seinem »Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus« das rechte Geflügelte Wort gefunden hatte – wenn auch wahrscheinlich erst dreißig Jahre danach. Die neue Epoche, nämlich die der Revolution, des Bürgertums und der Nationalstaatswerdung, war den Truppen der Fürsten in Form eines Revolutionsheeres entgegengetreten, das mit Begeisterung für Freiheits- und Gleichheitsutopien focht. Aus den Kabinettskriegen wurden nun Volks- und Weltanschauungskriege, die die Gefechtstaktik veränderten, alle Einwohner mit in den Strudel des Krieges zogen und auch eine geistige Beeinflussung nötig machten, die später psychologische Kriegführung hieß.
Die Prinzessinnen Luise und Friederike bekränzen die Büste Friedrich Wilhelms II. anläßlich des Friedens zu Basel.
Gemälde von Friedrich Georg Weitsch, 1795
So erzählt Laukhard, der Magister, der sich in Halle als preußischer Musketier hatte anwerben lassen, von Flugblättern der Neufranken, wie man die revolutionären Franzosen damals nannte, die die preußischen und österreichischen Soldaten zum Überlaufen verleiten sollten. In ihnen wird das neue Frankreich als Land der Glücklichen und Gleichen beschrieben, und den Überläufern werden reichlicher Sold und sogar Pensionen versprochen. »Kommt also hin nach Frankreich ins Land der Gleichheit und der Freude! Verlaßt die Edelleute und die Könige, für welche Ihr wie eine Herde Schafe zur Schlachtbank geht, und kommt zu uns, Euren Brüdern, ein Glück zu suchen, welches der Menschen würdig ist. Wir schwören es Euch, daß wir Euch hernach helfen wollen, Eure Weiber, Eure Kinder, Eure Brüder, Eure Schwestern aus der Sklaverei zu erretten, und Ihr sollt mit uns den Ruhm teilen, allen Völkern von Europa die Freiheit zu schenken.«
Auch von politischen Streitgesprächen zwischen den Soldaten beider Seiten weiß Laukhard zu berichten, wie sie bei der Belagerung von Mainz stattfanden, wo sich zufällig, aber doch wie bezeichnend für die Ideologisierung der Krieges, unter den Belagerern neben Laukhard und Goethe auch Kleist und Clausewitz befanden, unter den Belagerten aber Georg Forster und Caroline Böhmer, die spätere Frau August Wilhelm Schlegels und Schellings. Da lagen die Vorposten beider Seiten in Hörweite hinter ihren Wällen, so daß sie sich gegenseitig als Königsmörder und Tyrannenknechte beschimpfen konnten, sich später dann aber auch Kamerad nannten, »oft sogar Kartell unter sich machten, versprachen, sich nicht zu schießen, auf die Verschanzung traten, wo sie sich ganz freundschaftlich miteinander unterhielten«.
»Preuße: Ihr Spitzbuben habt euern König ermordet und dafür müßt ihr alle zum Teufel fahren.
Franzose: Wenn ihr keine Hundsfötter wäret, so würdet ihr es allen Tyrannen ebenso machen. Wenn ihr das tätet, so wäret ihr noch Menschen, so aber seid ihr Tyrannensklaven und verdient alle Prügel, die ihr bekommt.
Preuße: Wenn ihr nur euren König nicht umgebracht hättet!
Franzose: Kamerad, sei kein Narr! Es ist nun einmal so, und weils einmal so ist, so wollen wir auch dafür sorgen, daß weder euer König, noch der Kaiser, noch der Teufel uns wieder einen geben soll.
Preuße: Aber wo kein König ist, da sind doch auch keine Soldaten.
Franzose: Ja, freilich, solche Soldaten gibt es dann nicht wie du und deinesgleichen. Ihr seid Sklaven, leibeigne Knechte, die einen Tyrannen über sich haben müssen, der ihnen kaum halbsatt zu essen gibt und sie prügeln, spießrutenlaufen und krummschließen läßt, wenns ihm einfällt. Solche Soldaten sind wir nicht, wir sind freie Leute, republikanische Krieger.«
Und diese waren, so räubermäßig sie anfangs auch aussahen, für die preußische und österreichische Armee ernsthafte Gegner, wie nicht nur der Rückzug bei Valmy, auf den Goethes Geflügeltes Wort gemünzt war, bewies. Clausewitz, der seine ersten militärischen Erfahrungen, die später auch in sein kriegsphilosophisches Hauptwerk eingingen, auf den Mainzer Belagerungswällen gemacht hatte, weiß davon zu berichten, daß die Verbündeten 1792 eine von der Revolution geschwächte französische Streitmacht erwartet hatten und von einer gestärkten überrascht wurden, weil der Krieg Sache des Volkes geworden war. Die gut gedrillten und glänzend aussehenden Armeen der alten Mächte standen Soldaten gegenüber, die schlecht gekleidet und bewaffnet waren, ihre technischen und organisatorischen Schwächen aber durch staatsbürgerliche Motivation wettmachen konnten. Der Kornett Fouqué war von dem Patriotismus, den er bei französischen Kriegsgefangenen erlebte, tief beeindruckt, und als er 1796 und 1797 von den glänzenden Siegeszügen des Generals Bonaparte in Italien hörte, versetzte ihn die Erwägung, im Gefolge dieses »Heldenjünglings« fechten zu dürfen, in einen »seligen Taumel«, den er später in seinem Roman »Abfall und Buße« darzustellen versuchte. Die Preußen standen hier der Armee gegenüber, die wenige Jahre später, nachdem Napoleon sie diszipliniert und vervollkommnet hatte, fast alle Länder Europas erobern, unterdrücken und teilweise auch modernisieren sollte – mit dem Ergebnis, daß nach diesem fünfundzwanzigjährigen Kriege nichts mehr so war wie zuvor.
Vom Lehrjungen zum Meister
Johann Gottfried Schadow, Sohn eines Berliner Schneidermeisters, der es sich am Ende seines Lebens leisten konnte, die Annahme des Pour le Mérite von Bedingungen abhängig zu machen, war zweiundzwanzig, als König Friedrich in Sanssouci starb. Um seine Bildhauerausbildung zu vervollständigen, lebte er zu dieser Zeit in Italien, wurde bald nach seiner Rückkehr Hofbildhauer und schon nach seinen ersten Arbeiten, zu denen auch die Quadriga des Brandenburger Tores gehörte, in Europa bekannt.
Sein Geburtsjahr war 1764, das erste Jahr des Friedens nach dem verlustreichen Siebenjährigen Kriege, sein Geburtsort die Lindenstraße, nahe dem Halleschen Tor, in Berlin. Seine Eltern kamen aus bäuerlichen Familien der Zossener Gegend, die Mutter aus Mellen, der Vater aus Saalow (das Fontane in seinen »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« fälschlich für Schadows Geburtsort hielt). Die Mutter war schon als Kind nach Berlin gekommen und bei einem Onkel, der Buchdrucker gelernt hatte, erzogen worden, weshalb sie, wie Schadow meinte, die »Neigung zum Bücherlesen« lebenslang beibehielt. Der Vater, der sich seiner schwächlichen Statur wegen der Landarbeit nicht gewachsen gefühlt hatte, war erst nach der Heirat in die Residenzstadt gezogen, in der er sich mehr und bessere Kundschaft versprochen hatte, doch erfüllte sich diese Hoffnung wohl erst, als man aus dem Süden der Stadt ins Zentrum gezogen war. Die heute nicht mehr vorhandene Heiliggeiststraße, die, parallel zur Spandauer Straße verlaufend, die Poststraße nach Norden verlängerte, wurde nun zu Schneider Schadows Adresse, und die Familie vergrößerte sich um einen Bruder und zwei Schwestern; doch eiferte keines der Geschwister dem Ältesten nach. In der Stadtschule (nicht im Gymnasium) zum Grauen Kloster lernte der Junge Rechnen, Schreiben und Lesen, konnte aber am Zeichenunterricht nicht teilnehmen, da man zu diesem zusätzliches Lehrgeld verlangte, das beim Schneidermeister nicht vorhanden war.
Anna Catharina Schadow, die Mutter des Bildhauers.
Zeichnung Johann Gottfried Schadows von etwa 1780
Gottfried Schadow, der Vater des Bildhauers.
Zeichnung Johann Gottfried Schadows von etwa 1780
Von seinem Zeichentalent, das sich früh schon bemerkbar machte, erzählte Schadow später noch mit merkbarer Freude. Wenn in der Schule auf Schiefertafeln gerechnet werden mußte, »zeichnete er kleine Pferde mit solchem Beifall, daß die andern Schüler ihm ihre Tafeln heimlich zuschoben und ihm unterdessen die Rechenexempel machten«. Aber auch der Vater, »Herzvater« genannt, bemerkte das besondere Talent des Sohnes und ließ ihn zu Hause im Zeichnen unterrichten, und zwar von einem seiner Kunden, einem aus Italien stammenden Bildhauergesellen, der mit der Lehrtätigkeit seine Schneiderschulden beglich. Durch ihn erfuhr man in der Bildhauerwerkstatt von dem begabten Jungen, wodurch der Vierzehnjährige mit der Familie des Hofbildhauers bekannt wurde, die für sein weiteres Schicksal bestimmend war.
Der aus Antwerpen stammende Bildhauer Jean-Pierre Antoine Tassaert, den König Friedrich 1775 aus Paris nach Berlin geholt hatte, war mit einer französischen Miniatur- und Fächermalerin verheiratet, die, als Schadow ihr begegnete, schon eine beleibte und gichtgeplagte Dame war. Wenn sie den älteren ihrer acht Kinder Zeichenunterricht erteilte oder die Honoratioren der Französischen Kolonie um sich versammelte, war sie, wie Schadow erzählt, »in ihrem Fauteuil wie festgebannt«. Sie war des Deutschen, das sie verachtete, nicht mächtig, wollte aber, da sie die Zeichen der Zeit erkannte, ihre Kinder darin unterrichtet wissen und nahm deshalb den Schneidersohn Gottfried, dessen Zeichentalent ihr imponierte, als eine Art Pflegekind mit ins Haus. Die elterliche Wohnung in der Heiliggeiststraße war nun für den Jungen nur noch Schlafstelle, tagsüber lebte er im Tassaertschen Hause, das sich erst an der Friedrichwerderschen Kirche, später an der Königsbrücke, in der Nähe des heutigen Alexanderplatzes, befand. Er wurde von Hauslehrern mit den Tassaert-Kindern zusammen unterrichtet, lehrte sie Deutsch, lernte von ihnen Französisch und befreundete sich innig mit Jean-Joseph, dem ältesten Sohn seiner Pflegeeltern, der das Kunstinteresse mit ihm teilte und sich später für den Beruf des Kupferstechers entschied. Von Madame Tassaert gefördert, besuchten die Freunde häufig die Italienische Oper, also das Opernhaus Unter den Linden, und auch das deutsche Schauspiel auf der Döbbelinschen Bühne in der Behrenstraße, wo sie Stücke von Lessing kennenlernten und sich für Shakespeare begeisterten – den ihr König etwa zur selben Zeit in seiner engstirnigen und anmaßenden Abhandlung über die deutsche Literatur barbarisch fand.
Nachdem die Freunde auch die Zeichenschule der Akademie der Künste besucht hatten, ließ Madame Tassaert, die auch Unterricht im Malen erteilte, ihnen die freie Wahl zwischen den Kunstgattungen, und Schadow, der in der Werkstatt schon hatte helfen dürfen, entschied sich für die Bildhauerei.
In Tassaerts Werkstatt, die man erst im ehemaligen Grottensaal des vom Großen Kurfürsten erbauten Lusthauses, am Rande des Lustgartens, gleich neben der Domkirche, untergebracht hatte, bis der Hofbildhauer sie in seinem neuen Haus an der Königsbrücke einrichten konnte, arbeitete Schadow nun unter Tassaerts Leitung. »Nach Gips zeichnen«, so erzählte er später, »Ton kneten, bossieren, Formen in Gips ausgießen, reparieren, in Marmor ebauchieren, schleifen, dazwischen ausfegen, einheizen, Frühstück holen«, mit solchen Beschäftigungen vergingen die langen Arbeitstage, in denen der Lehrjunge und später Geselle zwar gründlich das Handwerk lernte, aber kaum Zeit für Weiterbildung und eigne Arbeiten fand. Sein Prinzipal, »ein Mann von rauher Gemütsart, groß, stark und von furchtbarem Ansehen«, vermied es, den Schüler zu loben oder auch nur zu ermutigen, so daß in diesem der Wunsch, endlich frei über seine Arbeitszeit verfügen zu können, von Tag zu Tag wuchs.
Im Hause Tassaert hätte man aber gern über seine Zukunft anders entschieden. Er sollte eine der Töchter (»ein artiges Kind, welches auch nachmals sein gutes Teil fand«, wie die alte Schadow meinte), eine angehende Pastellmalerin, heiraten und später Amtsnachfolger seines Gönners und Schwiegervaters werden. Da Schadow aber das Mädchen, das neben ihm wie eine Schwester aufgewachsen war, nicht liebte (»es hatte sich meine Neigung anderswo hingewendet«) und er schon der Generation angehörte, die gegen Konventionen ihre individuellen Glücksansprüche setzte, ging er, obgleich er sich wahrscheinlich undankbar vorkam, auf diesen Handel nicht ein. Sein Herz gehörte schon einer andern, und dieser opferte er die Sicherheit seines Fortkommens auf.
Die Erwählte, eine Wiener Jüdin von üppiger Schönheit aus reichem Hause, hieß Marianne Devidels und war sechs Jahre älter als er. Eines Fehltritts wegen, der eine uneheliche Geburt zur Folge gehabt hatte, war sie von ihren vornehmen Eltern erst in einem Kloster versteckt und dann nach Berlin geschickt worden, wo man in dieser Hinsicht wohl vorurteilsloser war. Sie hatte sich in der Heiliggeiststraße eingemietet, schnell Freunde und Verehrer, besonders in jüdischen Kreisen, gefunden und auch im geselligen Hause des Arztes Herz verkehrt. Hier, wo an zwei Abenden in der Woche Marcus Herz vor einer Versammlung von Gelehrten mit physikalischen Vorträgen glänzte, während im Nebenzimmer seine junge Frau Henriette, geborene de Lemos (die, nach Schadows Worten, »schon im fünfzehnten Jahr die junonische Gestalt erreicht hatte«, nach der die Männer sich umdrehen mußten), die Schöngeister um sich scharte, war die elegante Wienerin dem zwanzigjährigen Schadow begegnet, der, obwohl noch nicht volljährig, schnell zur Heirat entschlossen war. Die Einwilligung der Eltern war leicht zu erlangen. Der Schneidermeister und seine Frau wußten die Mitgift und das Erbe der Braut aus reichem Hause zu schätzen, und der Brautvater in Wien war wohl glücklich darüber, die Gefallene auf diese Weise unter die Haube gebracht zu sehen.
Marianne Schadow, geb. Devidels, die Frau des Bildhauers.
Aquarell Johann Gottfried Schadows von etwa 1800
Anscheinend war es Schadow unmöglich, der Hofbildhauerfamilie, der er so viel verdankte, das Durchkreuzen ihrer Zukunftspläne durch sein Fremdgehen zu beichten. Und da er, eines Titelkupfers wegen, den er für einen gegen den Minister Hertzberg gerichteten satirischen Roman gemacht hatte, eventuell mit polizeilichen Weiterungen rechnen mußte, gab er alle Zukunftsaussichten auf und wählte (»in stiller Verlegenheit«, wie er später seinen Zustand beschrieb) die heimliche Flucht.
Nach einem Plan seiner tüchtigen Mutter und von dieser begleitet, floh er, ohne sich von seinem Freund Jean-Joseph zu verabschieden, mit der Geliebten bei Nacht und Nebel, erst nach Mellen bei Zossen, dem Heimatdorf seiner Mutter, wo deren Bruder mit dem Fuhrwerk schon wartete, um das Paar samt der Mutter nach Baruth in der Niederlausitz, nahe der sächsischen Grenze, zu fahren, wo angeblich ein Pastor heimliche Ehen schloß. Das Gerücht aber erwies sich als unrichtig. Der Pastor weigerte sich, ohne gesetzlich vorgeschriebenes Aufgebot tätig zu werden, und das Paar mußte, während Mutter und Onkel nach Mellen zurückkehrten, ungetraut mit der Postkutsche weiterreisen, über Dresden nach Wien. Dort aber konnte die Heirat aus Anstandsgründen auch nicht stattfinden, da der Brautvater sie öffentlich schon als bereits vollzogen gemeldet hatte, so daß die Reise des angeblich schon verheirateten Paares ohne kirchlichen Segen nach Rom weiterführte, wo nun aber eine Schwierigkeit neuer Art entstand. Die Braut hatte sich nämlich während ihres Aufenthalts im Kloster zum Katholizismus bekehren lassen, und da in Rom sogenannte Mischehen nicht geschlossen wurden, mußte auch der Protestant Schadow den Glauben wechseln – was dem im friderizianischen Rationalismus aufgewachsenen Einundzwanzigjährigen, der sich ohne Vorurteile in der katholischen Tassaert-Familie und in den reformjüdischen Kreisen um Marcus und Henriette Herz bewegt hatte, wohl keine Seelenqualen bereitet hat. In Berlin später fand er zum Luthertum wieder zurück.
Im Sommer 1785 wurde der Lebensbund endlich eingesegnet, im Jahr darauf der Sohn Ridolfo geboren (der selbstverständlich katholisch getauft werden mußte), und da der Wiener Schwiegervater reichlich Stipendium zahlte, die künstlerische Ausbildung, die teils in der Werkstatt des Schweizer Bildhauers Trippel, teils in den reichhaltigen Museen und Sammlungen stattfand, gute Fortschritte machte, bei einem Wettbewerb junger Künstler ein bedeutender Preis errungen wurde und sich Berliner Freunde, wie die Brüder Janus und Hans Christian Genelli, auch in Rom einfanden, war das Jahr 1786 (in dem Friedrich der Große starb und Goethe seine erste italienische Reise machte) für den angehenden Bildhauer ein großer Gewinn.
In diesem Jahr erreichte ihn auch ein Brief seiner Mutter (einer von dreien, die der Nachwelt erhalten blieben), der die wenig gebildete, aber kluge und tatkräftige Frau, und zwar nicht nur durch ihre abenteuerliche Rechtschreibung, trefflich charakterisiert. Nachdem der Sohn ihr aus Rom von seiner Auszeichnung berichtet hatte, schrieb sie an die »lieben Kinder« von der Freude, die man in der Familie darüber empfunden hatte: »Wie sprachlos stum wir uns anstaunten und mit einem wiederholten: ach Gott ist dass möglich, Gottfried eine Goldne Medallge – das hättet ihr sehn müssen, beschreiben kann ich es nicht. Kurtz, wir feierten diesen Tag recht festlich und unsere Freunde gingen erst nach Mitternacht zu Hause. Die Freude lis mir nicht schlaffen, der Gedancke diese Nachricht zu Deinem baldigen Vortheil am gehörigen Ort anzubringen war mein Hauptzweck. […] Ich ging den andern Tag zu H. Meil, ich wis ihm Deinen Briff, versicherte ihm das er der erste wäre dem ich diese Nachricht brächte, sein Stoltz fand sich so geschmeichelt, und er war bei Lesung Deines Briffes gantz auser sich, seine Freundschaft gegen Tassa [gemeint ist Tassaert] war mir bekannt. Er behilt Deinen Briff, versicherte mir, er wollte ihn Selbst den Minister (Finkenstein) überreichen, welches denn auch geschahe, wobey er den Minister sagte: wen er die Mutter selb sprechen wollte, so würde sie ihm alles deutlich sagen können. Der Minister lis mich ruffen, man Empfing mich mit aller der Achtung als wen ich von Stande wäre, ich war nicht wenig Stoltz drauff Deine Mutter zu sein. Der Graf Solms, der Dockter, der Bergraht Gerhart waren bey ihm, ich sagte dem Bediente ich wollte warten bis die Weg wären, nein sagt er, Ihr Excellenz haben befohlen ihnen sogleich zu melden, und die andern mussten warten. Der Minister sprach ¾ Stunde mit mir, er wunderte sich nicht wenig dass Du ihm so unbekannt bis jetz wärs gewesen, er frug mich wie alt Du wärst, ich sagte ihm 23 jahr, ich habe ihn nichts verschwigen […] Kan ich nichts zu sehn bekommen von Ihren Sohn? Ihro Exzelentz, ich habe noch Einige Schkizen, wen sie befelen – gut meine liebe Frau, schicke sie sie her aber morgen schon. Wird denn ihr Sohn wieder kommen? Ihr E., er hat mir in Einigen Briffen Schon versichert dass er wünschte in sein Vaterland zurück zu gehen, dass er aber zweifelte ohne Ettwas gewisses zu haben, hir sein Glück zu machen. […] Und wo denkt den ihr Sohn sonst hin zu gehen, wen er nicht hier will kommen? Ihr E., ich weis nicht anders als nach Wien, weil er dort einen reichen Schwiger Vater hat welcher ihm versprochen, in welchen lande er sich niederlisse, ihm zu unterstützen, und nach seinem Tode ist die Tochter die einzige Erbin. – nu meine liebe Frau, wen sie ihren Sohn schreibt grüsse sie ihm von mir, und sage sie ihm, ich hätte mich recht gefreut, und er möchte mir doch eine Zeichnung schicken, ich würde gewis vor ihm sorgen – und so Endigte sich meine ambassade. Ich habe geglaubt, Reichtum ist eine bessere Empfelung wie armut. Ich habe ihm Deine besoffne Satirs und Einige Zeichnungen geschickt. Sage gar nichts an die Genellis. Sonst erfert Tassa alless wieder, er ärgert sich so genung dass wirs nicht haben melden lassen. – Dein Briefff geht jetzt noch immer rum, jetzt hat ihn Her Berger, welcher mir so offt hat drum bitten lassen. Wie viel Complimente ich Dir zu machen, das weis ich wircklich selbst nicht mehr […] nun meine liebe Tochter ich erwarte mit der grösten Sehnsucht die Nachricht einer glücklichen Entbindung, und freue mich Euch bald mit meinem kleinen Enckel zu umarmen, ich bin Eure Mutter Schadow.«
Schadows Rückkehr nach Berlin war also von der Mutter und anderen schon vorgearbeitet worden. Er kam im eignen Reisewagen, hatte für Ridolfo eine Kinderfrau bei sich und traf unangemeldet (der Brief kam eine Stunde später) am 5. November 1787, nachmittags um vier, in der Heiliggeiststraße ein. »Du kanst Dir den Schreck und die Freude dencken«, schrieb die Mutter nach Frankfurt an der Oder an ihren zweiten Sohn Rudolf. »Sie schickten die Frau [die Kinderfrau] mit dem Kinde zuerst rauf, da aber die Frau nicht bescheid wusste und sich lange in dem dustren angtre aufhielt, so fing das Kind an zu schreien, Lottchen [eine der Töchter] ging raus, Gottfried kommt zu, kennt Lotten nicht, fragt immer wer das ist, ich höre seine Stimme und schreie: ach Gottfried, und so war er in meine Arme; seine Frau sieht noch Eben so aus wie sonst, der Junge wie ein Engel, und Gottfried sieht aus wie ein Apoll. Sollte diese Zeichnung nicht richtig sein, so war es seine Mutter, die sie machte, genung, in meinen und seiner Frau Ihren Augen ist er Einer von den schönsten Männern.«
In Berlin hatte sich seit dem Tode des Alten Fritzen auch in den Bereichen von Kunst und Bau viel verändert; einheimische Künstler waren jetzt wieder stärker gefragt. Der Staatsminister Friedrich Anton von Heinitz, der Schadows Bedeutung frühzeitig erkannt hatte und jetzt dabei war, die unter Friedrich vernachlässigte Kunstakademie zu reformieren, machte den Vierundzwanzigjährigen, nachdem er ihn einige Zeit mit Hans Christian Genelli zusammen in der Königlichen Porzellanmanufaktur beschäftigt hatte, nach Tassaerts plötzlichen Tode zum neuen Hofbildhauer, in welchem Amt sich Schadow schon bei seinen ersten großen Arbeiten glänzend bewährte: bei der Quadriga für das Brandenburger Tor, bei dem Standbild der Kronprinzessin Luise und ihrer Schwester Friederike, und, ganz zu Anfang, 1788 bis 1789, bei einem aufwendigen Grabmal für die Dorotheenstädtische Kirche, das heute als Dauerleihgabe in der Alten Nationalgalerie steht. Es war das Grabmal für den sogenannten Grafen von der Mark, einen mit achteinhalb Jahren gestorbenen unehelichen Sohn des nun regierenden Königs, den dieser sehr geliebt hatte; er ließ ihm auch in Potsdam, in der Nähe des Marmorpalais, ein Denkmal setzen, in Form einer Ehrenurne, die sechzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus dem Heiligen See geborgen werden konnte, in den sie 1945 geraten war.
Mutter des Gräfleins war Wilhelmine Enke, die Tochter eines Trompeters aus der Kapelle Friedrichs des Großen, die schon in jungen Jahren Friedrich Wilhelms Geliebte geworden war. Er, damals noch Thronfolger, sorgte für ihre Ausbildung, wobei er sie teilweise auch selbst unterrichtete, so daß das intelligente Mädchen nicht nur zur perfekten Dame wurde, die sich in der besseren Gesellschaft ohne Schwierigkeiten bewegen konnte, sondern später auch zu seiner Ratgeberin. Auf Verlangen Friedrichs des Großen mußte sie eine Scheinehe mit dem Kämmerer Ritz eingehen, blieb aber auch als Madame Ritz und nach dem Ende sexueller Beziehungen die vertraute Freundin des Königs, wahrscheinlich der einzige Mensch, der ihm lebenslang wirklich nahe stand. Als Gräfin Lichtenau wurde sie 1796 von ihm geadelt und, zum Entsetzen des Kronprinzen, kurz danach auch bei Hofe offiziell eingeführt. Schadow hatte nicht ihr, wie manchmal behauptet wurde, sondern dem Minister von Heinitz den Auftrag für das Grabmal ihres Söhnleins zu danken, aber er schuf für sie sieben Reliefs mit Todessymbolen, mit denen sie ein Zimmer ihres Charlottenburger Landhauses schmückte, das dem Andenken ihres Sohnes gewidmet war. Persönlich ist er ihr wohl kaum nahe gekommen. Ihre einmalige knappe Erwähnung in seinen Erinnerungen bezieht sich auf ein mißglücktes Gespräch mit ihr. Wie er schreibt, hatte er ihr, wohl im Zusammenhang mit den Reliefs, seine »Aufwartung zu machen. Sie war bei der Toilette und umgeben von Dienerinnen. Es währte nicht lange, so« wurde aus dem Auftragsgespräch ein privates und sie »begehrte, ich sollte ihr meine Aventuren, meine Romane erzählen«, womit sie sein Liebes- und Fluchterlebnis meinte, das dem Klatsch natürlich nicht verborgen geblieben war. Er aber fand es würdelos, in dieser Umgebung von seinen Herzensangelegenheiten zu reden, mußte das Ansinnen also, »ungeschickt«, wie er schreibt, ablehnen, worauf sie ihn ungnädig gehen ließ.
Diplomatisch geschickt vorzugehen, war nie seine Absicht. Sein Stil war das Berlinisch-Direkte, wie es auch die Anekdoten zeigen, die Fontane über den alten Schadow erzählt. Dazu gehört auch die Geschichte von seiner Art, einen Orden entgegenzunehmen. Als 1842 die Friedensklasse des Pour le Mérite gestiftet und an dreißig verdiente Männer verliehen wurde, stellte Schadow für seine Annahme die Bedingung, daß die Auszeichnung nach seinem Tode an seinen Sohn Wilhelm, den Maler, übergehen müßte. Und als Begründung sagte er, nach Fontane, zum König: »Was soll ich alter Mann noch mit’n Orden, Majestät?«
Neben den Phrasen von der hohen Sendung der Künstler war ihm, der auf gutes Handwerk hielt, auch alles vornehme Gehabe, wozu auch das Französischsprechen gehörte, immer zuwider. Seine unvollendeten Erinnerungsaufzeichnungen über die Lage der Künstler unter Friedrich dem Großen, also in seiner Jugend, schließen mit der Bemerkung, daß nach dem Tode des Königs die académie des sciences sich in die Akademie der Wissenschaften verwandelte und wieder auflebte, daß das deutsche Schauspiel aus dem Hinterhaus in der Behrenstraße als Nationaltheater auf den Gendarmenmarkt wechselte und daß auch die vornehmsten Leute sich änderten: Sie lernten jetzt nämlich richtig Deutsch.
Das Tor
Der Dicke Willem, wie die Berliner den Nachfolger des Alten Fritzen nannten, neigte nach außen zu Abenteuern, wie seine Feldzüge nach Holland, Frankreich und Polen zeigen, und ließ im Innern die Zügel schleifen, was nach dem strengen Regime seines Onkels für manche der Untertanen sicher wohltuend war. Er lebte liederlich und ließ Liederlichkeiten gelten, auch solche, die gegen die starren Regeln des Ständestaates verstießen, den zu reformieren er aber nicht fähig war. Bezeichnend dafür ist nicht nur die bekannte Geschichte seiner lebenslangen Geliebten, der Tochter des Musikers Enke, die er zur Gräfin Lichtenau machte und regelwidrig bei Hofe einführte, sondern auch der Aufstieg des Pastors und Pastorensohns Woellner, der unter Friedrich Wilhelm II. zu einem der mächtigsten Männer im Staate wurde und vor allem als Urheber des antiaufklärerischen Religions- und Zensuredikts von 1788 in schlechter Erinnerung blieb.
Auch Friedrich Wilhelms Verhältnis zu allem Deutschen war anders als bei seinem Onkel. Er fühlte sich stärker dem Reich und dem Kaiser verpflichtet und war schon vorwiegend von deutscher Kultur geprägt. Nach seiner Thronbesteigung ging es mit dem kulturellen Einfluß Frankreichs bei Hofe und in den Akademien zu Ende, wenn auch die Sprache der Diplomaten noch lange das Französische blieb. Schillers Feststellung, daß »Die deutsche Muse« (so der Titel seines Gedichts) weder Schutz noch Anerkennung »Von dem größten deutschen Sohne,/Von des großen Friedrichs Throne« zu erwarten gehabt hatte, galt nicht mehr für den Thron seines Nachfolgers. Für das deutsche Schauspiel zum Beispiel wurde Berlin nun wichtig, und die Akademie der Künste, die noch bis 1809 den Zusatz »… und der mechanischen Wissenschaften« im Namen führte und noch keine Abteilungen für Musik, Literatur und Schauspiel hatte, entwickelte sich nun zu einem städtischen Kulturzentrum, das für die Gesellschaft nicht weniger Bedeutung hatte als die sich in dieser Zeit herausbildenden Salons.
Büste Friedrich Wilhelms II. von Johann Gottfried Schadow von 1792
Kurfürst Friedrich III. hatte die Akademie 1696 gegründet und ihr durch Aufstockung des Marstalls Unter den Linden ein Domizil in zentraler Lage gebaut. Zwischen der Charlotten- und der heutigen Universitätsstraße, wo sich seit 1913 das mächtige Gebäude der Staatsbibliothek befindet, residierte die Akademie in sechs Sälen über dem Stall für 200 Pferde und brachte es unter ihrem Gründer, der sich 1701 als Friedrich I. zum preußischen König gekrönt hatte, zu beachtlichem Ansehen, verkümmerte aber nach 1713, als Friedrich Wilhelms I. Sparsamkeitsregime begann. Nachdem 1743 ein Brand ihr Gebäude verwüstet hatte und die Kriege Finanznöte brachten, konnte sie sich auch unter Friedrich II. nicht recht erholen, bis sich in dessen letzten Lebensjahren Daniel Chodowiecki um ihre Neubelebung bemühte und in dem Minister Friedrich Anton Freiherr von Heinitz einen einflußreichen Mitstreiter fand.
Heinitz war auch zuständig für den Bergbau und das Hüttenwesen, und er wußte diesen Teil seiner Aufgaben mit denen der Akademie durchaus zu verbinden, so daß es in dem neuen Akademiereglement, das im Januar 1790, also schon unter Friedrich Wilhelm II., beschlossen wurde, hieß: »Da nun der Endzweck dieses Instituts dahin gehet, daß es auf der einen Seite zum Flor der Künste sowohl überhaupt beitrage, als insbesondere den vaterländischen Kunstfleiß erwecke, befördere und durch den Einfluß auf Manufakturen und Gewerbe dergestalt veredle, daß einheimische Künstler in geschmackvollen Arbeiten jeder Art den auswärtigen nicht ferner nachstehen; auf der anderen Seite aber diese Akademie als eine hohe Schule für Bildende Künste sich in sich selber immer mehr vervollkommne, um in Sachen des Geschmacks, deren Beurteilung ihr obliegt, durch vorzügliche Kunstwerke jeder Art selbst Muster sein zu können.«
Und tatsächlich gehörten zur Akademie bald alle bedeutenden Maler, Graphiker, Bildhauer und Baumeister, und daneben trugen Ehrenmitglieder, wie Goethe, Gleim und Angehörige der Königsfamilie, zu ihrem Ansehen und ihrer Förderung bei. Sie war Ausbildungstätte für Bildende Künstler, veranstaltete Ausstellungen, bot Raum für Vorträge, verlieh Preise, vergab Stipendien und schrieb Wettbewerbe aus. Minister von Heinitz verhalf armen Künstlern durch Tätigkeiten in der Königlichen Porzellanmanufaktur, KPM, zu einem Einkommen, und zusammen mit dem Ausbau des Hüttenwesens, besonders in Oberschlesien, konnte er den Eisenkunstguß zu einem Kunstzweig entwickeln, an dessen Aufblühen nach seinem Tode (1802) dann neben Schadow, Tieck, Posch und Schinkel noch mancher andere Künstler beteiligt war. Mit Denk- und Grabmälern, Brückengeländern, Kleinskulpturen, Medaillons, Schmuck und sogar Stühlen und Tischen waren in den nächsten Jahrzehnten die neu gegründeten Gießereien in Berlin und Lauchhammer vollauf beschäftigt. Schinkels Kreuzbergdenkmal zum Beispiel zeugt noch heute von dieser besonders preußisch anmutenden, aber durchaus nicht auf Preußen beschränkten Kunst.
Die Orientierung der Akademie auf einheimische Künstler war Teil der allgemeinen Besinnung aufs Nationale, die sich im Bürgertum und in Teilen des Adels schon seit Jahrzehnten vollzogen hatte und nun auch die Höfe erreichte – gerade noch rechtzeitig, um den vielen Talenten, die in diesen Jahren heranwuchsen und sich zeitweilig oder auf Dauer in Berlin niederließen, Gelegenheit zur Bewährung zu geben, sie zu unterstützen oder ihnen doch wenigstens nicht im Wege zu stehen.
Als im April 1795 das Abkommen von Basel das literarisch und künstlerisch so fruchtbare Friedensjahrzehnt für Norddeutschland einleitete, waren Kleist und Fouqué als angehende Offiziere noch in den Militärapparat eingebunden, während der zweiundzwanzigjährige Ludwig Tieck schon die ersten Werke veröffentlicht hatte und E.T.A. Hoffmann in Königsberg mit den Plagen des ersten juristischen Examens beschäftigt war. Chamisso, der Sohn französischer Emigranten, verkaufte noch in Bayreuth Blumen, bevor er Page bei der Königin in Berlin und in Freienwalde wurde. Scharnhorst stand noch in Hannoverschen Diensten. Gneisenau, schon in Preußen, war gerade zum Hauptmann befördert worden. Clausewitz, einer der eifrigsten Autodidakten, benutzte die Zeit des langweiligen Garnisonsdienstes in Neuruppin zu seiner wissenschaftlichen Weiterbildung. Marwitz, noch Fahnenjunker, kehrte vom Feldzug in Polen zurück. Achim von Arnim und Adam Müller waren noch Schüler, der eine am Joachimsthalschen Gymnasium, der andere in dem zum Grauen Kloster, während die zehnjährige Bettine Brentano von ihrem Vater im Kloster Fritzlar bei Kassel untergebracht worden war. Clemens, ihr älterer Bruder, wußte noch immer nicht, welchen Beruf er erwählen sollte, und Savigny, sein späterer Schwager, bereitete sich noch auf das Jurastudium in Marburg vor. August Wilhelm Schlegel ließ sich als freier Schriftsteller in Jena nieder, wo sich auch Wilhelm von Humboldt aufhielt und Fichte lehrte und bald auch Friedrich Schlegel zu ihnen stieß. Schleiermacher erhielt nach seinem ersten theologischen Examen eine Stelle als Hilfsprediger in Landsberg an der Warthe. Hegel war noch als Hauslehrer in Bern tätig. Iffland bereitete sich darauf vor, von Mannheim nach Berlin überzusiedeln. Gentz war durch seine kommentierte Übersetzung von Burkes Schrift gegen die Französische Revolution schon berühmt geworden, und Rahel Levin, bei der viele dieser Berühmtheiten sich später treffen sollten, hatte ihren ersten Salon in der Jägerstraße bereits etabliert.
Ähnlich verheißungsvoll wie bei den Schriftstellern und Philosophen sah es auch bei den Bildhauern und Baumeistern aus. Viel stärker als jene waren diese auf den Hof angewiesen, aber da Friedrich Wilhelm II., wie fast alle Hohenzollern, eine Leidenschaft für das Bauen hatte, ebnete er vielen von ihnen, die Berlin in den nächsten Jahrzehnten zu einem wahren Spree-Athen machen sollten, den Weg. Schon zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung hatte er den jungen Schadow zum Hofbildhauer ernennen lassen, und jetzt gehörte zu dessen Schülern unter anderen auch Friedrich Tieck. David Gilly, vorher Baudirektor in Pommern, war 1788 nach Berlin berufen worden, wo er zehn Jahre später die Bauakademie gründen sollte, und er hatte auch seinen genialen Sohn Friedrich mitgebracht. Schinkel, später Friedrich Gillys Schüler, besuchte noch das Gymnasium, war aber von Neuruppin schon nach Berlin übergesiedelt, während sein späterer Freund und Kollege Rauch noch Lehrling in Kassel war.
Auch Carl Gotthard Langhans, der aus Schlesien stammte und vorher vorwiegend dort auch gebaut hatte, war 1786 nach Berlin geholt worden, wo er nun mit dem Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt (das allerdings 1817 schon abbrennen sollte) und dem Brandenburger Tor, das in den nächsten Jahrhunderten zum Wahrzeichen der preußischen und deutschen Hauptstadt wurde, die wichtigsten Aufträge seines Lebens bekam.
Ansichten der Propyläen in Athen und des Brandenburger Tores.
Kolorierte Radierung von Johann Carl Richter von etwa 1795
Das alte Tor, das damals die Stadtgrenze markiert hatte, war, neben dreizehn anderen Toren, nötig geworden, als die Stadt, um Schmuggel und Desertion zu erschweren, von Friedrich Wilhelm I. nach 1730 mit einer Zoll- oder Akzisemauer umzogen worden war. Wie aus einem Stich Chodowieckis ersichtlich, war das alte Tor, wie die meisten Bauten des Soldatenkönigs, schlicht und zweckmäßig gestaltet worden. Zwei Torpfeiler mit barocken Verzierungen, die die hölzernen Torflügel hielten, wurden von zwei einfachen Gebäuden, für Zoll, Torschreiber und Stadtwache, flankiert.
Den Blick in den Tiergarten, den diese Anlage verwehrte, wollte Langhans möglichst weit öffnen. In seiner Denkschrift für den König, die auch das krönende Viergespann schon erwähnte, wurde in verständlicher Übertreibung die Lage des Tores als die »schönste der ganzen Welt« bezeichnet und damit begründet, daß es sehr licht und offen sein müsse. Als Vorbild habe er sich das »Stadt-Thor von Athen« genommen – womit er die Propyläen der Akropolis meinte, die er freilich nur durch Stiche, nicht aber durch eigne Anschauung kannte. Denn nach Griechenland, das noch von den Türken besetzt war, reisten deutsche Künstler damals noch nicht.
Schadow, der als zweite große Aufgabe in seiner Stellung als Hofbildhauer (die erste war das Grabmal des Grafen von der Mark gewesen) die Quadriga zu fertigen hatte, vermutete in späteren Aufzeichnungen, die manchmal auch bissig waren, daß Grund für die »Wiederholung anerkannter Meisterwerke« durch Langhans der Mangel an eignen Ideen gewesen sei. Der Gedanke, daß mit diesem ersten frühklassizistischen Bauwerk ein neues Kapitel preußischer Baugeschichte begonnen hatte, lag ihm, dem Mitbeteiligten, also fern.
Noch weniger freilich konnte er ahnen, daß dieser großartige Abschluß der Straße Unter den Linden in der politischen Geschichte Berlins, Preußens und Deutschlands eine größere Symbolkraft erlangen würde als all die vielen Denkmäler, die eigens zu diesem Zwecke das 19. Jahrhundert hervorbringen sollte. Die Kyffhäuser-, Niederwald-, Hermann- und Völkerschlacht-Denkmäler, die einst mit großem Aufwand errichtet wurden, sind heute im öffentlichen Bewußtsein kaum noch vorhanden, das Brandenburger Tor aber, das in allen äußeren, inneren und kalten Kriegen eine Rolle zu spielen hatte, ist weltbekannt.
Eröffnet wurde die Reihe der Ereignisse, denen das Tor als Kulisse zu dienen hatte, 1806, im Oktober, als Kaiser Napoleon, der den politischen Nutzen theatralischer Inszenierungen kannte, es zu seinem Einzug in Berlin nutzte, was dann Historienmalern zugute kam. Napoleon war es auch, der die Quadriga dadurch berühmt machte, daß er sie als Kriegsbeute nach Paris entführte, von wo sie 1814 im Triumphzug wieder heimgeholt wurde und dadurch an Symbolwert gewann. Bei dieser Gelegenheit wurde die Lenkerin des Viergespanns, die ursprünglich eine Eirene darstellte, durch ein Eisernes Kreuz, einen Eichenkranz und den preußischen Adler in eine Victoria verwandelt, die dann für die Siegesparaden nach den drei Bismarckschen Kriegen recht passend war. Auch später ließen sich weder die 1918 von der Front heimkehrenden Truppen noch die revolutionären Matrosen, die Freikorpskämpfer und die ihre Machtergreifung feiernden Nationalsozialisten den Marsch unter Schadows Gespann hindurch nehmen, denn er bedeutete soviel wie Sieg. Das Tor war zum Wahrzeichen der Stadt und des Landes geworden, was auch die Sowjetsoldaten meinten, als sie im Mai 1945 auf der zerstörten Quadriga ihre rote Fahne hißten, deren Entfernung den Aufständischen vom 17. Juni 1953 aus den gleichen Gründen wichtig erschien. Als dann 1961 die Teilung Berlins und Deutschlands durch Stacheldraht und Mauern erfolgte, wurde das zweihundert Jahre alte Bauwerk zum Wahrzeichen für die Hoffnung auf Einheit – weshalb es dann auch für die Wiedervereinigungsfeier besonders geeignet war.
Als im August 1791 das Tor dem Verkehr übergeben und 1795 die Quadriga aufgesetzt wurde, ahnte man nicht, daß damit die große Kunstepoche Berlin eröffnet war. Auch war man sich wohl der repräsentativen Wirkung des Tores noch nicht sicher. Denn als am 22. Dezember 1793 die schönen Prinzessinnen Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelitz als Bräute des Kronprinzen und seines Bruders unter dem Jubel der Berliner in die geschmückte Residenz einzogen, leitete man den Festzug nicht durchs Brandenburger, sondern auf dem kürzeren Wege durchs unansehnliche Potsdamer Tor.
Die Prinzessinnen
Zu den Berlinern, die durch die Schönheit der beiden Prinzessinnen in Begeisterung versetzt wurden, gehörte auch Schadow. Er war so entzückt von den beiden in Darmstadt aufgewachsenen Mädchen, daß er den hessischen Dialekt, den sie sprachen, für die »angenehmste der deutschen Mundarten« hielt. Er glaubte einen »Zauber« zu spüren, der sich durch den Liebreiz der sechzehn- und siebzehnjährigen Schwestern über der Residenz ausbreitete und die Berliner durch die Frage entzweite, welche die Schönere von beiden sei.
Für Frauenschönheit am Königshofe war man in Berlin in besonderem Maße empfänglich, weil man sie in Friedrichs langen Regierungsjahren hatte vermissen müssen. Der Einsiedler von Sanssouci, der sich aus Frauen nichts machte, hatte die seine stets von sich ferngehalten, so daß die Königin für das Volk nicht in Erscheinung getreten war. Sein lebens- und liebeslustiger Neffe dagegen war für weibliche Reize verschiedenster Art empfänglich gewesen, doch hatte er seine Gemahlinnen immer im Hintergrund gehalten. Und da seine Nebenfrauen zwar Anlaß zum Klatsch, nicht aber zur Verehrung geboten hatten, kam die künftige Königin Luise, in der sich Schönheit, Würde und Tugendhaftigkeit zu verbinden schienen, einem Bedürfnis entgegen, das lange nicht gestillt worden war.
Des frühen Todes ihrer Mutter wegen waren die beiden mecklenburgischen Prinzessinnen bei ihrer Großmutter im hessischen Darmstadt aufgewachsen und im März 1793 in Frankfurt am Main mit dem preußischen König und seinen Söhnen bekannt geworden, die sie, wie alle Welt, reizend gefunden hatten, und der Kronprinz hatte sich richtig in Luise verliebt. Noch im selben Jahr, in den Weihnachtstagen, waren im Berliner Stadtschloß die Hochzeiten gefeiert worden, und Luise, nun Kronprinzessin, erregte überall in Preußen Sympathie und Bewunderung, besonders auch bei den Dichtern, Malern und Bildhauern, die viel zum Kult um sie beitrugen, das ganze folgende Jahrhundert hindurch. Das bedeutendste dieser Werke ist Schadows Doppelstandbild der Schwestern, die sogenannte Prinzessinnengruppe, die den Zauber, den der Künstler schon beim ersten Anblick empfunden hatte, auch noch nach mehr als zweihundert Jahren zu vermitteln vermag.
Es war der Minister von Heinitz, der dem König den Vorschlag machte, die Schönheit der Schwestern von Schadow verewigen zu lassen, und da dieser schon fünf Jahre erfolgreich im Amt war und so bedeutende Werke wie die Quadriga, das Grabmal des Grafen von der Mark und das Zieten-Denkmal für den Wilhelmplatz geschaffen hatte, konnte Heinitz ihn mit Recht als einen Künstler bezeichnen, »der jetzt unter allen Bildhauern Europas den ersten Platz« beanspruchen konnte. Der König, den der Reiz seiner Schwiegertöchter nicht weniger beeindruckt hatte, stimmte dem Vorschlag zu.
Die beiden jungen Paare, die am 24. und 26. Dezember 1793 getraut worden waren, wohnten in Berlin Unter den Linden benachbart, Friedrich Wilhelm und Luise im Kronprinzenpalais, Ludwig und Friederike in dem Gebäude daneben, das später, als Luises Töchter hier bis zu ihrer Verheiratung lebten, den Namen Prinzessinnenpalais erhielt. Schadow wurde ein Arbeitsraum im Seitenflügel des Kronprinzenpalais angewiesen, und täglich um die Mittagsstunde kam Friederike, die jetzt Prinzessin Ludwig oder Louis genannt wurde, herüber, um ihm zu sitzen, mit ihm zu plaudern und dabei die Reize ihrer knapp siebzehn Jahre auszuspielen, die manchen Männern des Hofes gefährlich wurden. Nur ihr Mann, der erotisch schon anderweitig gebunden war und sie nur aus Gehorsam geheiratet hatte, machte sich wenig aus ihr.
Weniger intim war die Arbeit mit der Kronprinzessin, die Schadow nur in Begleitung ihres steifen, mit Zeit und Worten geizenden Gatten sah. Sie saß ihm auch nicht in seinem Arbeitszimmer, sondern ließ von ihm während ihrer Audienzen studieren. Zwar konnte er sie dann auch in den Pausen erleben, wenn sie sich zum Beispiel über die allzu große Ergebenheit der Besucher amüsierte, aber meist sah er doch die offizielle Luise, von der dann im Werk auch etwas zu finden ist.
Johann Gottfried Schadows sogenannte Prinzessinnengruppe von 1795
Zuerst entstanden die Büsten der Schwestern, die auch die unterschiedlichen Charaktere zeigen. Luise, die ältere und ernstere, hat etwas Feierliches und Hoheitsvolles. Der geradeaus gerichtete Blick macht das schöne Gesicht unlebendig. Die pflichtbewußte Königin, zu der sich das lebensfrohe, oft ausgelassene und tanzwütige Mädchen entwickeln sollte, ist hier von Schadow vorweggenommen. Auch der tiefe Ausschnitt des Kleides (der auf Einspruch des Gatten in einer späteren Fassung geschlossen werden mußte) vermittelt kaum sinnlichen Reiz.