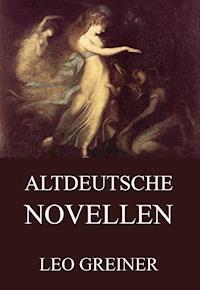
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leo Greiner war ein österreichischer Schriftsteller jüdischer Herkunft, Kritiker, spätromantischer Lyriker, Lenau-Forscher und Übersetzer aus dem Chinesischen. Dieser Band beinhaltet seine wichtigsten Übersetzungen altdeutscher Novellen. Inhalt: Vorwort Adam und Eva Der Bussard Crescentia Der treue Ritter Das Auge Kaiser Ottos Bart Die alte Mutter Frauentreue Wie man Frauen zieht Alten Weibes List Die Heidin Der Frauenturnei Der Ritter mit den Nüssen Der genarrte Ehemann Die treue Magd Das Häslein Aristoteles und Phillis Das Schneekind Der Schlegel Karl der Große Das Natternrecht Der Teufelspapst Saladin Marius mit den drei Frauen Helmbrecht Die Wiener Meerfahrt Der Richter und der Teufel Die drei Wünsche Die Beichte Der begrabene Block Das üble Kraut Der lebendig begrabene Ehemann Weib und Mann Das Schrätel und der Wasserbär Zwei Tiergeschichten Der Esel in der Fremde Kater Freier Sankt Martinsnacht Wie der Trunkenbold ein Einsiedel wurde Der geäffte Pfaffe Die Hasen Die drei Mönche von Kolmar Das Gänslein Maria und der Schüler Maria und die Mutter Der Ritter als Mönch Marien Rosenkranz Der Welt Lohn Bruder Felix
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Altdeutsche Novellen
Nach dem Mittelhochdeutschen von Leo Greiner
Inhalt:
Altdeutsche Dichtung
Vorwort
Adam und Eva
Der Bussard
Crescentia
Der treue Ritter
Das Auge
Kaiser Ottos Bart
Die alte Mutter
Frauentreue
Wie man Frauen zieht
Alten Weibes List
Die Heidin
Der Frauenturnei
Der Ritter mit den Nüssen
Der genarrte Ehemann
Die treue Magd
Das Häslein
Aristoteles und Phillis
Das Schneekind
Der Schlegel
Karl der Große
Das Natternrecht
Der Teufelspapst
Saladin
Marius mit den drei Frauen
Helmbrecht
Die Wiener Meerfahrt
Der Richter und der Teufel
Die drei Wünsche
Die Beichte
Der begrabene Block
Das üble Kraut
Der lebendig begrabene Ehemann
Weib und Mann
Das Schrätel und der Wasserbär
Zwei Tiergeschichten
Der Esel in der Fremde
Kater Freier
Sankt Martinsnacht
Wie der Trunkenbold ein Einsiedel wurde
Der geäffte Pfaffe
Die Hasen
Die drei Mönche von Kolmar
Das Gänslein
Maria und der Schüler
Maria und die Mutter
Der Ritter als Mönch
Marien Rosenkranz
Der Welt Lohn
Bruder Felix
Altdeutsche Novellen, Leo Greiner
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849626426
www.jazzybee-verlag.de
AltdeutscheDichtung
Mit der Glanzzeit des Rittertums fällt auch die volle künstlerische Ausbildung der mittelalterlichen Dichtung in deutscher Sprache zusammen. Die reiche und prächtige Ausgestaltung höfischen ritterlichen Lebens und Treibens, die Verfeinerung der Lebensformen, das Hervortreten der Frau in der höfischen Geselligkeit und das gesteigerte Bedürfnis nach anmutiger Unterhaltung förderte mächtig die Ausbreitung wie die Bereicherung und kunstmäßige Vervollkommnung der Dichtung des Ritterstandes. Erzählungsstoffe, in denen der äußere Glanz und die Ideale des Rittertums weit über die Wirklichkeit hinaus gesteigert erschienen, fanden Eingang. In zierlicher Darstellung, mit eindringlicher Beobachtung und Erörterung der seelischen Vorgänge wurden sie behandelt. Reicher stilistischer Schmuck wurde darüber hingebreitet, und Vers- und Reimkunst wurden zu voller Reinheit und zu gefälligem Wohllaut durchgebildet. Die lyrische Dichtung umspinnt das Empfindungsleben mit kunstvollem Gedankenspiel und entwickelt die metrischen Formen zu unübersehbarem Reichtum; die Lehrdichtung stellt weltliche Tugendideale neben die geistlichen und greift in die politischen Bewegungen und die sozialen Verhältnisse der Zeit ein. In der Ausbildung ritterlichen Lebens und Dichtens waren die Franzosen den Deutschen vorangegangen, und sie gaben ihnen für beides das maßgebende Vorbild. Von Frankreich entlehnte die höfische Epik ihre Vorlagen, an die sie sich oft auf das engste anschloss; von Frankreich nahm auch der höfische Stil der erzählenden wie der lyrischen Dichtung seinen Ausgang. Als Vater höfischer Erzählungskunst galt den späteren Dichtern Heinrich von Veldeke mit seiner um 1180 nach französischer Quelle gedichteten »Eneide«. Ihm folgte auf dem antiken Stoffgebiet Herbort von Fritzlar mit der Bearbeitung einer französischen Darstellung des »Trojanerkrieges«, Albrecht von Halberstadt mit einer Umdichtung von Ovids »Metamorphosen«, während die vollste Durchbildung der höfischen Kunstform und zugleich die Einführung der am meisten vom Geiste ritterlicher Romantik belebten Stoffe seit den 90 er Jahren des 12. Jahrh. durch Hartmann von Aue erfolgte. Durch seinen »Cree« und seinen »Iwein«, beides Bearbeitungen von Dichtungen des Chrétien von Troyes, verpflanzte Hartmann den Arturroman nach Deutschland; im »Gregor« und »Armen Heinrich« schuf er die ritterliche Legende; Stil und Vers der höfischen Erzählung aber bildete er zu unerreichter Anmut und Gefälligkeit aus. In weit weniger flüssiger, mit originellen Bildern schwer beladener Darstellung gestaltete der tiefsinnigere Wolfram von Eschenbach um 1205 einen französischen »Parzival«, in dem sich die Artursage mit der Gralsage verband, zu einem gedankenvollen biographischen Roman aus, in dem er sich den Helden durch ein tatenreiches Leben voll Torheit und Irrung zur Vereinigung ritterlicher und geistlicher Vollkommenheit emporringen lässt. Ebenso verkörpert er auch in seinem »Willehalm« sein Ideal des christlichen Ritters. Der allbezwingenden Gewalt der Minne ist dagegen das Werk seines literarischen Gegners Gottfried von Straßburg gewidmet, die Erzählung von »Tristan und Isolde« (um 1210), deren Stoff, schon um 1180 von Eilhart von Oberge als Abenteuerroman behandelt, bei Gottfried von einem begeisterten Minnekultus durchwärmt, mit feinfühligen psychologischen Erörterungen durchwebt und mit allen rhetorischen und metrischen Reizen höfischer Kunst geschmückt wird. Doch führt Gottfrieds glattfließende Form auch schon zur Breite und zu virtuoser Spielerei. Hartmann, Wolfram und Gottfried bleiben für die Folgezeit die unerreichten Vorbilder höfischer Erzählungskunst. An die beiden ersten schließen sich vor allem die Dichter der Arturromane an. So zeigt sich der Einfluss von Hartmanns »Erec« schon in dem wenig später verfassten »Lanzelet« des Schweizers Ulrich von Zatzikhoven und der Einfluss Hartmanns und Wolframs in dem gut erzählten »Wigalois« des Wirnt von Gravenberg. Spätere Dichter, die für ihre Erzählungen aus dem Arturkreise schon nicht mehr französische Vorlagen benutzen, sondern überlieferte Motive mit eigner Erfindung frei kombinieren, wie Heinrich von Türlin, der Stricker und der Pleier, pflegen nicht nur im Ausdruck, sondern auch im Inhalt ihrer Gedichte Anleihen bei Hartmann und Wolfram zu machen. Diejenigen aber, die Wolframs Erzählungen unmittelbar fortsetzen, gehen auch in der einseitigen Nachahmung Wolframscher Manier am weitesten, so Albrecht, der Wolframs Fragmente eines »Titurel« zur Unterlage eines großen Gralromanes machte, so die Verfasser des »Lohengrin« und Ulrich von Türlin, der Fortsetzer des von Wolfram nicht vollendeten »Willehalm«. Hartmanns Einwirkung erstreckt sich auf allen Gebieten der höfischen Erzählung am weitesten; ihm folgt auch um 1220 Konrad Fleck in der Erzählung der anmutigen Liebesgeschichte von »Flore und Blancheflor«. Doch tritt ihm in Alemannien Gottfried von Straßburg als maßgebendes Vorbild zur Seite. Diesem folgen vor allem Rudolf von Ems (gest. 1250/54) und Konrad von Würzburg (gest. 1287), der kunstvollste und formgewandteste unter den Epigonen. Beide pflegen neben dem außerhalb des Arturkreises liegenden ritterlichen Abenteuerroman einerseits die großen historischen Stoffe, anderseits die legendarische und novellistische Gattung und wirken mit ihrer sorgfältigen Technik wiederum auf spätere Dichter ein. Die kleinere Erzählung in Reimpaaren ist, seit schon der Stricker (um 1230) sie mit Glück gepflegt hatte, zahlreich vertreten, und neben die schwankartigen und novellistischen Stoffe wird ein Motiv aus dem wirklichen Leben im »Meier Helmbrecht« von Wernher dem Gartenäre gestellt. Eine poetische Selbstbiographie liefert Ulrich von Lichtenstein in seinem »Frauendienst«, der gegenüber der Darstellung eines verkommenen Raubrittertums im »Meier Helmbrecht« die ganze Phantastik abenteuernder Arturhelden in die Wirklichkeit versetzt.
Die reinen gefälligen Formen der höfischen Epik werden vorbildlich auch für Erzählungen, die nicht ausschließlich der Unterhaltung dienen, sondern wie die Reimchroniken zugleich belehren, oder wie die Legenden erbaulichen Zwecken dienen wollen. So zeigen z. B. noch im Anfang des 14. Jahrh. die große steierisch-österreichische Reimchronik Ottokars Anlehnung an Hartmanns »Iwein«, die großen zyklischen Legendenwerke, »Das Passional« und das »Leben der Altväter«, Einfluss des Rudolf von Ems. In Niederdeutschland werden freilich in solchen Werken die alten kunstlosen Formen noch festgehalten, sofern sie ganz in der heimischen Mundart gedichtet sind, wogegen die Nachahmer der höfischen Kunstpoesie, vor allem Romandichter wie Eilhart von Oberge und Bertold von Holle, mit den hochdeutschen Kunstformen auch mehr oder weniger hochdeutsche Sprachformen aufnehmen.
Während von Westen aus die höfische Epik mit ihren aus Frankreich entlehnten Stoffen und ihren von eben dorther beeinflussten Formen eindrang, bildete sich im äußersten Südosten, in den österreichischen Ländern, das mittelhochdeutsche Nationalepos aus, und die alten von der Völkerwanderung her von Mund zu Mund in Lied und Sage überlieferten einheimischen Stoffe hielten erst jetzt ihren Einzug in die d. L. In denselben Gegenden und in derselben Zeit, wo der Kürenberger seine Lieder sang, sind in derselben Strophenform auch Lieder von den Nibelungen erklungen. Sie wurden um 1200 zur modernern Form des ritterlichen Leseepos vereinigt, umgedichtet und erweitert, und so entstand das Nibelungenlied. Die Großartigkeit der alten sagenhaften Hauptmotive und Charaktere, die tragische Verkettung der Handlung und die treue poetische Wiedergabe altnationaler Anschauungen erhebt es zum bedeutendsten aller mittelalterlichen Epen. Versbau und Reim sind auch hier durchaus nach den strengen Anforderungen der Blütezeit geregelt, aber der weit schmucklosere und objektivere Stil unterscheidet sich sehr wesentlich von der Weise des höfischen Epos. Das »Nibelungenlied« wurde vorbildlich für die literarische Ausbildung der nationalepischen Traditionen überhaupt. Am Rhein, wo die höfischen Kreise ganz durch die romanisierende Richtung beherrscht wurden, dauerten noch die alten Überlieferungen nationalepischen Stiles in den Erzeugnissen niederer Spielmannspoesie, wie »Orendel« und »Salman und Morolf«, unberührt durch die moderne Kunst und vielfach ins Burleske gezogen, fort. Zunächst beherrschte in Österreich und Bayern der edlere Stil des Nibelungenliedes das nationale Epos, das auch meist gleich ihm die strophische Form den Reimpaaren vorzog. Doch dringt mit der Zeit auch in diese Dichtungen aus der nationalen Heldensage die kunstlosere, formelreichere und weniger ernsthafte Behandlungsweise der Spielmannsdichtung ein. Am nächsten steht dem Nibelungenlied an poetischem Gehalt wie im Stil die in einer Erweiterung der Nibelungenstrophe gedichtete »Gudrun«. Die Bruchstücke einer mittelhochdeutschen Bearbeitung derselben Sage, die Eckehart im »Waltharius manufortis« behandelt hatte, sind ihm in der Darstellungsweise wie in der Strophenform verwandt. Ganz hat sich dem Einfluss des Nibelungenliedes kaum eins der mittelhochdeutschen Epen aus der nationalen Heldensage entzogen. Ihren beliebtesten Gegenstand bildete die Sage von Dietrich von Bern. Die Kämpfe, die Dietrich im Verein mit Etzels Helden gegen Siegfried und König Gunthers Recken ausfocht, werden im »Biterolf« und im »Rosengarten«, seine Kriege in Oberitalien in »Alpharts Tod«, der »Rabenschlacht« und »Dietrichs Flucht«, seine Kämpfe mit Zwergen, Riesen und Drachen im »Laurin« und den Liedern von »Ecke«, »Goldemar«, »Sigenot« und »Virginal« besungen. Aus einer alten fränkischen Königssage, die jedoch durch die Sage von dem Berner wesentlich beeinflusst wurde, erwuchsen die Dichtungen vom Helden »Wolfdietrich«, die z. T. mit einer Dichtung von der Brautfahrt und dem Tode des lombardischen Königs »Ortnit« vereinigt wurden und in ihren verschiedenen Fassungen die fortschreitende Umbildung des Nibelungenstils in die Spielmannsmanier erkennen lassen.
Während so eine volkstümliche Epik neben der französierenden höfischen durch diese ganze Periode hindurchgeht, wird die alte ritterlich volkstümliche Lyrik, wie sie zuerst in Kürenbergs Liedern hervortrat, bald durch den französischen Geschmack und die Nachahmung französischer, insbes. südfranzösischer, provenzalischer Dichtung verdrängt. Die ersten Vertreter der neuern Richtung sind der Limburger Heinrich von Veldeke, der Pfälzer Friedrich von Hausen, der Schweizer Rudolf von Fenis, der Thüringer Heinrich von Morungen, der zugleich der bedeutendste mittelhochdeutsche Lyriker vor Walther von der Vogelweide ist. In Süddeutschland ist Reinmar der Alte (R. von Hagenau) der Typus der neuen Auffassung. bei der die Minnelyrik der Ausdruck des konventionellen, nach Art des Lehnsdienstes aufgefassten Minnedienstes ist, die unmittelbare Empfindung eine unbedeutende Rolle spielt und die Reflexion stark überwiegt. Den Höhepunkt der mittelhochdeutschen Lyrik stellt Walther von der Vogelweide (etwa 1170–1228) dar. Von direkter Nachahmung romanischer Muster ist bei ihm keine Rede mehr. Er verschmilzt die von der neuen Richtung ausgehenden Anregungen mit volkstümlichen Elementen; er vertritt in seiner Dichtung die verschiedensten Gattungen der mittelhochdeutschen Lyrik: das weltliche Lied in seinen verschiedenen Formen, ebenso das Tagelied, das geistliche Lied (in seinen Kreuzliedern, einem Lied auf Maria) wie die lehrhafte Spruchdichtung, die bei ihm zuerst auch politischen Charakter gewinnt, und in der er lebhaft für den Kaiser gegen das Papsttum Partei ergreift. Zahlreich sind die Nachfolger dieser Vorbilder gewesen. In Mitteldeutschland war hauptsächlich Heinrich von Morungen maßgebend, in Süddeutschland Reinmar und Walther. Besonders zahlreich sind schweizerische Dichter vertreten. Einer der besten unter den Epigonen ist der schon erwähnte Steiermärker Ulrich von Lichtenstein (um 1250). Eine entschiedene Richtung auf das Realistische nahm die mittelhochdeutsche Lyrik durch Neithart von Reuenthal (um 1230), den Begründer der »höfischen Dorfpoesie«, der seine Stoffe aus dem bäuerlichen Leben, aus der Tanz- und Liebesfreude der Dörfler schöpft. Zu den bemerkenswertesten Vertretern einer mehr realistischen Richtung gehören noch Gottfried von Neifen, der Tannhäuser und Steinmar.
Den lehrhaften Sprüchen ritterlicher und bürgerlicher Lyriker, den Sentenzen und reflektierenden Ausführungen höfischer Epen traten im 13. Jahrh. auch umfänglichere Lehrgedichte zur Seite, die zunächst den sittlichen Idealen und den Lebensanschauungen der ritterlichen Kreise Ausdruck gaben. So verfasste 1215–16 Thomasin von Zirclaere den »Welschen Gast«; etwa aus derselben Zeit stammt der »Winsbeke«; dem Ende der 20er Jahre gehört Freidanks »Bescheidenheit« an, die in der Form lose aneinander gereihter Sentenzen, unter reichlicher Benutzung alter Spruchweisheit, ihre praktische Lebensweisheit spendet. Den Jahren 1283–99 entstammt der österreichische »Kleine Lucidarius«. Der im I. 1300 geschriebene umfangreiche »Renner« des Magisters Hugo von Trimberg ist bereits den höfischen Lebensidealen völlig abgekehrt.
Vorwort
Der Titel "Altdeutsche Novellen" rechtfertigt sich durch seine Allgemeinheit, obgleich in den folgenden Dichtungen die ästhetische Grenze der Novelle vielfach überschritten wird. Zuweilen erweitert sie sich zu der dem deutschen Geiste sichtlich tief entsprechenden Form der Erzählung: So erscheint die Geschichte der Magelone hier in einer wenig gangbaren Fassung (Der Bussard), der Genovevastoff in einer besonders schönen, weniger dramatischen, aber um so reicheren und reineren Verarbeitung (Crescentia), das Thema zum "König Lear" ins Bürgerliche übersetzt, wodurch es zwar an tragischer Fallhöhe verliert, die Handlung sich aber um so leichter und natürlicher aus den Verhältnissen entwickelt (Der Schlegel), während die Motive zu der "Widerspenstigen Zähmung" in einer sehr eindringlichen Formulierung in der Doppelnovelle "Wie man Frauen zieht" für den späteren Bearbeiter vorbereitet liegen. Manchmal erreicht die Dichtung den Bereich der Novelle überhaupt nicht ganz und verengt sich dann zur Anekdote, manchmal wieder rückt sie deutlich in die Nähe der Ballade wie in dem weiten, trümmervollen Gedicht vom Sohne des Meiers Helmbrecht. Daneben stehen Legenden und Fabeln als mehr abseitige Spielarten.
Sämtliche Geschichten sind von ihren ursprünglichen Verfassern in Versen bearbeitet worden. Dennoch empfahl sich die Nacherzählung in Prosa schon aus äußerlich formalen Gründen: der Übersetzer hätte sonst all' die Nöte des Ausdrucks und Reimes, die den altdeutschen Autor bei der Abfassung plagten, bei einer wörtlichen Umschreibung ins Neuhochdeutsche noch einmal durchmachen und den Leser mit Langwierigkeiten und nicht zum wenigsten auch mit ungewollter Maniriertheit ermüden müssen. Zu dem schien die Prosa auch dem Zwecke dieses Buches besser zu entsprechen; jene Versnovellen waren zum mündlichen Vortrag, dieses zum Lesen bestimmt. So ergab es sich von selbst, die Art der Darstellung zu wählen, die dem Leser der Gegenwart in diesem Fall als die selbstverständlichere und natürlichere erscheinen mußte.
Leo Greiner
Adam und Eva
Jedermann weiß, wie es kam, daß Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben wurden. Da lebten sie nun jämmerlich, machten sich ein Hüttlein und saßen darin in großer Reue und Klage. So blieben sie sieben Tage lang, ohne zu essen, als aber der achte Tag verschied, hungerte es sie, so daß sie sich am neunten Tage aufmachten, zu suchen, womit sie sich des Hungers erwehren möchten. Aber da war nichts andres zu finden als Kraut, Laub und Gras, die auch den Tieren zur Nahrung dienen. Da sprach Herr Adam, der heimatlose, weise Mann: "Weh uns, daß des Teufels Untreue uns um das Paradies betrog, darin wir der englischen Speise genossen, und wir nun hier essen müssen, was für die Tiere ist!" Da entgegnete Eva weinend: "Adam, mein lieber Herr, gewähre, worum ich dich bitte, und nimm mir das Leben, ob Gott vielleicht dich wieder zurücknähme und ließe dich bei ihm bleiben. Denn durch meine Schuld hast du deine Freuden verloren, zu denen Gott dich erwählt hatte." "Eva, so sollst du nicht sprechen", sagte Adam, als er ihre Rede vernahm, "damit nicht Gott noch grimmiger an uns räche, was wir wider ihn getan haben. Laß uns lieber eine Buße auf uns nehmen, so schwer, als es unsrer Sünde geziemt, damit Gott sich gnädig unserer erbarme und uns wieder in seine Huld aufnehme. Es ist ein Wasser, das heißt Tigris mit Namen und fließt aus dem Paradiese her: da sollst du nackend hineingehn und dich auf einen Stein stellen, tief bis an dein Kinn, und während du so stehst, Gott um nichts bitten und keinen Laut der Klage von dir geben. So bleibe vierunddreißig Tage! Ich selbst aber will vierzig Tage lang die gleiche Buße im Flusse Jordan tragen, vielleicht, daß Gott uns dann wieder gnädig wird."
Sogleich ging Eva, wo sie das Wasser Tigris fand, und tat, wie Herr Adam sie geheißen hatte. Dieser eilte indes zu dem Flusse Jordan, um unverzüglich mit der Buße zu beginnen. Jämmerlich sah sie ihm nach, als er in das Wasser stieg. "Ich bitte dich, Wasser Jordan", begann Adam zu beten, "und die Fische, die darinnen sind, und euch, ihr Vöglein in den Lüften, und alles Getier auf Erden, daß ihr mir weinen helft und meinen großen Kummer klagen. Denn ihr seid unschuldig daran, ich bin's allein, der gesündigt hat." Als er so gesprochen hatte und um sich blickte, sah er, daß das Wasser sein Fließen ließ: die Tiere und die Vöglein und alle Geschöpfe halfen ihm klagen. So standen sie achtzehn Tage lang.
Das aber ärgerte den Teufel, der von je alle guten Dinge nur mit Schelsucht ansah, auf das grimmigste, denn er dachte, wenn sie so zu Ende stünden, würden sie sich zuletzt noch mit Gott versöhnen und wieder zurückgenommen werden. Er nahm daher die Gestalt eines Engels an und begab sich sogleich zu dem Wasser, in dem er Eva weinend stehen fand, begann mit ihr zu weinen und sprach arglistig: "Was stehst du hier so allein? Mich dauert dein Elend. Dein Weinen ist zu Gott gekommen, auch Adams Klage ward gehört: da baten wir Engel für euch und Gott ließ sich erbitten: nun tritt aus dem Wasser und ruhe dich aus! Denn mich hat Gott zu dir gesandt, daß ich dich zu Adam führe, und ihn auf die gleiche Weise tröste. Dann soll ich euch wieder nach dem Paradies zurückgeleiten."
Eva glaubte ihm die Lüge, wurde von Herzen froh und stieg aus dem Wasser, wo der Teufel sie sogleich empfing. Ihre Haut war von der Kälte gebleicht wie ein falbes Kraut, ohnmächtig fiel sie zu Boden. Aber der Teufel hub sie wieder auf und führte sie sofort dahin, wo Adam in Klagen stand. Als dieser die beiden kommen sah, brach er weinend in noch heftigeren Jammer aus: "Weh dir, Eva, weh dir, weh! Du bist zum andern Mal betrogen von dem, der uns schon einmal verriet und um das Paradies gebracht hat! Erneuert ist unsre Missetat, weh über seine falsche Rede!" So quälte sich Herr Adam, Eva aber, als sie dies vernahm und erkannte, daß sie den Teufel bei sich habe, fiel vor Betrübnis zur Erde auf das Gras und rief: "Was hab' ich dir getan, o Satan, daß du uns zu jeder Stunde verfolgst? O wie brennen mich meine alten Wunden!" Und leidvoll sagte Adam: "Weh, was bist du uns gar so gram? Hab' ich dir deine Ehre genommen? Ist es durch unsere Schuld geschehen, daß du deine Herrlichkeit verloren hast?" Da seufzte der Teufel tief auf und sprach: "Wie magst du mir dies sagen? Dein ist die Schuld, wenn ich mit meinen Genossen verstoßen ward, und ich hasse dich mit Recht. Denn Gott, unser aller Schöpfer, gebot mir bei seiner Gnade, ich solle dich, den er nach seinem Ebenbilde geschaffen, daß er ihm gleich wäre, anbeten, doch ich wollte es nicht. Denn mich hat er schöner und eher geschaffen als dich, so geziemte es dir, daß du mich anbetest. Alle Engel beteten dich an, nur ich nicht. Da forderte mich Michael, der Engel hehrster, auf, mit ihnen anzubeten. Ich aber rief, die Rede wäre mir Wind und leicht möchte Gott mich erzürnen, daß ich mit meinem Throne gen Mitternacht säße und ihm gleich würde. Da ward ich auf Gottes Gebot herabgestoßen und fuhr in schauerlichem Sturz hernieder in Elend und Fremde. Sollte ich euch nun in den Freuden lassen, von denen ich vertrieben ward? So riet ich denn deinem Weibe, von dem verbotenen Obst zu essen, und betrog sie, daß sie ihre Buße verließ. Und so will ich immerdar tun und vernichte dich und dein Geschlecht." Da weinte Adam und flehte zu Gott, er möge ihm Trost und Rat verleihen und geben, daß der Verräter ihm nicht obsiege, und befahl sein Leben und seine Seele dem Herrn. Als Gott seine Treue sah, erfüllte er ihm sein Gebet und befreite ihn von seinem Kummer: der leidige Feind verschwand und er sah ihn nie wieder. Da Adam die Gnade erkannte, wollte er an Gott nicht verzagen und stand die ganzen vierzig Tage, bis seine Buße zu Ende war. Da sprach Eva: "Freue dich, daß du nicht betrogen bist gleich mir! Denn darum will der Herr dir Freude und ewigliches Leben geben. Festige dein Gemüt und behüte dich vor jeglichem Leiden! Denn ich will nun von dir gehen, meine Schuld ist so groß, daß ich nicht wert bin, deine Genossin zu sein. So laß mich meines Endes harren!" Damit machte sie sich auf, um von ihm zu gehen. Das Scheiden tat ihnen beiden weh, sie hätten Blut weinen mögen. Sie ging und wanderte gegen Sonnenuntergang, bis ein Gewitter sie zwang, sich eine Hütte zu zimmern. Aber es fiel ihr schwer, denn sie verstand nichts davon. Sie trug ein Kind mit Kummer unterm Herzen, denn sie wußte nicht damit umzugehen. Die Zeit nahte, da sie es zur Welt bringen sollte, die Wehen warfen sie darnieder, aber nirgends war Ruhe für sie, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen. Da rief die Freudenarme: "Oh weh, daß ich je geboren ward, um durch Schuld den Zorn meines Schöpfers zu erregen! Nun hab' ich niemand, bei dem ich Rat fände als Gott, der mich geschaffen hat! Er sende mir den Tod oder helfe mir von meinen Nöten!" Aber Gott hörte sie nicht, denn er zürnte ihr noch. Da rief sie: "Oh weh, daß ich nun niemand habe, der mir einen Trost geben möchte! So groß ist meine Schuld, alle Geschöpfe sind mir gram. Wüßt' es doch Herr Adam! Wüßt' ich, wen ich fände, es ihm zu künden, ich wollt' es ihm sagen lassen! Nun will ich euch gerne bitten, dich, Sonne, und auch euch, Sterne, wenn ihr gen Sonnenaufgang kommt, helft mir und sagt es meinem lieben Herrn, wie große Pein ich leide!"
So erhielt Adam Kunde von Evas Not. Weinend hub er sich von dannen, bis wo er sie in ihrem Jammer fand. Als sie seiner ansichtig wurde, rief sie ihm entgegen: "Adam, mein lieber Herr, nun bitte du Gott, daß er sich über mich erbarme! Vielleicht erhört er dich, denn meiner Sünde ist so viel, daß meine Bitte nichts vor ihm gilt." Da betete Adam fleißig zum Herrn, daß er gedenken möge, wie seine Geschöpfe sich vermehrten, wenn sie ein Kind zur Welt brächte, und ihm Lob und Ehre davon erwüchse. Da tat Gott, worum er ihn bat, erbarmte sich über Eva und sandte ihr zwölf Engel, die ihr beistehen sollten. Denn da sie noch nie dergleichen erduldet hatte, wußte sie nicht, was beginnen, bis Michael sie belehrte und ihr sagte, was sie zu tun habe. Er selbst half mit der Hand dazu und hielt Eva auf der einen Seite, die übrigen Engel auf der andern Seite. Keine Kaiserin hat je so herrliche Ammen gewonnen als hier die arme Eva in ihrer Not. Sankt Michael aber sprach: "Eva, du mußt heilig sein um deines Gatten willen. Denn diesen hat Gott erkannt, daß er uns zu dir gesendet und seinen Zorn gestillt hat." Da ward ein schönes Kind geboren, das wurde Kain geheißen, das sprang sogleich auf und lief hin und brachte ein grünes Kräutlein und gab es seiner Mutter.
Als dies sich zugetragen und so ihr Leid gewendet war, bereitete sich Adam, um mit seinem Gesinde wieder gen Sonnenaufgang zu ziehen. Michael mußte ihn lehren, wie man arbeitet und das Feld bestellt, davon die Erde heute noch trägt: er wies ihm alle Samen, unter denen sie die besten wählten, damit Adam von ihren Früchten zu leben vermöchte; er nannte ihm die Tiere und Vögel, reine und unreine, bis er alles wohl zu unterscheiden verstand. Dann segnete er die Vertriebenen und fuhr mit den andern Engeln gen Himmel.
Da begann Adam die Erde zu bebauen. Von ihm erstand ein großes Geschlecht, dreißig Söhne und dreißig schöne Töchter, die wieder viele Männer und Frauen zeugten. Er lebte neunhundertunddreißig Jahre, bis der Herr dem Tod befahl, ihn mit sich aus diesem Jammertale zu nehmen.
Der Bussard
In England herrschte einst ein König, der sandte, als die Zeit gekommen war, seinen Sohn auf die hohe Schule zu Paris. "Denn", sagte er sich, "mein Sohn ist nun erwachsen und muß an Wissen und Kenntnis der Welt zunehmen, damit er dereinst in Ehren dieses Land beherrsche." Sogleich wurde die Fahrt zugerüstet: Frauen und Mannen begleiteten den Scheidenden vor das Tor und umarmten ihn herzlich. Innig umfing er noch einmal die Königin, seine Mutter, neigte sich tief vor ihr zum Zeichen des Dankes und ritt hinweg, während die anderen den Weg zur Burg zurückgingen.
Man hatte ihm zum Hofmeister einen Kaplan mitgegeben, der ihn nun schon unterwegs auf mancherlei Art über edelmännisches Wesen, höfische Sitten, Worte und Gebärden belehrte. Der Schüler faßte rasch auf und erglühte, als er zu Paris angekommen war und die hohe Schule besuchte, sogleich von solchem Wissensdurst, daß er bald zwei seiner Genossen, die beide Söhne des Königs von Frankreich waren, an Wissen und edlem Wesen überflügelte. Da schlossen diese sich enger an ihn an und erwirkten von ihrem Lehrer, daß auch sie bei dem englischen Kaplan Unterricht empfangen dürften, so daß die drei Jünglinge rasch auf das innigste verbunden wurden. Auf diese Weise kam der junge Fürst auch zu Hofe, denn seine Freunde brachten ihn mit sich und führten ihn freudestrahlend ihrem Vater, dem König, vor. Das Hofgesinde hieß ihn allgemein herzlich willkommen und auch die junge Königstochter grüßte ihn freundlich. Ihm aber schien es, als wäre all der andern Gruß ein Wind wider den lieblichen Willkomm, den die zarte Prinzessin ihm bot. Er verneigte sich tief und ging tugendhaft fürbaß. Der König selbst empfing ihn wohl und auch die alte Königin: "Wer ist dieser edle Junker?" fragte sie, "er ist wohlgetan, ein Engel möchte ihn um sein lichtes Wesen beneiden." Da trat der Kaplan vor und erklärte, auch dieser sei eines mächtigen Königs Kind und weile von England hier, die hohe Schule zu besuchen. "Was am Hofe liegt, seine Absicht zu befördern", sagte der König, "das sei ihm jederzeit gewährt", und hieß ihn nochmals willkommen. Alles freute sich des guten Empfangs, besonders aber die liebliche Tochter des Königs mußte dem Jüngling immerzu mit den Blicken folgen. Auch er sah sie oftmals an, Herz und Sinne neigten sich ihr zu, und seine Augen sagten ihr, wie lieb sie ihm wäre. Doch wagte er ihr nicht mit Worten zu verraten, worum Liebe zu bitten pflegt.
Der Kaplan aber sah mit Zorn, wie der beiden Neigung von Tag zu Tage wuchs: "Herr", sprach er, "entehrt Ihr das Kind des Königs, nachdem Ihr hier bei Hofe so ehrenvoll empfangen worden, und wird man der Liebe gewahr, die Ihr zu ihr im Herzen tragt, nicht Ihr noch ich werden jemals England wiedersehen. Besser, wir ziehen unserer Straße und verlassen dieses Frankreich, als daß Ihr uns hier in Schande und Elend bringt." "Du hast recht", erwiderte der Prinz. "Wohlauf, laß uns von hinnen! Wenn mich die junge Königin entläßt, was soll ich dann noch hier." Aber der König und die alte Königin wollten ihn nicht fortlassen und baten, er möge doch noch ein Jahr verziehen. Da sah er die Geliebte an. "Gewährt es uns!" sagte sie und blickte ihm ins Gesicht. So blieb er denn und dachte, wie er mit ihr zusammen kommen möchte.
Nun traf es sich eines Tages, daß er die Jungfrau bei einem Fenster stehen fand: sie waren allein, da umfing sie ihn. "Sei Gott willkommen", sprach er, "daß ich dir nun endlich sagen darf, was ich so lange verhehlte", und redete von seiner Liebe. Sie aber umfaßte ihn noch inniger: "Warum", sprach nun auch sie, "hast du nicht meinen Vater um mich gebeten? Denn nun, sagt man mir, sei ich einem Manne anverlobt, der habe ein Königreich mit goldenen Bergen. Aber wie es darum auch stehen mag, er wird mich nie und nimmer bekommen, denn ich liebe keinen andern Mann als dich." "So will auch ich keine Frau lieben außer dir", erwiderte er: "Doch hat dein Vater das getan, so wird er nie davon zurückkommen, es wäre denn, du würdest ihm genommen und ich führte dich heimlich fort mit mir." "Still", sagte sie, "sprich nicht so laut davon! Pack auf, fahre heim und säume dich nicht! Wenn du aber zu Hause bist, so weile dort ein ganzes Jahr, denn sie haben auch schon den Tag bestimmt, an dem ich dem fremden König gehören soll. Indessen mußt du sorgen, daß du dir drei Fohlen verschaffst, edler, als sie irgend sonst zu finden sind. Mit denen komm dann heimlich wieder genau auf den Tag, da sie mich fortführen wollen, hier in dem Baumgarten wirst du mich wartend finden. Kommt dann der König mit den goldenen Bergen geritten, so werden sie ihm entgegengehen. Dann schwingen wir uns auf und sind schon weit, ehe sie erraten mögen, wohin wir verschwunden sind." Da umfaßten sie eins das andere und küßten sich.
Der Kaplan aber beobachtete wohl, daß etwas vorging, und wurde immer zorniger. "O weh, Herr, der Not", sprach er, "Ihr wollt uns ohne Zweifel dem Tode überliefern." "Hat dich denn der Teufel hergebracht", rief der Jüngling, "daß du mich ausspürst und mit deiner Neugier verfolgst? Auf, nimm aus der Schatztruhe Gewand, Silber und Schwert und heiße den Knecht uns die Pferde satteln – wir wollen gen England reiten!" Was er befohlen hatte, geschah. Er ging zum König, beugte das Knie und dankte ihm für die Huld und Gnade. Als er aber hinauskam, sah er die junge Königin vor der Tür stehen und seiner warten. Sie bot ihm ihre schneeweiße Hand: da brannten sie beide in Liebe und Sehnsucht. Und während ihr die Tränen über die Wangen rannen, sagte sie leise: "Nun gehst du und ich habe Freude mit Weinen." "Laß mich aus deinen Armen", erwiderte er, "und weine nicht! Wir müssen uns meiden, bis uns der liebe Tag erscheint, da ich dich mit mir nehme! Bis dahin schütze Gott dich vor aller Not!" So schieden die beiden in Jammer und Lust.
Als er in England ankam, fand er daselbst Städte und Burgen in blühendem Frieden. Der König kam ihm mit seinen Mannen entgegengeritten und empfing ihn ehrenvoll. Aber seine Sehnsucht und sein Herz war fern bei der Geliebten und achtete nicht darauf, was um ihn vorging: "O lieblicher, roter Mund", dachte er, "wann soll ich dich wieder küssen? Mir ist so weh nach dir, daß ich keine Freude mehr habe." Frauen und Männer trieben mancherlei Kurzweil vor ihm, Trommeln, Pfeifen und Saitenspiel, Turnieren, Stechen und Singen. Aber ihm wollte keines davon gefallen, seine Trauer wich nicht von ihm und je mehr schöner Frauen er sah, desto tiefer nur wurde sein Leid, gedachte er jener, die er in Kummer dort zurückgelassen. Indessen ritt er aber im Lande herum und erforschte eifrig die Namen der Burgvögte. Als er sie alle kannte, ließ er drei der besten abseits in ein Haus kommen, und bat sie, ihm drei schnelle Rosse zu verschaffen, edler, als sie irgend sonst gefunden würden. Da suchte man manche gute Stadt ab, ehe man die besten fand: doch wurden sie schon in kurzem vor ihn gebracht. Indessen hatte er bereits einen Ort ausfindig gemacht, wo die Tiere heimlich stehen sollten, daß niemand sie entdeckte. Dort wurden sie hingeführt und glänzend gepflegt: drei kunstreiche Sättel wurden angeschafft, Zaum und Steigbügel mit Golde beschlagen und alles, was sonst von Leder ist, aus seiner Seide hergestellt und mit goldenen Borten überzogen, und Sporen und Sattelbogen aus dem edelsten arabischen Golde gearbeitet. Als dies vollendet war, ließ er sich eine gute Fiedel mit seidenen Saiten und goldenen Nägeln fertigen, wie sie einem Fürsten geziemt: das Holz glänzend poliert, den elfenbeinernen Griff mit Gold und Edelsteinen ausgeziert, dazu einen Fiedelsack von Seide, mit seidenen Goldborten und lieblichem Bildwerk geschmückt.
Über solchen und ähnlichen Vorbereitungen war endlich das Jahr vorübergegangen und der Tag der Abreise da. Der Jüngling brannte, fortzukommen, und schickte seinen Knecht voraus, daß er ihn vor dem Tore erwarte. Dann ritt er ihm heimlich auf Wegen, wo niemand ihn sehen konnte, nach und sprengte mit ihm in fliegender Eile die Straße gen Frankreich zu. "Ich gäbe das Himmelreich um diese Fahrt", dachte er und ließ das Bild der Geliebten vor seinem Auge schwanken. Nachts, wenn sie in der Herberge waren, schlief er nur selten bis zum nahenden Morgen: "Auf!" rief er und weckte den Knecht, "wir wollen reiten, es ist mir eilig mit dieser Fahrt!" Der Knecht mußte ihm die kostbare Geige nachtragen. Denn er wollte, daß ihn niemand in Frankreich erkannte, bis er endlich in die Nähe des Hoflagers kam. Da wunderten sich Frauen und Edelleute, daß ein so stolzer Herr nichts andres wäre als ein fahrender Fiedler, und der König trat ihm entgegen und bat ihn, bei der Hochzeit seiner Tochter aufzuspielen. Doch der Fremde weigerte sich: "Nein", sagte er, "ich muß allein weiterreiten bis zu einer, der ich es angelobt habe." "Ei seht mir doch den Tobsüchtigen", rief der König, "schlägt er mir nicht meine reiche Gabe und die Ehre ab, bei meinem Feste zu spielen?" "Ach, Ihr wißt ja nicht, wie es darum steht", erwiderte der Fiedler, "vor einem Jahr hab' ich eine weiße Taube in einem Strick gefangen, in dem sie immer noch gefesselt liegt. Ließ' ich sie nun noch länger darin, so nähme sie mir vielleicht ein anderer Mann, aber dem gönn' ich sie nicht, weil ich sie selber haben will." Da lachte der König, denn es dünkte ihn ein rechter Narrenstreich, daß einer wegen einer Taube seine Einladung in den Wind schlüge. So ritt der Jüngling denn weiter, den wohlbekannten Weg dahin, und begab sich an eine Stelle, wo er vor dem Blicken der andern wohl geborgen war. Indessen befahl der König seinem Hofgesinde, sich zum Empfange des Königs von Marokko gerüstet zu halten, denn dieser war es, der die Prinzessin an diesem Tage holen sollte. Als der Bote kam, gingen alle Frauen und Mannen dem König feierlich entgegen, um ihn mit geziemenden Ehren zu begrüßen. So vergaß man der Jungfrau und ließ sie allein. Als sie dessen gewahr wurde, ging sie rasch hinunter in den Baumgarten, den Geliebten zu erwarten, er aber war schon da. Schnell, ohne sie erst noch zu begrüßen, denn Furcht und Not drängte, hub er sie auf sein Roß, die ihm geschwind ihr Händlein hinaufgereicht, und ritt mit ihr und den Pferden in fliegender Eile dahin. Sie hielten sich umschlungen und küßten sich Mund und Wangen, während die Rosse über das Gefilde sausten. Inzwischen war auch der fremde König eingeritten und man fragte nach der Braut. Alles suchte, aber die Jungfrau war nirgends zu finden. Da erhob sich allgemeiner Jammer und Leid, denn das Gerücht verbreitete sich, ein Engel habe sie entführt, damit ihr reiner, zarter Leib nie durch eines Mannes Liebe befleckt werde. So nahm denn der König von Marokko Abschied und ritt wieder dahin, von wannen er gekommen war.
Um dieselbe Zeit war der junge Fürst mit der Entflohenen in einen verwilderten Tann gelangt, der lieblich in Maienwonne voll von Blumen und Blüten stand. Da bat sie ihn herzlich, er möge den Knecht in die nächste Stadt vorausschicken, Herberge zu beschaffen. Sie selbst aber blieben allein auf dem grünen Plan zurück und ruhten im Grase zwischen den Blumen, bis das Mädchen ihm auf dem Schoß entschlief. Sie hatte zwei Ringlein an der Hand, die zog er ihr ab, während sie schlief, und betrachtete sie, denn ihn dünkte, er habe nie schönere an eines Menschen Hand gesehen. Da stieß plötzlich ein Bussard herab und riß ihm den einen von den Ringen aus der Hand. Ihn dauerte die Kostbarkeit, zornig sprang er auf und eilte mit Prügeln und Steinen hinter dem Bussard her, der immer weiter entflog. So kam er stets tiefer in die Wildnis hinein, irrte, den Vogel verfolgend, bald hierhin, bald dorthin und fand sich am Ende so fern von der Stelle, von der er ausgegangen war, daß er den Weg zurück nicht mehr finden konnte. Da brach er in schrecklichen Jammer aus und schrie in Elend und Not: "Nun hab' ich mein Lieb verloren, weh, warum wählte sie mich, da doch ein Fürst, viel edler als ich, sie in Freuden und Herrlichkeit dahingeführt hätte, und ritt mutterseelenallein mit mir aus Ehre und Glück davon! Hätt' ich die Fahrt nie getan, lieber wollt' ich für immer ein landfremder Pilgrim sein und morgen nicht schlafen, wo ich heute schlief!" So klagte er fort, Stiche durchbohrten sein Herz, wilde Tränen quollen ihm strömend über Wangen, Brust und Hände. Er schlug und raufte sich und gab Hirn und Mark so grenzenlos dem Jammer dahin, daß seine Vernunft zerbarst: er wurde wahnsinnig. Da mißhandelte er seinen Leib, zerrte seine Kleider herab, ließ sich auf die Hände nieder und lief gleich den wilden Tieren des Waldes auf allen vieren durch Dornen und Gebüsch. Menschlicher Sinn schwand ganz und gar von ihm: so lebte er vertiert in dem großen Walde.
Inzwischen war fern in dem Tann, wo der Bussard ihm den Ring geraubt, das Jungfräulein in süßem Schlafe gelegen und erwachte nun. Sie sah sich um und es wurde ihr ein wenig angst, als sie den Liebsten nicht bei sich fand, aber sie dachte: "Sein Roß und sein Mantel sind hier, so wird er wohl bald wiederkommen", und tröstete sich. Als es aber gar zu lange währte, saß sie traurig da und blickte weit um sich: "Liebster, was hast du mich so lange hier allein gelassen", sprach sie zu sich selber. Sie kannte nicht Weg noch Steg, da sah sie dorther ein Wasser fließen, dem ritt sie nach und ihr war ernst und trüb zumute. Endlich kam sie an eine Mühle, wo sie zu nächtigen gedachte, und stieg vom Roß. Der Müllermeister trat ihr entgegen, da grüßte sie ihn züchtig, neigte sich und bat ihn herzlich um Herberge. "Schönes Fräulein", sagte er, "wie kommt es doch, daß Ihr so alleine seid?" Da erzählte sie ihm, sie habe ihren Begleiter verloren. Er führte sie hinein und ließ ihr von seinem Knaben die Rosse abnehmen. Drinnen bereitete man ihr einen schönen Sitz, darauf sie sich niederließ, und der Müller fragte sie nun weiter darüber aus, was in dem Walde geschehen sei. Da berichtete sie ihm alles, wie es sich zugetragen. "So ist mein Rat", sagte er, "daß Ihr hier bei mir in der Mühle bleibt. Ist er am Leben, so kommt er hierher sicherlich früher, als an irgendeinen andern Ort." "So nimm und verkaufe die Pferde", erwiderte sie, "und bring uns um drei Mark Seide und Gold, daß ich damit unsern Unterhalt verdiene. Denn Stolen und Kirchengewänder, Tücher und Borten weiß ich gar kunstreich zu machen, und wir können beide von meiner Hände Arbeit leben."
So war sie in der Mühle ein ganzes Jahr, bis gegen Ostern, da die Vöglein wieder zu singen begannen und Klee und Blumen aufs neue hervordrangen. Ihr war weh um ihren Lieben, aber sonst hatte sie es gut. Nun hauste in der Nähe der Mühle ein reicher Herzog, der es liebte, sich am Maientag im schönen Wald mit seinem Hofgesinde um einen Brunnen zu lagern und sich den Tag lang im Freien zu ergötzen. Die Mühle lag mitten im Walde, eine schöne Linde stand davor, unter der ein kalter Brunnen entsprang. Da ritten sie nun alle hin, um dort ihr Lustlager aufzuschlagen. Als die Herzogin das königlich feine Mägdlein erblickte, wunderte sie sich und sprach zu ihr: "Wie mag das sein? Bist du in dieser Mühle erzogen? Wärst du als ein lieblicher Engel aus dem Himmelreich hierher gekommen, du könntest nicht schöner sein." Sie bat den Müller, er möge gestatten, daß sie das edle Mägdlein als Hoffräulein mit sich nehme. Aber dieser erwiderte: "Gnaden, Frau Herzogin, fragt sie selbst, denn ich wag' es nicht, darüber zu bestimmen." "Ich täte es gern", sagte das Mägdlein, "verstünd' ich nur, wie man auf Burgen dienen muß. Doch weiß ich leider nicht Bescheid darin." "Was sprichst du da!" entgegnete die Herzogin. "Du wirst es mir nicht ausreden, daß du aus einem edlen Hause bist, alles spricht dafür, die Bildung deines Leibes, dein Wesen und lieblicher Anstand. Wo hast du so herrlich nähen gelernt? Dergleichen Arbeit mit Seide und Gold ward wohl noch selten in Mühlen gesehen." "Wir wollen sie mit uns nehmen", entschied der Herzog.
Dieser entstammte dem mächtigen Hause derer von Engelstein und war ein Bruder des Königs von England, mit dem gemeinsam er noch tiefes Leid um das Unheil trug, das sie betroffen, als der junge Fürstensohn spurlos verschwunden war. Zwar hatte man manchen Boten weithin in die Lande gesendet, aber keiner hatte Kunde von dem Verlorenen gebracht. Am Hofe dieses Herzogs lebte nun die Jungfrau und wurde von allen auf das beste gehalten und geehrt. Aber kein Mensch sah sie jemals fröhlich. Wenn sie allein war, weinte sie. So ging abermals ein Jahr dahin.
Eines Tages nun fuhr des Herzogs Jägermeister mit seinen Gesellen in den Wald zur Jagd. Man koppelte die Hunde los und machte sich auf: über rauhe Stege ging es kreuz und quer dahin, durch Gefilde, Wald und Ödnisse. Man war einem Hirsche auf die Spur gekommen, der lang und lang vor ihnen herlief. Da erblickten sie plötzlich einen Mann, der in der Wildnis auf allen vieren herumging. Die Hunde liefen ihn an, da floh er hoch auf einen Baum und wiegte sich in seinem Wipfel. Es waren im ganzen drei Jägersleute: von denen blieben zwei bei dem Wilden zurück, den dritten aber schickten sie heim, daß er dort verkündige, wie ihr Meister einen behaarten wilden Mann erjagt habe, der dann auf einen Baum entflohen sei. "Ich will hinreiten", sagte der Herzog, ließ sich sofort Reitkleid und Roß geben und machte sich auf. Aber ehe er noch in den Wald kam, hatten die Jäger den wilden Mann gefangen und trieben ihn vor sich her. Als der Herzog dies sah, erbarmte ihn des Mannes Unglück: er ließ ihn aufrichten und ihm die Beine gerade ziehen. Aber es half nichts, der Wilde fiel wieder zurück und war auf keine Weise zu bewegen, wie ein Mensch zu gehen. Doch der Herzog sprach: "Er sieht nicht aus wie einer, der von Geburt auf so tierisch gewesen. Gebt ihm warme Speise und pflegt ihn, so wird er wieder zu sich kommen." So führten sie ihn denn mit sich nach Hause.
Als man daselbst angekommen war, bat man die Frauen, hinauszugehen, denn man wollte ihnen den schrecklichen Anblick ersparen, ehe der Wilde nicht gebadet und geschoren sei. Denn Leib, Arme und Beine waren ihm ganz und gar mit spannenlangen Haaren überzogen. Sechs Wochen wurde er nun gebadet und geschoren, des Abends gesalbt und gerieben und Tag und Nacht mit guter Speise gepflegt, dergestalt, daß Hirn und Mark ihm wieder frisch ward und er menschliche Rede verstehen, reiten und gehen konnte. Da sah er einmal einen Falken bei der Wand auf dem Gestänge sitzen. "Kannst du damit umgehen?" fragten sie ihn. "Ei ja, gehörte der mir", entgegnete er, "da könnt' ich wohl mit beizen und jagen." Darüber lachte der Herzog und gab ihm vier Leute mit, die ihn bewachen sollten, wenn er in Toben geriete. Als sie nun draußen auf dem Gefilde waren, sahen sie einen Bussard fliegen. Kaum hatte der Wilde diesen erblickt, so ließ er den Falken schwingen und rief: "Bringe mir den Bussard, das gebiet ich dir, denn er muß mein sein!" Schnell schwang der Falke sich auf, noch schneller senkte er sich wieder und stieß den Bussard zu Tode. Da stürzte der Jüngling sich über den getöteten Vogel, biß ihm den Kopf ab, riß ihm Haut und Fleisch vom Leibe und warf Gebein und Gefieder in den Schmutz. Als die vier dies sahen, sprachen sie untereinander.: "Wir wollen ihn heimbringen, es scheint, er will wieder toben." Sie legten Hand an ihn, er aber rief: "Laßt mich hier draußen, bis wir einen Vogel erlegen, den wir dem Herzog bringen können." Da kam just hoch und schnell eine wilde Ente vorübergeflogen, der beizte der Falke nach, bis er sie herunterstieß. Sogleich sprang der Jüngling vom Rosse, nahm den Falken auf die Hand und streichelte ihm das Gefieder. Dann hob er die tote Ente auf und stieß sie in seine Jagdtasche. So ritten sie hinein: man brachte Wein und Brot und bewirtete sie wohl, wie es glücklichen Jägern geziemt. Der Herzog selbst setzte sich zu dem Wilden und trank und aß wacker mit. Man hatte ihm erzählt, was der Mann draußen getrieben: "Nun wird es ihm aber nicht erlassen," sprach er, "er muß sogleich ansagen, aus welchem Grunde er den Bussard so jämmerlich zerriß." Der Fremde zögerte zuerst: "Ihr würdet nimmer froh", sagte er, "erführt Ihr nur die Hälfte von dem, was Leides mir widerfahren ist." Dann aber begann er zu erzählen: und je mehr er erzählte, desto höher und klarer stiegen die Erinnerungen in ihm auf, bis er mit dem Raub des Ringes, der wilden Verfolgung des Bussards und seinem Irrgang in der Wildnis schloß. "Mir hätte der Tod nicht so weh getan", sagte er, "als daß ich die Allerliebste dort allein ließ und nicht weiß, wie es ihr geht. Denn sie war die Tochter eines Königs in Frankreich, ich aber bin von England her und auch eines Königs Sohn."
Als die Jungfrau dies vernahm, sprang sie auf und sank ihm weinend in die Arme, dann fiel sie ohnmächtig zu Boden. Der junge Fürst schwieg still, denn das Wort versagte ihm. Der Herzog aber, ohnmaßen froh über die Kunde, umfing sie beide und sprach: "Bist du meines Bruders Kind, so sei mir Gottwillkommen! Und ist jemand hier, dem meine Ehr' und Freude lieb ist, der trete auch herzu uud begrüße meinen Fürsten und Herrn!" Man geleitete sie auf die Sitze zurück, bot ihnen den Ehrenplatz und bewirtete sie noch reicher und edler denn zuvor. Dann gab der Herzog Befehl, zwölf stolze Ritter sollten sich zur Fahrt bereit halten, sechs gen England, sechs gen Frankreich. Als sie zu Paris ankamen, empfing der König sie ehrenvoll und ließ ihnen Rosse und Gewänder geben, als er die Botschaft vernahm. Grafen, Freiherren und Dienstmannen, alles, was von edlem Geschlechte an dem Hofe war, Ritter und Knappen wurden sogleich zur Fahrt gerüstet. Die Königin befahl ihren Jungfrauen, ihre festlichsten Kleider anzulegen und sich gleichfalls zur Reise bereit zu halten. So machte sich der glänzende Zug schleunig gen Engelstein auf.
Als man daselbst angelangt war, wurden auf dem Gefild die prächtigsten Lustzelte aufgeschlagen. Da kam auch schon der von England daher, reich mit Geleit und Rossen. Als man auf der Burg vernahm, daß beide Könige mit großem Gefolge angekommen seien, erschien der Junker mit vierundzwanzig Rittern, selbst ritterlich gekleidet, zu Rosse auf dem Plan, danach die junge Königin von Frankreich mit ihren Mägden. Ein Ausrufer verkündigte im Lande zweier Könige Hof, die ihre Kinder verloren und wiedergefunden hätten und nun die Vereinigung mit nie dagewesenen Lustbarkeiten zu feiern gedächten. Da kamen viele Bischöfe und Herren des Landes auf das liebliche Gefild bei Engelstein, und Frauen und Männer drängten sich stürmisch heran. Vierhundert Spielleute machten Musik und war keiner unter ihnen, der nicht Stoffe und Kleider zum Lohn erhalten hätte. Der Junker wurde zum Ritter geschlagen und warf, desgleichen die Braut, güldene Pfennige unter die Menge, als der Hochzeitszug sich über den Platz bewegte. Da wurde reich gegessen, getrommelt, gepfiffen und gefiedelt, turniert und gestochen, bis endlich das Fest zu Ende ging. Als man nun den Junker fragte, wo er wohnen wolle, in Paris oder England, entschied er sich für beides abwechselnd, erhielt von seinem Vater Städte und Burgen und lebte mit seinem lieblichen Gemahl in Glück und Herrlichkeit bis sein sein Ende.
Crescentia
Einst herrschte zu Rom ein König, mit Namen Narcissus, dem hatte das Schicksal alles geschenkt, bis auf eins: er besaß keinen Erben. Da gebot er seinen Untertanen, fleißig zu Gott zu beten, daß er seines Kummers befreit und ihm ein Sohn geboren würde. Kurz darauf genas seine Gemahlin, die Königin Elisabeth, lieblicher Zwillinge, deren jeder Dietrich genannt wurde. Als nun der König und die Königin starb, entstand im Reiche große Not, da man nicht wußte, welchem von den beiden Brüdern das rechtmäßige Königtum gebührte. Da gebot der Papst, daß derjenige König werden sollte, der zuerst ein Weib gewinnen würde. So erzog man denn die beiden edlen Kinder, bis sie so weit herangereift waren, daß sie Schwerter tragen konnten.
Nun besaß ein König in Afrika eine wunderschöne Tochter, Crescentia mit Namen, um die bewarben sich die Brüder beide, von gleicher Liebe entflammt. Der Vater wunderte sich darob, der Senat aber entschied, man solle den Streit also schlichten, daß ein Ring gebildet werde: welchen dann die Jungfrau wolle, dem möge das Reich gehören. Nun war der eine Dietrich ein Held von erlesener Schönheit und wurde im Land nicht anders als der schöne Dietrich genannt, der andre aber war schwarz und von fahler Gesichtsfarbe, so daß er allgemein nur der ungetane Dietrich hieß. Als sie sich nun aber beide in den Ring begaben, wählte die Jungfrau nicht den schönen, sondern den häßlichen von ihnen, dem also Rom und der Lateran von diesem Tage an untertänig wurden.
Kaum war der ungetane Dietrich zum Königtum gelangt, so gedachte er mit einem kräftigen Heere über Meer zu ziehen, um daselbst einen mächtigen König zu bezwingen. Da befragte er seine Ratgeber, wo er indessen sein schönes Weib lassen solle, daß sie in Ehren seiner Rückkunft harre. Sie rieten, er möge sie heim in ihr Land, zu ihrem Vater senden, da wäre sie in guter Hut. Aber den König





























