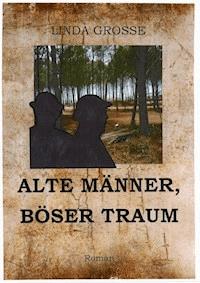
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sigurd Plastrothmann, der homosexuelle Staranwalt der Rechten, liebt sein lockeres und ungebundenes Leben, ohne zu realisieren, dass Heinrich, sein Großvater und Mentor, besonderes in der Politik mit ihm vorhat. Als ehemals hochdekorierter Offizier während des Nationalsozialismus, ging er mit seinem Enkel von dessen Kindheit an zielstrebig vor. Plastrothmann ist ein treuer Kunde der Berliner Blumenhändlerin Clea Neumann. Deren sonst so ruhiges Leben ändert sich schlagartig, als der junge Maler Nikolas (Nikki) sein Atelier über ihrem Laden bezieht. Durch ihn kommt Clea mit rechtsradikalen Kreisen in Berührung, ohne sich dessen bewusst zu sein. Auch der sich entwickelnden Beziehung zwischen Sigurd und Nikki steht sie lange ahnungslos gegenüber. Während einer Wahlparty lernt Clea Heinrich Wagner kennen. Nikkis Beziehung zu Sigurd stellt für Heinrich Wagner eine langsam wachsende Bedrohung seiner ehrgeizigen Pläne dar. Als graue Eminenz der Partei will er, ermutigt von hochrangigen Persönlichkeiten, seinen Lebenstraum verwirklichen: Die Partei in den Bundestag bringen. Gemeinsam mit Hauptkommissar Krieger und seinem Enkel erarbeitet er ein Konzept, in welchem der charismatische Fabrikant Thomas Rautenberger eine wichtige Rolle spielen soll. Als die Affäre zwischen Plastrotmann und dem Maler in der Öffentlichkeit bekannt zu werden droht, wird kurzerhand dessen Beseitigung angeordnet. Clea ist geschockt, als Nikki eines Tages tot aufgefunden wird. Durch die Ermordung des Malers zerbricht die jahrelange Freundschaft zwischen Thomas Rautenberger und Sigurd Plastrothmann. Hauptkommissar Krieger wittert darin die lang ersehnte Chance, Heinrich Wagner zu beerben. Doch er hat die Rechnung ohne eine, für ihn unbedeutende Randfigur gemacht, den V-Mann vom Verfassungsschutz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Linda Große
Alte Männer - böser Traum
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Erster Teil: Beziehungsweisen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Zweiter Teil: Machtarten
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Dritter Teil: Erinnerungsformen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Impressum neobooks
Vorwort
Alte Männer, böser Traum
Sigurd Plastrothmann, der homosexuelle Staranwalt der Rechten, liebt sein lockeres und ungebundenes Leben, ohne zu realisieren, dass Heinrich, sein Großvater und Mentor, besonderes in der Politik mit ihm vorhat. Als ehemals hochdekorierter Offizier während des Nationalsozialismus, ging er mit seinem Enkel von dessen Kindheit an zielstrebig vor.
Plastrothmann ist ein treuer Kunde der Berliner Blumenhändlerin Clea Neumann. Deren sonst so ruhiges Leben ändert sich schlagartig, als der junge Maler Nikolas (Nikki) sein Atelier über ihrem Laden bezieht. Durch ihn kommt Clea mit rechtsradikalen Kreisen in Berührung, ohne sich dessen bewusst zu sein. Auch der sich entwickelnden Beziehung zwischen Sigurd und Nikki steht sie lange ahnungslos gegenüber. Während einer Wahlparty lernt Clea Heinrich Wagner kennen. Nikkis Beziehung zu Sigurd stellt für Heinrich Wagner eine langsam wachsende Bedrohung seiner ehrgeizigen Pläne dar. Als graue Eminenz der Partei will er, ermutigt von hochrangigen Persönlichkeiten, seinen Lebenstraum verwirklichen: Die Partei in den Bundestag bringen.
Gemeinsam mit Hauptkommissar Krieger und seinem Enkel erarbeitet er ein Konzept, in welchem der charismatische Fabrikant Thomas Rautenberger eine wichtige Rolle spielen soll. Als die Affäre zwischen Plastrotmann und dem Maler in der Öffentlichkeit bekannt zu werden droht, wird kurzerhand dessen Beseitigung angeordnet. Clea ist geschockt, als Nikki eines Tages tot aufgefunden wird.
Durch die Ermordung des Malers zerbricht die jahrelange Freundschaft zwischen Thomas Rautenberger und Sigurd Plastrothmann. Hauptkommissar Krieger wittert darin die lang ersehnte Chance, Heinrich Wagner zu beerben. Doch er hat die Rechnung ohne eine, für ihn unbedeutende Randfigur gemacht, den V-Mann vom Verfassungsschutz.
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden.
Die Personen, wie sie im Roman beschrieben werden, leben in der Vorstellung des Autors.
Erster Teil: Beziehungsweisen
Kapitel 1
Der Staatssekretär legte die Fingerspitzen aneinander und trommelte mit den Zeigefingern im steten Rhythmus auf seine Unterlippe. Er war sich seiner schönen Hände sehr bewusst. Deshalb besaß er ein beachtliches Repertoire an Gesten, die seine feingliedrigen, aber nicht zu dünnen, langen Finger mit den wohlgeformten, perfekt gepflegten Nägeln für sein jeweiliges Gegenüber zum Blickpunkt machten.
Viele Frauen, die ihn als treuen, regelmäßigen und gutsituierten Kunden schätzten, lobten sie wiederholt mit erfreulichem Enthusiasmus. Aufgrund seiner nicht unbeträchtlichen Bezüge aus verschiedenen Quellen konnte er sich Dienstleistungen jeder Art leisten, die das Leben eines Junggesellen mit angenehmen Verzierungen, wie er es nannte, bereicherten.
Bei seinem Gegenüber zeigte sich keinerlei Wirkung, auch das war ihm bewusst, doch nicht der Grund dafür, das Stakkato zu beenden. Er hatte etwas zu sagen. Etwas Bedeutsames!
„Die Zeit ist reif.“
Da sich keine erkennbare Reaktion zeigte, wiederholte er den Satz ohne ein Anheben der Lautstärke, jedoch mit veränderter Modulation.
„Die Zeit ist reif!“
Heinrich Wagner nickte nun unmerklich und der Staatssekretär gab für einen Moment seine Attitüde auf, ließ sich zurückfallen in den ledernen Fauteuil, der unter seinem Fliegengewicht lediglich ein schwaches Knarren von sich gab.
„Die Zeit ist reif“, wiederholte Heinrich nun, tonlos, so als wäre er überrascht oder sogar überfordert. Der schmalschulterige Oberkörper des Staatssekretärs schnellte nach vorne, als würde er von einem unsichtbaren Mechanismus gesteuert. Automatisch brachte er auch wieder seine, eben noch sehr entspannt auf den Armlehnen ruhenden Hände in den Vordergrund. Die Handflächen nach oben gewandt, schob er sie dem alten Mann entgegen.
„Das ist ein klarer Auftrag die Partei nach vorne zu bringen!“
Erneut nickte Heinrich Wagner. Auf seinem strengen Gesicht, in das die Disziplin ihre steinernen Spuren gemeißelt hatte, war nicht der geringste Funke einer Emotion zu erkennen.
Obwohl er den Alten gut kannte, machte der Staatssekretär eine ungehaltene Geste. Seine rechte Hand zerschnitt in einer schnellen Bewegung den starren Blick seines Gegenübers, als könne er dadurch dessen verborgene Gedankengänge sichtbar machen.
„Wir erwarten Ergebnisse, baldige Ergebnisse. Der Tag hat sich genaht. Die Nacht ist vorbei. Licht strahlt auf am Horizont! Der Kommunismus ist schon lange tot, verwest, verschwunden. Der Kapitalismus ist genauso zum Sterben verurteilt. Die Globalisierung reißt die Maske vom Gesicht dieses Zombies namens Wachstum. Die Politik ist zur Hure der Wirtschaft verkommen. Unsere Zeit ist da, das Warten ist vorbei!“
Während dieser flammenden Rede seines unscheinbaren Besuchers im eleganten Armani Anzug genoss Heinrich die Genugtuung im Innern, die sich ausbreitete wie ein sanftes Glühen in seiner Brust. Fast sechzig Jahre hatte er auf diesen Tag gewartet. Nicht untätig gewartet. Ganz im Gegenteil. Er hatte seinen Enkel erzogen, geschult, ja geformt, für diese Aufgabe, die nun in seine Hände gelegt werden sollte. Der letzte Schliff würde nicht mehr viel Zeit beanspruchen. Er war dieser Aufgabe unzweifelhaft gewachsen. Dafür war er selbst der Bürge. Vier Jahrzehnte, beginnend mit dem ersten Atemzug des Jungen, hatte er nichts dem Zufall überlassen.
Sein Blick fiel auf den schweren, eichenen Schreibtisch. Er entstammte dem Besitz einer jüdischen Bankiersfamilie, hatte die Kristallnacht ohne nennenswerte Beschädigung überstanden, im Gegensatz zu seinem damaligen Besitzer. In Heinrichs Gedächtnis existierte diese Tatsache nicht. Es war sein Schreibtisch! Er stand ihm zu! Er hatte so viele Opfer gebracht in seinem Leben. Fast sechs Jahrzehnte hatte er gewartet auf die Morgendämmerung: Geduld geübt, Selbstbeherrschung bekundet, grenzenlose Selbstbeherrschung. Sogar auf die Macht, Leben zu geben und Leben zu nehmen verzichtete er von dem Tag an, als er die Uniform ablegen musste.
„Das Volk braucht Führung“, drang die Stimme des Staatssekretärs in seine Überlegungen. „Es weiß nur nicht, wo es sie findet. Die Wahlbeteiligung sinkt seit Jahren drastisch. Es gibt keine Alternativpartei. Wir werden sie schaffen. Erneuerung! Das ist der Auftrag!“
„Der Auftrag der Vorsehung“, ergänzte Heinrich. „Wir werden ihn ausführen, wir sind bestens dafür gerüstet. Teilen sie das den Herren mit!“
Kapitel 2
11 Uhr 45, Samstag. Auftritt Plastrothmann! Wie immer ließ er sich für eine Nanosekunde durch das blecherne Gebimmel der altmodischen Ladenglocke ablenken. Als der Türdrücker ruckelnd die Tür hinter ihm zuschob, trat ein aufmerksamer Ausdruck in seine, gegen die Ladendecke gerichteten Augen. Dann senkte er gemächlich den kahlrasierten Schädel, während sein Blick an den Blumenkübeln entlang surfte, bis er an der Sorte hängen blieb, die er kaufen würde.
Clea amüsierte sich verstohlen darüber, wie er seinen massigen Körper mit leicht mäanderndem Hüftschwung durch den Laden schob. Er war weit über 1,90m groß, allerdings kein Problem für ihren kleinen Laden: Altbau mit hoher Decke. Doch seine Riesenlatschen manövrierte er haarscharf an den Eimern mit den Schnittblumen und den Blumentöpfen vorbei, die nur eine schmale Gasse bis zur Ladentheke frei ließen.
„Guten Tag, Frau Blume!“
„Guten Tag, Herr Anwalt.“
Dieser Teil des Rituals zeichnete nach wie vor eine Prise Verärgerung in ihre Mimik. Aber Plastrothmann schien absolut unsensibel zu sein, was die Gefühle seiner Mitmenschen betraf. Clea akzeptierte das eher zähneknirschend, schließlich war er seit der Geschäftsgründung ihr treuer Stammkunde. Samstag für Samstag. Acht Jahre lang. Acht lange Jahre! Und in wenigen Stunden würde ihr erster Urlaub beginnen. Zwei Wochen in Frankreich. Das bedeutete drei ganze Wochen ohne Plastrothmann!
„Die Tulpen, bitte.“
Das hatte sie schon vorher gewusst. Seine eingeschränkte Auswahl war durch die Jahreszeiten festgelegt. Tulpen, Nelken, Chrysanthemen. Rosen zu besonderen Anlässen. Und unbedingt mit Asparagus! Sie führte das Spargelgrün extra seinetwegen. Ihr freundlicher Hinweis, das Zeug sei Mega out, hatte ihn genauso wenig tangiert wie die schroffe Bemerkung, das “Frau Blume“ wäre einzig und allein für den Postboten reserviert.
Und nun also gelbe Tulpen mit Asparagus. Plastrothmanns Mutter akzeptierte nichts anderes. Anscheinend hat der Mann seine Sturheit von ihr geerbt, dachte Clea, als sie ihm beim Abreißen der Folie den Rücken zuwandte. Absichtlich hantierte sie ziemlich ungeschickt herum, nur um den Moment hinauszuzögern, da sie ihn wieder ansehen musste. Meine Güte, dachte sie, meine Nerven liegen wohl wirklich ziemlich blank. Der Typ kauft doch seit Jahren jeden Samstag bei mir ein! Also zwang sie ein freundliches Lächeln auf ihr Gesicht und drehte sich um. Wortlos schlug sie den Blumenstrauß in die Klarsichtfolie ein, befestigte einige Kräusel aus gelbem Geschenkband und reichte ihm das fertige Gebinde über die Ladentheke.
Er fingerte das Portemonnaie aus der Gesäßtasche seiner knallengen Jeans, deren Bund von seiner ausufernden Taille überschwemmt wurde. Als endlich die Ladentür hinter ihm und seinen gelben Tulpen mit reichlich Asparagus zufiel, fühlte sie sich plötzlich total erleichtert. Ein Blick auf die Uhr: Noch 42 Minuten bis Ladenschluss. Und Urlaubsbeginn! Drei Wochen ohne Plastrothmann! Einfach traumhaft!
Marlies Wittke stürmte mit der ihr eigenen Vehemenz herein. Nur sie brachte die Türglocke derart unverkennbar zum Scheppern.
„Na“, strahlte sie Clea an. „Schon ordentlich Reisefieber?“
Ohne eine Antwort abzuwarten holte sie eine Flasche Sekt aus ihrem Korb und dazu zwei Sektgläser.
„Eiskalt, gerade aus der Tiefkühltruhe. Ist reisefiebersenkend und steigert gleichzeitig die Stimmung!“
„Du hast Ideen! Aber nur ein Glas. Ich muss nachher gleich als Erste fahren. Simon braucht sein Mittagsschläfchen. Auch im Auto!“
„Das wird dir gut tun. Der Urlaub, meine ich“, sagte Marlies, alle wohlwollende Mütterlichkeit in ihren Blick legend, die sie aufbieten konnte.
„Ich freu mich so“, sagte Clea, „bin schon ganz hibbelig. Ich war noch nie in der Normandie. Veules les Roses, das hört sich richtig romantisch an.“
„Der richtige Urlaubsort für eine Blumenfrau“, meinte Marlies. „Es wird dir garantiert gefallen.“
Mittlerweile war sie wirklich mehr als urlaubsreif. Der nötige Anstoß für diese Reise kam im Sommer letzten Jahres von Marlies. Ungewohnt enthusiastisch war ihre Beschreibung dieses kleinen, verschlafenen Ortes an der normannischen Steilküste ausgefallen. Allein der Name klang für Clea schon wie ein Gedicht: Veules les Roses. Sie bemerkte erstaunt, wie ihre Augen plötzlich feucht wurden vor lauter Dankbarkeit, räusperte sich und schlürfte verlegen ihren Sekt. Marlies, genauso sensibel wie laut, entging das trotzdem nicht. Sofort verfiel sie in einen burschikosen, fast ruppigen Tonfall.
„Eigentlich wollte ich nur sehen, ob ich jetzt noch billig jede Menge Blumen absahnen kann, wo du doch so lange dicht machst!“
„Klar doch“, antwortete Clea und kam hinter dem Ladentisch hervor. „Ist aber leider nicht mehr viel da. Das Schild mit der Urlaubsankündigung war äußerst verkaufsfördernd.“
Marlies Wittke wartete geduldig bis Clea den Strauß zusammengebunden hatte.
Kurz darauf rauschte sie mit einem Arm voller Blumen genauso vehement aus dem Laden, wie sie ihn betreten hatte. Augenblicklich wurde es greifbar still in dem, jetzt verödet wirkenden Raum. In den Eimern ruhten die dunklen Scheiben der ungetrübten Wasseroberflächen. Vereinzelte, abgerissene Blätter lagen unbeweglich auf den glatten Spiegeln. Die verbliebenen Pflanzen wirkten wie Eindringlinge zwischen den Spuren des Tages. Auf dem gefliesten Boden setzten grüne Sprenkel von Blattteilen ein unregelmäßiges Feierabendmuster. Clea drehte sich mit ausgebreiteten Armen um sich selbst. In einer Stunde fängt mein neues Leben an! Mit einem Supertraumurlaub!
„1.September 39, da haben wir in Köln Dünnwald in Bereitschaft gelegen. Ich war Gefreiter Luft. Nachrichten. Mit allen Geräten. Da hatten wir einen Spieß! Hab mir immer gewünscht, das Arschloch würde mir noch mal über den Weg laufen!“
„Simon“, unterbrach Cleas Stiefmutter ihren Mann, „muss das sein? Solche Ausdrücke in der Öffentlichkeit?“
„Ist doch niemand hier, außer uns“, versuchte Clea sie zu beschwichtigten und schaute sich in dem leeren Speisesaal des Motels um. Ihr Vater ließ sich von seiner Frau nicht aus dem Konzept bringen: „Ich muss mich nicht dafür schämen, bei der Wehrmacht gewesen zu sein! Da gibt es andere! Rauhut hieß der Kerl. Walter Rauhut. ‘Ich – und – mein - Führer’, so stand der immer vor uns Soldaten. ‘Ich – und – mein – Führer‘. Beim ersten Einsatz war ‘Ich – und – mein - Führer’ weg. Spurlos verschwunden!“
„Und ich verschwinde jetzt in die Heia!“, erklärte Clea. „Habe schließlich einen extrem langen Tag hinter mir. Gute Nacht ihr zwei!“
Sie gab ihrem Vater einen Kuss auf die Wange. Dann war Lilo dran, weich und puderig. Zum ersten Mal fiel Clea auf, dass sie ihre Stiefmutter noch nie ungeschminkt gesehen hatte. Auch das Hotelbett war weich. Eigentlich zu weich, aber irgendwie doch ganz angenehm. Clea kuschelte sich richtig ein und wunderte sich nach einer halben Stunde darüber, dass sie immer noch nicht eingeschlafen war. Die roten Ziffern der Uhr machten beim Wechsel der Zahlen ein leises Tack-Tack. Draußen rauschten unvermindert die Autos über den Asphalt. Verdammt, dachte Clea, mein Urlaub wird doch nicht mit einer schlaflosen Nacht anfangen?
Kapitel 3
Heute wollte er sich einen Cognac gönnen. Das spartanische Abendessen stimmte nicht mit seinen Empfindungen überein. Den guten, französischen Cognac in dem großen Cognacschwenker, dessen Boden seine ganze Handfläche ausfüllte. Er begab sich gemessenen Schrittes zu dem Bücherschrank, in dem sich ein kleines, mit einer Klappe versehenes Barfach befand. Die selten gebrauchte Flasche stand gleich vorne, neben einem Kräuterlikör. Er nahm sie heraus, schloss die, durch Klavierband gehaltene Tür und entnahm der daneben stehenden Vitrine das Cognacglas und füllte das Glas fast zur Hälfte. Nun wandte er seine volle Aufmerksamkeit dem Glas zu, schwenkte es mit kurzen Drehbewegungen, bis die goldbraune Flüssigkeit Kreise zog. Er führte die Öffnung zu seinem Gesicht und sog den Duft ein. Langsam schob er die Lippen um den Rand und nippte behutsam etwas von dem Cognac. Die Wirkung erfolgte sofort. Der Geschmackssinn aktivierte Gefühle, die auf längst vergangenen, guten Erinnerungen beruhten. Gute Gefühle, angenehme Empfindungen, das hatte er sich jetzt wirklich verdient.
Zufrieden setzte sich Heinrich wieder in seinen Sessel hinter dem Schreibtisch. Auf der Platte ausgebreitet lagen die Orden und Ehrenzeichen, die ihm damals während des Krieges verliehen wurden. Heute gab er sich dem Luxus hin, in angenehmen Erinnerungen zu schwelgen. Sein größter Stolz, das Ritterkreuz, lag in der Mitte der beachtlichen Ansammlung.
Erneut nahm er einen Schluck Cognac zu sich, lehnte sich entspannt zurück und dachte an die Situation die ihn, relativ jung, zum Major und Ritterkreuzträger gemacht hatte. Mutig und entschlossen war er gewesen. Angst hatte er nicht verspürt. Einfach den Befehl erteilt, die Geschütze zu wenden, um auf die russischen LKWs zu schießen. Eine gelungene Anweisung! Dadurch war seine Truppe rausgekommen. Obwohl sie fast noch gescheitert wären an diesem Fluss, dessen Namen er mittlerweile vergessen hatte. Dieser Gefreite mit seinem Krad. Ein verwegener Kerl, leider mit einem herben Mangel an Disziplin. Ohne den Befehl abzuwarten, reagierte er auf die, schwer einzuschätzenden Handzeichen der russischen Bauern am gegenüber liegenden Ufer. Mit Vollgas war er in den Fluss gerast. Und hatte so die Furt entdeckt.
Es klopfte an die Tür des Büros, und Henriette betrat den Raum.
„Ich gehe jetzt zu Bett. Kann ich Ihnen vorher noch irgendetwas bringen?“ So entspannt durch den Alkohol erfreute ihn ihre gewohnte Unterwürfigkeit. Diese Freude wollte er auskosten.
„Mach mir doch noch ein Spiegelei. Mit Speck, knusprig gebraten. Und eine Scheibe getoastetes Graubrot dazu.“
Henriette ließ sich ihre Überraschung nicht anmerken, fragte lediglich: „Hier oder im Esszimmer servieren?“
„Hier.“
Er verspürte nicht den geringsten Appetit auf Spiegelei mit Speck, auch keine Spur von Hunger, aber es tat gut, einen so brav befolgten Befehl zu erteilen. Henriette war die vollkommene Dienerin schlechthin. Es sollte mehr solcher Frauen geben, dachte er. Für Sigurd hatte er bereits eine solche Frau gefunden. Und er würde sie, zum Wohle der Partei, bald ehelichen. Daran hegte er keinen Zweifel, auch wenn sein Enkel noch nichts davon wusste. Er war immer ein gehorsamer Junge gewesen. Man musste ihm nur genug Leine lassen.
Das uralte Rezept: Brot und Spiele. Ließ man ihm seine Spielchen, funktionierte er brav. Zur Lenkung gehörte zwar ab und an auch etwas Druck, aber der sollte möglichst unmerklich erfolgen. Er lachte leise vor sich hin. Der Höhepunkt seiner mühevollen Arbeit lag in greifbarer Nähe. Nichts würde seine Pläne stören können. Menschen zu lenken, das war seine Gabe. Und Sigurd war schon immer Wachs in seinen Händen gewesen, ganz anders als dessen Vater. Leichtsinn und Eigensinn hatten ihn ungeeignet gemacht für den Dienst am Vaterland. Wie gut, dass die Vorsehung auch Herr über die Zeit ist, dachte Heinrich und spülte die unangenehme Erinnerung an Albert mit einem großen Schluck Cognac hinunter. Und trotz allem konnte schließlich auch Albert seinen Teil dazu beitragen. Ja, Menschenführung, dass war die Gabe, die ihn ausmachte und erfüllte. So hatte er letztlich auch Albert in sein gut vorbereitetes Netz einbeziehen können.
Henriettes Klopfen überhörte er dieses Mal, eingesponnen in seine wohltuenden Erinnerungen. Sie stellte den Teller vor ihn hin, wünschte guten Appetit und verschwand wieder.
Der Anblick des gebratenen Eies mit dem Speck löste die nächste Erinnerung aus. Der Rückzug. Das russische Dorf. Seine Männer jagten die Hühner, die russischen Frauen kochten sie in einem großen Kessel. Und damit das Warten nicht zu lang wurde, brieten die Russen einige Eier. Dafür teilten seine Männer die Hühnersuppe mit den Bauersleuten. Wortführer dabei war wieder dieser Kradfahrer. Er holte alle an den Tisch, so als wären es Kameraden. Mit einer unbewusst heftigen Bewegung kippte Heinrich den letzten Schluck Cognac in sich hinein, schlug mit geballter Faust auf den Schreibtisch und verkündete laut:
“Die Zeiten sind vorbei. Es wird wieder gehorcht!“
Kapitel 4
„Ganz ruhig, mein kleiner Kaspar! Mami ist ja bei dir!“
Seit Stunden wiederholte Lilo diesen Satz. Als wenn der sowieso total apathische Mops, der wie eine schlecht gestopfte Wurst auf dem Rücksitz lag, diesen Zuspruch nötig hätte. Dafür entfaltete er seine hypnotisierende Wirkung ungewollt bei Clea. Sie hing mit hin und her pendelndem Kopf schlafend in ihrem Sicherheitsgurt. Simon war trotz seines hohen Alters fast die gesamte Strecke von Köln aus alleine gefahren. Die Nacht im ungewohnten Bett hatte ihm anscheinend weniger zugesetzt als seiner Tochter und seiner Ehefrau. Lilo war nicht bloß müde, sondern unüberhörbar entnervt. Seit sie durch Frankreich fuhren, erklärte sie alle fünf Minuten, sie fühle sich völlig “derangiert“.
Das konnte Simons guter Laune allerdings nicht das Geringste anhaben. Seit sie kurz hinter Mons die belgisch-französische Grenze überquert hatten, summte er immer wieder die französische Nationalhymne vor sich hin. Schließlich sang er laut die erste Zeile. Mehr vom Text konnte er zu Lilos Leidwesen nicht. So fing er immer wieder von vorne an: „Allons enfants de la patriiiiije...“
Die vielen i’s holten Clea endgültig aus ihrem unruhigen Schlummer. Auch Kaspar schreckte hoch. Wenn man bei seinen trägen Bewegungen überhaupt von Aufschrecken reden konnte. Jedenfalls öffneten sich die speckigen Fellröllchen um seinem Maul und er stieß einen hohen, langgezogenen Ton aus. Der hörte sich nicht im Entferntesten nach Hundegebell an. Eher nach dem Gesang eines Wals, fand Clea. Der nächste Urlaub geht nach Grönland, Wale beobachten, dachte sie, aber ohne das Hundevieh!
„Ganz ruhig mein kleiner Kaspar, Mami ist ja bei dir“, säuselte Lilo und knetete die Speckröllchen in Kaspars Genick. „Papi hat gute Laune“, erklärte sie dem Mops. Der ließ daraufhin augenblicklich seine Stimmmuskeln gemeinsam mit den Halsmuskeln erschlaffen und lag erneut so reglos wie zuvor.
„Du hast den armen Hund erschreckt, Simon!“, wandte sich Lilo nun an ihren Mann. Da Clea absolut keine Lust auf Diskussionen über Kaspars Seelenleben verspürte, schlug sie schnell eine kleine Pause vor:
„Bisschen die Beine vertreten.“
Ihr Vater war einverstanden.
„Ist schon nach zwölf. Mir wäre auch nach Mittagessen. Danach könntest du weiterfahren. Langsam spüre ich meine alten Knochen.“
Eigentlich war Clea überhaupt nicht hungrig. Sie konnte es kaum erwarten, endlich ans Ziel zu kommen. Doch leider befand sie sich in der Minderheit. Lilos Tonlage wechselte überraschend in erwartungsvolle Fröhlichkeit. Schließlich war die französische Küche bekannt für ihre Gaumengenüsse! Allerdings vertrat sie, rein verbal, in erster Linie die Bedürfnisse ihres armen Hundes.
„Kaspar muss unbedingt Gassi gehen!“
Drei zu eins, dachte Clea ergeben. Während Lilo den Hund an der Leine über den Parkplatz zu einem Baum zerrte, lehnte Clea sich mit dem Rücken an den Wagen und sah ihrem Vater zu, wie er einige halbherzige Kniebeugen machte. Der Parkplatz war ziemlich leer bis auf eine Reihe von Trucks.
Sie beobachtete amüsiert wie ihre Stiefmutter Kaspar zum nächsten Baum schleifte. Anscheinend gefiel dem Mops der trostlose Parkplatz genauso wenig wie Clea.
Eine Trostlosigkeit, die das Herz erwärmt! Marlies Wittkes Beschreibung ihrer Urlaubseindrücke fiel ihr plötzlich ein. Hatte so ungewohnt poetisch geklungen. Jedenfalls aus dem Mund von Marlies. Plötzlich zweifelte sie für einen Moment, ob die Wahl des Urlaubsortes wirklich die richtige war. Was hatte sie bloß an Trostlosigkeit anziehend gefunden? Allerdings erklärte Marlies anschließend sehr überzeugend, seit Jahren habe sie sich nirgends so wohl gefühlt und so gut erholt. Eine Entdeckung, eine wirkliche Entdeckung. Aber du solltest hinfahren, wenn die Rosen blühen! Die wiederholten Schwärmereien ihrer einzigen Freundin lösten dann allmählich den Wunsch aus, ihre seit acht langen, einsamen Jahren andauernde, selbst gewählte Isolation zu beenden. Mal wieder die Nase in die Welt stecken, in das Leben. Die wenigen Menschen, mit denen sie eher nur ein Hauch von zwischenmenschlichen Beziehungen verband, redeten ihr alle gut zu. Obwohl außer ihrem Vater keiner von ihnen den Grund für ihr selbst gebasteltes Schneckenhaus kannte, sagten alle irgendwie das Richtige. Et voila! Hier war sie also, in Frankreich!
Als sie nach dem Essen die Autobahn verließen und auf schmaler, schnurgerader Landstraße Richtung Amiens fuhren, war Clea überrascht, wie hoch sich der Himmel über der flachen, baumlosen Landschaft wölbte. In Berlin sah sie ihn meistens nur Stückchenweise. Selbst vor ihrem Wohnzimmerfenster im dritten Stock eines typischen Berliner Altbaus, erschien er nur als schmaler Streifen über der Straßenschlucht. Ihr Vater hingegen wurde von ganz anderen Sachen angeregt. Die Hinweisschilder ließen bei ihm erneut alte Kriegserlebnisse lebendig werden.
„Über Stadtkyll, Eupen, Malmedy sind wir rein. 15. November 39. Die erste große Panzerschlacht. Philippsville? Ich glaube, so hieß es. Die ersten Gräber! Meine Güte, ein Schock! Dann Amiens. Das war die richtige Feuertaufe. An der Somme von der französischen Artillerie eingedeckt. Von da nach Montedier, da bekam ich die Ruhr. Es ging auf Leben und Tod im Lazarett! Ist übrigens im Soldbuch bescheinigt. Kann ich dir zuhause mal zeigen. Sollte dann in die Heimat kommen, zum Aufpäppeln. Ging aber nicht, obwohl mir Genesungsurlaub zustand. Kam zurück zur Truppe. Die war in Amiens, in der Ecole St. Martin untergebracht. Da wurde ich dann Kradmelder. Eine Zeitlang den Cheffahrer vertreten, den Kommandanten gefahren. Danach wurden wir verladen, über Karlsruhe nach Sizilien.“
„Nun hör endlich auf damit, Simon! Clea kann sich ja gar nicht aufs Fahren konzentrieren“, ermahnte Lilo ihren Mann. „Und außerdem redest du doch sonst nie über solche Sachen!“
Stimmt, dachte Clea. Die Gegend muss bei ihm ja heftig Erinnerungen auslösen. Trotzdem kam ihr Lilos Ermahnung recht. Es fiel ihr wirklich schwer, sich auf die Hinweisschilder, das Fahren und Simons Erzählung zu konzentrieren. Außerdem lenkte die Aussicht sie immer wieder ab. Dazu stand auch noch die Sonne voll über der Windschutzscheibe und sie fühlte sich wie ein pochierter Rollbraten. Der Schweiß quoll aus sämtlichen Poren und sie lechzte nach einer erfrischenden Dusche. Für ein Bad im Atlantik war es um diese Jahreszeit wohl noch zu kalt. Lilo und ihre vertrackte Flugangst! Und natürlich Kaspars sensible Psyche! Vierzehn Tage in einer Hundepension hätten, nach Lilos Ansicht, den Hund unweigerlich in eine schwere und bleibende Psychose gestürzt.
Wo sie diese Weisheiten nur her hat, fragte sich Clea zum wiederholten Male. Lilos Statements zu sämtlichen, für sie schwerwiegenden Fragen des Lebens, sorgten entweder für amüsante Momente oder peinliche Augenblicke. Dazu kamen sie meistens völlig unerwartet. In der Regel, wenn Simon und Clea total entspannt und zufrieden waren, nicht einmal den Hauch eines Problems erahnten. Aber Lilos Horizont reichte eben weiter, viel weiter. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie bei ihren häufigen Arztbesuchen regelmäßig diese Frauenblättchen las. Clea fragte sich, ob Lilo nicht bloß aus diesem Grund ständig den Arzt aufsuchte, nämlich um ungestört diese Heftchen lesen zu können, ganz ohne Gesichtsverlust. Bei dem Gedanken musste sie unwillkürlich kichern.
„Mir ist das Lachen mittlerweile vergangen!“, meldete sich Lilo prompt. „Hier hinten ist es wie im Backofen. Umluftbackofen. Heiß und zugig! Sind wir nicht bald da?“
„Beim letzten Hinweisschild waren es noch 16 km“, antwortete Simon. Er wischte sich erneut Stirn und Nacken mit seinem völlig durchweichten Taschentuch.
“Wer ist bloß auf die Idee gekommen, mit dem Auto hierher zu fahren?“
Lilo als kluge Ehefrau wusste, wann es angebracht schien, eine Bemerkung zu ignorieren und erwiderte nichts darauf. Sie durchfuhren gerade wieder einen kleinen, verschlafenen Ort. Hinter hohen Hecken reckten sich die Erker und Türmchen verträumt wirkender Häuser.
„Richtige Schneewittchenschlösser“, staunte Clea. Schweres Gebälk rankte sich in anmutigen Schwüngen um die zahllosen, spitzen Giebel. Hinter einer Biegung eine hohe, gestutzte Baumreihe und überraschend plötzlich war der Ort zu Ende. Nur noch eine Fata Morgana im Rückspiegel. Ein Leinfeld in leuchtendem Gelbgrün veränderte unter einer plötzlichen Windbö seine Farbe. Wellenförmig erschienen sämtliche vorstellbaren Grüntöne auf der samtigen Fläche. Eine Möwe schaukelte mit dem Wind über dem Feld hin und her. Sie ließ ein aufgeregtes Kreischen hören, als gäbe es unter ihr irgendein Ärgernis. In einer Senke am Horizont lag das Meer.
„Schau Kaspar, das Meer“, ermunterte Lilo den hechelnden Mops. „Gleich sind wir da!“
„Jetzt eine kalte Dusche!“, verkündete Clea laut.
„Und ich bin froh, wenn ich meinen BH endlich loswerde. Er schnürt mich fürchterlich“, stöhnte Lilo. „Mit zunehmendem Alter macht die Gravitation meinem Busen ganz schön zu schaffen!“
„Gravitation?“, spöttelte Simon. „Laut Newton wirkt die auch schon bei Äpfeln. Und Apfelgröße hattest du zum Glück noch nie!“
„Männer!“, sagte Lilo.
„Väter!“, ergänzte Clea. „Je öller, je döller!“
Während Lilo sich darüber wunderte, dass alle Häuser Namen hatten, konzentrierte sich Clea auf die Wegbeschreibung. Sie fanden ihr Ziel ohne Probleme in dem kleinen Ort. Das graue Feldsteinhaus ruhte wie ein gestrandetes Schiff in einem wunderschönen romantischen Garten. Rosen rankten über Zäune, Wände und Blumengitter. Terrakottatöpfe mit blühenden Geranien säumten den Kiesweg. Dahinter die üppigen Polster von Lavendel mit einem ersten leisen Hauch von Blau über den Knospen. Und noch mehr Rosen aller Art und Couleur.
Der Weg verbreiterte sich und mündete in einen gepflasterten Hof. Mehrere schwere, weiß lackierte Tische mit den passenden Stühlen standen vor dem Haus, gusseisernes Rankwerk um Gestelle und Lehnen spiegelte die üppige Vegetation des Gartens wider. Kaspar schnupperte interessiert an einem Blumentopf und wollte gerade das Bein heben, als ihre Gastgeberin auf der Eingangstreppe erschien. Lilo zerrte an seinem Halsband. Nur widerstrebend ließ sich der Mops von seinem Vorhaben abbringen, das Terrain zu signieren. Also Kaspar gefällt es hier schon mal, dachte Clea.
„Herzlich willkommen. Ich bin Monique David.“
Ihr Deutsch war völlig akzentfrei. Von Marlies Wittke wusste Clea, dass Mme David in Deutschland aufgewachsen und zur Schule gegangen war.
„Bitte nennen Sie mich Monique. Wo haben Sie ihr Auto stehen? Ich zeige Ihnen gleich die Garageneinfahrt. Aber erst die Zimmer, dann können sie sich vor dem Begrüßungsdrink ein wenig frisch machen.“
„Ich hab vergessen das Auto abzuschließen“, entgegnete Clea.
„Ach, das macht nichts. Hier kommt nichts weg, keine Sorge.“
Kapitel 5
Das Wasser lief erfrischend kühl über ihren erhitzten Körper. Von Simon hatte sie sich zum ersten Pastis ihres Lebens überreden lassen. Der bewirkte jetzt ein sachtes Schwanken der Duschkabine. Duschen auf hoher See. So musste das sein, dieses leichte Trieseln im Kopf. Sie empfand es als sehr angenehm. Weshalb klagten die Leute immer über Seekrankheit? Dieses Schwanken wie bei Wellengang fand Clea gar nicht so übel.
Simon und Lilo hatten sich für ein Nickerchen zurückgezogen. Bis zum Abendessen war noch genügend Zeit. Und Clea drängte es ans Meer. Während sie im Garten ihre Drinks genossen hatten, schwebten einige Möwen von einer Windbö getragen auf den Dachfirst hinauf und ließen einen langgezogenen Klageschrei hören. Cleas Magen hatte sich bei dem Ton heftig zusammengezogen. Fast so heftig wie damals, als sie sich in Friedemann verliebte. Jedenfalls löste der Schrei der Möwe in ihr sehnsüchtig den Drang aus, sofort ans Meer zu wollen. Auf der Stelle! Aber ihre gute Erziehung hatte natürlich wie immer die Oberhand gewonnen. Sie war brav sitzen geblieben. Small talk mit Monique, dann Auto in die Garage, Gepäck auf die Zimmer, beim Auspacken helfen während Lilo eine Runde mit Kaspar drehte, die Betten verschieben bis sie so standen wie Lilo es wollte, usw., usw.. Irgendwann endlich, total verschwitzt und leicht beschwipst unter die Dusche.
„La mer, das Meer, lalala mer“, trällerte Clea, drehte den Hahn zu und angelte sich das zurechtgelegte Duschtuch. Natürlich in Marineblau. Aber die Handtücher waren rosarot. Rosenrot. Als sie an Simons und Lilos Zimmertür vorbeikam, ließ sich das vernehmbare Schnarchduett nicht überhören. Na denn, dachte Clea, dann werden die Zwei beim Abendessen wohl fit genug sein für die Konversation. Heute Abend würde sie auch endlich Moniques Mutter kennen lernen. Die Geliebte des deutschen Leutnants. Komisch, dass Marlies Wittke sogar von den flüchtigsten Bekannten immer gleich deren ganze Lebensgeschichte erfuhr. Nur meine nicht, dachte Clea mit einem plötzlichen Anflug von Stolz.
Veules les Roses war wirklich ein zauberhafter Ort. Clea blieb immer wieder stehen und bestaunte die Gärten und Häuser.
„Märchenhaft“, sagte sie halblaut, „einfach unglaublich! Wo ist Dornröschen? Wo haben sich Schneewittchen und die sieben Zwerge versteckt? Was zum Kuckuck findet Marlies hier trostlos?“
Die Sträßchen mündeten auf die auch nicht viel breitere Hauptstraße, die geradewegs zum Strand führte. Ein großer grauer Kasten versperrte die Sicht.
Wer hat diese Mietskaserne hierher gebeamt? fragte sich Clea geschockt. Doch ihr Blick wurde gleich wieder versöhnt durch eine kleine, weiße Villa mit einem parkähnlichen Garten am Fuße des fehlplazierten Steinklotzes. Ein geschwungenes Brückchen spannte sich über die eilig dahinfließende Veules. Clea lehnte sich an den gelb gestrichenen Gartenzaun und genoss den Blick auf die üppig blühenden Blumen und Sträucher. Vom Wasser der Veules stieg eine eisige Kälte auf, erzeugte eine Gänsehaut auf ihren nackten Armen.
Die Straße teilte sich und führte im Halbbogen beidseitig um das Mietshaus herum. Dahinter lag der leere, großflächige, asphaltierte Parkplatz. Rechts und links davon begrenzten steil aufragende Kreidefelsen das Sichtfeld. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes versperrte die Promenade den lang ersehnten Blick auf das Meer. Clea ging quer über den Asphalt, die aufgespeicherte Sonnenhitze des Tages umwaberte sie mit dem aufdringlichen Geruch nach Teer.
Als sie die flachen Stufen zur Promenade hinaufstieg, fegte eine kalte Brise über den Platz. Eine aufgescheuchte Schar Möwen kreischte über dem Strand. Es war Ebbe und das Meer weit weg, hing als schmale, blaue Borte am türkisfarbenen Abendhimmel. Clea balancierte vorsichtig über die aufgetürmten Steine hinweg, bis sie den Sand erreichte. Sofort zog sie ihre Sandalen aus und bohrte die Zehen genüsslich in den warmen Sand. Eine Weile blieb sie so stehen, öffnete sich völlig den Geräuschen und Gerüchen ihrer Umgebung. Dann marschierte sie entschlossen über den immer fester werdenden Sand, schnurgerade auf den Wassersaum zu.
„Schöne Ferien, Clea, schöne Ferien“, sagte sie laut zu sich selbst.
Kapitel 6
Plastrothmann, die Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt, strich mit beiden Händen prüfend über den kurzen Haarflaum seines Schädels. Trotz der hellblonden Stoppel waren seine ergrauenden Schläfen unverkennbar. Zuhause würde er seinen Kopf wie jeden Freitagabend kahlrasieren. Das war eines der feststehenden Rituale, aus denen für den oberflächlichen Beobachter Plastrothmanns ganzes Leben wie ein Puzzle zusammengesetzt schien. Auch der Umstand, dass er jetzt in der bereits seit dem frühen Nachmittag völlig verlassenen Kanzlei saß, gehörte zu diesen unveränderlichen Gewohnheiten. Er genoss diese Stunden und es lag auch nicht in seiner Natur, sich selbst darüber Rechenschaft abzulegen, weshalb er jedes Wochenende auf diese Weise anging. Freitag für Freitag, Monat für Monat, Sommer wie Winter.
Es war erstickend heiß im Raum. Die Bürotür stand weit offen, doch sogar im Treppenhaus schien jedes Quäntchen Kühle aus dem Mauerwerk herausgequetscht. Die Fenster zu öffnen, machte erst in den frühen Morgenstunden Sinn. Die Stadt war richtig aufgekocht. Nach Meinung der Meteorologen war es der heißeste Frühsommer seit Jahrzehnten.
Plastrothmann ließ das kalt. Er saß seit dem Weggang seines letzten Klienten in dieser Arbeitswoche immer noch vollkommen korrekt gekleidet an seinem aufgeräumten Schreibtisch. Obwohl sein durchgeschwitztes Jackett an ihm klebte, dachte er nicht daran, es auszuziehen. Nicht einmal den Knoten der Krawatte hatte er gelockert. Erneut überprüfte er die Haarstoppel auf seinem Kopf. Diesmal behutsam mit der flachen Handfläche, um jedes leise Pieken zu registrieren.
Die absolute Stille in der Anwaltskanzlei wurde durch nichts gestört. Die Putzfrauen kamen erst am Montagmorgen. Das waren die Stunden, wo ihm alles ganz allein gehörte. Dieses Gefühl konnte er stundenlang genießen. Es entspannte ihn vollkommen. Seine Gedanken machten sich selbstständig, befreit vom Druck der Arbeit und vor allem befreit von der Gegenwart seiner Mitarbeiter. Er war ein typischer Einzelgänger, Nähe konnte er nicht ausstehen. Jedenfalls nicht von Menschen, die meinten, ihn fordern zu müssen. So ignorierte er in seinem augenblicklichen Behagen vollständig die vor ihm liegenden Stunden mit Heinrich. Er übersprang sie einfach und verband das Gefühl der erfolgreich verlaufenen Arbeitswoche mit den erwarteten Freuden im ‘Chez Barbra‘. Meistens verließ er Heinrich gegen dreiundzwanzig Uhr. Dann ließ er sich mit dem Taxi in sein Lieblingslokal bringen. Dort, wo ihn jeder kannte und respektierte.
Sein Gehirn registrierte die Körper, Geist und Seele durchdringende Vorfreude, alles verschmolz zu einer wohligen Einheit, die ihren Höhepunkt in einer sexuellen Erregung fand. Die Entspannung löste Barrieren, Gedankensplitter stiegen an die Oberfläche des Bewusstseins. Unerwünscht rissen sie Teile seines anerzogenen Pflichtbewusstseins mit. Automatisch schaute er auf die Uhr, die vor ihm an der Wand hing. Es wurde Zeit aufzubrechen. Nicht nur, weil Heinrich auf Pünktlichkeit so sehr wert legte. Auch Henriette, Heinrichs Haushälterin, erwartete sein Erscheinen. Schließlich kochte sie jeden Freitagabend extra seinetwegen ein exquisites Menü.
Samstags dagegen pflegte er bei seiner Mutter zu essen. Pünktlich um 12 Uhr. Darauf legte sie genauso viel Wert wie auf das Spargelgrün im Blumenstrauß, den er ihr selbstverständlich auch jeden Samstag mitbrachte. Er fragte sich, wo er das Morgen herbekommen sollte. Die Blumenhändlerin, bei der er immer einkaufte, war in Urlaub. So lange seine Mutter in dieser Gegend wohnte, war das noch nie vorgekommen. Dabei führte sie das Zeug nur seinetwegen. Asparagus sei völlig out, hatte sie ihm erklärt. Zum Glück konnte sie es sich in diesem öden Wohnbezirk nicht leisten, die Extrawünsche ihrer Kunden zu ignorieren. Wo sollte er denn morgen Blumen kaufen, um dem Gezeter seiner Mutter zu entgehen? Musste diese kuhäugige, kleine Schwarzhaarige denn unbedingt verreisen?
Der aufwallende Ärger verkrampfte seine Nackenmuskulatur. Unbewusst fing er an sie durchzukneten. Dabei dehnte und drehte er den Hals, bis es im Genick krachte. Das indiskrete Klingeln des Telefons machte den Erfolg seiner Entspannungsübungen zunichte. Erst wollte er gar nicht abheben. Bestimmt falsch verbunden. Und wenn nicht war das auch egal. Um diese Zeit war die Kanzlei nicht besetzt. Er konnte sich auch nicht erinnern, jemals um diese Zeit einen Anruf erhalten zu haben. Schließlich, nach dem zwölften, immer aufdringlicher werdenden Klingelton, griff er zum Hörer.
„Heinrich?“, fragte er erstaunt. Beim Zuhören straffte sich sein ganzer Körper und ein konzentrierter Ausdruck veränderte sein Gesicht.
„Ja, bin schon unterwegs“, beendete er das Gespräch, legte den Hörer auf und ließ seinen Stuhl ein Stück vom Schreibtisch wegrollen. Der Unmut über Heinrichs Anruf erzeugte ein körperliches Unbehagen. Mit zwei Fingern fuhr er zwischen Hemdkragen und Hals entlang, dann lockerte er den Knoten seiner Krawatte. Der Alte hatte geradezu hysterisch geklungen. Verlangte sein sofortiges Erscheinen, weil er vor dem Essen noch etwas Wichtiges mit ihm besprechen wollte. Er schälte sich mühsam aus seinem verschwitzten Jackett. Jetzt blieb ihm keine Zeit mehr, nach Hause zu fahren, zu duschen und sich umzuziehen. Seine Hände umklammerten die Kante des Schreibtischs, langsam zog er den Stuhl wieder näher heran, löste die Finger und fing an, auf der Holzplatte herum zu trommeln. Heinrich hatte mit seinem Anruf die Aktivitäten von Plastrothmanns genormtem Wochenende durcheinander gewirbelt. Es fiel ihm schwer, seine aufkeimende Aggressivität zu unterdrücken. Erneut begann er, seine Halsmuskulatur zu kneten, drehte den Kopf hin und her bis es in den Wirbeln krachte. Danach stemmte er sich aus dem Sitz hoch und verließ unverzüglich sein Büro.
Kapitel 7
„Wieso sind die Getränke nicht da?“, fuhr Nehberg Marlies ungehalten an. „Es ist schon halb sieben!“
„Sie kommen in einer Viertelstunde. Bei der Hitze schwimmen uns doch die Eiswürfel weg!“
„Na, dann ist gut, dann ist gut.“
Nervös drehte sich der Galerist von Marlies weg und fing an, die Bilder zu inspizieren. Er überhörte das Klopfen an der noch abgeschlossenen Eingangstür.
Vor jeder Vernissage die gleiche Anspannung, dachte Marlies, kein bisschen cool, der Mann!
Sie ließ die junge Malerin, die sich in Begleitung ihres Galeristen und Entdeckers befand, ein. Die beiden waren gut gelaunt und wirkten auf Marlies Wittke wie ein frisch verliebtes Pärchen. Der ist doch bestimmt an die dreißig Jahre älter, dachte sie amüsiert. Kein Wunder, dass Nehberg sie ausstellte. Bei der Protektion. Sie fand die Arbeiten jedenfalls nicht besonders aufregend. Und dann gleich eine Einzelausstellung. Nette Bildchen, keines größer als 6ox90 cm. Mittelmäßiges Talent, ohne eigene Handschrift und Marlies bezweifelte, dass die sich noch entwickeln würde.
Nach sechzehn Jahren bei Nehberg hatte sie ein gutes Gespür für Kunst bekommen. Allerdings pflegte er sie niemals nach ihrer Meinung zu fragen. Ungeachtet dessen, dass sie sich in den Jahren bei ihm von der Reinemachefrau zum unentbehrlichen Mädchen für alles entwickelt hatte. Es schepperte am Hintereingang. Das Personal vom Hotel nebenan lieferte die Sektkübel und Getränke. Alles dampfte vor Kälte. Marlies hoffte, sie würde nach der Einführung, die erfahrungsgemäß nie, wie in der Einladung angegeben, um 19 Uhr beginnen würde, noch gut gekühlten Sekt anbieten können. Sie wies die Mädchen an, Mineralwasser und Orangensaft um den Sekt herum aufzubauen.
„Ganz dicht heran an die Sektkühler“, sagte sie. „Wenn das Zeug wärmer wird, macht nichts. Aber der Sekt soll so lange wie möglich kalt bleiben.“
„Wir haben ihn bis jetzt im Tiefkühler gelassen“, erklärte Olga, die junge Weißrussin. „In einigen Flaschen sind schon kleine Eisstückchen.“
„Na fein, dann wird’s schon klappen“, bedankte sich Marlies. Nachdem die Mädchen abgezogen waren, kontrollierte Marlies nochmals die Gläser und stellte nach einem Blick auf die Uhr fest, dass es fast Sieben war. Normalerweise wären um diese Zeit schon die ersten Besucher in der Galerie. Sie fing Nehbergs nervösen Blick auf und lächelte ihm beruhigend zu. Sie würden schon kommen. Einige Treue tauchten immer auf. Die Künstlerin und ihr Begleiter waren nicht zu sehen, so stellte Marlies sich zu ihrem Arbeitgeber.
„Das mit der Dreizimmerwohnung scheint zu klappen“, teilte sie ihm mit. Sein Gesicht hellte sich auf. „Das freut mich.“
„Aber der Hausbesitzer will ihn trotzdem vorher noch kennen lernen. Er hatte noch nie einen Maler in seinem Haus. Scheinbar hat er ein wenig Angst um seine Parkettböden!“
„Na, dann muss Nikolas eben in Anzug und Krawatte bei ihm vorstellig werden. Ich denke, das ist kein Problem.“
Die Einführung von Dr. König begann um 19 Uhr 35. Es waren nicht mehr als zwanzig Personen anwesend. Während der Ansprache kamen zum Glück noch einige Nachzügler. Dr. König war trotz Anwesenheit seiner Gattin offensichtlich auch sofort dem Charme und guten Aussehen der Malerin verfallen. Seine begeisterte Ansprache dauerte fast zehn Minuten länger als gewöhnlich. Sogar die hartgesottensten Vernissagebesucher schoben sich erwartungsvoll immer näher an die Getränke heran. Als Marlies endlich den ersten Sektkorken knallen lassen konnte, ging eine Woge der Erleichterung durch die ganze Runde. Selbst Nehberg griff nach seinem Glas wie ein Verdurstender, statt sich zuerst den potentiellen Käufern zu widmen.
Der Sekt war noch angenehm kühl. Mineralwasser und Orangensaft hatten größtenteils Zimmertemperatur erreicht, bis auf die wenigen Flaschen, die direkt um die Sektkübel gruppiert waren. Das Eis war fast vollständig zerschmolzen. Nachdem alle mit Getränken versorgt waren, flüchtete Marlies auf die Damentoilette. Mit einigen Papiertaschentüchern trocknete sie Gesicht und Nacken. Der Schweiß lief ihr in Strömen über Rücken und Bauch. Sie wünschte sich, der Abend wäre endlich vorbei. Ihr Mann saß jetzt gemütlich im Garten und ließ wahrscheinlich die Beine in den Swimmingpool baumeln. Nun war sie ihm doch dankbar, dass er sich mit dem Schwimmbecken durchgesetzt hatte. Obwohl es die halbe Rasenfläche in ihrem Schrebergarten platt machte. Aber bei der Hitze war das Ding wirklich unbezahlbar. Sie war richtig froh, dass dies die letzte Vernissage vor der Sommerpause war.
Kapitel 8
Ein Familienidyll wie in einem Rosamunde Pilcher Film! dachte Clea. Fast schon unwirklich. Aber irgendwie schön! Sie war angenehm satt. Moniques Küche war wirklich ein Erlebnis für einen berufstätigen Single. Da kamen ihre TK-Pizzen wirklich nicht mit, nicht mal Dimitris Kebab, das sie sich meistens am Samstagmittag nach Ladenschluss gönnte. Das war immer der Höhepunkt des Wochenendgefühls für sie. Diese vage Stimmung von Freiheit. Spätestens Samstagabend nach der Tagesschau verflüchtigte sie sich für gewöhnlich. Und jedes Mal der Vorsatz, sich für das kommende Wochenende etwas vorzunehmen. Sie seufzte leise auf bei diesen Erinnerungen, die ihr schon nach der einen Woche in Veules ziemlich bizarr, ja geradezu fremd erschienen. Henri David, aufmerksamer Gastgeber, interpretierte ihr Seufzen falsch.
„Eau de vie, Clea“, diagnostizierte er. „Ist die Bauch zu voll?“
Clea musste lachen. Henris Deutsch war so miserabel wie ihr Französisch. Deswegen unterhielten sie sich wohl auch so ungezwungen zweisprachig, und wenn das nicht reichte, eben mit Händen und Füßen. Dazu kam noch sein mitreißender Charme, den Clea ganz ungezwungen genoss. Sein Sohn Jean-Paul besaß den gleichen Charme. Doch bei ihm hatte Clea das merkwürdige Gefühl, er meine sie persönlich. Natürlich glaubte sie aufgrund ihres, von Friedemann total zerstörten weiblichen Selbstwertgefühls, sie würde sich das nur einbilden, was allerdings keinerlei beruhigende Wirkung auf sie ausübte. Ganz im Gegenteil. So vermied sie ziemlich krampfhaft den Augenkontakt mit ihm, obwohl er direkt neben ihr saß.
„Clea ist nur traurig, soviel alte Leute hier!“, widersprach Jean-Paul seinem Vater auf Deutsch und mit einem breiten Grinsen. „Sie braucht etwas Abwechslung!“
Clea und Henri protestierten beide gleichzeitig. Doch Jean-Paul ließ sich nicht von seiner Meinung abbringen, um der nun folgenden Einladung den nötigen Nachdruck zu verleihen.
„Morgen Abend gibt es eine Fete, Freunde von mir haben hier eine Ferienvilla. Komm doch mit Clea, wir wollen den Rosenmonat feiern.“
„Den Rosenmonat?“
„Ja, der Juni ist der schönste Monat in Veules. Und gestern hat er angefangen. Wir treffen uns immer am ersten und am dritten Samstag im Juni hier. Juli, August gehört die Stadt den Touristen. Einfach ein furchtbarer Trubel. Und Mama hat dann auch gar keinen Platz für uns, alle Zimmer sind in der Hochsaison ausgebucht.“
„Kommt Betty auch mit?“
„Ja klar. Obwohl sie mit ihren fast 26 Jahren eigentlich schon zu alt für unsere Fete ist!“, neckte er Clea.
„Wie alt bist du denn?“, fragte Clea spontan und genierte sich sofort für ihre direkte Frage. Doch Jean-Paul hatte kein Problem damit.
„23 Jahre“, antwortete er bereitwillig. Au weia, dachte Clea. Das war noch jünger als sie gedacht hatte. Andererseits half ihr das, sein Angebot anzunehmen.
„Okay, wenn es dich nicht stört, dass ich fast deine Mutter sein könnte, komme ich mit!“
Jean-Paul schien das sehr komisch zu finden. Er sagte in seinem schnellen Französisch etwas zu seiner Schwester. Die zuckte nur die Schultern und wandte sich dann wieder ihrer Großmutter Claudine Schneider zu. Clea lehnte sich zufrieden zurück, nahm ihr Weinglas in die Hand, schnupperte genießerisch und steigerte damit die Vorfreude auf den nächsten Schluck. Die Gespräche um sie herum plätscherten wie eine kleine Melodie in ihrem Bewusstsein, erzeugten einen Moment des vollkommenen Wohlbehagens.
Wie gut, dass sie diese Reise gewagt hatte. Alles war geradezu vollkommen. Sie fühlte sich zum ersten Mal seit langem frei, richtig frei. Jeden Tag der vergangenen Woche war sie durch Veules les Roses gestreift. Der Ort verzauberte sie geradezu. Dazu noch die langen Spaziergänge durch die Felder, oben auf den Klippen. Die steile Treppe aus Beton bei Sotteville, zernagt von den Wellen des Atlantiks. Trotz des Sperrschildes mit der Warnung vor der Einsturzgefahr, hatte sie es den Anglern nachgemacht und sich auf den steilen Abstieg begeben. Im unteren Drittel schwang sich die Treppe im Bogen um die Klippe und gab den Blick frei auf die lange, sichelförmig geschwungene Kreideküste von Fecamp bis Dieppe.
Die weißen Klippen fassten das ruhig daliegende, grünblaue Meer ein. Sie hatte sich auf eine der hohen, zerbröckelnden Stufen gesetzt und dieses Bild auf sich einwirken lassen. Und musste lauthals herauslachen, als ihr mit einem Mal klar wurde, woran sie dieser konturierte farbige Anblick plötzlich erinnerte: An Waldmeisterfruchtgelee in einer weißen Porzellanschüssel! Ihr Lachen scheuchte einige Möwen auf, die mit missfallendem Meckern davon segelten und auf irgendeinem Felsvorsprung ihre verloren gegangene Ruhe suchten.
Aber bei Moniques Küche war es wirklich kein Wunder, wenn ihr Gehirn solche Assoziationen hervorbrachte! Sie kehrte mit ihren Gedanken in die Gegenwart zurück und stellte erleichtert fest, dass niemand sie vermisste. Monique war in der Küche verschwunden. Betty als brave Tochter war dabei, das Geschirr abzutragen. Jean-Paul diskutierte ziemlich erregt über irgendetwas mit seinem Vater. Lilo hatte ihren Platz gewechselt, so dass Claudine Schneider jetzt zwischen ihr und Simon saß.
Na, dachte Clea, da geht’s doch wieder um die gemeinsamen Kriegserlebnisse! Für ihren Abendspaziergang war es viel zu spät, draußen wurde es schon dunkel. Doch eine kleine Stippvisite zum Meer konnte nach der üppigen Abendmahlzeit keinesfalls schaden. Also verschwand Clea so unauffällig wie möglich aus dem großen Salon, holte sich eine leichte Jacke aus ihrem Zimmer, beruhigte Kaspar, der hinter der verschlossenen Tür leise anfing zu winseln als er sie hörte und schlich sich aus dem Haus.
Es war sehr still, auffällig still, fand Clea. Als Großstädterin benötigte ihr Gehör immer eine ganze Weile, bis es die Geräusche der Natur wahrnahm. Doch die Düfte erreichten sie sofort. Obwohl sie leichter waren als in ihrem Laden. Nicht so schwül, ohne diesen Unterton von Verwesung. Den Geruch sterbender Pflanzen gab es um diese Jahreszeit nicht in Veules les Roses. Noch gab es keine verwelkten Rosenblüten, nur prall gefüllte Knospen, die farbige Signale durch die aufbrechenden, grünen Hüllen schickten. Und frisch erblühte Rosen in ihrer vollkommenen Eleganz und Grazie. Die schweren, aufgeblühten Exemplare, die ihr ganzes Innenleben ausschütten würden, mit den ersten bräunlichen Verfärbungen an den äußeren Blütenblättern, die brauchten noch einige warme Tage.
Ich bin genau zur richtigen Zeit hier, dachte Clea glücklich. Sie lief die schmale Straße entlang, die am Kirchplatz auf die Hauptstraße mündete. In den schwarzen Schatten der Häuser glühten die Rosen- und Malvenblüten, gaben nur zögernd das eingefangene Licht des Tages her. Sie hörte Stimmen. Leises Lachen sprühte durch die Abendluft, schien in feine Tröpfchen zu zerstieben. In der Creperie brannte noch ein warmes, gelbes Licht. Draußen die vier kleinen Tische waren alle besetzt. Nur junge Leute, deren Ausgelassenheit von der Schönheit des Abends gezügelt wurde.
Clea war dankbar dafür. Lärm passte wirklich nicht in ihre Stimmung. Aber das Meer machte Krach. Unüberhörbar stürzten sich die Wellen in die Steinwälle an der Promenade. Scheppernd, splitternd, kreischend, dumpf donnernd. Das Spektakel rollte ohrenbetäubend über den Platz und die Schallwellen brachen sich erst an dieser trostlosen Mietskaserne, deren Wohnungen größtenteils leer standen.
Es war hohe Flut. Zum ersten Mal sah und hörte Clea, wie das Meer die ganze Breite des Sandstrandes eingenommen hatte und bis hinauf in die Steine brandete. Sie lehnte sich an die Balustrade und staunte über die Kälte des Metalls, geradezu eisig. Da erst fiel ihr auf, dass mit dem Wasser ein kalter Wind über das Meer kam, kalt und feucht. Der Blick in den Himmel zerstreute ihre Befürchtungen, Mond und Sterne blinkten, nirgendwo schwarze Wolkenfetzen am indigoblauen Abendhimmel.
Sie entspannte sich wieder und konzentrierte sich auf die ungewohnt gewaltige Klangkulisse. Schließlich schloss sie die Augen, und da erst fiel ihr der Unterschied auf. Die heran rollenden Wellen lösten Chaos aus in den Steinen, daher diese überwältigende Kakophonie. Doch anschließend, nach einer fast unmerklichen und doch deutlichen Pause, wenn das Meer die Steine aus seiner Gewalt entließ, sich zurückzog, dann rollten die Steine. Alle zusammen und doch jeder seinen Weg, rollten sie zurück und betteten sich dann mit einem leisen Knirschgeräusch in den Sand ein. Clea war fasziniert, sie konnte gar nicht genug davon bekommen.
Als Jean-Paul sie ansprach, erschrak sie richtig. Natürlich konnte sie ihn bei solch einem Geräuschpegel nicht kommen hören, trotzdem ärgerte es sie, so überrascht worden zu sein. Er schien das nicht zu bemerken, sein jungenhafter Charme machte ihn wohl wirklich immun gegen Verstimmungen und Ressentiments. Offensichtlich erwartete er von Clea nichts als Freude über sein unerwartetes Auftauchen. Sie ergab sich in ihr Schicksal und machte ihn auf ihre Entdeckung aufmerksam. Er stellte sich neben sie und schloss brav die Augen. Lange Zeit sagte er gar nichts und Clea begriff irgendwann, dass er wirklich zuhörte und wohl genauso fasziniert war wie sie selbst. Das stimmte sie versöhnlich und plötzlich fand sie ihn einfach nur sympathisch.
„Weißt du, es ist doch wirklich toll wie die Steine damit umgehen, findest du nicht? Sie rollen einfach wieder in eine angenehme Lage zurück!“
„Like a rolling stone!“
„Oh, das ist gut. Lauter rolling stones. Rollende Steine sind laut! Laut rollende Steine. Das werde ich mir merken.“
„Ich bin ein rolling stone“, sagte Jean-Paul. „Bist du auch ein rolling stone, Clea?“
Sie schwieg eine ganze Weile auf seine Frage. Sicher wollte sie ein rolling stone sein, aber was ging ihn das an? Nach acht Jahren wurde es wirklich Zeit, dass sie wieder zu sich selber fand. Aber jetzt wollte sie daran wirklich nicht erinnert werden. Zumal die unvermittelt aufkeimende Angst ihrer Aufbruchsstimmung wirklich nicht gut tat. Und wieder war sie ärgerlich über Jean-Paul. Zum Glück beharrte er nicht auf eine Antwort.
„Es wird kalt, das Wetter wird umschlagen. Kommst du mit zurück?“
Clea nickte nur und so liefen sie wortlos nebeneinander her bis sie das Haus der Davids erreichten.
Die alte Garde hatte es sich in den Sofas am Kamin bequem gemacht, in dem zu Cleas Erstaunen ein Feuer brannte. Jetzt erst bemerkte sie, wie ausgekühlt sie vom Wind war.
Betty war nirgendwo zu sehen und auch Jean-Paul verabschiedete sich mit der Bemerkung, er müsse noch für zwei Klausuren in der nächsten Woche lernen.
„Wann fahrt ihr zurück?“, fragte seine Großmutter.
„Erst am Montag, nach dem Frühstück“, antwortete Henry David für seinen Sohn. „Ich habe erst am Nachmittag wieder Termine.“
Claudine Schneider nickte zufrieden und sagte dann auf deutsch zu Lilo:
“Im Sommer sehe ich die Kinder kaum. Und Jean-Paul will in den Semesterferien mit Freunden nach Griechenland. Betty bleibt immer bei ihrem Vater in Paris, jedenfalls bisher. Sie hat immer noch keinen Verehrer. Diese jungen Leute! Wollen nicht heiraten und wollen keine Kinder. Nur Karriere im Kopf.“
Lilo sagte nichts dazu, schließlich hatte sie auch nie Kinder gewollt. Um von dem Thema abzulenken stellte sie Monique David die Frage, die sie nun schon den ganzen Abend beschäftigte, seit Henri mit Sohn und Tochter aus Paris angekommen war: „Betty ist doch kein französischer Name, nicht wahr?“
„Nein, wirklich nicht“, antwortete Monique lächelnd. Das liegt an meiner Schulzeit in Deutschland. Unser Englischbuch, Peter Pim and Billy Ball. Billy hatte eine Schwester namens Betty. Ich fand den Namen so schön. Von da an sollte meine Tochter, wenn ich denn eine bekommen würde, Betty heißen. Nun ja, mein Mann hatte nichts dagegen, als unser erstes Kind dann wirklich eine Tochter wurde. Oder vielleicht ist ihm auch kein besserer Name für ein Mädchen eingefallen?!“
„Nein, es ist wirklich ein hübscher Name“, befand Lilo. „Wo sind Sie denn in Deutschland zur Schule gegangen?“
„Das war in Karlsruhe. Ich bin erst bei meiner Heirat mit Henri nach Frankreich zurück gekommen.“
„Deswegen das perfekte Deutsch. Und ihre Kinder?“
„Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Und in den Ferien waren sie immer bei ihrer Großmutter in Karlsruhe. Maman ist erst nach dem plötzlichen Tod meines Vaters vor zehn Jahren zu uns nach Paris gezogen.“
„Aha“, machte Lilo zufrieden. Ihre Neugier war fürs erste befriedigt.
„Hatten sie denn nie Heimweh nach Frankreich?“, fragte nun Clea Moniques Mutter.
„Oh, das ist schwer zu beantworten. Dazu müsste ich eine lange Geschichte erzählen. Und ich glaube, ihr Vater und ich haben in den letzten Tagen schon zu viele alte Geschichten erzählt.“
„Nein, nein“, protestierte Clea mit wachsendem Interesse. „Ich finde diese alten Geschichten hochinteressant.“
Sie schaute in die Runde. Doch nicht mal Lilo schien heute Einwände zu haben. So wandte sich Clea mit einer auffordernden Handbewegung an Mme Schneider.
Die zierte sich nicht länger und fing unvermittelt an:
„Ich war noch nicht mal 17, als ich mich in Konrad verliebte. Uniformen wirken auf junge Mädchen wohl sehr anziehend. Und er sah so gut aus. Dazu blond, mit blauen Augen. Nun ja, so nahm die Liebe eben ihren Lauf. In so einer kleinen Stadt wie der unseren blieb das natürlich nicht verborgen. Aber da unser Bürgermeister sehr lukrative Beziehungen zu den deutschen Offizieren unterhielt, hatten wir sozusagen den Segen der Obrigkeiten. Leider währte unser Glück nur wenige Wochen. Bis wir von den Alliierten befreit wurden. Da hat unser braver Bürgermeister dann ein Exempel an mir statuiert. Er ließ mir vom Frisör des Ortes, bei Anwesenheit einiger honoriger Bürger, den Kopf kahl scheren und schickte mich so durch die Stadt nach Hause.“
Sie machte eine Pause. Es blieb ganz still im Raum. Nur das Knistern des Kaminfeuers brachte etwas Erleichterung in die lähmende Ruhe. Clea tat es jetzt leid, die alte Frau zum Reden animiert zu haben. Man konnte ihr ansehen, wie weh ihr diese demütigende Erinnerung tat. Plötzlich schoss Clea eine Erzählung ihres Vaters durch den Kopf.
„Simon hat etwas Ähnliches erlebt, nachdem sein Vater verhaftet worden war.“ Alle Augen wurden nun auf Cleas Vater gerichtet.
„Das stimmt“, bestätigte er. Gleichzeitig nickte er Claudine Schneider tröstend zu. „Nachdem mein Vater abgeholt worden war, bin ich mit der roten Fahne auf dem Fahrrad durch Storkow gefahren. Bei der zweiten Runde holten mich einige, ebenfalls sehr honorige Herren vom Rad und prügelten mich grün und blau.“ Er schaute in die Runde und fuhr dann fort: „Und genau diese ehrenwerten Herren sind von unseren russischen Befreiern wieder ins Amt gebracht worden. Mein Vater musste das miterleben, als er aus dem KZ kam. Seine heiß ersehnten großen Brüder aus der kommunistischen Sowjetunion brachten die Nazis seiner Heimatstadt wieder in Amt und Würden! Ich bin bis heute davon überzeugt, dass er deswegen ein halbes Jahr später starb. Ja, er ist an gebrochenem Herzen gestorben, nachdem er seine Ideale schon zuvor zu Grabe getragen hatte.“
„Mein jüngerer Bruder hat ebenfalls ziemlich heftig reagiert“, nahm Moniques Mutter ihre Erzählung wieder auf, während ihre Tochter für Henri noch einiges von Simons Erzählung ins Französische übersetzte. „Wie alt war er damals? Noch nicht ganz vierzehn, ja im Juli ist sein Geburtstag. Er hat mit ein paar Freunden zusammen den Hund des Bürgermeisters entführt. Das war ein deutscher Schäferhund, ein wirklich prachtvolles Tier. Der ganze Stolz des Bürgermeisters. Die Jungen haben ihn also eingefangen und dem armen Tier den Hintern glatt rasiert sowie den ganzen Schwanz und den oberen Teil der Hinterbeine. Ich sehe ihn noch heute vor mir, sah aus wie ein Pavian. Aber das Beste war, sie haben auf seine beiden kahlen Hinterbacken mit Tinte zwei große Hakenkreuze gemalt. Danach brachten sie das Tier auf die andere Seite der Stadt und ließen ihn los. Auf seinem Weg nach Haus musste er die ganze Stadt durchqueren.“
Clea konnte sich ein Kichern nicht verkneifen. Die Vorstellung war einfach zu komisch. Doch die alte Frau ließ sich nicht aus ihren Erinnerungen holen.
„Aber es war genau so nutzlos wie ihre Fahrt mit der roten Fahne“, sagte sie zu Simon. „Zu dem Zeitpunkt war bereits die ganze Stadt davon überzeugt, ausnahmslos in der Resistance gewesen zu sein. Ausnahmslos, bis auf mich. Ich war ihr Alibi. Nun ja, so ist das Leben.“
„War das hier in Veules?“, fragte Clea.
„Nein, ich bin niemals dorthin zurückgekehrt. Und ich hatte und habe kein Heimweh dorthin“, beantwortete sie nun Cleas anfängliche Frage ganz direkt. „Nicht mal Heimweh nach Frankreich in den ersten Jahren. Aber ich musste es noch fast zwei Jahre aushalten, bis Konrads Brief kam in dem er mich einlud nach Karlsruhe zu kommen und seine Frau zu werden. Ich packte auf der Stelle meine Koffer und bin zu ihm. Ich habe sogar versucht zu vergessen, dass ich Französin bin. Allerdings änderte sich mein Standpunkt mit den Jahren, als ich endlich begriff, dass es auch in Deutschland nicht anders war. Da hatte es scheinbar, genau wie in Frankreich, nie einen Nazi gegeben. Jedenfalls konnte sich niemand daran erinnern! Diese Zeit war ja auch in Deutschland ein Tabuthema. Aber wenn sie wirklich mal zur Sprache kam, hat keiner von irgendetwas gewusst. Der einzige Unterschied zu meinen Landsleuten bestand darin, das die nachträglich alle behaupteten, in der Resistance, im Widerstand gewesen zu sein, während es in Deutschland nur arme Opfer gab, aber keine Täter. Nun ja, lassen wir das, es bringt nichts.“
„Trinken wir auf die Liebe. Vive l’amour!“, forderte Henri David mit seinem erhobenen Weinglas auf. Alle stießen erleichtert mit ihm an. Nur Clea dachte: Bei mir haut leider nicht mal das hin. Was für ein Käse! Be a rolling stone, Clea. Die anderen können das doch auch!
Bis zum Frühstück war noch etwas Zeit. Lilo hatte gerade mit Kaspar das Haus verlassen. So klopfte Clea bei ihrem Vater an die Zimmertür. Er saß am Fenster und schaute hinaus in den Garten. Clea setzte sich dazu.
„Das war ein interessanter Abend“, sagte sie. „Aber wie hast du das nur alles weggesteckt. Den Krieg und all das. Und dann noch Mamas Tod?“
Er schwieg eine Weile bis er leicht die Schultern hob und erklärte:
„Nun ja, was blieb mir denn anderes übrig, Kind?“
Clea dachte über seine Antwort nach.
„Wieso krieg ich das nicht gebacken? Ich habe heute Nacht von Friedemann geträumt! Jetzt, wo ich ihn doch endgültig aus meinem Leben streichen will, da fang ich wieder an, von ihm zu träumen.“
„Was hast du denn geträumt?“
„Total peinlich, Paps! Ich stand mit ihm vor dem Traualtar. Richtig glücklich war ich dabei. Doch dann sagte der Priester, er könne uns nicht trauen, erst müsse ich mir den Kopf kahlrasieren lassen. Irgendjemand tauchte mit einer großen Schere auf und gab sie Friedemann. Doch ich wollte nicht. Plötzlich war ich dann in meinem Laden, allein. Aber es waren keine Blumen, die ich verkaufte, sondern Perücken. Dann ging die Ladenglocke und ich bin aufgewacht.“
„Nun ja“, beruhigte Simon sie, „ich bin kein Traumdeuter, wie du weißt. Aber ich finde der Traum hört sich gut an. Irgendwie sehr positiv.“
„Findest du?“
„Ja, wirklich. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. So wie ich. Bist eben doch Papas Tochter!“
Kapitel 9
„Ist diese Blumenfrau denn immer noch in Urlaub?“, quengelte Plastrothmanns Mutter und schaute missbilligend auf seinen mitgebrachten Blumenstrauß. „Du weißt doch, ich verabscheue Schleierkraut! Das sieht so nach Beerdigung aus!“
Nein, er wusste das nicht. Er wusste überhaupt nicht viel von dieser Frau. Obwohl er sie jeden Samstag besuchte, pünktlich wie ein Uhrwerk. Von zwölf bis fünfzehn Uhr. Dabei redete sie die ganzen drei Stunden fast ununterbrochen. Doch er hörte ihr nicht zu. Das machte diese Pflichtbesuche so erträglich für ihn, fast entspannend. Sie redete und er dachte an gar nichts. Doch heute stieg bei ihrer Klage über den Blumenstrauß eine leise Wut in ihm hoch, stieg ihm kribbelnd ins Genick. Eine völlig untypische Reaktion für ihn, den eiskalten, disziplinierten Logiker. Er hatte für alles was er tat gute Gründe, für Emotionen war da kein Platz. Selbst diese Besuche bei seiner Mutter hatten nichts mit irgendwelchen Empfindungen für sie zu tun. Er tat es aus reinem Pflichtgefühl, jedoch nicht ihr gegenüber, weil sie ihn geboren hatte. Nein, nur seinem Vater gegenüber, weil der sie erwählt hatte, ihm einen Sohn zu schenken. Dessen Ehefrau, die Plastrothmann nach wie vor als seine wahre Mutter betrachtete, eine große nordische Blondine, war unfruchtbar gewesen; ein Irrtum der Vorsehung. Ein grausamer Irrtum, wie Heinrich zu sagen pflegte.





























