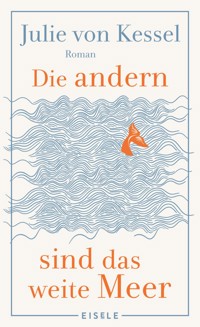12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Adelsfamilie, die an ihrem Erbe fast zerbricht. 1945 ist das Leben in Ostpreußen zu Ende. Agnes von Kolberg hat ihren Mann verloren, zwei Güter, aber nicht ihren pragmatischen Lebensmut. Sie beginnt mit ihren zehn Kindern im Westen neu. In der wenig glamourösen Bundesrepublik finden alle Kinder ihren Platz, nur die beiden Jüngsten machen Sorgen: Nona, die Schöne, bricht aus und bietet der selbstherrlichen Mutter die Stirn. Konrad, Agnes' Augapfel, kämpft lange um einen Lebensentwurf. Er sieht in der Wiedervereinigung die Chance, das Land seines Vaters in Brandenburg wiederzubekommen. Mit Gut Altenstein möchte er endlich an die vermeintlich glorreiche Zeit der Familie anknüpfen. Das Geld dafür muss er sich bei einer seiner Schwestern leihen. Zwischen den Geschwistern entbrennt ein erbitterter Streit um das Gut, der viele Fragen aufwirft: politische, gesellschaftliche, Fragen nach alten Wunden und Loyalitäten, Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis. »Ein toller Debütroman.« Brigitte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Im Winter 1945 sitzt ein Kind in einem überfüllten Personenzug von Königsberg nach Westen. Sehnsüchtig blickt der kleine Konni hinaus in den Schnee. Seine Mutter, Gräfin Agnes von Kolberg, wird ihren zehn Kindern erst später auf das Gut Altenstein in Brandenburg folgen. Doch auch ihren Sommersitz muss die Familie auf der Flucht vor der Front verlassen. Die Geschwister wachsen in ärmlichen Verhältnissen bei Bonn auf. Trotzdem finden alle Geschwister ihren Platz in der neuen Heimat – bis auf Konni und seine nächstältere Schwester Nona, die sich besonders nahestehen. Als die Wende kommt, wittert Konni seine Chance, das Gut Altenstein in den Familienbesitz zurückzuholen. Das Geld dafür muss er sich bei einer seiner Schwestern leihen. Zwischen den Geschwistern entbrennt ein erbitterter Streit um das Gut, der politische und gesellschaftliche Fragen aufwirft, Fragen nach alten Wunden und Loyalitäten, Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis.
Die Autorin
Julie von Kessel ist Journalistin und freie Autorin. Seit vielen Jahren arbeitet sie beim ZDF in Berlin. Ihrem Debütroman Altenstein folgten die Romane Als der Himmel fiel und Die andern sind das weite Meer. Sie wuchs in Helsinki, Wien, Zagreb, Bonn und Washington D.C. auf und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin.
Julie von Kessel
Altenstein
Roman
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
ISBN 978-3-96161-259-8
© 2017 Julie von Kessel
© 2025 Julia Eisele Verlags GmbH, Lilienstraße 73, 81669 München
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: mauritius images / Nongkran Pornmingmas / Alamy / Alamy Stock Photos
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Inhalt
Über das Buch / Über die Autorin
Titel
Impressum
Die Familie von Kolberg
Prolog
Das Gut
Eine Kaltfront
Die süße Erde
Ein Baum im Herrenhaus
Tote Pferde
Ihre Kinder sind wie Blütenblätter
Die Neunte
Pension Märkischer Hof
Eine Angst
Konrad
Im Keller
Der Kolberg’sche Katzenkopf
Unter dem Eis
Es wäre nicht machbar
Die Murmelbahn
Das grüne Hollandrad
Nona
Die bessere Gesellschaft
Der Bruch
Im Garten des Kardinals
Die Geschwister
Ihres Lebens würdig
Die Glücksformel
Entfernte Verwandte
Offene Vermögensfragen
Das dunkle Erbe
Bobby
Genetische Schwächen
Ein Christkind
Es bleibt in der Familie
Der Einbruch
Eine Tochter
Der Wald
Das Revier markieren
Unter Artenschutz
Ein ganzes Drittel
Das Fest
Konrad II
Die Schneekönigin
Drei mal drei
Die letzten Tage
Rote Bete
Das Pferd in den Dünen
Vor verschlossener Tür
Die Rückkehr
Landschaftsmalerei
Die Beerdigung
Kunos mildes Lächeln
Nicht gläubig
Es ist Zeit
Epilog
Danksagung
Nachweise
EMPFEHLUNGEN
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Die Familie von Kolberg
Agnes und Kuno von Kolberg
Ihre gemeinsamen Kinder
Kuno Moritz v. Kolberg, genannt Moritz
seine Frau Isabella, Tochter Cosima
Agnes Helene v. Kolberg, genannt Leni
ihr Mann Friedrich, ihr Sohn Hans, ihre Tochter Annett
Marie Elisabeth v. Kolberg-Frederiksen, genannt Nona
ihr erster Mann: Ake v. Ehrenfeld, Tochter Alexa;
ihr zweiter Mann: John
Konrad v. Kolberg, genannt Konni
seine Frau Ira, ihre Söhne Tobias und Ferdinand
Die Halbschwestern
Isolde Schaller-Kolberg, genannt Bobby
(aus Kunos erster Ehe)
ihr Mann Franz Schaller, Kinder: Leopold und Niko
Margarethe v. Gallwitz (aus Agnes’ erster Ehe)
ihr Mann Richard
Cousins in Kletten
Julius v. Canstein, Viktor v. Canstein
Prolog
Die Lok, die langsam in den Bahnhof einrollt, stößt riesige weiße Rauchschwaden vor sich her. Konrad beugt sich auf dem Arm seiner Mutter weit vor, um den Zug besser sehen zu können. Er trägt einen Anzug, darüber mehrere Jacken, einen Mantel und eine Fellmütze.
»Nicht, Konni!«
Die Mutter zieht ihn wieder an sich. Sie riecht nach Erde und Parfüm, aber auch ein bisschen muffig, sie hat einen Pelzmantel an. Ein Schwall warmer Luft entweicht dem Mantel jedes Mal, wenn sie sich bewegt, Konrad versucht, ihren Duft einzuatmen. Er schiebt seine Hand in ihren Ausschnitt, er tastet sich zwischen den Knöpfen ihrer Seidenbluse hindurch, er fühlt nach ihrer Haut, sie ist warm und etwas feucht.
Kleine Rauchwölkchen steigen aus ihrer Nase, es ist kalt.
Seit den frühen Morgenstunden warten sie schon auf dem Bahnsteig, inmitten einer wogenden und immer größer werdenden Masse aus Mänteln, Koffern, Fellmützen. Seine Mutter ist groß und schlank, sie überragt die meisten Wartenden um sie herum, Konrad hat einen guten Ausblick.
Die Lok bremst ab und zischt dabei laut. Konrad macht das Geräusch nach: Zschhhhh.
Seine Mutter verlagert ihn auf die andere Hüfte. Konrad wechselt dabei schnell die Hand in ihrem Mantel, mit der anderen krallt er sich hinten an dem Pelz fest.
Der Zug kommt näher, er wird immer langsamer, als er sich an ihnen vorbeischiebt, stößt er plötzlich einen lauten Seufzer aus. Konrad zuckt zusammen. Er fühlt den warmen Luftzug der Lok. Jetzt kann er in die Fenster blicken. Fremde Gesichter, die müde in die Luft starren. Konrad lacht und winkt ihnen zu, niemand winkt zurück. Plötzlich werden sie beiseitegestoßen, ein Mann will näher an den Zug, näher an die Tür. Sie wanken einen Moment lang, dann werden sie von der Menge nach vorne gedrückt. Die Mutter verliert das Gleichgewicht und schreit kurz auf. Konrad versteckt sein Gesicht in ihrem Mantel, er spürt, wie sie fallen, doch jemand greift nach ihrem Arm und zieht sie hoch.
Es ist Emma. Konrad kennt sie kaum, heute Morgen auf dem Weg zum Bahnhof hat er sie erst das zweite Mal gesehen. Sie ist ein Mädchen, sie geht seiner Mutter nicht mal bis zur Schulter. Sie hat ein rundes, liebes Gesicht und zwei dicke, geflochtene Zöpfe. Jedes Mal, wenn Konrad sie anschaut, lächelt sie ihm zu. In der Kutsche hat seine Mutter ihn auf Emmas Schoß gesetzt und sich dann von beiden weggedreht, als müsse sie draußen etwas Wichtiges beobachten. Emma nahm seine Hände, spielte mit seinen Fingern. »Em-ma«, sagte sie und klatschte dabei zwei Mal: »Kon-ni«, »Ma-ma«. Ihre Stimme ist hell und gurrend, sie spricht anders als seine Mutter, mit vielen Zischlauten, die Wörter purzeln in einem melodischen Singsang aus ihrem Mund.
Die Mutter zieht ihren Mantel zurecht und nickt Emma dankbar zu. Emma strahlt, ihre Wangen sind gerötet. Jetzt quietschen die Eisenbahnräder laut, er muss sich die Ohren zuhalten. Der Zug kommt zum Stehen. Konrad streckt die Hand aus und fasst nach einem Metallgriff, der außen am Waggon befestigt ist. Er hinterlässt schwarze Striemen auf seiner Haut. Sie haben Glück, sie stehen nah an einer Tür. Seine Mutter schiebt Emma darauf zu. Emma hat einen kleinen roten Koffer dabei, sie trägt ihn vor sich her, um sich ihren Weg durch die Menge zu bahnen.
Sie steigen drei Stufen hinauf in den Waggon. In den Gängen stehen Männer mit dunklen, stoppeligen Gesichtern, es ist warm und feucht und riecht scharf nach Schweiß, obwohl die Fenster geöffnet sind. Einige rauchen. Die Frauen und Kinder in den Abteilen sehen müde und abgekämpft aus.
Die Mutter quetscht sich mit Konrad auf dem Arm vorbei, hinter Emma her, sie öffnen jede Tür zu den überfüllten Abteilen.
»Ist hier noch frei?«
Konrad schwitzt unter seiner Fellmütze.
»Ist hier noch frei?«
Niemand reagiert. Die Mutter schaut besorgt auf die vielen Menschen, die im Gang stehen. Im fünften Abteil sitzt eine Frau mit drei Mädchen, einem Jungen und einem Baby im Korb, sie hat einen großen, abgewetzten Männermantel an, die Kinder sehen blass aus, ihre Augen rot geweint. Kein Mann steht vor der Tür, sie scheinen allein zu reisen. Als die Mutter klopft, schüttelt die Frau hinter der Glasscheibe den Kopf. Die Mutter greift nach Emmas Koffer, zieht eine Milchflasche heraus und hebt sie hoch. Die Frau stutzt, dann nickt sie kurz, sagt etwas zu ihrer ältesten Tochter, beugt sich vor und schiebt die Glastür zur Seite. Das Mädchen steht vom Fensterplatz auf und quetscht sich neben ihren protestierenden kleinen Bruder. Die Frau nimmt die Flasche, lässt sie in ihrem übergroßen Mantel verschwinden und rückt mit dem Knie zur Seite, damit Emma zum Fensterplatz gelangen kann.
Emma hievt ihren Koffer auf die Ablage, setzt sich und nimmt Konrad auf den Schoß. Seine Mutter beginnt gerade, ihm den Mantel aufzuknöpfen, als sie draußen einen schrillen Pfiff hören. Die Mutter erschrickt, nimmt Konrads Gesicht in ihre Hände und küsst ihn mehrmals fest auf den Mund, dann zwängt sie sich eilig durch die Menschen im Gang hinaus. Konrad blickt ihr hinterher, er sieht ihren schmalen Rücken, er spürt noch den festen Druck ihrer Finger an seiner Wange.
Emma zieht Konrad die Mütze aus, sie schält ihn aus seinem Mantel und der Strickjacke darunter, dann setzt sie ihn so, dass er aus dem Fenster schauen kann. Die Zugtüren werden mit einem lauten Knall geschlossen. Emma zeigt auf die vielen Menschen, die immer noch auf dem Bahnsteig stehen.
»Wo ist Mama, Konni, schau. Wo ist Mama?«
Die Eisenbahn zischt und rollt langsam an. Die Wartenden auf der Plattform fangen an zu rufen und zu gestikulieren, sie schieben sich gegenseitig zur Seite. Einige rütteln an den Türgriffen.
Plötzlich sieht Konrad das Gesicht seiner Mutter. Sie steht ganz still vor dem Fenster, ihre Augen suchen die Abteile ab, dann erblickt sie die beiden und hebt die Hand.
Emma hält Konni näher an das Fenster.
»Da, Konni, schau! Da ist Mama, mach winke, winke«, sagt sie.
Konni jauchzt und winkt, seine Mutter nickt Emma ernst zu und winkt jetzt zaghaft zurück, sie bewegt ihren Mund, aber sie können nicht hören, was sie sagt, dann legt sie ihre Hand an die Scheibe. Sie sagt noch etwas. Wieder und wieder sagt sie es, mit der linken Hand hält sie den Schal fest, der um ihren Kopf gewickelt ist, die rechte drückt sie ans Glas. Konni versucht, nach ihren Fingern zu greifen, er tatscht an das Fenster und hinterlässt kleine, feuchte Spuren.
Der Zug rollt an, seine Mutter geht neben ihnen her, sie ist ganz nah, ihr Blick hängt an Konrad. Konrad lacht und winkt weiter, ihm macht das Spiel immer noch Spaß, auch Emma lächelt. Der Zug beschleunigt, noch berühren ihre Fingerspitzen das Fenster, dann zieht seine Mutter die Hand zurück und wird plötzlich von der Menschenmenge verschluckt.
Der Zug fährt jetzt so schnell, dass Emma und Konni keine Gesichter mehr ausmachen können, nur noch ein Meer aus braunen und schwarzen Mänteln. Dann öffnet sich das Dach des Bahnhofs, und der Zug fährt hinaus. Konrad sieht Straßen, Häuser, ein paar Pferdekutschen. Gleißende Sonne fällt durch das Fenster in ihr Abteil, die Strahlen blenden ihn, Konrad muss kurz die Augen schließen.
Das Gut
Eine Kaltfront
Berlin, 2005
Ein eisiger Wind fegt durch die Bleibtreustraße, vorbei an den Antiquitätenläden, den Cafés und den Secondhand-Boutiquen. Er wirbelt kleine braune Blätter vor den herrschaftlichen Jugendstil-Fassaden empor, er hebt die Mäntel der Passanten, die geduckt an den Häusern vorüberhasten. Der Himmel hängt schwer und grau über den Dächern. Am Ende der breiten, kopfsteingepflasterten Allee rattert die S-Bahn zwischen den Fensterfronten im ersten Stock.
Es ist Ende März. In den letzten Wochen gab es ein paar mildere, sonnige Tage. Die Bäume trieben bereits zarte Knospen, auf den Verkehrsinseln kämpften sich die ersten Krokusse durch die harte Erde, sodass alle schon auf einen baldigen Frühling hofften. Doch direkt nach Ostern schob sich erneut eine unerbittliche Kaltfront aus östlicher Richtung heran und legte sich wie eine frostige Glocke über die Stadt.
Nona eilt die Straße entlang, sie zieht sich den Schal enger um den Kopf und biegt dann in den Eingang eines frischgestrichenen weißen Hauses. Vor der Tür steht eine junge Frau, sie inspiziert die geschwungenen Schriftzüge auf den Messingschildern. Mutter und Tochter umarmen sich kurz.
»Wann ist es passiert?«, fragt Alexa, während sie klingelt.
»Heute Vormittag, glaube ich. Woher weißt du …?«
»Ira hat mir eine SMS geschickt.« Alexa hält ihr Handy hoch. Konrad ist gestorben. Kommt zum Tee, steht im Display. Nona schnaubt verächtlich.
Der Türöffner summt.
Nona und Alexa steigen langsam die dunkle Mahagoni-Treppe hinauf. Es riecht nach frischer Farbe. Das Treppenhaus ist gerade saniert worden, hier und da hängen noch Klebestreifen und Plastikplanen an der Holzvertäfelung, darüber leuchtet es hellbeige. Neue, auf antik gemachte Jugendstil-Lampen hängen von der Decke, sie tauchen alles in gedämpftes, edles Licht.
Die Wohnungstür im zweiten Stock ist angelehnt, sie treten leise ein. Iras Stimme schallt durch den Flur, sie ist hinten in der Küche, sie telefoniert.
»Ja, KOLBERG. Gräfin KOLBERG. Richten Sie ihr bitte aus …«
Nona zieht die Tür vorsichtig hinter sich zu, sie schleichen ins Wohnzimmer – zwei herrschaftliche Salons in kräftigem Gelb, die durch eine Flügeltür miteinander verbunden sind. Stuck an der Decke, Stiche an der Wand. Eichenparkett. Ira hat das silberne Teeservice auf den Tisch zwischen den Biedermeier-Sofas gestellt, neben Silberputzmittel und einen schwarz verschmierten Lappen. Quer über dem großen Perserteppich liegt ein Staubsauger, anscheinend erwartet sie die Putzfrau. Die beiden Fenster, die zur Straße hinausgehen, sind geöffnet, die Vorhänge bauschen sich im Wind.
Iras Stimme dringt aus der Küche.
»Sie soll HEUTE kommen, HEUTE. Nicht MORGEN. Sofort. Kommen.«
Nona und Alexa stehen etwas unschlüssig herum.
Nona räuspert sich und schält sich langsam aus Mantel und Tüchern.
Ira eilt mit energischen, lauten Schritten über das Parkett. Sie ist groß, blond und braun gebrannt, mit der drahtigen Figur einer lebenslangen Reiterin. Ihre Haare wippen in einem hohen Pferdeschwanz hinter ihr her, sie trägt Jeans und ein weißes Polohemd. Obwohl sie Ende fünfzig ist, hat sie etwas Mädchenhaftes. Sie zwinkert stark mit den Augen – es ist einer ihrer Ticks, der sich mit der Zeit immer stärker ausgeprägt hat.
»Entschuldigt, ihr beiden Süßen! Das Telefon geht unentwegt, und Jadwiga ist heute noch nicht gekommen. Ich muss noch so viel organisieren. Wie geht es euch, was kann ich euch denn anbieten, Kaffee, Tee?«
Der Tod ihres Mannes scheint Iras eifrige, patente Betriebsamkeit nicht zu beeinträchtigen, im Gegenteil, sie wirkt besonders geschäftig und tatenhungrig. Als gehe es darum, etwas Aufregendes zu organisieren. Etwas Großes.
Nona schaut sich im Wohnzimmer um.
»Danke, ich glaube, wir brauchen nichts, Ira.« Alexa hat sich angewöhnt, für beide zu antworten, da ihre Mutter inzwischen oft nur noch in ihrer eigenen Welt zugegen ist.
»Gut, umso besser, das Silber ist ja immer noch nicht geputzt. Das muss ich auch noch alles machen. Herrgott! Wie ihr seht, geht es hier –«
Nona räuspert sich erneut, sie lehnt sich leicht nach vorn, um einen Blick in den angrenzenden Salon werfen zu können. »Wo …?«
Ira blinzelt sie an.
»Was kann ich dir bringen, Liebes?«
»Wo ist er?«
Das Gästezimmer ist ein schmaler Schlauch, der hinter der Toilette vom Flur abgeht. Es ist höchstens zwei Meter breit, verjüngt sich nach hinten und endet mit einem winzigen Fenster zum Hof. Eigentlich ist es das Dienstbotenzimmer, das kleinste Zimmer der Wohnung, eng, fast klaustrophobisch, mit abgehängter Decke. Neben das Einzelbett passen gerade noch zwei wackelige Holzstühle. Auf dem Nachttisch brennt eine dicke, weiße Kerze. Jemand hat eine Vase mit weißen Lilien auf den Boden gestellt, sie verströmen einen penetranten Duft.
Ira, Nona und Alexa stehen im Türrahmen und schauen hinein.
Konrad sieht aus, als halte er gerade ein Nickerchen, er liegt auf dem Rücken, die Hände sind auf der Brust gefaltet, die Füße ruhen auf einer karierten Decke. Der Siegelring an seinem Finger leuchtet im Schein der Kerze.
»Warum ist er hier?«, fragt Nona.
»Ich dachte mir, dass er es hier am ruhigsten hat.«
Nona und Alexa quetschen sich an Ira vorbei und nehmen auf den Stühlen Platz.
Konrad trägt dieselbe Kleidung wie immer: ein hellblaues Hemd, einen grauen Kaschmirpullover mit Aufnähern an den Ellenbogen, eine beigefarbene Stoffhose. Seine Füße stecken in schwarzen Socken. Der Pullover wirft Falten am Ärmel, alles sieht zwei Nummern zu groß aus an ihm, er ist mager geworden. Dort, wo sein linkes Handgelenk aus dem Hemd schaut, sieht Nona seinen runden, fingernagelgroßen Leberfleck: »die Uhr«.
»Seid ihr sicher, dass ich euch nichts bringen kann?«, fragt Ira, die noch immer im Türrahmen steht.
»Nichts, danke«, sagt Alexa und lächelt. Geh jetzt bitte.
»Noni?«, setzt Ira nach.
Nona reagiert nicht, sie starrt auf ihren Bruder. Alexa schüttelt den Kopf und lächelt ihrer Tante entschuldigend zu.
»Na gut, wenn ihr ganz sicher alles habt, was ihr braucht …« Für einen Moment erscheint Ira unschlüssig. Sie schaut von Nona zu Konrad und wieder zurück. In der Küche klingelt das Telefon.
»Endlich, das ist hoffentlich Jadwiga. Bülows wollten noch kommen, auch Hartmanns haben sich angekündigt.« Ira schickt sich an zu gehen, doch dann überlegt sie es sich anders, sie macht einen Schritt ins Zimmer, beugt sich zu Konrad hinunter und streicht ihm mit der flachen Hand seitlich über die Stirn, mehrfach, als wolle sie seinen Scheitel richten. Sie küsst seinen Kopf und richtet sich wieder auf. Es ist eine innige, zärtliche Geste.
»Na, na, mein Konnilein, jetzt geht es dir besser.«
Nona ist endlich aus ihrer Trance aufgewacht. Sie und Alexa tauschen kurz Blicke aus. Für wen ist dieses Schauspiel gedacht?
»Du glaubst gar nicht, was Särge kosten, Nona!«, hat Ira sie vor einigen Monaten aufgeklärt, als sie beim Adventstee im Wohnzimmer saßen. »Zwei- bis dreitausend Euro, und da geht es erst los! Das einfachste Modell: Birkenholz, furniert. Zwei – tausend – Euro! Für Furnier! Aber nicht mit mir. Ich habe mich schlaugemacht im Internet. Ich habe eine Website gefunden mit unglaublichen Angeboten, in Polen, sie bringen die Särge sogar rüber. Kiefer, aber auch edle Sachen, Nussholz, Mahagoni. Ich lass mich doch nicht über den Tisch ziehen!«
Alexa saß mit Konrad im Nebenzimmer. Trotz der Adventsmusik war Iras schrille Stimme nicht zu überhören. Konrad verdrehte die Augen und quittierte Iras Vortrag erst mit einem spöttischen Lächeln, doch als seine Frau partout nicht aufhörte, richtete er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf und brüllte in den Gang: »Könntet ihr beiden euch diese reizende Unterhaltung vielleicht für später aufsparen?« Er zitterte vor Anstrengung, doch seine Stimme war erstaunlich kraftvoll. »Noch bin ich am Leben!«
Dann drehte er sich zu Alexa um, lächelte konspirativ und fügte leise hinzu: »An Scheidung haben wir nie gedacht. An Mord – täglich.«
Konrad ist erst seit ein paar Stunden tot, und doch sieht er vollkommen verändert aus. Sein Haar ist dunkler, fast schwarz, die Haut dagegen schimmert transparent, als bestehe sie aus verschiedenen Wachsschichten. Olivgrüne Schatten liegen um seine Augen. Seine Züge wirken schärfer als sonst, wie aus Holz geschnitzt. Schmale Lippen, gebogene Nase. Der Mund steht ein Stück offen, der Unterkiefer sackt leicht nach unten. Sein Gesichtsausdruck ist verzerrt, er wirkt leidend. Wie nach einem schweren Kampf.
Er sieht aus wie Agnes, denkt Nona. Vielleicht tun wir das zum Schluss auf dem Totenbett alle, wir gehen, wie wir gekommen sind, als Teil von ihr.
Nona beugt sich vor und nimmt vorsichtig seine linke Hand. Sie streichelt seinen Handrücken, das Muttermal, sie fährt mit ihrem Finger über den Ring. Seine Hände sind so weich, sie waren es immer schon, als Kind ganz besonders, aber auch als erwachsener Mann hatte er noch dieselben weichen Handinnenflächen. Seine Haut ist glatt und kühl, doch sie spürt, wie sich die Muskeln darunter langsam verhärten. Seine Finger sind schon leicht gekrümmt, wie eine geöffnete Tatze.
Hinter seinem Ohr haben sich bereits dunkelrote Flecken gebildet, rote Blutkörperchen, die sich nach dem Tod an der Unterseite des Körpers sammeln. Livor mortis, Leichenflecken. Nona hofft, dass Alexa es nicht bemerkt.
Nona hebt seine Hand an ihr Gesicht, sie streichelt sie und will sie an ihre Wange legen, als Konrad auf einmal ein lautes Seufzen entfährt.
Ihr wird heiß und kalt, ein Gefühl des Grauens packt sie. Hat er gerade ausgeatmet?
Wenn sie länger hinschaut, kommt es ihr so vor, als würde sein Brustkorb sich leicht heben. Nona blickt erschrocken zu Alexa, doch die hält ihre Augen geschlossen.
Konni?
Nona beginnt zu schwitzen. Ihr Herz rast.
Sie will ihn ansprechen, doch es ist ihr vor Alexa peinlich. Sie legt seine Hand zurück auf die Brust, behutsam, als könnte sie ihm weh tun, und lehnt sich zurück. Sie starrt auf seine Nasenlöcher, seinen Mund. Nichts bewegt sich. Langsam beruhigt sie sich wieder.
Jemand kommt zur Haustür herein, sie hören gedämpfte Stimmen im Flur, der Gong einer Wanduhr ertönt. Kurz darauf das Summen des Staubsaugers. Iras flinke Schritte hallen immer wieder durch den Flur. Es klingelt. Jemand klopft leise an der Tür, Konrads ältester Sohn Tobias steckt seinen Kopf herein. Er lächelt den beiden zu. Er wirkt gefasst. Schließlich wussten sie alle, dass dieser Tag bald kommen würde.
Vor zwei Jahren bekam Konrad die Diagnose. Schon monatelang hatte er verschiedene Symptome gehabt, die er immer unterschiedlich einordnete. Blaue Flecken an den Beinen – die stammten wohl von einer Radtour mit Heike im Erzgebirge. Nasenbluten, zum ersten Mal in seinem Leben – das lag bestimmt an der schlechten Luft im Truckerhof. Er fühlte sich ungewöhnlich schlapp – doch das war sicher die Frühjahrsmüdigkeit. Er kaufte teure Vitaminpräparate aus der Apotheke, aber es wurde nicht besser. Er nahm ab. Anfangs schob er es auf den Stress, das Rauchen, seine Geldsorgen. Doch die Symptome wurden stärker, irgendwann konnte er sie nicht mehr ignorieren.
Als der Chefarzt des Westend-Klinikums ihn bat, noch am gleichen Tag zu ihm zu kommen, glaubte Konrad ihm anfangs nicht.
»Akute Leukämie? Wie Blutkrebs? Sind Sie sich sicher?«
Der Arzt nickte. »Leukämie ist leider tückisch. Sie ist nicht leicht zu erkennen. Oft stellen wir eine Erkrankung ganz zufällig fest. Und Sie scheinen auch schon seit ein paar Jahren daran zu leiden.«
Konrad fing sofort mit der Chemotherapie an. Wenn jemand diesen Krebs besiegen würde, dann er! Hatte er nicht schon hundert Mal seinen Kopf aus der Schlinge gezogen? Wie oft hatte er seinen Job verloren, war ein Investor abgesprungen oder ein Deal geplatzt. Immer wieder hatten sie vor dem Nichts gestanden – mit zwei kleinen Kindern und einer hohen Hypothek. Monatelang hatte er sich verkrochen, in seine Depression eingeigelt, während Ira weiter Tennis spielte oder zu Reitturnieren nach Südfrankreich fuhr. Doch ihm war in letzter Minute immer etwas Neues eingefallen, was er aufziehen konnte: einen Porsche-Vertrieb, Immobiliengeschäfte, Tankstellen im Osten.
Die Chemotherapie kam viel zu spät. Nach drei Zyklen setzte er sie ab: keine Veränderung im Tumormarker, das Blutbild hatte sich kaum verbessert. »Keine sichtbare Eindämmung des Verlaufs«, vermerkte sein Arzt lapidar in der Akte. »Einvernehmliche Beendigung der Therapie.«
Immerhin musste Konrad ohne Medikamente deren Nebenwirkungen nicht mehr ertragen. Ohne Chemotherapie konnte er fast vergessen, dass er krank war, zumindest am Anfang. Sein Gesicht war zwar noch aufgedunsen, aber seine Kraft kehrte zurück. Er fühlte sich besser, schmiedete neue Pläne. Manchmal beschlich ihn heimlich der größenwahnsinnige Gedanke: Konnte es nicht sein, dass er den Krebs doch besiegt hatte, ganz ohne Medizin?
Allein der Blick in den Spiegel, sein konturloses Gesicht, bei dem der Hals nach oben hin anschwoll und einfach nahtlos in seine Wangen überging – dieser Anblick holte ihn aus seinen Träumen zurück und erinnerte ihn erbarmungslos daran, dass er krank war.
Der Chefarzt des Westend-Klinikums blieb unerbittlich. Dies wird Ihr letzter Sommer, Herr von Kolberg. Dann: Wenn Sie bis zum Herbst durchhalten, wäre das ein Wunder. Danach: Mit etwas Glück schaffen Sie es in den November.
Es war Konrad selbst, der bei jedem Besuch um diese Todesprognosen bat. »Bitte reden Sie nicht um den heißen Brei herum! Sagen Sie mir klipp und klar mein Verfallsdatum.« Er weidete sich geradezu daran, ein besonders düsteres Urteil zu bekommen.
Vielleicht haben Sie noch ein letztes gemeinsames Weihnachten. Silvester werden Sie nicht mehr feiern. Dann: Bis in den Februar schaffen Sie es vielleicht noch, aber Ostern erleben Sie bestimmt nicht mehr.
Jeden neuen Termin schien Konrad als Ansporn, als Herausforderung zu sehen. »Ostern liegt früh in diesem Jahr, das wäre doch gelacht!«, gab er Nona gegenüber an.
Und tatsächlich: Er starb nicht. Alle paar Wochen empfingen die Ärzte ihn aufs Neue, kopfschüttelnd, lächelnd: Er war immer noch da. Falls sie anfangs noch mit ihm witzelten, verdunkelte sich ihre Laune jedoch merklich, sobald die Sprechstundenhilfen die neuesten Laborwerte hereinreichten. Dann wurde es ernst, die Ärzte seufzten und gaben ihm ein neues Ultimatum mit nach Hause, mit dem Versprechen, ihm gute Schmerzmittel zur Verfügung zu stellen.
Es war geradezu so, als weigere er sich zu sterben. Und wieso sollte er auch? Sein Leben war noch nicht vorbei. Herrgott, er war das jüngste der zehn Geschwister! Und die lebten alle noch! Warum sollte er als Erster gehen müssen? Er hatte doch eine glückliche Familie. Zwei gelungene Söhne! Endlich Erfolg im Job, nach einigen Rückschlägen (und noch einigen Altlasten). Eine Frau in Berlin, eine Geliebte in Leipzig – wer kann das schon vorweisen? Wochenenden beim Jagen, zwei BMW – geleast, aber immerhin. Er lebte intensiver als diese ganzen Schnarchnasen zusammen, mit ihren drögen Bürojobs, Bausparverträgen und ihrem risikobefreiten Alltag. Sollte doch einer dieser Lahmärsche Krebs kriegen.
»Ich sehe es nicht ein. Ich bin nicht bereit«, hatte er Nona gesagt. Er hörte auf, den Ärzten zu glauben.
»Ostern werden Sie nicht mehr erleben, ganz sicher nicht«, das war die letzte Prognose des Chefarztes.
Ira kommt zurück ins Totenzimmer. Sie hat sich umgezogen, sie trägt ein graues, mit türkisen Fäden durchwirktes Kostüm, in der Hand hält sie zwei Perlenohrringe. Eine Parfümwolke umgibt sie.
Sie setzt sich Nona und Alexa gegenüber auf die Bettkante, wobei sie Konrads Arm leicht zur Seite schiebt wie ein Kissen, das im Weg ist. Sie legt den Kopf zur Seite und steckt ihre Ohrringe an, dann lächelt sie triumphierend.
»Eins kann ich euch sagen.« Sie hebt den rechten Zeigefinger und macht eine kurze Kunstpause. Klimper, klimper. »SIE. Wird. Nicht. Zur. Beerdigung. Eingeladen.«
Ira wartet kurz, damit ihre Worte die volle Wirkung entfalten können, aber weder Nona noch Alexa reagieren auf die Ankündigung.
Ira fährt unbeirrt fort.
»Sie wird nicht eingeladen. Und sie wird es nicht ertragen! Sie wird wissen, dass alle kommen, die ganze Familie wird zur Beerdigung kommen, ohne sie!«
Sie kichert ein bisschen. »Es wird sie umbringen.«
Es klingelt wieder an der Haustür. Ira steht auf, glättet ihren Rock und geht hinaus, um die neuen Gäste zu begrüßen. Im Wohnzimmer sitzen ein paar Besucher, auf den Tischen stehen mehrere große Blumensträuße. Es gibt Tee. Nona huscht in den Flur, greift nach ihrem Mantel und verlässt grußlos die Wohnung. Alexa folgt ihrer Mutter, sie wirft im Vorbeigehen noch einen Blick in den Salon und nickt der Gruppe entschuldigend zu.
Als sie auf die Bleibtreustraße hinaustreten, hat die Abenddämmerung eingesetzt. Die Gaslaternen springen mit einem kurzen Flackern an, ein warmes Licht erhellt die Galerien. Es riecht nach Frost, winzige Schneeflocken fallen vom Himmel und tanzen im Lichtkegel der Laternen. Auf dem Bürgersteig hat sich eine dünne, weiße Decke gebildet.
»Lausiges Wetter«, sagt Nona. Sie wickelt sich den Schal um den Kopf und schaut nach oben. Der Schnee wird immer dichter, die Fassaden der gegenüberliegenden Häuser sind nur noch undeutlich zu erkennen.
»Immerhin«, sagt Alexa.
»Was immerhin?«
»Immerhin hat er doch bis nach Ostern durchgehalten.«
Die süße Erde
Gut Mohrungen bei Königsberg, 1943
Agnes steigt langsam die breite Treppe hinauf. Sie tastet sich am Geländer entlang, das Licht der Messingleuchten auf der Empore ist schwach. Sie kennt sich im Ostflügel von Mohrungen nicht gut aus. Der Ostflügel ist Kunos Reich. Ihr Mann ist erst vor ein paar Tagen von der Front zurückgekehrt, sie haben seitdem kaum ein Wort miteinander gewechselt. Agnes will ihn aufsuchen. Sie hat einen Plan, und sie hat nicht mehr viel Zeit, ihn umzusetzen.
Draußen ist die Sonne schon fast untergegangen. Im Garten kann sie nur schwach die Umrisse des alten Apfelbaums ausmachen, darunter eine kleine, kahle Erhebung. Seit Du begraben liegst auf dem Hügel / Ist die Erde süß. Agnes bleibt stehen und schließt kurz die Augen.
Einen Tag lang hat sie im Bett gelegen, dann ist sie aufgestanden und wieder zur Tagesordnung übergegangen. So, wie man es von ihr erwartete. Es gibt ja immer viel zu tun, mit den Kindern, den Angestellten, dem Gut. Und Agnes ist vor allen Dingen ein äußerst pragmatischer Mensch. Das kleine Ställchen hat Frieda noch in der ersten Nacht abgebaut, die Wiege diskret verschwinden lassen. Es war so, als wäre nichts geschehen. Und was hätte es auch genutzt zu klagen.
»So etwas passiert, Frau Gräfin. Sie trifft keine Schuld. Es war Gottes Wille. Denken Sie nicht daran, leben Sie Ihr Leben weiter, und erfreuen Sie sich an den Kindern, die Sie haben«, sagte der Arzt, als er sie untersuchte. Agnes nickte. Er sah sie aufmunternd an und klappte seinen Koffer zu. »Sie werden sehen, bald ist Sommer, und Sie haben alles vergessen.«
Doch sie vergaß es nicht. Auch wenn sie ihre Gedanken tagsüber unter Kontrolle hatte, während sie Besorgungen in Königsberg erledigte, mit dem Schmied durch die Ställe ging, um die Pferde neu beschlagen zu lassen, oder mit den Kindern vor dem Zubettgehen in der Bibel las, nachts dachte sie daran. Sie schlief kaum, drehte sich unter ihren Decken hin und her. Sie schwitzte so stark, dass sie mehrfach das Nachthemd wechseln musste. Woher kam diese ganze Flüssigkeit in ihr?
In der dritten Nacht, als sie die Hoffnung auf Schlaf gänzlich aufgegeben hatte, schlich sie schließlich hinunter in den Salon. Emilie, die erste Frau ihres Mannes, hatte regalweise Bücher hinterlassen, Gedichtbände, Romane, Biographien, Agnes hatte sie jahrelang ignoriert. Nichts hätte Agnes von Kolberg unter normalen Umständen ferner gelegen, als sich nachts in Romanwelten zu flüchten oder Gedichte zu lesen, doch nun zog sie ein paar Bände heraus und nahm sie mit nach oben. Und so gefasst Agnes sonst war, die Gedichtzeilen taten ihre Wirkung, schon nach den ersten Seiten flossen ihr die Tränen über die Wangen, sie löste sich auf in ihrer Trauer. Seit du begraben liegst auf dem Hügel / Ist die Erde süß. Wo ich hingehe nun auf Zehen, Wandele ich über reine Wege. O, deines Blutes Rosen / Durchtränken sanft den Tod. Ich habe keine Furcht mehr / Vor dem Sterben.
Hatte ihr Glück sie verlassen? So schnell hatte man den kleinen Jungen fortgeschafft, und jetzt lag er da so allein in der kalten Erde. Hätte sie ihn nicht noch etwas im Arm halten können? Es war ihr peinlich, es entsprach ihr gar nicht, sich ihren Gefühlen so hinzugeben. Sentimental! Aber sosehr sie es auch versuchte, der Anblick ihres toten Kindes ging ihr nicht aus dem Kopf. Eine Nacht lang werde ich noch an ihn denken, an sein feines Gesicht, die schmalen Finger, die hellen Haare. Nur noch eine Nacht.
Schließlich war es Frieda, das Kindermädchen, das Agnes wieder Mut machte. Sie erschien eines Morgens in ihrem Zimmer, schob die Vorhänge beiseite und riss die Fenster auf. Die Gedichtbände vom Nachttisch sammelte sie ein. »Die bringe ich jetzt mal nach unten.« Sie stellte Agnes ein Tablett auf ihre Decke, mit Tee, einem Marmeladenbrot und einem blühenden Zweig vom Apfelbaum in einer kleinen Vase. »Draußen blüht alles wieder«, sagte Frieda, als sie sah, wie Agnes nachdenklich die weißen Blätter berührte. »Wer weiß, was noch alles kommt im Leben. Als meine kleine Schwester geboren wurde, war unsere Mutti schon dreiundvierzig!«
Agnes sah sie erstaunt an.
»Man weiß nie, will ich damit nur sagen!«
Agnes biss in das Marmeladenbrot und überlegte, während Frieda das Bett frisch bezog. Vielleicht war es ja möglich. Vielleicht würde das Schicksal sie ein weiteres Mal beschenken. Und nachdem sie beschlossen hatte, dass nichts endgültig entschieden war, ging es ihr tatsächlich besser.
Agnes wird schnell schwanger. Sie und Kuno haben bereits drei Kinder, zudem hat sie drei Töchter mit in die Ehe gebracht und Kuno ebenso. Insgesamt acht Mädchen sind es auf Gut Mohrungen und – immerhin – ein Junge: Moritz. Agnes hat bislang alles, was die Fortpflanzung betrifft, dem Zufall überlassen. Sie liebt Kuno, auch wenn sie den Akt an sich nicht besonders schätzt. »Es soll ja Frauen geben, die Gefallen daran finden«, sagt sie bisweilen spöttisch. Sie gehört eindeutig nicht dazu. Doch sie hat sich damit abgefunden, schließlich heiligt der Zweck die Mittel. Und so ist sie in dieser Ehe jedes Mal nur wenige Monate nach der letzten Geburt wieder schwanger geworden.
Allerdings mit einem Makel. »Es gibt einen starken Frauenüberschuss im Hause Kolberg«, seufzt Frieda immer, wenn die Mädchen sich zanken. Acht Mädchen auf einen Jungen – dabei konnte es nicht bleiben.
Agnes versuchte, die Ursache ihrer Mädchenlastigkeit zu ergründen. Noch mehr Mädchen brauchte nun wirklich niemand. Sie las dicke medizinische Wälzer, vor allem aber konsultierte sie Hebammen und die Frauen im Dorf. Eines Abends trat sie aus ihrem Zimmer und verkündete das Ergebnis ihrer Recherche: »Alles habe ich falsch gemacht! Es war zu früh! Ich muss erst den Mittelschmerz abwarten, und dann gehe ich zu Papi.«
Ihr größtes Problem dabei ist Kuno. Ihr Mann hat ihr schon bei der letzten Schwangerschaft zu verstehen gegeben, dass sein Bedarf an Kindern gedeckt ist.
Sosehr er seine zweite Frau auch liebt, die drei Kleinen, die sie zusammen haben, sind ihm mehr als genug. Moritz – gut, das war etwas anderes. Moritz’ Geburt vor sechs Jahren war ein Fest! Endlich ein Erbe! Zwanzig Schüsse wurden in Mohrungen abgefeuert, in Königsberg läuteten die Glocken. Agnes war stolz auf ihn und erleichtert darüber, dass sie die an ihren Bund mit Kuno gestellten Erwartungen sofort erfüllt hat.
Der kleine Moritz ist ein hübscher Junge, er sieht aus wie Agnes, mit einem schmalen, feingezeichneten Gesicht, blondem Haar und großen blauen Augen. Doch mit der Zeit entwickelte er sich zu einem nervösen und weinerlichen Kind, leicht reizbar, voller Albträume und Ängste. Er liegt Agnes nicht, er stillt nicht ihr Verlangen.
Für Kuno hätte dieser eine Sohn gereicht. Als dann Helene und Nona mit Abstand von nur einem Jahr kamen, zeigte er sich wenig begeistert. »Ich lehne jede Verantwortung ab!«, war sein Standardspruch, wenn er sich über ihre Wiegen beugte. Agnes versuchte, ihm ihre kleinen Mädchen anzupreisen: »Schau, Kunolein, Leni hat so einen musikalischen Hinterkopf und wunderbare Hände. Sie wird sicher eine ganz große Pianistin.« Doch es half nichts.
Die kleinen Kinder sind Kuno nicht nah. Ihr Gezänk, Moritz’ Weinerlichkeit, Helenes Herumdonnern auf dem Klavier – das alles zehrt an seinen Nerven, er meidet die Kinder, wo er kann. Agnes ist erstaunt darüber und auch etwas verletzt vom Desinteresse ihres Mannes. Schließlich ist sie seine große Liebe. Für sie hat er seine erste Frau verlassen.
Emilie war Agnes’ Cousine und von frühester Kindheit an ein ätherisches Wesen, klein, intellektuell und versponnen. Aufgrund einer mysteriösen Krankheit musste sie die Sonne meiden, zumindest gab sie dies vor, um die Tatsache zu rechtfertigen, dass sie so gut wie nie nach draußen ging. Es war ihr lieber so, sie las viel und schrieb Gedichte. Als Agnes sich eines Tages völlig unerwartet auf Altenstein, der Sommerresidenz der Kolbergs, ankündigte, hatten sie und Emilie sich zehn Jahre nicht gesehen. Emilie hatte sich gefreut. Sie liebte jegliche Ablenkung vom tristen Landleben.
»Du musst sie kennenlernen, Kuno, sie ist eine ganz außergewöhnliche Person!«, hatte sie mit dem Brief in der Hand gesagt. »Schon als Kind war sie sehr ernst, sehr bestimmt. Sie ist frisch geschieden, sie soll eine schreckliche Ehe hinter sich haben.«
Agnes erschien zwei Tage später mit dem Zug aus Berlin. Als sie ankam, lag Emilie gerade inmitten von Stapeln von Büchern und Zeitungen in einem der Salons. Ihre hellblonden Locken waren ungekämmt und standen wild in alle Richtungen ab, Bluse und Rock waren zerknittert, als habe sie darin geschlafen, ihre Brille saß etwas schief.
»Agi, mein Agilein! Wie herrlich!«
Emilie sprang auf. Die beiden mussten lachen, als sie sich umarmten, Emilie ging ihrer fünf Jahre jüngeren Cousine gerade bis zur Schulter. Agnes war groß und schlank mit einer männlich-schmalen Figur, das, was man eine »Erscheinung« nennt. Sie hatte ein strenges, ernsthaftes Gesicht mit einer geraden Nase und schmalen Lippen, umrahmt von kurzen, aschblonden Locken. Sie war erst dreißig, hätte aber auch zehn Jahre älter sein können.
»Agilein, schön, dich zu sehen! Du siehst, bei mir hat sich nichts verändert, ich verbringe den Tag immer noch inmitten meiner Bücher.«
Agnes lächelte nur, von den Büchern nahm sie keine Notiz, stattdessen musterte sie den Salon, die Eingangshalle. Sie zog ihre Handschuhe aus und begann, die vordere Fensterfront abzuschreiten.
Emilie lief neben ihrer Cousine her. »Kennst du die Gedichte von Stefan George, Agi? Er beeindruckt mich tief.« Emilie richtete ihren schwärmerischen Blick zur Decke. »Obwohl er düstere Vorahnungen hat über dieses Land …«
Agnes antwortete nicht, stattdessen schaute sie nachdenklich hinaus in den Garten. »Ein wunderbares Gut habt ihr hier, Emmy!«, sagte sie unvermittelt. »Der Baumbestand ist wirklich beachtlich.«
Emilie zog die Augenbrauen zusammen, als versuche sie, Agnes’ Gedanken zu folgen.
»Baumbestand … Ach, du meinst Altenstein?« Sie seufzte. »Weißt du, diese Güter unterscheiden sich für mich nicht sonderlich. Bäume, Felder, Pferde, ich hänge nicht daran. Wir sind nur im Sommer hier. Immerhin liegt es nicht so ab vom Schuss wie Mohrungen. Näher an Berlin. Aber du weißt ja, ich gehe ohnehin so gut wie nie in die Sonne, es ist fast egal, wo wir sind …«
Agnes kannte die Klagen aus Emilies Briefen: Das Gut, das Land, die Pferde, die Belange des Haushalts – all das empfand ihre Cousine als sterbenslangweilig. Mohrungen hätte genauso gut in Sibirien liegen können, was sie betraf. Sie war das Gegenteil einer patenten Gutsbesitzerin, die morgens ausritt und nach dem Rechten sah. Sie verachtete alles Ländliche. Die Sommermonate verbrachte sie in Berlin in literarischen Salons und den Winter in Freiburg, um der ostpreußischen Kälte zu entkommen.
Agnes schaute nachdenklich aus dem Fenster. »Natürlich ist diese Auffahrt vollkommen verschenkt«, stellte sie fest, ohne auf die Beschwerden ihrer Cousine einzugehen. »Ihr braucht eine Allee! Hier müsstet ihr eine Schneise durch den Wald schlagen, direkt auf das Hauptportal zu. So –«, Agnes vollführte eine ausladende Handbewegung, »so, dass man unter Kastanien direkt auf den Eingang zufährt. So, wie es jetzt ist – das ist doch keine Auffahrt.«
Emilie lachte erstaunt auf. »Na, zieh erst einmal deinen Mantel aus, bevor du hier alles abholzt.«
Die Tür öffnete sich, und ein Mädchen betrat den Saal, zwölf oder dreizehn Jahre alt. Es hatte die gleichen hellblonden Haare wie seine Mutter, trug sie aber kurz, kinnlang. Eine Spange fixierte den strengen Seitenscheitel. Sie war fast so groß wie ihre Mutter, nur kräftiger, fast pummelig, die Bluse spannte über dem Bauch. Selbstbewusst kam sie mit großen Schritten auf die beiden Frauen zu.
»Das ist Isolde, unsere Älteste«, erläuterte Emilie. Isolde streckte ohne eine Spur von Schüchternheit die Hand aus. »Willkommen auf Altenstein, Tante Agnes.«
Agnes musste lächeln über die kleine Hausherrin, die trotz der unvorteilhaften Figur ihrer zerzausten Mutter in Sachen Haltung und Auftreten einiges beizubringen vermochte.
Sie inspizierte das Mädchen genau, sein hellblondes Haar, die dichten, weißlichen Wimpern, die über den wässrig blauen Augen hingen und ihr etwas Kälbchenhaftes verliehen.
»I-SOL-de. I-sol-DE.«
Agnes betonte den Namen, als wäre er eine ihr unbekannte chemische Formel.
»Du bist ja ein hübsches Mädchen.« Isolde strahlte wie jemand, der nicht oft ein Kompliment bekam. »Und du hast ja eine fabelhafte Frisur. Die gefällt mir.«
Isolde drehte den Kopf zur Seite, damit der Gast ihr Haar besser bestaunen konnte. »Das ist ein Bob«, sagte sie.
»Ein Bob! Er steht dir ausgezeichnet. Bob. Bob-by. Bobby! Das passt besser!«
Erst dann wandte Agnes sich Kuno zu, der in der offenen Tür zum Salon stand und die Szene schweigend beobachtete. Sie schien nicht überrascht, den Gutsherrn zu erblicken. »Ich bin Agnes«, sagte sie und streckte ihre Hand aus. »Wir kennen uns noch nicht.«
Doch das stimmte nicht ganz. Agnes hatte Kuno ein paar Wochen zuvor gesehen, auf einem Fest bei Freunden in Berlin. Er war ihr sofort aufgefallen, mit seinen hellen Augen, dem weichen Blick, dem traurigen Mund. Sie hatte ihn einen Moment lang beobachten können, wie er verträumt durch die Schar der Gäste gewandelt war, seinen Gedanken nachhängend – entrückt, als schwebe er in anderen Sphären. Sie wurden einander an dem Abend nicht vorgestellt, aber Agnes war sich sicher: Der sollte es sein und kein anderer. Sie hatte sich nach ihm erkundigt und war schließlich, als sie von der familiären Verbindung erfuhr, nach Altenstein gefahren. Mit festen Vorsätzen.
Zwei Wochen später zog Emilie mit ihren Töchtern und ein paar Bücherkisten aus Altenstein aus, zurück nach Freiburg. Kuno und Agnes hatten ihr zu verstehen gegeben, dass sie ihrer Nachfolgerin möglichst schnell Platz machen solle. »Mamis Schränke sind noch warm«, klagte eine der verdrängten Töchter. »Ich habe es ihr erklärt«, sagte Agnes hingegen, als wäre dies ein ganz gewöhnlicher Vorgang und kein Rausschmiss, und fügte gönnerhaft hinzu: »Freiburg passt viel besser zu ihr.«
Nur Isolde blieb. Sie selbst hatte es so entschieden, der Schule wegen, hieß es. In Wirklichkeit war es ihre sofortige, innige Verbundenheit mit der neuen Stiefmutter, die Bobby bleiben ließ. Sie hatte sich geradezu verliebt in diese Frau, die ihr vom ersten Moment an so viel Achtung entgegengebracht hatte. Agnes nahm die neue Tochter mit dem Großmut der Siegerin auf. Sie zog mit ihren drei eigenen Töchtern ein, noch bevor der Sommer zu Ende war.
Während Agnes in Mohrungen die Treppe emporsteigt, beschleichen sie Zweifel. Sie bleibt auf der vorletzten Stufe stehen. Wie wird sie Kuno überzeugen können? In seiner Verfassung? Die Weltlage ist seit ihrer letzten Schwangerschaft nicht freundlicher geworden. In den letzten Wochen hatte selbst sie manchmal Zweifel an dem Vorhaben bekommen. Aber heute früh spürte sie das vertraute Ziehen im Bauch wie ein kurzes Aufflackern, und ihr war nach dem Frühstück kurz heiß und kalt geworden. Sie weiß: Nun ist der Moment da, der Moment für einen Jungen. Kuno ist außerdem zugegen, wenn sie die Gelegenheit jetzt nicht nutzt, wird sie vielleicht nie wiederkommen.
Agnes klopft vorsichtig an die Tür und öffnet sie dann, ohne auf Einlass zu warten. Kuno sitzt auf seinem Bett und raucht, ein Aschenbecher und verschiedene Dokumente liegen vor ihm. Er schaut hoch zu seiner Frau, zuerst überrascht, dann seufzt er leicht und lächelt wehmütig wie jemand, der verloren hat und seine Niederlage eingestehen muss.
»Nun, Agnes.«
Er schiebt die Blätter beiseite und klopft auf die Bettdecke.
Ein Baum im Herrenhaus
Altenstein, 1992
Nonas Haare wehen im Wind. Sie trägt ein rotes Kopftuch, um ihre Frisur zu schützen, doch einige Strähnen haben sich gelockert und peitschen ihr immer wieder ins Gesicht. Konrad sitzt am Steuer seines Porsches, nach langen Verhandlungen hat Nona ihm erlaubt, das Verdeck abzunehmen. Es ist Mai, sonnig, aber noch kühl. Die Betonplatten der DDR-Autobahn geben den steten Rhythmus ihrer Fahrt vor: Te-Dum, Te-Dum, Te-Dum.
Sie sind auf dem Weg nach Altenstein. Konrad ist erleichtert, dass Nona mitgekommen ist. Er ist schon ein paarmal in die neuen Bundesländer gefahren, aber noch nie hierher, in das flache, sandige Land nördlich von Berlin. Das hat er sich bisher nicht getraut, obwohl er seit jener Nacht im November, in der die Menschen auf der Mauer getanzt haben, an fast nichts anderes mehr denken kann. Er ist elektrisiert, besessen von dem Gedanken. Es muss doch möglich sein? Jetzt ist doch alles anders? Er ist nach Berlin, nach Leipzig, sogar nach Neuruppin gefahren, um dort beim Amt für Offene Vermögensfragen seinen Antrag einzureichen. Nur um Altenstein selber hat er bisher einen Bogen gemacht.
Schließlich ist ihm Nona eingefallen. Sie könnte doch mitkommen! Nona würde sich in Altenstein auskennen, sie würde wissen, wo das Gut lag, wen man im Dorf ansprechen konnte, wer von früher noch dort lebte. Und überhaupt: Sie würde ihn unterstützen. Sie hatte es immer getan.
Die Landschaft um sie herum ist flach, zu beiden Seiten der Straße liegen bestellte Felder, zwischen denen sich hier und da kleine Misch- und Nadelwäldchen erheben. Der Raps blüht grellgelb. Die Sonne scheint zwischen den Lindenbäumen hindurch, an den Ästen schimmert zartes Grün.
Es war nicht ganz einfach, seine Schwester von der Reise zu überzeugen. Vor allem die Aussicht auf eine lange Autofahrt mit ihm schreckte sie ab. »Sechshundert Kilometer Transitstrecke, mit dir am Steuer? Im Porsche? Auf gar keinen Fall. Und wozu? Um mir eine Ruine anzusehen?« Doch schließlich willigte sie ein, auch sie war neugierig.
Natürlich mit strengen Auflagen. Sie wäre nicht Nona, wenn sie der Sache nicht ihren Stempel aufdrücken würde. Nona wirkt weich und anschmiegsam mit ihren braunen Rehaugen und ihrer olivfarbenen Haut, so als käme sie gerade aus dem Urlaub, braun gebrannt, ewig jugendlich. Immer ist sie bereit, sich von ihm amüsieren zu lassen. Doch Konrad weiß nur zu gut, dass das reine Fassade ist. Seine Schwester verfügt über einen eisernen Willen, den sie in fast jeder Situation durchsetzt – eine Eigenschaft, die ihn schon bei seiner Mutter rasend gemacht hat. Anders als bei Nona wusste man bei Agnes allerdings beim ersten Blick auf ihr strenges Feldwebel-Gesicht, woran man bei ihr war. Nona dagegen ist eine echte Mogelpackung.
»Falls wir fahren, und ich sage nur falls, dann sollten wir in Berlin übernachten. Und wir sollten uns zwei Tage Zeit lassen für die Fahrt, mindestens.« Dies war die erste Bedingung.
»Mindestens?«, fragte Konrad ungläubig. »Ich fahre sonst an einem halben Tag hin. Was willst du denn zwei Tage lang auf der Strecke?«
Doch Nona war noch nicht fertig. »Außerdem: Keine Überholmanöver, Konni! Weder von rechts noch von links. Wir bleiben auf der rechten Spur, die ganze Zeit, hörst du? Und schwöre, dass du nicht schneller als hundert fahren wirst! Und das Verdeck bleibt geschlossen, die ganze Zeit.«
»Nönnschn! Du worst ja scheinbor noch nie bei die Brüdär und Schwestärn seit dr Wände. In där D-D-ÄRR dorfst du niemols schnellr wie Hundärt foahrn. Des ist verbotän! Außerdäm lässt doas dr sozialistische Bodnbeloch net zu!«
Nona lächelte. »Es ist mein Ernst, Konrad. Schwöre! Sonst kannst du in deiner Proleten-Schleuder alleine fahren.«
Konrad hob Zeige- und Mittelfinger zum Schwur, dann lächelte er spöttisch. »Immerhin habe ich noch kein Knöllchen bekommen, weil ich auf der Autobahn zu langsam gefahren bin«, sagte er süffisant. »Ganz im Gegensatz zu dir.«
Seitdem sie die ehemalige deutsch-deutsche Grenze passiert haben, ist Nona entspannt. Sie hat endlich aufgehört, auf der Beifahrerseite mit zu bremsen oder sich am Türgriff festzuklammern, wenn ihnen ein Auto entgegenkommt. Ihre nackten Füße liegen auf dem Armaturenbrett. Sie raucht, sie versucht, den komplizierten Falk-Atlas zu entfalten, sie schiebt seine Musik in den CD-Player und singt mit. Wenn sie Menschen am Straßenrand sieht, gestikuliert sie wild herum und ruft: »Ist das hier alles die Täterääää?«
Konrad fischt eine Zigarette aus seiner Brusttasche, zündet sie an und schaut seiner Schwester zu, die sich gerade im Beifahrerspiegel die Lippen nachzieht. Nona sieht seinen Blick und hebt eine Augenbraue.
»Was Agnes wohl sagen würde?«, fragt er.
Nona dreht den Kopf zur Seite. »Wie meinen? Sprechen Sie bitte in mein gutes Ohr!« Nona ist seit ihrer Kindheit auf dem linken Ohr taub. Gespräche im Cabrio sind eigentlich unmöglich.
»Was, meinst du, würde sie sagen? Agnes! Dazu, dass wir nach Altenstein fahren?« Er muss schreien, um gegen den Fahrtwind, die Betonplatten, Nonas Taubheit und Paolo Conte anzukommen.
Nona fährt sich mit Zeigefinger und Daumen über die Mundwinkel, eine typische Agnes-Geste, auf die zumeist eine strenge Zurechtweisung der Kinder folgte. Von allen Geschwistern kann sie ihre Mutter am besten nachahmen.
»Nun, Konnilein, es wurde aber auch Zeit, dass aus dir endlich mal etwas wird und du Papis Gut für uns zurückholst.«
In Gerstenberg fahren sie von der Autobahn ab, doch Altenstein ist nicht zu finden. Stattdessen nur unattraktive Straßendörfer mit hässlichen Namen, die ihm nichts sagen. Pirow. Ternitz. Netzeberg. Dazwischen wunderschöne Alleen mit hohen Linden und Kastanien. Eine halbe Stunde lang kurven sie durch verlassene Ortschaften. Nona faltet hektisch den Atlas auseinander und wieder zusammen. Sind sie zu früh abgefahren? Eigentlich ist es denkbar ungünstig, dass sie für die Navigation zuständig ist, bei ihrem Orientierungssinn. Konrad lenkt den Wagen zurück auf die Autobahn.
»Die nächste Abfahrt muss es sein, da bin ich ganz sicher«, sagt Nona kleinlaut. Doch es kommt nichts. Keine Ausfahrt, keine Tankstelle, an der sie fragen könnten. Nur weitere Rapsfelder. Nach einer halben Stunde wird sie ungeduldig.
»Sind wir vorbei? Ich habe das Gefühl, wir sind gleich in Hamburg! Vielleicht habe ich die Karte falsch gelesen.«
Konrad grinst breit. »Du die Karte falsch lesen? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!«
Er will gerade rechts auf den Standstreifen rollen, da sehen sie das Schild: Altenstein. Nona jubelt. Die Ausfahrt ist kaum erkennbar, eine schmale, marode Straße führt ohne Markierung direkt vor einer Tankstelle in ein Feld. Konrad biegt ab, doch mitten auf der Abfahrt bleibt er stehen.
»Was machst du?«, fragt Nona. Sein Blick ist nach vorne gerichtet, auf die Tankstelle. »Fahr weiter, jetzt weiß ich, wo wir sind, ehrlich. Hier die Straße hoch und dann rechts.« Konrad verharrt noch einen kurzen Moment, dann legt er den ersten Gang wieder ein und fährt an. Der Porsche holpert um die Kurve und weiter durch die Felder, bis sie an einer breiten Allee ankommen. In der Ferne kann er einen Ort erkennen, Bäume, eine kleine Häuseransammlung, einen Kirchturm. Darüber zieht ein Bussard langsam seine Kreise. Konrad spürt eine Anspannung, etwas legt sich um seinen Brustkorb, er ist tatsächlich aufgeregt, als stünde etwas Großes bevor.
Die Allee ist schnurgerade und von Linden gesäumt. Weit und breit ist kein Auto in Sicht. Er spürt die helle märkische Sonne auf seinem Gesicht, die Äste über ihnen werfen ihre Schatten, hell, dunkel, hell, dunkel.
»Nächstes Jahr werde ich fünfzig.«
»Darüber willst du dich nicht ernsthaft bei mir beschweren, oder?« Nona lächelt. Sie ist drei Jahre älter als er. »Außerdem hast du dich doch gut gehalten.«
Konrad seufzt.
»Darum geht es auch nicht. Ich will mit fünfzig nicht immer noch Autos verkaufen. Es muss etwas passieren. Ich habe es Ira versprochen.«
»Ach, du hast dich doch so oft neu erfunden, Konni. Der Einzige von uns ohne Abitur, ohne Studium, und trotzdem hast du mehr verdient als wir alle.«
Er lächelt. »Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Und womit? Das ist doch nichts … nichts Bleibendes. Nichts, was ich eines Tages auf meinen Grabstein schreiben könnte.« Er grinst sie an.
In dem Moment erscheint auf der rechten Seite das Ortsschild: Altenstein. Nona zeigt darauf. »Das kann sich ja jetzt ändern.«
Eine Reihe niedriger, grauer Häuser duckt sich entlang der Dorfstraße, kleine Fenster, schmale Türen in unverputzten Fassaden, durch die sich Risse ziehen. Halbe Spitzenvorhänge, dahinter ist es duster. Manche Rollläden sind heruntergelassen, ein paar sind kaputt und hängen schräg in der Halterung. Wohnt hier überhaupt jemand?
Die Bürgersteige davor sind schmal und kopfsteingepflastert, hier und da von Baumwurzeln aufgerissen. Einzig die Vorgärten sehen gepflegt aus, selbst der winzigste Rasen ist in perfektem Zustand und liebevoll ausgestattet mit Gartenzwergen oder sich eifrig drehenden Windrädern.
Ab und zu fahren sie an verlassenen, heruntergekommenen Villen vorbei. Wem gehören sie? Das ganze Land liegt da, entvölkert, verlassen, als interessiere niemanden, was daraus wird. Konrad muss an die Behörde denken, die er in Neuruppin aufgesucht hat: Amt für Offene Vermögensfragen.
»Tja, hier wären wir. Direkt vor den Toren unserer neuen deutschen Hauptstadt.«
Rechts kommen eine Kirche, ein Friedhof, sie rollen über eine Kreuzung, dann haben sie Altenstein schon wieder verlassen.
Nona schaut sich um. »Und wo ist jetzt das Gut?«
Konrad wendet den Porsche in einem Zug und parkt am Straßenrand direkt vor einem der letzten Häuser. Nona steigt aus und breitet die Karte auf der Kühlerhaube aus. Konrad öffnet die Fahrertür. Der Vorhang im Fenster bewegt sich, jemand schaut kurz heraus und weicht dann zurück ins Dunkel.
Es ist warm geworden, Konrad zieht sein maßgeschneidertes italienisches Sakko aus, krempelt die Ärmel seines hellblauen Hemdes hoch, gähnt, streckt sich und zündet sich eine Zigarette an. Eine Strähne seines Seitenscheitels fällt ihm in die Stirn, er streicht sie aus dem Gesicht. Über den Rand seiner Sonnenbrille hinweg inspiziert er die triste Dorfstraße.
»Mann, Mann, Mann.«
Tief zieht er den Rauch ein und bläst Ringe in die Luft. Dann stellt er sich neben Nona und wirft einen Blick auf die Landkarte.
»Nonalein, kennst du dich denn auf dem Land deines Vaters gar nicht mehr aus?«
Zwei graue Gestalten kommen ihnen entgegen, ein Mann und eine Frau, klein und quadratisch, er mit Hut, sie mit mehreren bunten Plastiktüten. Sie bewegen sich langsam, es ist schwer, ihr Alter zu schätzen, der Statur und dem lethargischen Gang nach könnte es überall zwischen sechzig und hundert liegen.
Konrad und Nona schauen hoch, Konrad nickt ihnen zu, Nona lächelt. Die Spaziergänger reagieren nicht.
»Frag doch mal unsere Brüder und Schwestern, wo das Gut ist«, zischt Nona.
Als sie später den holprigen Waldweg entlangfahren, muss Nona immer wieder loslachen. »Du bist unbeschreiblich, Konrad! Unbeschreiblich peinlich.«
Sie streckt betont markig die Hand aus und äfft seinen selbstherrlichen Ton nach:
»›Graf Kolberg mein Name. Ich suche das Gut meines Vaters.‹«
Konrad grinst, fischt mit seiner linken Hand eine Zigarette aus der Brusttasche und zündet sie an.
»Na und? Ist doch so. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid.«
Nona ist noch nicht fertig.
»›Sagen Sie den anderen Eingeborenen bitte, dass der Herr Graf wieder zurück ist.‹ Das hättest du eigentlich gleich noch hinzufügen können. Du tust so, als wärst du hier, um deine Fahne in erobertes Gebiet zu rammen, Konni! Meinst du, dass die Leute dich hier mit offenen Armen aufnehmen?«
Er ist kurz still. »Hör mal, wenn wir uns auf dich und die beschissene Landkarte verlassen hätten, würden wir jetzt noch in Ternitz rumkurven!«
Er greift nach dem Falk-Atlas, der zwischen ihnen liegt, und schleudert ihn mit einer nachlässigen Handbewegung in den Wald. Nona kreischt auf und schlägt ihn.
»Konrad, du Schaf! Jetzt müssen wir für immer hierbleiben. In einer Ruine in der ostdeutschen Pampa. Ich frage mich, ob Altenstein überhaupt noch steht.«
Sie fahren weiter durch den Wald.
»Weiß Moritz eigentlich, dass wir hier sind?« Nona schaut ihren Bruder vorsichtig von der Seite an.
»Nee. Was soll der Quatsch? Wenn’s ihn interessiert, soll er fragen.«
Zwei Schwalben fliegen neben ihnen her wie ein Empfangskomitee, Nona betrachtet sie, wie sie neben den Kotflügeln aufsteigen und sich in gedehnten horizontalen Achten wieder fallen lassen.
»Moritz hat seinen Titel abgelegt. Wusstest du das?«
Konrad starrt sie entgeistert an. »Wie meinst du das?«
»Er heißt jetzt nur noch Kolberg. Ohne Graf, ohne von.«
Konrad schnaubt verächtlich. »War das Isabellas Idee?« Er schüttelt den Kopf und bläst Rauch aus. »Der hat Probleme.«
Kurze Zeit später biegen sie in eine überwucherte Einfahrt ein. Zwei steinerne Pfeiler stehen links und rechts vom Weg, Reste eines Tores. Ein Zweig peitscht Nona ins Gesicht, als sie hindurchfahren. Konrad grinst und schaut seine Schwester dabei über den Rand der Sonnenbrille an, die Zigarette zwischen den Zähnen. Er lässt den Motor aufheulen und die Reifen durchdrehen, bis der Rollsplit hinter ihnen hochfliegt.
Nona verdreht die Augen. »Lass es einfach.«
Der Kiesweg dehnt sich aus zu einer schmalen Allee, die schnurgerade unter Kastanienbäumen auf ein Gebäude zuführt. Konrad zeigt nach vorne.
»Das muss es sein.«
Er beschleunigt und wendet das Cabrio am Ende der Auffahrt scharf um hundertachtzig Grad, sodass sie direkt vor dem Haus zum Stehen kommen.
Für einen Moment verschlägt es beiden die Sprache. Das Gutshaus steht noch, es sieht auf den ersten Blick sogar intakt aus. Es ist ein zweistöckiges, helles Herrenhaus mit einem zentralen, imposanten Portal, an das sich links und rechts zahlreiche hohe Fenster anschließen. Eine ausladende, halbrunde Steintreppe führt zu der breiten, dunklen Eingangstür hinauf. Das Dach ist an einigen Stellen eingesunken, ein paar Ziegel fehlen. Einige Scheiben sind eingeschlagen. Unkraut rankt die Mauern hinauf. Doch etwas ist merkwürdig. Nona sieht es zuerst.
Aus einem Fenster im ersten Stock ragt ein Baum.
Konrad stellt den Motor ab, sie steigen aus und sehen sich um. Der Garten vor dem Haus ist zugewachsen. Gras und Unkraut stehen kniehoch. Löwenzahn bedeckt die ehemaligen Blumenbeete, nur noch erkennbar an ihrer Einfassung. Links vom Eingang liegt eine umgekippte verrostete Schubkarre, sie scheint eins geworden zu sein mit der Wiese. Etwas Verwunschenes schwebt über dem Haus und dem Garten, als wären sie einem Märchen entsprungen.
»Wahnsinn«, sagt Nona.
»Hättest du es erkannt?«
»Ja. Nein.«
Nona schaut die Stufen hinauf zum Haus.
»Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Also, bis auf den Baum.«
Sie gehen die Steintreppe hinauf. An der Eingangstür baumelt ein Schild. Konrad dreht es um: »Unbefugte«, steht darauf, in dicken schwarzen Buchstaben, umrahmt von einem roten Kreis. Mit einem kräftigen Ruck reißt er es ab.
»Wenn einer befugt ist, dann wohl wir.«
Das Schloss an der Doppeltür sieht massiv aus, doch es hängt lose in der Verankerung, wie eine Formalität, die nun keiner mehr braucht. Konrad zieht es wie selbstverständlich aus dem morschen Holz heraus. Er schiebt die Tür auf, es liegt von innen einiger Schutt davor, sodass er sich dagegen stemmen muss. Sie betreten die imposante Eingangshalle. Schwaches Licht fällt durch die verdreckten Fenster, aufgewirbelte Staubkörner tanzen darin. Es riecht nach Staub und Mörtel. Der Boden ist übersät mit Schutt und Steinen. Überall hat sich die Natur ausgebreitet. Äste ragen durch die zerbrochenen Fenster, an manchen Fensterrahmen wachsen Farne oder Moos. Der Kronleuchter an der Decke ist kaum noch als solcher zu erkennen, fast alle Kristalle fehlen, nur das traurige Metall-Gerippe ist übrig geblieben mit ein paar blinden, kaputten Glühbirnen.
Konrad schiebt mit dem Fuß etwas von dem Geröll beiseite, dann hockt er sich hin und begutachtet das Parkett. Neben seinem Fuß liegt ein kleines, filigranes Tierskelett. Erst jetzt sieht Nona die kleinen dunkelbraunen Kötel, mit denen der Boden übersät ist.
Konrad hebt einen hoch.
»Mäuse?«, fragt Nona.
»Marder, würde ich sagen.« Er lässt ihn wieder fallen. »Mein Gott, wie es hier aussieht!«
»Bist du überrascht?«
»Na ja …«, er wischt eine Stelle am Fußboden frei. »Ich hatte gehört, dass Haus sei zu DDR-Zeiten als Parteizentrale genutzt worden. Aber das alles –«, er zeigt auf die Äste, die durch die Fenster ragen, »das kann ja nicht erst seit der Wende passiert sein.« Konrad klopft auf den Boden. »Das Parkett scheint allerdings in Ordnung.«