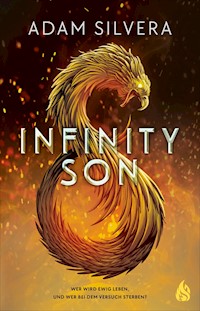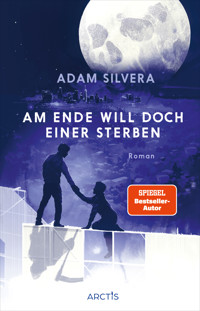
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Band #3 der TODESBOTEN-Reihe | Fulminant und bewegend – die Geschichte nach dem TikTok-Phänomen und Megaseller AM ENDE STERBEN WIR SOWIESO! Paz wartet schon seit Langem auf den Anruf des Todesboten. Er hat eine traumatische Kindheit erlebt und kann seine Einsamkeit nicht länger ertragen. Als ein für ihn furchtbarer Tag erneut ohne Anruf endet, beschließt Paz, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Alano ist der Erbe des Todesboten, der alle dazu ermutigt, das Leben jeden Tag aufs Neue zu schätzen. Alano hat jedoch nicht mehr das Gefühl, Kontrolle über sein eigenes Dasein zu haben. Als er auch noch bedroht wird, will er sein Leben endgültig ändern. Das Schicksal führt Paz und Alano zusammen und sie müssen sich gemeinsam großen Herausforderungen stellen, damit am Ende niemand stirbt … Exklusives BONUS-Material: Interview mit Adam Silvera und Filmszene aus Scorpius Hawthorne und die unsterblichen Kinder des Todes Adam Silveras TODESBOTEN-Bestsellerreihe: - #1: Der Erste, der am Ende stirbt (Orion und Valentino) - #2: Am Ende sterben wir sowieso (Mateo und Rufus) - #3: Am Ende will doch einer sterben (Paz und Alano)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adam Silvera
Am Ende will doch einer sterben
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Diestelmeier, Meritxell Piel und Alexandra Rak
Liebe Leser:innen, dieses Buch enthält Elemente, die belastend sein könnten, besonders in Bezug auf Suizidalität. Aus diesem Grund findet ihr am Ende des Buchs eine Triggerwarnung. Wir wünschen euch das bestmögliche Leseerlebnis.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel The Survivor Wants to Die at the End bei Quill Tree Books, ein Imprint von HarperCollins Publishers, New York
Deutsche Erstausgabe
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.
Copyright © 2025 by Adam Silvera
Published by Arrangement with Adam Silvera
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Übersetzung: Katharina Diestelmeier, Meritxell Piel und Alexandra Rak
Lektorat: Petra Deistler-Kaufmann und Sophie Hofmann
Sensitivity Reading: Nora Bendzko – norabendzko.com/finsterbunt
Coverillustration: Simon Prades
Coverüberarbeitung: Niklas Schütte
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.
ISBN978-3-03880-168-9
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für alle, die sich wie Lügner:innen fühlen,
wenn sie über die Zukunft sprechen.
Nehmt euch einen Tag nach dem anderen vor.
Ein großes Dankeschön an meinen Hund Tazzito
und meine Therapeutin Rachel dafür,
dass ihr mir immer und immer wieder das Leben rettet.
Und an Luis Rivera. Ohne dich hätte ich
am Ende nicht überlebt. Love you the most, Kidd.
Vorwort des Autors
Dieses Buch berührt das Thema Suizidgedanken und beinhaltet eindrückliche Beschreibungen von selbstverletzendem Verhalten und Selbstmord. Falls ihr euch entscheidet, die Geschichte weiterzulesen, möchte ich darauf hinweisen, dass der nun folgende Satz einen Spoiler enthält, den ihr überspringen könnt, indem ihr einfach mit dem nächsten Absatz fortfahrt: (ANFANG SPOILER) Obwohl in diesem Buch Figuren sterben werden – wie es in der Natur dieser Reihe liegt –, stirbt keine der Hauptfiguren durch Suizid. (ENDE SPOILER)
Wenn es euch schlecht geht und ihr Hilfe braucht, wendet euch bitte an die Telefonseelsorge unter den Rufnummern, die ihr am Ende des Buchs findet. Fühlt ihr euch nach dem ersten Anruf immer noch nicht gut, beendet das Gespräch und ruft wieder an. Und wieder und wieder und wieder, bis ihr vor euren destruktiven Gedanken in Sicherheit seid. Ich selbst habe diese Anrufe in der Vergangenheit ebenfalls getätigt und bin hier, um euch heute davon zu berichten.
Lasst uns gemeinsam ins Morgen aufbrechen.
ERSTER TEILNICHT-ABSCHIEDSTAGE
Der Todesbote hat nicht nur unser Leben verändert, das wir vor dem Tod führen, sondern auch das Leben derer, die über ihren eigenen Tod nachdenken. Wenn der Todesbote die Leidenden nicht anruft, ist ihr Abschiedstag noch nicht gekommen. Ganz einfach. Es bricht mir das Herz, wenn Menschen beweisen wollen, dass der Todesbote sich irrt. Ich wünsche mir inständig, dass wirklich jeder Einzelne wieder gesund wird, einfach weil er lebt, und nicht länger unseren Anruf herbeisehnt.
Joaquin Rosa, Schöpfer des Todesboten
LOS ANGELES
22. Juli 2020PAZ DARIO
07:44 Uhr (Pacific Daylight Time)
Der Todesbote ruft nie bei mir an, um mir zu sagen, dass ich sterben werde. Ich wünschte, er würde es tun.
Jede Nacht zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr morgens, wenn die Boten die Todgeweihten über ihren bevorstehenden Abschiedstag informieren, bleibe ich wach und starre auf mein Handy, um es mit meiner Willenskraft dazu zu bringen, den eindringlichen Klingelton von sich zu geben, der meinen verfrühten Tod ankündigen wird. Oder besser gesagt, meinen verspäteten Tod – wenn wir ehrlich darüber reden, wie lange ich schon nicht mehr leben will. Ich träume von der Nacht, in der ich die Beileidsbekundungen meines Boten unterbrechen kann, um einfach nur zu sagen: Danke für die beste Nachricht meines Lebens.
Und dann werde ich, irgendwie, endlich sterben.
Gestern hat mein Telefon nicht geklingelt, deshalb bin ich gezwungen, einen weiteren Nicht-Abschiedstag durchzustehen.
An solchen Tagen ziehe ich immer eine regelrechte Show für all die Menschen ab, die hart daran arbeiten, mich am Leben zu erhalten: meine Mom, klar; mein Stiefvater, der früher einmal Beratungslehrer war und sich immer noch wie einer aufführt; meine Therapeutin, die ich jeden Freitagtagnachmittag anlüge; und mein Psychiater, der mir die Antidepressiva verschreibt, mit denen ich im März überdosiert habe. Ich fühle mich fast schon schuldig, weil ich die Zeit dieser Leute verschwende, obwohl ich ein hoffnungsloser Fall bin. Aber wenn ich sie nicht restlos davon überzeugen kann, dass ich nur wegen dieser Doku über den Vorfall in meiner Kindheit versucht habe, mich umzubringen, werde ich in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Dort bemühen sich dann nicht nur noch mehr Menschen darum, mein Überleben zu sichern, sondern ich habe dann auch keine Chance mehr, einen weiteren Selbstmordversuch zu unternehmen.
Falls der heutige Nicht-Abschiedstag allerdings so erfolgreich verläuft, wie ich es mir erhoffe, könnte ich mich durchaus freuen, noch ein Weilchen auf der Welt zu sein.
Denn zum ersten Mal seit fast zehn Jahren habe ich ein Callback, einen Rückruf, bekommen. Und zwar keinen gewöhnlichen Rückruf, sondern eine Einladung zu einem gemeinsamen Vorsprechen, um zu testen, ob die Chemie zwischen mir und dem anderen Hauptdarsteller stimmt, mit dem ich im Film ein Liebespaar spielen soll. Und auch nicht in irgendeinem Film, sondern in der Adaption meines Lieblings-Fantasyromans Goldenes Herz. Alles, was für meine Bewerbung nötig war, waren eine mörderisch gute Videoaufnahme von mir selbst und ein paar Lügen darüber, wer ich bin.
Und gleich werde ich losziehen, um mir meine Traumrolle zu sichern.
Ich laufe in meinem Zimmer auf und ab und gehe meinen Text immer wieder durch, obwohl ich ihn längst auswendig kann. Alles in meinem Zimmer ist schwarz-weiß, abgesehen von den Büchern, den gebundenen Theaterstücken und den Videospielen, die mich an meinen Nicht-Abschiedstagen bei Laune halten. Außerdem hat Mom mir diese große Zebrapflanze gekauft, die – ihrem Namen zum Trotz – jedoch nicht zum Vibe dieses Raums passt. Es war zwar ein netter Gedanke, einen Hauch natürliches Grün hier reinzubringen, aber da ich schon genug damit zu tun habe, mich selbst zu versorgen, ist die Blume längst wegen Vernachlässigung eingegangen; was mich daran erinnert, sie wegzuwerfen, denn ich kann nicht dabei zusehen, wie eine Pflanze vor mir stirbt.
Okay, Zeit, mich fertig zu machen. Ich lege die Textblätter in meine Hardcover-Ausgabe von Goldenes Herz, die ich als 912-seitigen Glücksbringer mitnehmen werde, und stecke alles in den Rucksack, den ich normalerweise zum Wandern benutze. Dann schnappe ich mir das schwarze T-Shirt und die schwarze Jeans, die beim Casting Usus sind. Doch als ich mich gerade auf den Weg zur Dusche machen will, fällt mein Blick auf mein Ganzjahrestagebuch, das neben meinem Bett auf dem Boden liegt. Schnell werfe ich es zurück in mein Nachtschränkchen. Heute Morgen gegen 3 Uhr habe ich es offensichtlich vergessen und ich kann einfach nicht riskieren, dass irgendjemand das Buch aufschlägt.
Als ich meine Zimmertür einen Spaltbreit öffne, ertönt ein spanisches Lied aus dem alten Radio, das ich oben auf den Kühlschrank gestellt habe, nachdem wir den ganzen Alkohol entsorgt hatten. Mom und Rolando lachen, während sie das Frühstück zubereiten. Gleich wird Mom zu dem Frauenhaus fahren, in dem sie arbeitet. Es sind diese kleinen Momente, in denen meine Mutter mir weder Pflanzen schenkt noch die Dosierung meiner Antidepressiva überwacht, die mir Hoffnung geben, dass sie tatsächlich darüber hinwegkommen wird, wenn ich sterbe. Und das, obwohl sie nach meinem Selbstmordversuch etwas ganz anderes behauptet hat. Damit meine ich übrigens meinen ersten Selbstmordversuch im März, denn von dem zweiten weiß niemand.
Bevor ich für Mom und Rolando eine Show als Happy Paz abziehe, muss ich mich vorbereiten, genau wie jeder Schauspieler, der vor seinem Auftritt von einer Haar- und Make-up-Crew zurechtgemacht wird. Ich war zwar erst an einem einzigen Filmset – damals, als ich sechs war –, aber ich erinnere mich noch, wie cool ich es fand, dass die Künstlerinnen und Künstler mir geholfen haben, in meine Rolle zu schlüpfen, bevor der Regisseur »Action« ruft. Inzwischen bereite ich mich selbst auf meine Rolle als Happy Paz vor, bevor ich mein Glücklichsein schauspielere.
Ich eile durch den Flur ins Bad, das immer noch warm und diesig von Rolandos morgendlicher Dusche ist. Dann wische ich über den beschlagenen Spiegel und versuche den Bösewicht in mir zu erkennen, den alle anderen sehen. Doch ich sehe bloß einen Jungen, der seine dunklen Haare blond gefärbt hat, um diese neue Rolle zu bekommen; und der sich seine Locken wachsen lässt, um das Gesicht zu verbergen, das die Leute eher mit der Dokuserie über den ersten Abschiedstag in Verbindung bringen als mit dem kleinen, aber vielversprechenden Auftritt des Jungen im letzten Scorpius-Hawthorne-Film.
Das kalte Wasser der Dusche weckt mich schlagartig auf, bevor ich das Ventil so weit aufdrehe, dass das heiße Wasser meine sonnengebräunte Haut rot färbt. Ich zwinge mich, stehen zu bleiben, obwohl mein Körper versucht, die Kontrolle zu übernehmen und mich einen Schritt zurücktreten zu lassen. Am Ende gewinnt mein Körper und ich steige aus der Dusche.
Um das Waschbecken herum steht lauter Krimskrams von Mom und Rolando, wie zum Beispiel Moms Bürste mit einem Wald aus schwarzen und weißen Haaren darin, Rolandos Kamm und sein Rasiergel, die Kaktusseife, die die beiden vom Melrose Markt mitgebracht haben, und der Porzellanteller, auf dem Mom ihren Verlobungsring ablegt, wenn sie sich ihrer Hautpflegeroutine widmet. Auf meine Existenz gibt es keinen wirklichen Hinweis – mit Ausnahme der Zahnbürste, die mit den beiden anderen in dem orangefarbenen Plastikbecher steht. Das ist auch durchaus so beabsichtigt. Denn wenn ich tot bin, möchte ich, dass Mom mich so schnell wie möglich vergisst. Das bedeutet, sie darf nichts in unseren gemeinsamen Räumen vorfinden, was mir gehört. Sollte Mom sich nämlich von meinem Tod verfolgt fühlen, wird sie gezwungen sein, wieder umzuziehen, um meinem Geist zu entkommen. So haben wir es nach Dads Tod gemacht. Doch dieses winzige Häuschen hier, das sie sich zusammen mit Rolando gekauft hat, ist für sie das Schönste an ihrem Leben in Los Angeles. Es symbolisiert unseren Neuanfang.
Oder zumindest das, was unser Neuanfang sein sollte.
Zusätzlich zu meinem Abschiedsbrief für Mom wäre es gut, auch einen für Rolando zu hinterlassen, damit er einen Gedenkflohmarkt organisieren kann. Mir ist nämlich klar, dass Mom es nicht übers Herz bringen würde, meine Sachen selbst zu verkaufen. Sie verdient das Brot in unserem Haushalt – allerdings eher schlecht als recht; wir reden hier also von abgestandenem, Wochen altem Brot. Meine signierte Ausgabe des letzten Scorpius-Hawthorne-Bands sowie die Polaroids von mir mit der gesamten Filmbesetzung würden Mom und Rolando wahrscheinlich ein paar Tausend Dollar einbringen.
Die Reise mit Mom nach Brasilien, um meine Szene für den Film zu drehen, war atemberaubend. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich wirklich dieses ikonische Set mit dem Milagro-Schloss und –
Stopp! Kein Schwelgen in Erinnerungen an meine Zeit als junger Larkin Cano. Immerhin liegt jetzt eine ganz andere Rolle vor mir – und damit meine ich nicht die beim heutigen Casting, sondern die, die ich an jedem Nicht-Abschiedstag durchziehe.
Sauber und vollständig bekleidet greife ich nach dem Türknauf und flüstere: »Action.«
Und dann verwandle ich mich in Happy Paz.
»Guten Morgen«, sage ich mit einem Oskar-reifen Lächeln, als ich das Wohnzimmer betrete.
Mom und Rolando frühstücken gerade Tacos in der Essecke und spielen Othello. Als Kind habe ich dieses Brettspiel geliebt. Mit einem echten Lächeln schauen die beiden auf, weil Happy Mom und Happy Rolando nicht bloß gespielte Rollen sind.
»Morgen, Pazito«, sagt Mom.
Pazito genannt zu werden, ist noch etwas, das ich als Kind geliebt habe.
»Na, bist du bereit?«
»Jap.«
Rolando macht mir einen Teller mit Essen fertig. »Greif zu, Paz-Man. Heute brauchst du Energie.«
Ich zwinge mich zum Essen, weil Mom und Rolando misstrauisch werden würden, wenn ich es nicht täte.
Die Wahrheit ist, dass ich zwar meistens keinen Appetit auf Essen habe, aber immer hungrig nach Leben bin. Manchmal fühle ich mich so leer, dass mein Magen schmerzt, so als würde er danach knurren, endlich glücklich zu sein. Leider ist dann nie etwas Essbares oder ansprechend Aussehendes in der Nähe. Und wenn ich doch endlich mal in der Stimmung bin, etwas auszuprobieren, fühlt es sich an, als wollte niemand meine Bestellung aufnehmen.
»Brauchst du Hilfe beim Text-Durchgehen?«, fragt Rolando.
Ich lehne ab. Bei meinem ersten Versuch, mein Vorstellungsvideo zu drehen, hat Rolando meinen Gegenpart gesprochen. Dabei klang er übertrieben dramatisch, so als würde er sich von seinem Platz hinter der Kamera aus für irgendeine Telenovela bewerben. Ich musste ihn rauswerfen und den Text meines Gegenübers mit dunkel verstellter Stimme selbst sprechen, wobei ich Pausen eingebaut habe, die ich anschließend mit meiner eigenen Rolle füllte. Und genau diese Aktion hat mir das Callback eingebracht. Aus diesem Grund möchte ich jetzt lieber nicht wieder an Rolando denken.
»Wie wär’s dann mit einer Mitfahrgelegenheit zum Casting?«, fragt er – wie immer verzweifelt darum bemüht, zu zeigen, dass er anders ist als mein Dad. Was ich – ganz klar – natürlich weiß.
»Nein, ich geh zu Fuß. Ich brauch frische Luft.«
Rolando hält die Hände hoch, als wollte er sich ergeben. »Ich nehme mir jedenfalls den Tag frei, falls du es dir anders überlegst.«
»Brauchst du nicht einen Job, um dir den Tag freinehmen zu können?«, frage ich. Ich fake ein Lachen, damit das Ganze wie ein Scherz klingt. Mom lässt es sich trotzdem nicht nehmen zu motzen, obwohl Rolando ebenfalls lacht. Doch auch sein Lachen ist gefakt.
»Ich nehme mir den Tag von der Jobsuche frei«, korrigiert er sich, während er Tee aufbrüht und über die Arbeiten spricht, die er rund ums Haus erledigen will.
Ich schalte auf Durchzug.
Letzten Monat ist Rolando aufgrund von Budgetkürzungen vom örtlichen College entlassen worden. Das war echt mies, weil er sich wirklich gefreut hatte, wieder einen Bürojob zu haben. Vor allem, nachdem er mich den Großteil meiner Highschool-Zeit zu Hause unterrichtet hatte. Aber die steigenden Hypothekenraten und die Kosten für unsere medizinische Versorgung sind noch mieser. All diese Dinge sind wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass er ein Riesending aus seinem nächsten Job macht. »Auf keinen Fall etwas, das mich emotional involviert«, erklärt er immer wieder.
Die Arbeit als Karriereberater am College war perfekt für ihn, weil es ein ganz normaler Job war, bei dem er über andere Jobs sprechen konnte. Außerdem ließ sich damit sein Bedürfnis befriedigen, Menschen zu helfen. Ganz anders als die ermüdenden Jahre als Vertrauenslehrer an einer Grundschule. »Wer hätte geahnt, dass Kinder solche Probleme haben können?«, hat Rolando mehr als einmal gefragt – und das sogar in meinem Beisein, obwohl ich als Kind sehr viele Probleme hatte. Und dann war da natürlich noch sein kürzester, aber seelisch verheerendster Job als einer der ersten Todesboten auf der Welt. Fast zehn Jahre sind vergangen, seit Rolando direkt am ersten Abschiedstag gekündigt hat. Derselbe Tag, der mein Leben so schlagartig verändert hat, dass ich zu einem Kind mit sehr vielen Problemen wurde.
Es wäre so was von genial, wenn ich die Filmrolle bekäme, bevor Rolando einen Job finden würde.
Rolando bringt Mom Tee und gibt ihr einen Kuss. »Lass es dir schmecken, Glorious Gloria.«
»Danke dir, mi amor.«
Ich bin so glücklich, dass Mom verliebt ist – und diesmal ist es wahre Liebe –, aber manchmal fällt es mir schwer, das alles mit anzusehen. Es macht mir stets bewusst, dass ich ungeliebt sterben werde. Jede Nacht, die ich allein im Bett liege und darauf hoffe, dass der Todesbote anruft, frage ich mich, ob ich anfangen würde, um mein Leben zu fürchten, wenn jemand neben mir läge. Jemand, der mich festhalten würde. Jemand, der mich küssen würde. Jemand, der mich lieben würde.
Aber wer würde sich jemals in einen Mörder verlieben?
Richtig. Niemand.
Ich stehe auf und spüle meinen Teller ab, wobei ich zulasse, dass das Wasser erneut viel zu heiß auf meine Hände trifft. Dann drehe ich den Wasserhahn ab, bevor jemand merken kann, dass meine Hände sauberer sind als der Teller.
»Pazito?«
»Ja, Mom?«
»Ich hab dich gefragt, ob alles okay ist.«
Um ein großartiger Schauspieler zu sein, muss man auch ein großartiger Zuhörer sein, aber ich war gerade so in Gedanken, dass ich meine Szenenpartnerin nicht gehört habe. Jetzt starre ich vor mich hin, als hätte ich meinen Text vergessen. Ich falle aus der Rolle, so als würden mir meine Happy-Paz-Maske und mein sorgfältig gewebtes Kostüm vom Leib gerissen, um mich als einen erwerbslosen Schauspieler zu entblößen, der das Arbeiten nicht verdient hat. Aber nein. Ich bin ein großartiger Schauspieler, und ja, großartige Schauspieler müssen großartige Zuhörer sein. Doch sie müssen auch wahrheitsgetreu spielen. Deshalb werde ich jetzt die Wahrheit sagen – na gut, eine Wahrheit.
»Sorry, Mom. Ich bin einfach nervös wegen dem Casting«, sage ich, während ich auf den Boden starre, als wäre mir das peinlich. Okay, dieser Teil mag gespielt gewesen sein, aber ich verkaufe trotzdem eine Wahrheit: nämlich die Wahrheit, dass meine Stimmung zwar neben der Spur ist, ich jedoch – schaut her! – darüber rede, anstatt alles in mich reinzufressen. So wie letztes Mal. Und dann kröne ich das Ganze noch mit einer Lüge: »Es geht mir gut.«
Die Beine von Moms Stuhl schrammen über den Boden und verstummen dann abrupt. Mom will mich unbedingt trösten, doch ich habe ihr schon mal gesagt, dass ich meinen Freiraum brauche, wenn ich meine Gefühle ausdrücke. Ihr ständiges Helikoptern macht aus jeder Mücke einen Elefanten. Ich habe auch all die richtigen Wörter benutzt, die ich von meiner Therapeutin gelernt habe, um ihr das zu erklären. Das hat auch tatsächlich funktioniert – allerdings weiß ich, wie schwer es für Mom ist, mich nicht zu bemuttern.
Und für mich ist es ebenfalls schwer. Wenn eine Umarmung mich doch nur retten könnte.
»Das Beste, was du tun kannst, ist, du selbst zu sein«, sagt Mom.
»Muss er nicht eine Figur spielen?«, wirft Rolando ein.
»Er muss die Figur so zum Leben erwecken, wie nur er es kann«, erwidert Mom. Schon seit ich Kind war, hat sie meine Träume immer unterstützt. »Geh und mach aus diesem Callback dein Comeback, Pazito«, fügt sie hinzu.
»Das werde ich«, sage ich.
So viel wie heute stand noch nie auf dem Spiel. Denn wenn ich diese Rolle nicht bekomme, habe ich nichts, wofür es sich zu leben lohnt.
Ich mache mich auf den Weg zur Tür, doch Mom ruft mir noch einmal hinterher.
»Warte, ich gebe dir noch schnell deine …« Ihre Stimme verhallt, als sie in ihrem Schlafzimmer verschwindet.
Ich weiß, dass sie meine täglichen Antidepressiva holt. Das Fläschchen mit den Prozac ist irgendwo in ihrem Zimmer versteckt, weil man mir seit meinem ersten Selbstmordversuch nicht mehr trauen kann.
Dabei hatte ich dafür durchaus meine Gründe:
Anfang Januar hat der Sender Piction+ begonnen, eine kurze Dokuserie mit dem Titel Bei Nichtanruf Tod zu streamen, in der es um die Toten Zwölf ging. Die zwölf eingetragenen Todgeweihten, die am ersten Abschiedstag ohne Vorwarnung gestorben waren. Dieses Missgeschick war durch einen mysteriösen Fehler im genauso mysteriösen Vorhersagesystem des Todesboten ausgelöst worden. Die einzelnen Folgen der Dokureihe wurden wöchentlich ausgestrahlt und jede handelte von einem anderen Todgeweihten. Im Finale der Serie ging es um meinen Dad, der nicht mal an den Todesboten geglaubt hatte. Die Filmmacher wollten auch Mom und mich in die Sendung miteinbeziehen, aber Mom hat abgelehnt und die Leute angebettelt, die Folge nicht zu drehen, weil sie grässliche Wunden wieder aufreißen würde (als ob diese Wunden sich jemals richtig geschlossen hätten). Doch Moms Flehen wurde ignoriert, weil »Geschichte erinnert werden muss«. Es war keine große Überraschung, als Mom und ich ziemlich schnell herausfanden, dass die Produzenten der Serie Pronaturalisten waren – Leute, die den natürlichen Weg des Lebens und Sterbens bewahren wollen, wie es ihn vor dem Todesboten gab. In der Dokureihe ging es in Wirklichkeit also nie um das »Erinnern von Geschichte«; stattdessen war sie nichts anderes als eine Hetzkampagne gegen den Todesboten selbst und ich bin ins Kreuzfeuer geraten.
Und als wäre mein Angstlevel damals noch nicht himmelhoch genug gewesen, wurde die Sendung auch noch ausgerechnet in der Woche ausgestrahlt, als die Regierung den ersten Corona-Lockdown verhängte. Das Timing sorgte dafür, dass die Leute buchstäblich nichts anderes zu tun hatten, als auszuflippen und fernzusehen. Es hat mir damals regelrecht die Luft abgeschnürt, die gemeinsame Pressekonferenz der Gesundheitsbehörde mit dem Todesboten zu verfolgen, in der prophezeit wurde, dass weltweit mehr als drei Millionen Menschen sterben könnten, wenn wir nicht alle sofort handelten und uns isolierten. Die Dokuserie hat diese allgemeine Panik nur noch verschlimmert, indem sie den fatalen Fehler des Todesboten wieder ausgegraben und ihn dazu verwendet hat, Zweifel an der Legitimität dieser Organisation zu schüren.
Aber Pandemie hin oder her – nach der Ausstrahlung des Finales wäre die Welt sowieso kein lebenswerter Ort mehr für mich gewesen. Ich habe mir die Folge nie angeschaut, doch anscheinend haben die Filmmacher den traumatischen Vorfall in meiner Kindheit und den darauf folgenden Gerichtsprozess ausgeschlachtet, um mich als psychotischen Auftragskiller hinzustellen, der von Mom manipuliert worden war, damit sie ihre Affäre mit Rolando fortführen konnte. Und Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern haben das geglaubt.
Und genau aus diesem Grund habe ich an Tag vier des Lockdowns – eine Stunde nachdem die Anrufe des Todesboten geendet hatten – versucht, dem Todesboten einen Irrtum nachzuweisen, indem ich den Inhalt einer ganzen Flasche Antidepressiva geschluckt und ihn mit Rolandos Bourbon runtergespült habe.
Anschließend habe ich darauf gewartet zu sterben – was allmählich zum roten Faden meiner Lebensgeschichte wird.
Nachdem ich die Tabletten intus hatte, merkte ich, wie mein Blickfeld verschwamm und mein Körper vor Fieber zu brennen begann. Ich verlor immer wieder das Bewusstsein, weil ich geradezu schockiert darüber war, endlich zu sterben. Ich war zu schwach, zu benommen, zu betrunken und dem Tod zu nah, um darüber zu trauern, dass ich an diesen finsteren Ort gelangt war. Trotzdem war ich froh, alles hinter mir zu lassen. Normalerweise wäre ich in dieser Nacht auch wirklich gestorben, wenn Mom nicht aus einem ihrer üblichen Albträume über Dad aufgewacht wäre, um in der Realität etwas noch Schlimmeres vorzufinden: mich, bewusstlos, inmitten meiner eigenen Kotzpfütze.
Bis heute erinnere ich mich nicht daran, aus dem Bett gefallen und mit dem Krankenwagen transportiert worden zu sein; oder daran, dass man mir den Magen ausgepumpt hat. Doch ich werde immer noch von dem Augenblick verfolgt, als ich in der Notaufnahme wach wurde und mit Handschellen an das Gitter meines Betts gefesselt war, so als wäre ich der gefährliche Kriminelle, den die Dokuserie aus mir gemacht hatte. Und ich weiß immer noch, wie Mom ihre OP-Maske vom Gesicht gezogen und mich angefleht hat, so etwas nie wieder zu tun.
»Ich bin eine Planerin«, hat sie unter Tränen zu mir gesagt, während sie meine Hand umklammert hielt. »Aber ich werde nicht planen, in einer Welt ohne dich zu leben, Pazito. Wenn du dir dein Leben nimmst, werde ich planen, mir auch meins zu nehmen.«
Anschließend habe ich drei Tage in der geschlossenen Psychiatrie verbracht und über Moms Worte nachgedacht. Ich liebe Mom über alles, aber ich hasse ihre Drohung, sich umzubringen, wenn ich mich umbringe. Denn Mom hat so viel, wofür es sich zu leben lohnt – selbst wenn sie dann keine Mom mehr sein wird, weil ihr einziges Kind tot ist.
Dieser Druck, weiterleben zu müssen, obwohl es nichts Lohnenswertes in meinem Leben gibt, ist einfach unerträglich.
Stattdessen muss ich mein Leben – und meinen Tod – so regeln, wie ich es für richtig halte.
Inzwischen habe ich beschlossen, den richtigen Zeitpunkt für meinen Tod abzuwarten, weil es gar nicht so einfach ist, dem Todesboten einen Irrtum nachzuweisen. Schließlich gab es nicht nur meinen Selbstmordversuch im März, sondern auch den zu meinem Geburtstag letzten Monat. Der muss allerdings ein Geheimnis bleiben, sonst habe ich keine Chance mehr, in zehn Tagen – am zehnten Todestag meines Vaters – einen weiteren Versuch zu unternehmen.
Mom kommt mit meiner Tablette den Flur entlang und reißt mich aus meinen Gedanken.
Ich schlucke mein Prozac und lächle, so als hätte das Medikament meinen Depressionen schon ein anti vorangesetzt.
Mom mustert mich eine Weile, fast so, als wäre sie die Casting-Direktorin, die mir meine Performance als Happy Paz nicht abkauft und lediglich einen Schauspieler sieht, der in seinem übermäßigen Spiel gefangen ist – das Letzte, was ein respektabler Schauspieler will. Doch so ist es nicht. Denn Mom betrachtet mich immer noch als ihr Baby, ihr einziges Kind. Sie sieht in mir den kleinen Kerl, den sie zu Castings begleitet und den sie beim Anprobieren von Halloween-Kostümen gekitzelt hat. Den kleinen Kerl, der großen Prophezeiungen vertraut hat, weil er noch an die Zukunft glaubte.
Den, der dachte, er sei ein Held, als er das Leben seiner Mom rettete.
Und der nun erwachsen geworden ist und sterben will.
»Ich hoffe, es geht dir bald besser, Pazito.«
»Ich auch, Mom.« Ich sage die Wahrheit, doch ich weiß, dass das Ganze nichts weiter ist als ein frommer Wunsch.
Ich verlasse das Haus.
»Cut«, flüstere ich.
Ich bin nicht mehr Happy Paz. Und ich bin es schon seit dem ersten Abschiedstag nicht mehr. Seit dem Tag, als ich meinen Dad umgebracht habe.
NEW YORK
ALANO ROSA
11:00 Uhr (Eastern Daylight Time)
Der Todesbote hat nicht bei mir angerufen, weil ich heute nicht sterben werde. Aber andere haben mich sehr wohl angerufen und mir mit dem Tod gedroht. Und das aus einem einzigen Grund: weil ich der Erbe des Todesboten-Imperiums bin. Immerhin schicken mir diese Leute eine Warnung. So wie es beim Todesboten üblich ist.
Im Laufe der Jahre haben mir ganz unterschiedliche Menschen immer wieder gesagt, dass ich mich von solchen Todesdrohungen nicht aus der Ruhe bringen lassen soll, da ich meinen Abschiedstag ja sowieso längst kennen würde. Das stimmt aber nicht. Mein Vater ist der Gründer des Todesboten und daher genieße ich viele Privilegien, aber dazu gehört definitiv nicht, dass ich weiß, wann ich sterben werde. Im Gegenteil. Mein Vater hat meine Ausbildung beschleunigt, damit ich die Firma an seinem eigenen Abschiedstag übernehmen kann. Wann das sein wird, ist ihm genauso wenig bekannt wie mir mein eigener Abschiedstag. Klar ist allerdings, dass die pronaturalistische Bewegung ihre Agenda immer radikaler vorantreibt, um ihren Favoriten für die Präsidentschaftswahl zu unterstützen. Und mein Vater weiß genau, dass sie ihn im Visier haben, denn die Anhänger des sogenannten Todeswächters fordern das Ende des Todesboten. Es wäre wirklich Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet mein Vater sterben würde, ohne seine Angelegenheiten geregelt zu haben.
Wir müssen vorsichtig sein, sogar hier in New York, wo bis vor Kurzem von pronaturalistischer Propaganda kaum was zu spüren war. Das hat sich am Sonntag, den 29. März, geändert, als der zweiwöchige Lockdown endete und die Leute bei ihrer Rückkehr in die Außenwelt überall Plakate mit der Aufschrift DER TODESBOTE IST UNNATÜRLICH vorfanden: in der U-Bahn, in Kirchen, Lebensmittelgeschäften, an Brücken und allen möglichen anderen öffentlichen Orten. Wenn es nach dem Todeswächter ginge, wären Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ohne Vorwarnung am Coronavirus gestorben, weil das ja der »natürlichen Ordnung« entspräche.
Die natürliche Ordnung von Leben und Tod hat sich am Donnerstag, den 1. Juli 2010, als Präsident Reynolds das Land über den Todesboten informierte, grundsätzlich verändert. Was ich mit meinen damals neun Jahren nicht ahnen konnte, war, dass sich die Welt von diesem Tag an immer mehr in zwei Lager aufspalten würde: in diejenigen, die an die Mission des Todesboten glauben, und diejenigen, die ihn ablehnen. Auch Präsident Reynolds war darauf nicht vorbereitet. Zwei Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit erhielt er den Anruf des Todesboten und verbrachte seinen Abschiedstag in einem unterirdischen Bunkerversteck, nur um dann von seinem engsten Geheimdienstmitarbeiter ermordet zu werden, der beschlossen hatte, die Seite zu wechseln, und sich nicht länger für seinen Präsidenten, sondern stattdessen für den Pronaturalismus zu engagieren.
Heute Morgen las ich gerade Präsident Reynolds Biografie zu Ende, statt mir das Vorabexemplar der Memoiren meines Vaters vorzunehmen, als ich von einer unbekannten Nummer angerufen wurde.
»Ich werde dich töten, Alano Ángel Rosa«, drohte ein junger Mann.
»Danke fürs Bescheidsagen, Kumpel«, sagte ich und legte auf.
Das war meine siebenundvierzigste Todesdrohung. Auf das Telefonat folgten noch sechs weitere übergriffige Anrufe innerhalb einer Stunde, bis ich die Leitung schließlich deaktivierte und ein neues Handy einrichtete. Es ist nervig, mich jedes Mal wieder in den Todesboten-Account einloggen und meine Nummer ändern zu müssen, sobald sie geleakt wurde, aber das wird sich mit der neuesten Erfindung meines Vaters bald ändern. Bis dahin kann ich leider nicht viel mehr tun, wenn ich nicht komplett auf ein Telefon verzichten will. Meine Eltern sagen mir ständig, ich soll unbekannte Nummern blockieren und Drohnachrichten melden, ohne ranzugehen, aber ich kann nicht anders. Wenn Leute meinen Tod wollen, muss ich erfahren, wie viel sie wissen. Kennen sie nur meinen Namen und meine Telefonnummer, könnte es irgendwer an irgendeinem x-beliebigen Ort sein. Erfahrungsgemäß sind das dann bloß leere Drohungen. Aber wenn jemand behauptet, mich kurz vor Mitternacht auf dem Heimweg durch den Central Park zu beobachten, nehme ich diese Drohung ernst und renne um mein Leben.
Das Beunruhigendste an dem ersten Anrufer heute war, dass mir die Stimme bekannt vorkam, ich sie aber nicht genau zuordnen konnte. Er klang jung, aber auch nicht allzu jung. Es könnte irgendein Typ gewesen sein, der sich am Todesboten rächen will, aber ich glaube fast, dass es ein Angehöriger eines der Toten Zwölf war.
Da wäre beispielsweise Travis Carpenter, dessen ältere Schwester Abilene in Dallas, Texas, von einem Lkw überfahren wurde. Am Freitag, den 27. August 2010, hat sich mein Vater persönlich bei der Familie entschuldigt und wurde prompt von Travis Senior mit einer Schusswaffe bedroht. Ich frage mich, ob Vater und Sohn Travis sich zusammengetan haben, um meinen Vater am eigenen Leib spüren zu lassen, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren, aber meinen Nachforschungen zufolge scheint Travis Junior vollauf mit seinem Politikstudium beschäftigt zu sein. Travis Carpenter ist auch weiterhin bei unserem Dienst angemeldet, im Unterschied zu Mac Maag, dessen Onkel Michael Maag am ersten Abschiedstag ausgeraubt und erstochen wurde. Ich habe keine Ahnung, ob Mac Maag zum Todeswächter gehört, weil er seit drei Jahren nicht mehr auf Social Media aktiv ist, aber es würde mich beruhigen zu wissen, dass er einfach ein friedliches pronaturalistisches Leben führt. Und dann gibt es da noch Paz Dario, den ich schon vor dem ersten Abschiedstag kannte, weil er der süße Junge in Scorpius Hawthorne und die unsterblichen Kinder des Todes war, aber inzwischen ist er vor allem deshalb berühmt, weil er seinen Vater Frankie Dario umgebracht hat. Ich habe früher öfter mal auf seine Social-Media-Profile geschaut, bevor er die aufgrund der unfairen, üblen Reaktionen nach der Doku Bei Nichtanruf Tod allesamt deaktiviert hat. Hoffentlich geht es ihm gut.
Was mich angeht, mache ich mir wegen der heutigen Todesdrohungen also keine großen Sorgen, erst recht nicht, da ich mich hier im Hauptquartier des Todesboten befinde, das über die besten Sicherheitsvorkehrungen verfügt, die man für Geld kaufen kann. Ich konzentriere mich voll und ganz auf meine Arbeit, was im Augenblick bedeutet, dass ich als passiver Zuhörer an einem Treffen meiner Eltern mit Dalma Young, der Erfinderin der App Letzte Freunde, teilnehme.
»Der Todesbote hat den Tod neu definiert, aber mein Ziel war es immer, das Leben zu verändern«, sagt Pa.
»Und das ist Ihnen gelungen«, bestätigt Dalma, die meinen Eltern gegenübersitzt, während ich mit meinem Tablet in der Ecke des Sitzungssaals stehe.
»Ihnen aber ebenso, junge Dame«, sagt Ma.
Dalma ist achtundzwanzig, aber man könnte ohne Weiteres glauben, dass sie erst einundzwanzig ist, vielleicht sogar erst neunzehn, so wie ich. Sie sieht aus wie eine Göttin mit ihrem aufwendig geflochtenen schwarzen Haarkranz aus schwarzen Braids, der strahlend braunen Haut und dem Kaftankleid in Weiß. »Danke für das Kompliment, aber meine Rückenschmerzen vermitteln mir nicht wirklich das Gefühl, noch jung zu sein.«
Mein Vater lacht. »Harte Arbeit schmerzt nun einmal. Nein, im Ernst: Wir möchten Ihnen für Ihr außerordentliches Engagement unsere aufrichtige Anerkennung aussprechen.«
Dalmas Blick springt zwischen meinen Eltern hin und her. »Mir Ihre Anerkennung aussprechen? Sie beide haben doch bereits so viel für mich getan. Die Stipendien, all die Werbung, die Sie für Letzte Freunde geschaltet haben. Ganz abgesehen von Ihrer berührenden Rede bei meiner Examensfeier, Mr Rosa.«
Mein Vater hat ein ziemliches Ego, das meine Mutter schon seit Jahren zu zähmen versucht, aber er ist nun mal ein einzigartiger Typ – wie ein Drache an einem Himmel voller Tauben. Solange er der Einzige ist, der eine derart besondere Firma wie den Todesboten erschaffen kann, lässt er sich von nichts und niemandem bremsen.
»Die Beziehungen, die über die App Letzte Freunde geschlossen wurden, haben mich so oft bei meiner Arbeit inspiriert, Ms Young«, entgegnet er. »Und daher sollen Sie die erste Preisträgerin unseres neu gestifteten Todesboten-Preises für lebensverändernde Errungenschaften werden, den wir nächste Woche im Rahmen der Jubiläumsgala zu unserem zehnjährigen Bestehen verleihen wollen.«
Tränen rinnen Dalma über die Wangen. »Wirklich? Gibt es niemanden, der diesen Preis eher verdient? Was ist mit den Gründerinnen von Make-A-Moment?«
»Nun, die Geschwister Holland gehören gewiss ebenfalls zu den herausragenden Erfinderinnen, die das Todesboten-Zeitalter mitgeprägt haben. Sie jedoch haben das Leben all jener Todgeweihten verändert, die in ihren letzten Stunden menschliche Nähe brauchen.«
Dalma versucht kopfschüttelnd ihr Schluchzen zu unterdrücken. »Aber manche haben meinetwegen ihr Leben auch verloren.«
Kurz vor dem fünften Jahrestag der App am 8. August gab es eine Reihe detaillierter Berichte über Letzte Freunde, in denen all das Gute, das die App bewirkt hat, Erwähnung fand. Ebenso wurden aber auch die Verbrechen angesprochen, die in der Geschichte der Plattform begangen wurden. Todgeweihte, die letzte Freunde zu sich nach Hause einluden und dann von ihnen ausgeraubt wurden. Forderungen nach Nacktbildern und sexuellen Gefälligkeiten wie bei der App Necro. Außerdem die unermüdliche Belästigung durch Todeswächter, die Todgeweihte immer wieder abgeschreckt haben. Missbrauch durch Leute, die Dampf ablassen wollten und sich an den Todgeweihten abreagierten. Aber der dunkelste Fleck in der Geschichte des Unternehmens ist sicherlich der Sommer 2016, als der Letzte Freunde-Serienmörder elf Todgeweihte umgebracht hat. Anschließend dachten alle zunächst, der Mörder sei weg und selbst inzwischen gestorben, weil es mehrere Monate lang zu keinen weiteren Morden mehr kam. Doch am Freitag, den 13. Januar 2017, und am Donnerstag, den 25. Mai 2017, holte der Kerl sich seine letzten beiden Opfer, bevor er endlich gefasst wurde.
Ich weiß eine Menge über den Letzte Freunde-Serienmörder. Der Bruder meines besten Freundes war sein erstes Opfer.
Der gehetzte Ausdruck in Dalmas Blick ist mir vertraut; sie kann das Blut an ihren Händen nicht ignorieren, auch wenn sie die dreizehn Todgeweihten nicht selbst getötet hat.
Mein Vater starrt gedankenverloren in eine Ecke des Saals. »Es ehrt Sie, dass Sie bereit sind, für jeden Schatten, der auf Ihre Firma fällt, die Verantwortung zu übernehmen, so wie wir das auch stets tun, aber Sie müssen verstehen, dass dieser schreckliche Serienmörder, der unter unschuldigen Todgeweihten gewütet hat, genauso wenig Ihr Fehler ist, wie es mein Fehler ist, dass Todgeweihte nach ihrem Abschiedsanruf sterben.«
Dalma nickt, aber sie wirkt nicht überzeugt. »Mr und Mrs Rosa, es schmeichelt mir sehr, dass Sie eine derart hohe Meinung von mir haben, aber ich fühle mich nicht wohl damit, diesen Preis entgegenzunehmen. Manchmal glaube ich, die Todgeweihten wären besser dran, wenn ich die App aufgeben würde, damit so etwas Schreckliches nie wieder passieren kann.«
Meine Eltern wechseln einen ratlosen Blick.
»Sie haben so viel Gutes getan, Ms Young«, werfe ich zur Überraschung aller ein. Es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass sich der passive Zuhörer einmischt. »Die Reportage im Time Magazine über Menschen, die sich aktiv als Lebende Letzte Freunde engagieren, um Todgeweihten beizustehen und mit ihnen Zeit zu verbringen, hat mich tief berührt. Ich selbst hatte bisher nicht die Ehre, so eine Rolle einzunehmen, aber ich hoffe, dass ich wenigstens einmal die Gelegenheit haben werde, jemandem den Abschiedstag zu verschönern.«
Ich nehme mir einen Stuhl und setze mich neben Dalma. »Sie können diese dreizehn Todgeweihten genauso wenig zurückholen, wie wir die Toten Zwölf wieder zum Leben erwecken können, aber unsere beiden Firmen sollten überleben und ihre Arbeit fortsetzen, weil wir viel mehr Gutes als Schlechtes bewirkt haben. Der Rekordhalter Ihrer App, Teo Torrez, war seit Januar 2018 schon über hundertdreißig Mal als letzter Freund aktiv, zu Ehren seines Sohnes Mateo, der dank seines letzten Freundes Rufus Emeterio den allerbesten Abschiedstag verbracht hat. Und dieser Rufus hatte drei Freunde, die Plutos, die am 5. September 2018 eine kleine Tradition gestartet haben und sich zu seinen Ehren jeweils einen Tag lang als letzte Freunde engagieren. Diese Verbindungen existieren dank Ihnen, Ms Young. Wenn Sie die App abschaffen, schaffen Sie damit nicht den Tod ab, sondern nur solch lebensverändernde Abschiedstage.«
Dalma reibt sich die verweinten Augen und ich reiche ihr eine Taschentuchbox. »Sie klingen wie meine Therapeutin«, sagt sie und putzt sich die Nase.
»Ich habe ein paar Ratgeber zum Thema Selbsthilfe gelesen.«
»Das ist definitiv gut investierte Zeit.«
»Heißt das, Sie nehmen den Preis an?«, fragt Pa.
Dalma nickt. »Ich werde eine Rede vorbereiten.«
»Fabelhaft.« Ma kommt um den Tisch herum und umarmt Dalma innig. »Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu feiern. Bitte laden Sie gerne Ihre ganze Familie dazu ein.«
»Meine Mutter und mein Stiefvater verbringen den Sommer in San Juan, aber meine Schwester und ihre Freundin – Verzeihung, Verlobte – sind in der Stadt. Ich werde sie einladen. Dahlia liebt Cocktailpartys.«
Pa steht auf. »Herzlichen Glückwunsch an Ihre Schwester und ihre Partnerin. Lassen Sie uns doch bei Gelegenheit ihre Kontaktdaten zukommen, damit wir den beiden eine offizielle Einladung schicken können.« Eigentlich will er damit sagen, dass wir die Namen brauchen, damit unser privater Sicherheitsdienst Schutzschild sie gründlich durchleuchten kann, bevor er sie ins Gebäude lässt. »Ich glaube, Ihr Freund Orion Pagan hat uns bereits zugesagt. Stimmt das, Alano?«
Ich bin heute schon mit Pas Stabschefin die Gästeliste durchgegangen. »Ja. Mr Pagans Teilnahme ist bestätigt.«
Es dauert einen Augenblick, bis Dalma lächelt. »Das ist großartig«, sagt sie. Ihr Tonfall besagt das Gegenteil.
Ich dachte eigentlich, dass Dalma Young und Orion Pagan beste Freunde seien. Schließlich hat Orions Beziehung zu einem Todgeweihten – Valentino Prince, den mein Vater am ersten Abschiedstag persönlich angerufen hat – den Grundstein für die App Letzte Freunde gelegt. Jetzt sieht es allerdings vielmehr so aus, als könnte es einiges an Drama bei der Jubiläumsgala geben. Ich mache mir in Gedanken eine Notiz, die beiden während der Veranstaltung vom Sicherheitsdienst beobachten zu lassen.
Während ein Wachmann Dalma wieder ins Erdgeschoss begleitet, gehe ich, gefolgt von unseren persönlichen Leibwächtern Ariel Andrade, Nova Chen und Dane Madden, mit meinen Eltern durch den Flur zum Büro meines Vaters. Dieses Gebäude ist wie gesagt perfekt gesichert, aber es kann nicht schaden, extra vorsichtig zu sein.
»Elegant gelöst«, sagt Pa zu mir.
»Habe ich nicht zu dick aufgetragen?«
»Ganz und gar nicht. War dieser Artikel aus dem Time Magazine über die Lebenden Letzten Freunde Teil deines Briefings?«
Es ist meine Aufgabe, alles über alle zu wissen. Wenn wir uns mit einer Person treffen, recherchiere ich im Vorfeld stundenlang und schreibe umfassende Berichte über die Betreffenden – von ihrem Geburtsort über ihre aktuelle Stellung, ihre Hobbys bis hin zu den Themen, die man in der Sitzung besser meidet. Über Dalma Young habe ich ein Memo verfasst, das mich als ihren persönlichen Biografen qualifizieren würde.
»Ja«, antworte ich. Sogar eine Zusammenfassung des Artikels habe ich hinzugefügt, die offensichtlich niemand gelesen hat.
»Ich werde mir deine Unterlagen nächstes Mal genauer anschauen.« Pa klopft mir auf den Rücken. »Auf jeden Fall haben wir dank deiner gründlichen Recherche unser Ziel erreicht. Besonders beeindruckt hat mich, wie mitfühlend du auf die Geister ihrer Vergangenheit eingegangen bist und wie es dir gelungen ist, sie zur Fortsetzung ihrer wichtigen Arbeit zu bewegen, damit Todgeweihte nie wieder allein sterben müssen. Du wirst eines Tages einen hervorragenden Firmenchef abgeben, mi hijo.«
Mein ganzes Leben lang ist schon klar, dass ich den Todesboten erben werde, sobald meine Eltern sich zur Ruhe setzen, aber mein Vater hat immer darauf bestanden, dass ich mich im Unternehmen hocharbeite, statt ihm direkt nachzufolgen. Er kann mir zwar alles beibringen, was man wissen muss, um CEO zu sein, aber letztendlich wird mich allein die Erfahrung erfolgreich machen. Deshalb habe ich in den letzten Sommerferien als Praktikant gearbeitet und bin seit Montag, den 6. Januar, komplett in die Firma eingestiegen, nachdem ich Neujahr/meinen Geburtstag in Ägypten verbracht habe. Ich bin kein großer Fan von Verwaltungsaufgaben und kann gut darauf verzichten, irgendwelche Daten in Excel-Tabellen einzutragen oder Materialien zu ordern, aber dafür hat mich mein Vater auch nicht eingestellt. Er hat mich eingestellt, weil ich ein Naturtalent in Sachen Lernen bin und echt gerne recherchiere. Vermutlich war ich in einem früheren Leben Historiker. Ich liebe meine Arbeit und würde sie auch ohne Bezahlung machen.
Das hat allerdings nicht viel zu sagen, da meine Familie so wohlhabend ist, dass wir sterben werden, bevor wir überhaupt Gelegenheit hatten, all unser Geld auszugeben. Was nicht heißt, dass mein Vater das nicht unermüdlich versuchen würde. Wir leben die meiste Zeit in unserem Penthouse direkt am Central Park, aber er hat auch ein Haus in einem Vorort von Chicago gekauft, ein noch größeres Haus in Orlando und das allergrößte in den Hollywood Hills mit einem umwerfenden Blick über das Zentrum von Los Angeles. Ach ja, und nicht zu vergessen das Haus in San Juan. Leider waren wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr dort, aber wenigstens hat die Familie meiner Mutter ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegt. Unsere anderen Häuser stehen alle leer, seit wir entdeckt haben, dass alte Freunde der Familie eine unserer Wohnungen verwanzt haben, um hinter die geheime Methode zu kommen, mit deren Hilfe der Todesbote seine Vorhersagen trifft.
Zum Glück können wir der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Meine Familie hat so viele Millionen gespendet und investiert, dass mein Vater offiziell vom Milliardär zum Millionär zurückgestuft wurde. Alle feierten ihn dafür, obwohl es meine Mutter war, die die Benefizorganisation Spendenbote ins Leben gerufen hat, aber sie hat nicht Pas Ego. Sie gibt sich große Mühe, mich in diesem Luxusleben zu erden, damit ich eines Tages zwar die Firma, aber nicht das zugehörige Ego erbe.
Wir alle halten uns an eine wichtige Regel: Wir nehmen nichts für umsonst an, wofür wir selbst bezahlen können. Keine Einladung im Restaurant, egal wie dankbar die Köchin ist, dass der Todesbote ihr einen schönen Abschiedstag mit ihrem Ehemann ermöglicht hat, der sonst unerwartet gestorben wäre. Keine Super-Bowl-Suite von dem Trainer, der im Vorjahr entgegen der ärztlichen Warnung vor einer möglichen tödlichen Verletzung seinen Tight-End-Superstar eingesetzt hat, der dann vier Touchdowns erzielte, inklusive des spielentscheidenden letzten. Und auch keine kostenlosen Eintrittskarten zur letzten Met-Gala, obwohl uns die genialen Modeschöpfer bei Saint Laurent für den roten Teppich einkleiden wollten und ich meine Eltern anbettelte, hingehen zu dürfen, weil ich schon immer ein großer Modefan und diese Gala ein Lebenstraum für mich war. Ich bitte nicht oft um etwas, also haben sie zugesagt und mir ein Ticket gekauft. Auf dem Teppich glänzte ich in meinem dunklen Paillettenanzug und einem weißen Seidenhemd mit einer großen Schleife. Ich freundete mich mit dem Kreativdirektor von Saint Laurent an, der mich nun auch für die Jubiläumsgala einkleiden wird.
Fürs College galt die Wir-zahlen-alles-selbst-Regel ebenfalls. Wegen meines erstklassigen Notendurchschnitts wurde mir ein Stipendium für Harvard angeboten, aber alle dachten, dass meine Familie die Vergabekommission bestochen hätte, da ich zu Hause unterrichtet worden war (als ob Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, sich nicht für Stipendien qualifizieren könnten), und dass meine Eltern darüber hinaus auch meine Privatlehrer bestochen hätten, um meine Noten zu manipulieren (als wäre ich nicht von Natur aus brillant). Als ich das Stipendium dann als Zeichen meines guten Willens ablehnte, half das auch nicht. Ich hatte nur eine einzige Möglichkeit, die anderen davon abzubringen, mich als ehrlosen Betrüger zu bezeichnen, und das war, letzten Herbst zur ersten Uniwoche zu erscheinen und den gesamten Lehrstoff schon zu kennen, nachdem ich den ganzen Sommer über im Urlaub auf Ibiza die Literatur des ersten Semesters von vorn bis hinten auswendig gelernt hatte. Für die vegetarische Paella dort im La Brasa würde ich übrigens sterben. (Nicht im Ernst natürlich. Kein Essen ist es wert, dafür zu sterben, aber ich würde mir diese Paella an meinem Abschiedstag aus Ibiza einfliegen lassen.)
Nach dem ersten Semester habe ich das College wieder verlassen. Ich konnte mich nicht auf das Studium konzentrieren, während die Leute um mich herum ständig versuchten, sich bei mir einzuschmeicheln, oder mich sogar direkt bedrängten, ihnen unsere Firmengeheimnisse zu verraten, obwohl ich allen, die danach fragten, wie der Todesbote die Tode vorhersagen kann, erklärte, dass mir mein Vater diese Information bisher vorenthält. Niemand glaubte mir. In Wahrheit verließ ich Harvard vor allem aus Gründen der Sicherheit. Am Montag, den 2. Dezember 2019, kehrten wir alle nach Thanksgiving an die Uni zurück, und ich wurde direkt von Duncan Hogan angegriffen, einem Studenten, dessen Mutter an Thanksgiving um 00:19 Uhr gestorben war, bevor die Boten sie um 00:35 Uhr anrufen konnten. Duncan war verständlicherweise wütend, dass ihn der Tod seiner Mutter unvorbereitet getroffen hatte und er um seinen Abschied gebracht worden war. Er trauerte, indem er mich im Burden Park blutig prügelte. Dann gründete er eine pronaturalistische Vereinigung auf dem Campus, die mich den ganzen Monat über belästigte. Dass mein Leibwächter mich sogar zu den Vorlesungen begleitete, machte die Sache nicht besser, also kehrte ich nach den Weihnachtsferien nicht an die Uni zurück. Es ist jammerschade, weil ich meine Profs mochte und die Atmosphäre eines normalen Studentenlebens, aber genau genommen kann mich das College sowieso nicht wirklich darauf vorbereiten, CEO des Todesboten zu werden.
Ich habe mich meiner vorgezeichneten beruflichen Laufbahn so intensiv gewidmet, dass ich am Mittwoch, den 1. Juli, zum Assistenten der Geschäftsleitung ernannt wurde und jetzt bei jeder Sitzung und bei jeder Videokonferenz dabei bin, sei es mit dem Aufsichtsrat, mit Firmeninhabern, Sicherheitskräften, Stipendienempfängern, Politikerinnen oder sogar dem Präsidenten der Vereinigten Staaten.
»Deine Aufgabe ist es, alles zu wissen, was zu wissen möglich ist«, hatte mein Vater mir an meinem ersten Tag als Vorstandsassistent gesagt. »Bis es so weit ist, dass du auch das erfährst, was zu wissen einst unmöglich war.«
Das Geheimnis des Todesboten.
Sobald er dieses Gespräch mit mir führen wird, weiß ich, dass meine Ausbildung abgeschlossen ist.
Jetzt kehren wir erst mal alle ins Büro meines Vaters zurück. Vor den Fenstern, die auf den Times Square hinausführen, stehen große Monstera-Pflanzen, es gibt eine Sitzlandschaft für die seltenen Gäste, die hierher eingeladen werden, eine ganze Wand voller Sachbücher, von denen ich mir regelmäßig welche ausleihe – zuletzt die Biografien von Präsident Reynolds, Ada Lovelace und Vincent van Gogh –, einen Schreibtisch, der dem Resolute Desk aus dem Weißen Haus nachempfunden ist, nur dass seine Front statt des präsidentiellen Staatswappens das Sanduhr-Logo der Firma ziert, und einen Bronzeglobus an der Stelle, wo der Barwagen meines Vaters stand, bis er an seinem fünfzigsten Geburtstag am Dienstag, den 11. Februar, aufgehört hat zu trinken, nachdem er wiederholt Filmrisse hatte.
»Dein Termin um elf Uhr dreißig mit Mr Carver wurde auf eins verschoben, du triffst dich stattdessen mit Aster«, erinnere ich Pa. Seine Stabschefin muss noch eine lange Liste mit ihm durchgehen vor der Gala nächste Woche, und bevor Pa sich mit dem Produzenten trifft, der ihn über den aktuellen Stand seiner aufregenden neuen Schöpfung informieren soll. Codename: Meucci-Projekt.
»Ich denke, es ist Zeit, Alano.«
Ich schaue noch mal auf die Uhr. »Du hast noch zwölf Minuten.«
»Das meine ich nicht.«
Auch Ma wirkt verwirrt. »Wofür ist es dann Zeit, Joaquin?«
»Zeit, dass Alano seine eigenen Erfahrungen mit der intensiven Basisarbeit des Todesboten macht«, sagt Pa. Er sieht mich an, während er sich darauf vorbereitet, mich um etwas zu bitten, worum ich mich seit Jahren drücke und worum ich mich liebend gern für den Rest meines Lebens gedrückt hätte. Etwas, das mein Vater selbst nur ein einziges Mal getan hat. »Heute Nacht wirst du deinen ersten Todgeweihten anrufen.«
LOS ANGELES
PAZ
08:38 Uhr (Pacific Daylight Time)
Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir von New York in eine Gegend von Los Angeles gezogen sind, die Miracle Mile heißt. Dieses Viertel macht seinem Namen bisher keine Ehre.
Eine wutinspirierte, spätnächtliche Google-Suche hat mir verraten, dass dieser Teil von LA, die Miracle Mile, wegen seines einst »unwahrscheinlichen Aufstiegs zur Berühmtheit« von einer einfachen Schotterpiste zu einer Gegend mit millionenschweren Grundstücken so bezeichnet wird. Ich habe nicht die geringste Ahnung von Gebäudekonstruktion, außer dass das Ganze echt schwer sein muss. Aber kann es schwerer sein, als meinen guten Ruf wiederherzustellen, nachdem ich Dad getötet habe? Ist es nicht unwahrscheinlicher für mich, Berühmtheit zu erlangen, als für die ganzen Museen und Restaurants und Parks? Und wäre es so unwahrscheinlich, dass mir irgendjemand ein Wunder schenkt, damit ich mein Leben wieder aufs rechte Gleis bringen kann?
Mom nennt unser Haus ein Wunder. Sie hat es vom Online-Immobilienmarktplatz Zillow gemietet, bevor wir überhaupt hierhergezogen sind. Sie war sofort verliebt: ein weißer Backsteinbungalow im spanischen Kolonialstil mit der gleichen Mönch-und-Nonne-Ziegeldachdeckung, die all unsere Nachbarn haben; zwei Schlafzimmer, die wir dringend brauchten, nachdem wir uns jahrelang in Rolandos Apartment gequetscht hatten; ein winziger, aber ausreichend geräumiger Garten, den Mom geliebt hat, als er immer grüner wurde und nicht mehr wie eine Schotterpiste aussah. Außerdem hat das Haus eine zentrale Lage, die es uns ermöglicht hat, an den Wundern der Museen, Restaurants und Parks teilzuhaben, als wir noch kein Auto hatten. Mom glaubt, das größte Wunder bestand darin, dass die Besitzer im Dezember beschlossen haben, das Haus an Mom zu verkaufen; ich dagegen bin der Meinung, das wahre Wunder war die Tatsache, dass Mom und Rolando keine Räumungsklage an den Hals bekommen haben, weil sie einen Killer unter ihrem Dach beherbergten.
Um schneller zum Ort meines heutigen Castings zu gelangen, nehme ich die Abkürzung durch die La-Brea-Asphaltgruben, obwohl ich den Schwefelgeruch hasse. Als ich zum ersten Mal von diesen eiszeitlichen Teergruben gehört habe, habe ich sie mir deutlich cooler vorgestellt, weil sie immerhin die einzige Fossilienlagerstätte mitten in einer Großstadt sind. Aber im Grunde sind sie nichts weiter als eine Parkanlage mit Modellen ausgestorbener Tiere, die im sehr realen blubbernden Teer stecken bleiben. Bei Am Abgrund, einem Forum für Überlebende von Suizidversuchen, habe ich von einem Mann gelesen, der sich in einer der Asphaltgruben ertränken wollte. Das Versinken hat allerdings so lange gedauert, dass er es sich doch anders überlegt und seinen Weg zurück nach draußen erkämpft hat. Ich habe mich schon mit vielen Arten zu sterben beschäftigt, aber etwas so Unsicheres würde ich nach meinem ersten gescheiterten Selbstmordversuch definitiv nicht wählen. Ich brauche eine schnellere Methode, die mir keine Zeit lässt, die Sache noch einmal zu überdenken.
Jetzt will ich eine Zigarette.
Die meisten Leute hören im Januar mit dem Rauchen auf, doch genau da hab ich angefangen. Die Weihnachtsfeiertage sind für mich immer deprimierend, aber die letzten waren die schlimmsten seit Jahren. Ich konnte meinen geheimen Instagram-Account nicht aufrufen, ohne glückliche Familien in Weihnachtspullis zu sehen. Auf TikTok war es noch schlimmer, weil der Feed mit Videos vom Geschenkeauspacken zugemüllt war. Währenddessen hatten meine Familie und ich ein weiteres ruhiges Fest mit einem einfachen Baum, den ich dekorieren musste, obwohl ich das hasse. Ich schaffe es einfach nie durch die Feiertage, ohne mich daran zu erinnern, wie ich früher auf Dads Schultern saß und einen Stern auf den höchsten Zweig gesteckt habe. Und dann, an Silvester, habe ich wie üblich allein rumgestanden, als Mom und Rolando sich ihren Mitternachtskuss gegeben hatten. Danach ist Mom auf die Knie gegangen und hat Rolando gefragt, ob er ihr Lebenspartner sein will. Ich wusste nicht, dass sie das vorhatte oder dass Rolando in der Lage ist, vor Glück zu weinen. Zu sehen, dass Mom genug Vertrauen in Rolando hatte, um ihn zu heiraten, obwohl die Beziehung mit Dad sie traumatisiert hat, war wirklich schön; aber es hat auch dazu geführt, dass ich mich noch einsamer gefühlt habe.
Um das Ganze irgendwie erträglicher zu machen, habe ich dann mit dem Rauchen angefangen. Manchmal stelle ich mir währenddessen vor, wie meine rosa Lunge mit jedem Zug schwärzer wird, nur um mir ins Gedächtnis zu rufen, warum ich eigentlich noch rauche, obwohl ich den Geschmack und den Geruch hasse. Das Ganze hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich rebellisch wäre oder so. Mom und Rolando haben nämlich noch immer keine Ahnung, weil ich alle verräterischen Spuren mit Pfefferminzbonbons und dem Extra-T-Shirt verwische, das ich meist mit mir herumtrage. Stattdessen rauche ich, weil ich dem Tod hinterherlaufe. Klar ist das nicht die schnellste Art zu sterben, aber wenn das Sterben ein langer Weg ist, muss ich früh genug losgehen, um irgendwann anzukommen.
Jetzt gerade werde ich allerdings nicht rauchen, denn ich muss frisch sein und eine gesunde Lunge für die Rolle mitbringen, die ich mir gleich sichern werde.
Ich verlasse den Park und biege links in die Sixth Street ein, dann gehe ich die Fairfax rauf, wo gerade das Oscar-Museum gebaut wird. Vor meinem Callback hätte ich geschworen, dass ich niemals etwas erreichen könnte, das wertvoll genug wäre, um in diesem todessternartigen Gebäude ausgestellt zu werden, aber wir werden sehen.
Ein paar Blocks weiter, gegenüber von der Writers Guild of America, erreiche ich das Hruska-Castingbüro, wo ich mir hoffentlich bald einen Namen machen werde.
Einen anderen, besseren Namen.
»Möchtest du dich anmelden?«, fragt der Mann im Vorzimmer.
»Ja, ich heiße Howie Medina«, lüge ich.
Ich werde nach oben in den Wartebereich geschickt.
Ihr müsst wissen – ich liebe meinen Namen, ehrlich. Aber diese Dokuserie wurde von Hunderten Millionen Menschen angeschaut und es gibt nun mal nicht Hunderte Millionen Paz Darios auf der Welt. Wenn ich also auch nur die leiseste Chance auf meine Traumrolle haben wollte, musste ich mir vor meinem Casting eine neue Identität zulegen. Und mit dem Namen Howie Medina ehre ich nicht nur meine familiären Wurzeln, indem ich Moms Mädchennamen wiederbelebe, sondern auch den Schauspieler Howie Maldonado, der vor drei Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Howie spielte Scorpius Hawthornes bösartigen Rivalen. Als ich mit ihm am Filmset war, um in einer Rückblende sein jüngeres Ich zu spielen, stellte sich heraus, dass er privat nicht entspannter hätte sein können. Später ist er sogar als Leumundszeuge bei meinem Gerichtsprozess aufgetreten (nicht, dass irgendwer davon erfahren hätte, denn in der Dokureihe wurde alles rausgeschnitten, was mich hätte gut dastehen lassen). Deshalb glaube ich wirklich, Howie würde sich freuen, dass ich ihn mit meinem Künstlernamen repräsentiere.
Ich trete aus dem Aufzug und sehe im Wartebereich einen Typen sitzen. Er ist ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet, doch mit seinen naturblonden Haaren, diesen strahlend grünen Augen, dem spitzen Kinn und seiner schlanken, muskulösen Statur ist er auffallend schön. Normalerweise wird er wahrscheinlich allein wegen seines Porträtfotos gebucht. Der Typ – meine Konkurrenz – lächelt höflich und auf seinem Gesicht bildet sich dabei auch noch ein gottverdammtes Grübchen.
»Hi, wie geht’s?«, fragt er mit tieferer Stimme, als ich ihm zugetraut hätte. Er klingt wie jemand, der jung aussieht, aber in Wirklichkeit älter ist – was für die Rolle, auf die wir uns bewerben, perfekt wäre. Ich hoffe inständig, dass er nicht schauspielern kann, obwohl das in Hollywood eigentlich egal ist, wenn man so heiß aussieht. Aber wenn er auch noch ein guter Schauspieler ist, bin ich mit meinem Look definitiv am Arsch.
»Gut«, lüge ich, während ich mich auf das gegenüberstehende Sofa setze. »Und dir?«
»Aufgeregt. Ich bin Bodie.«
»Pa… Howie«, sage ich und räuspere mich. »Howie.«
»Ich wollte immer schon bei einem großen Fantasyfilm mitmachen. Kann’s echt kaum erwarten.«
Er hört sich beinahe so an, als wäre er der Meinung, schon gebucht worden zu sein. Vielleicht war sein Lächeln vorhin also gar nicht höflich, sondern siegessicher, weil er mich nicht als ernst zu nehmende Konkurrenz betrachtet.
»Das wird legendär«, sage ich so selbstbewusst, als würde die Rolle bereits mir gehören.
Bodie verengt die Augen zu Schlitzen, so als wollte er mich abchecken – oder aber versuchen, mich wiederzuerkennen. »Hast du schon mal geschauspielert?«
Ja, in der krassesten Fantasy-Franchise-Serie aller Zeiten, du Bastard, will ich antworten.
»Nur in einer kleinen Rolle«, sage ich stattdessen.
Bodie wirkt erleichtert.
»Und du?«
»In ein paar Sachen«, antwortet er, so als hätte er bereits eine florierende IMDb-Seite. »Ich war allerdings noch nie der Star einer Produktion. Aber dieses Projekt hier scheint echt riesig zu werden.«
»Klar, es basiert ja auch auf einem Bestsellerbuch. Sollte man definitiv gelesen haben, wenn man mitspielen will.«
»Na ja, das sind tausend Seiten oder so was.« Er zuckt die Schultern. »Ich werde der Rolle einfach meine eigene Note verpassen.«
Als Fan weiß ich jetzt schon, dass ich seine Interpretation hassen würde. »Viel Glück damit.«
Die Tür geht auf und ein Assistent lässt Bodie wissen, dass die Casting-Direktorin bereit ist.
»Danke«, sagt Bodie zu uns beiden und schreitet aufrecht hinein, so als würde er sein unabwendbares Schicksal annehmen.
Die Adaption dieses Romans verdient Schauspieler, die das Buch wirklich kennen, verdammt noch mal. Jemanden wie mich.
Goldenes Herz ist eine epische Liebesgeschichte zwischen einem Unsterblichen und dem Tod. Sie beginnt mit einem Neunzehnjährigen namens Vale Príncipe, der in ein anonymes Grab fällt, während er in eine totale Sonnenfinsternis schaut. Als er wieder rausklettert, trägt er ein goldenes Herz in sich, das ihm Unsterblichkeit verleiht. Er verbringt sein langes und einsames Leben damit, sich um andere Menschen zu kümmern, insbesondere um Kranke und Sterbende. Im ersten Jahrhundert seines ewigen Daseins wird Vale von Orson Segador aufgesucht, der neuesten Verkörperung des Todes. Dieser versteht einfach nicht, warum Vale nicht stirbt. Die beiden begegnen sich immer dann, wenn Orson die Seelen von Vales Gefährten holt. Stück für Stück lernen sie sich dabei kennen. Eines Tages beginnt Orson selbst auf mysteriöse Weise zu sterben. Jetzt braucht er dringend Vales goldenes Herz, um weiterhin Seelen ins Jenseits überführen zu können, so wie die natürliche Ordnung es verlangt.
Ab da wird die Geschichte richtig wild, denn Vale muss sich nun entscheiden, ob er den Tod sterben lässt, wodurch alle Kranken und Sterbenden ebenfalls unsterblich würden; oder ob er sein goldenes Herz opfert, um die einzige Seele zu retten, die er je geliebt hat – auch wenn das bedeuten würde, dass der Unsterbliche sterben muss, damit der Tod leben kann.
Der Roman ist so verdammt episch, dass daraus ein grandioser Film werden wird, der Millionen von Herzen bricht. Die Stelle, an der Vale seine Unsterblichkeit realisiert, ist die erste Szene, die die Leute umhauen wird. So war es definitiv bei mir. Vale kommt von seinem ersten Date mit einem Jungen nach Hause, der früher als Gärtner für seine Familie gearbeitet hat. Doch als er seinen Eltern von dem Date erzählt, schlägt sein Vater ihn tot … nur stirbt er eben nicht. Vale wacht mitten in einem fürchterlichen Sturm wieder auf, während seine Eltern ihn gerade durch den Wald in Richtung Meer schleifen. Sie sind geschockt, als sie merken, dass Vale noch am Leben ist. Seine Mutter fragt, wo all die blutigen Kratzer geblieben sind. Sein Vater wiegelt ab und sagt, der Regen habe das Blut weggewaschen. Dann fesselt er Vales Hände hinter seinem Rücken mit einer Angelschnur, steckt ihm Steine in die Hosentaschen und wirft ihn über die Klippen. Vale stürzt in eine brechende Welle und wird hin und her geschleudert, bevor er zu Boden sinkt. Minuten vergehen und Vale ist klar, dass er eigentlich verzweifelt nach Luft ringen sollte, doch irgendwie überlebt er … und dann sieht er zum ersten Mal den Tod. Zuerst ist die Gestalt nichts weiter als eine dunkle, skelettartige und unscharfe Erscheinung, die um Vale herumschwimmt und darauf wartet, dass er stirbt. Aber allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz lebt Vale weiter. Er befreit sich von der Angelschnur, wirft die Steine ab und durchbricht die Wasseroberfläche zurück in die Welt. Der Sturm hat sich gelegt, die Sonne scheint hell und der Tod ist verschwunden.
Vales Darsteller braucht auf jeden Fall eine große schauspielerische Bandbreite, von der ich denke, dass ich sie habe. Allerdings wurde die Rolle bereits an einen jungen Filmstar vergeben und sie ist auch nicht meine Traumrolle.
Denn ich spreche für die Rolle des Todes vor.