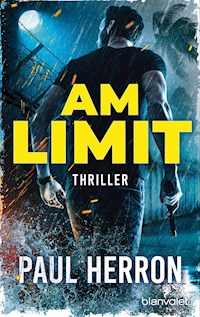
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Hochsicherheitsgefängnis. Ein gefährlicher Wirbelsturm. Ein Kampf ums Überleben.
Jack Constantine hat einen der drei Mörder seiner Frau erschossen. Dafür sitzt der Ex-Polizist nun in einem Hochsicherheitsgefängnis in Florida. Genau hier verbüßen auch die beiden anderen Killer ihre Haftstrafe. Constantines Rache ist zum Greifen nahe. Da rast ein Hurrikan und mit ihm riesige Flutwellen auf das Gefängnis zu. Die Wächter flüchten, ohne die Insassen zu evakuieren, und Constantine muss ausbrechen, um zu überleben. Zu seinem Glück findet er eine Verbündete: Keira Sawyer, eine junge Justizvollzugsbeamtin, die von ihren Kollegen aus Versehen zurückgelassen wurde. Gemeinsam stellen sie sich dem Sturm und den marodierenden Insassen des Gefängnisses. Bis Constantine sich entscheiden muss, was ihm wichtiger ist: sein Leben oder die Rache an den Mördern seiner Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Jack Constantine hat einen der drei Mörder seiner Frau erschossen. Dafür sitzt der Ex-Polizist nun in einem Hochsicherheitsgefängnis in Florida. Genau hier verbüßen auch die beiden anderen Killer ihre Haftstrafe. Constantines Rache ist zum Greifen nahe. Da rast ein Hurrikan und mit ihm riesige Flutwellen auf das Gefängnis zu. Die Wächter flüchten, ohne die Insassen zu evakuieren, und Constantine muss ausbrechen, um zu überleben. Zu seinem Glück findet er eine Verbündete: Keira Sawyer, eine junge Justizvollzugsbeamtin, die von ihren Kollegen aus Versehen zurückgelassen wurde. Gemeinsam stellen sie sich dem Sturm und den marodierenden Insassen des Gefängnisses. Bis Constantine sich entscheiden muss, was ihm wichtiger ist: sein Leben oder die Rache an den Mördern seiner Frau.
Autor
Paul Herron ist gebürtiger Schotte, der seit einigen Jahren in der Hitze und Feuchtigkeit Südafrikas zu überleben versucht (und an manchen Tagen scheitert). Er ist Autor diverser Computerspiele und Comics und hat an mehreren Fernsehsendungen mitgewirkt, von denen eine sogar für den renommierten Emmy Award nominiert wurde. »Am Limit« ist Paul Herrons Thriller-Debüt.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
PAUL HERRON
AM
LIMIT
THRILLER
Aus dem Englischen
von René Stein
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Break Out«
bei Headline Publishing Group, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Paul Crilley
The moral right of the author has been asserted.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -motiv:
© Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com
(MiaStendal, New Africa, railwayfx, shocky, Foto.Touch,
ДимаКарабинов, apithana, lindama) und
© Colin Thomas www.colinthomas.com
DK · Herstellung: sam
Satz: KCFG – Medienagentur Neuss
ISBN 978-3-641-26560-1V003
www.blanvalet.de
Für Jo
Wir haben überlebt, und es gibt keinen Zweifel, dass wir stärker aus all dem hervorgegangen sind, was wir durchgemacht haben. Und dennoch spenden mir nach all den gemeinsamen Jahren die Worte eines großen Philosophen des 20. Jahrhunderts immer noch Trost:
Things can only get better.
Und für Bella und Caeleb sowie das neue Mitglied unserer Familie, Callum. Dank euch wachsen mir buchstäblich graue Haare, aber ich liebe euch trotz alledem.
Wenn sich zwei Hurrikane immer weiter annähern, können die Wirbel miteinander verschmelzen und sich zu einem viel größeren Supersturm vereinigen.
Dieses Phänomen nennt man den Fujiwhara-Effekt.
Prolog
Drei Jahre zuvor
Drei Namen. Drei Kugeln.
Ich hab sie selbst angefertigt. Hab die Patronen aus Blei und Amys eingeschmolzenem Ehering gegossen.
Es gibt noch eine vierte Kugel, eine spezielle, für mich. Sie liegt auf dem Kaffeetisch, glänzend in der Nachmittagssonne, erst golden, dann rot, während das Tageslicht allmählich schwächer wird, wobei kleine Einkerbungen und Unebenheiten auf dem Geschossmantel zu erkennen sind.
Ich starre den ganzen Nachmittag darauf, wie ein Alkoholiker auf Entzug, der die Flaschen in einer Hotel-Minibar anstiert. Schließlich entscheide ich mich dazu, sie dort zu belassen, wo sie ist. Mir Amys Reaktion vorzustellen gibt den Ausschlag – sie hätte mir schon allein dafür, dass ich es überhaupt in Erwägung ziehe, in die Eier getreten.
Also lass ich die letzte Kugel in dem Haus zurück, in dem wir einst zusammengewohnt haben, in jenem Haus, in dem wir unsere Tochter großziehen wollten.
Das Haus, in dem Amy ermordet wurde.
Etwas weckt dich auf. Etwas … anderes. Etwas, das da nicht hingehört.
Du liegst im Bett, lauschst angestrengt. Es ist wahrscheinlich nichts. Ein Auto draußen, ein Waschbär bei den Mülltonnen.
Du wirfst einen Blick auf die Uhr auf dem Nachttisch: 3 Uhr 46. Jesus, du wirst niemals wieder einschlafen können.
Du lehnst dich rüber zu Amy …
Sie ist nicht da.
Du berührst das zerwühlte Laken. Immer noch warm, noch etwas feucht von ihrem Nachtschweiß. Das Geräusch muss von ihr gekommen sein, als sie zum Badezimmer gegangen ist.
Du rollst dich herum. Aus dieser Position kannst du direkt ins Bad schauen. Die Tür steht weit offen. Das Badezimmer ist leer.
Es gibt ganz bestimmte Regeln, wie man einen Hinterhalt stellt. Das habe ich damals in Afghanistan gelernt. Tatsächlich gibt es einen Scheißwust an Regeln, zusammengefasst unter Mission Analysis, die Auftragsanalyse, und Course of Action Development, also die Planung der genauen Vorgehensweise. Ich hab nicht die Zeit, nicht das Back-up und auch nicht die Leute dafür, aber all die Regeln kann man auf vier simple Grundprinzipien herunterbrechen:
Planung, Infiltration, Aktion durchführen, Rückzug.
Die Planung ist am wichtigsten. Du musst den Hinterhalt komplett durchdenken. Jedes kleinste Detail einbeziehen. Sichergehen, dass der Plan keine Lücken hat.
Keine Fehler.
Du sitzt aufrecht im Bett. Das Mondlicht scheint durchs Fenster und durch die Gardine, die in der mittsommerlichen Brise weht.
»Amy?«
Keine Antwort. Du stehst auf, gehst zur Tür und betrittst den Flur, lehnst dich über das Geländer. Unten brennt Licht. Die Küche.
»Amy?«
Nichts.
Du zögerst, und ein unangenehmes Gefühl macht sich in deiner Magengrube breit. Du kannst es nicht erklären, aber du spürst plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Dass etwas Schlimmes passiert ist.
Die erste Aufgabe besteht darin, eine passende »Kill-Zone« zu finden, also den Ort, wo der Hinterhalt stattfinden soll. Ideal dafür ist eine Stelle, an der das Ziel langsamer werden muss, etwa eine scharfe Kurve oder ein steiler Hügel.
Welche Stelle auch immer du wählst, es ist wichtig, dass du selbst genügend Deckung hast. Du willst nicht gesehen werden, bis du für den tödlichen Schuss bereit bist.
Du schlüpfst zurück ins Schlafzimmer und greifst deine Dienstwaffe, eine Beretta. Du lädst sie durch, entsicherst sie und gehst die Treppe hinunter. Ein kurzer Flur zu deiner Linken führt zum Gäste-WC, zu einem Gästezimmer und zur Küche. Das Wohnzimmer liegt zu deiner Rechten.
Du hältst inne und fragst dich, wohin du gehen sollst. Dann hörst du einen Laut. Ein Stöhnen? Du bist nicht sicher, aber es kommt aus dem Wohnzimmer.
Generell eignet sich ein erhöhter Punkt am besten für einen Hinterhalt. Wenn es ein paar Hindernisse gibt, die den Feind aufhalten, umso besser. Aus diesem Grund habe ich immer eine städtische Umgebung bevorzugt, aber das ist hier keine Option. Ein M249 in Downtown Miami abzufeuern würde zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Aber das ist Miami, wendest du ein. Wer zum Teufel nimmt dort Notiz davon, wenn irgendwo geschossen wird? Natürlich weiß ich das auch. Aber ich will das Risiko nicht eingehen. Womöglich kann ich dann den Job nicht zu Ende bringen.
Du musst auch festlegen, welche Art von Hinterhalt du planst. Ungestüme Angriffe kann man vom Ablauf her nicht exakt vorherbestimmen, man ist gezwungen zu reagieren, als wäre man auf Patrouille und zufällig über gegnerische Truppen gestolpert. Wollte ich so vorgehen, müsste ich den Bastarden lediglich nach Hause folgen und sie abknallen, wenn sie aus ihren Autos steigen. Aber ich will, dass sie leiden. Ich will ihnen in die Augen schauen.
Ich entscheide mich für einen durchdachten Hinterhalt. Einen, den ich durchplanen kann. Einen, den ich kontrollieren kann.
Ich habe bereits alle Infos gesammelt, die ich brauche. Ihr Bewegungsprofil, ihre Gewohnheiten, ihre bevorzugten Bars, den Namen ihres Dealers …
Du schleichst weiter, die Waffe bereit. Das Mondlicht fällt durch das Vorderfenster. Die Kommode ist durchwühlt, Schubladen sind herausgezogen, der Inhalt ist auf dem Teppich verstreut.
Dein Blick fällt auf das Chaos. Spielkarten, Münzen, alte USB-Sticks, Krimskrams …
Du gefrierst innerlich. Da hebt sich eine größere Gestalt vom Boden ab.
Etwas in dir zwingt dich dazu wegzusehen, ein Schutzinstinkt. Stattdessen starrst du auf eine Fotografie von dir und Amy, die auf dem Teppich liegt. Es ist das Foto, das du aufgenommen hast, als sie dir eröffnet hat, dass sie schwanger ist. Sie lacht. Du umarmst sie von hinten, das Smartphone in der Hand, als du das Foto im Schlafzimmerspiegel machst.
Schließlich zwingst du dich dazu, die formlose Gestalt anzusehen. Dein Herz pocht überlaut in deinen Ohren.
Also, was ich kontrollieren kann: wo der Hinterhalt stattfinden soll, wo ich selbst mich aufhalten werde und das Missionsziel, Foltern und Töten, langsam und qualvoll, mit extremer Voreingenommenheit.
Was ich nicht kontrollieren kann: So ein Trupp als Angriffsziel erfordert immer einen Überraschungsangriff, und man sollte sein Team aufteilen; eine Gruppe führt den Angriff aus, die andere gibt Feuerschutz. Wird’s diesmal nicht geben, denn ich hab weder Unterstützung noch jemanden, der mir Rückendeckung gibt. Ich bin auf mich allein gestellt.
Aber das ist in Ordnung, denn ich will die Sache ganz allein durchziehen, ich will nicht, dass irgendwer anders involviert ist.
Du streckst deinen Arm aus und legst den Lichtschalter um.
Dein Gehirn rebelliert.
Dein Sehvermögen nimmt alles stroboskopartig wahr, Bilder, die sich in dein Gehirn ätzen, Bilder, die du nie mehr vergessen wirst.
Amy, mit dem Gesicht nach unten auf dem Teppich liegend. Das T-Shirt, in dem sie schläft, ist hochgeschoben, sodass ihr Slip und das kleine Tattoo über der Niere zu sehen sind.
Ihren eingesunkenen Schädel, das Haar in Blut getränkt und verfilzt.
Der Baseballschläger aus Aluminium neben ihr.
Der dunkle Fleck, der sich auf dem Teppich ausgebreitet hat.
Die Wölbung über ihrem Schwangerschaftsbauch.
Du sackst gegen die Wand. Die Waffe fällt dir aus der Hand, als du dich auf den Teppich fallen lässt und deine Frau anstarrst.
Die wichtigste Regel bei einem Hinterhalt, nach den Vorbereitungen, all der Arbeit, ist Geschwindigkeit. Du musst den Feind kalt erwischen, ihm eine Scheißangst machen. Unnachgiebig rein, auf jeden schießen, dann zur Hölle weg mit dir. Der Feindkontakt darf nicht länger als sechzig Sekunden dauern.
Aber heute Abend wird das nicht passieren. Ich sorge dafür, dass es so lange dauert wie möglich.
Du händigst den ermittelnden Detectives nicht die Bilder deiner Überwachungskamera aus. Du sagst ihnen, dass du die Speicherkarte herausgenommen und nicht ersetzt hast. Die Blicke. Was ist das für ein Cop, der so schlampig ist, dass die eigene Überwachungskamera nicht funktioniert?
Dir ist es egal, was sie denken. Du behältst die Aufzeichnungen für dich. Schaust dir an, wie drei Männer in dein Haus einbrechen, und bearbeitest die einzelnen Bilder zu einer Schleife, die du immer wieder abspielst, bis sich ihre Gesichter in dein Gehirn gebrannt haben.
Nachdem du eine Weile auf die Endlosschleife gestarrt hast, bekommst du das überaus seltsame Gefühl, dass du sie kennst. Jeder Zug und jede Linie ihrer Gesichter sind dir so vertraut, als würdest du alte Freunde betrachten.
Anschließend benutzt du das Polizeiregister, um die Killer zu identifizieren. Dauert nicht lange. Jeder von denen hat ein Vorstrafenregister länger als dein Arm.
Marcus Tully, Barry Novak und Luther Wright.
Drei Namen.
Du notierst ihre Adressen, daneben Bekannte, soweit sie aufgeführt sind.
Dann startest du die erste Phase der Operation – Informationsbeschaffung.
Marcus Tully ist der Erste. Er lebt immer noch bei seiner Mutter in einem Ein-Zimmer-Apartment in Overtown.
Barry Novak ist ein Veteran, was dich überrascht. Und dich enttäuscht. Er hat fünf Jahre vor dir in Afghanistan gedient. Nicht in Mardscha, sondern woanders. Er lebt allein. Besucht eine Gruppe, die ehemalige Armeeangehörige unterstützt. Er geht zu einem Psychologen, trinkt jeden Abend eine Flasche Wodka. Der Typ ist eine wandelnde posttraumatische Belastungsstörung, sieht man aus einer Meile Entfernung.
Übler Scheiß.
Luther Wright ist der Außenseiter und nur Mitglied dieser Truppe, weil er hofft, dass etwas von ihrem verwegenen Ruf auf ihn abfärbt. Er ist ein Jasager, ein Befehlsempfänger, tut das, was immer man ihm sagt.
Phase eins ist abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden die Bekannten unter die Lupe genommen.
Sobald du feststellst, dass ein Drogendealer dazugehört, schält sich ein grober Plan in deinem Kopf heraus.
Ich nehme das M249 Paratrooper für den Hinterhalt, kurz Para, eine kompaktere Version des M249-SAW-Maschinengewehrs. Es hat einen kürzeren Lauf und einen ausziehbaren Schaft aus Aluminium, sodass man sich einfacher damit bewegen kann.
Ich musste von einem alten Kumpel aus der Armee eine Menge Gefallen einfordern. Er wollte mir ein M27 verkaufen, aber das hab ich nie gemocht. Magazine mit dreißig Schuss sind nichts im Vergleich zu Munitionsgurten, die beim M249 Anwendung finden. Zwar ist das Para älter als das M27, aber ich mag das. Fühlt sich vertrauter an, ich hab damit trainiert. Ich kenne es.
Ich hab mich ganz oben auf einem Anstieg positioniert, der außerhalb von Overtown über einem verlassenen Sägewerk liegt. Perfekt für meine Bedürfnisse. Weit genug von der Stadt entfernt, sodass niemand das Gewehrfeuer hören wird, und es gibt nur eine Straße rein und raus, sodass ich nicht mehrere Fluchtrouten im Auge behalten muss.
Ich schaue durch das Zielfernrohr und lasse den Blick langsam über das verlassene Fabrikgelände schweifen. Es ist aus den Dreißigern, eine Reihe alter Holzgebäude mit portablen Bürocontainern, die im hinteren Bereich beisammenstehen. Die Fabrik wurde vor drei Jahren dichtgemacht, als drei Mitarbeiter starben. Ich war damals in die Ermittlung involviert. Es war die Schuld des Eigentümers, es gab keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Keine Wartung der Sägen oder der Ausrüstung. Bei einer Säge war die Kette derart verschlissen, dass sie absprang, einen Typen köpfte, dem nächsten auf Höhe des Bauchs die Eingeweide bis zur Wirbelsäule zerteilte und beim letzten im Hals stecken blieb.
Das Gelände selbst und die Straße durch die Bäume liegen unter mir in einem schattigen Tal. Am Trauf der gegenüberliegenden Talseite befindet sich eine offene Baracke mit Stapeln aufgehäufter Baumstämme, die dort offenbar vor der Weiterverarbeitung in der Fabrik gelagert wurden. Ich hab vorhin zwei Propangasflaschen bei den Baumstämmen platziert, eine an jedem Ende der Stämme, direkt da, wo die Ketten sie zusammenhalten. Ich habe das Holz überprüft, als ich die Gasflaschen platziert hab. Ein Großteil ist verfault und modrig, aber für meine Zwecke ist das okay. Vielleicht brauch ich die Gasflaschen gar nicht, aber Vorbereitung ist der Schlüssel.
Die Stunde, bevor die Morgendämmerung einsetzt, eignet sich perfekt für eine überfallartige Attacke. Das Ziel schläft für gewöhnlich tief, der Körper ist total heruntergefahren. Das Opfer weiß überhaupt nicht, was zum Teufel da vor sich geht.
Du weißt bereits, dass der Dealer – Elias Finch – allein lebt. Du gehst kompromisslos vor, strahlst ihm mit einer grellen Taschenlampe ins Gesicht, packst ihn und schleuderst ihn auf den Boden. Finch gibt ein ängstliches Stöhnen von sich, das klingt, als wäre es nicht von dieser Welt. Du kennst es schon von früheren Überfällen, neun von zehn Leuten, die derart angegangen werden, geben diesen Laut von sich: animalisch, verängstigt, urzeitlich.
Du ziehst ihm eins mit dem Gewehrkolben über, schlägst ihn bewusstlos. Du wartest, lauschst, kontrollierst seine Atmung. Ein Hund bellt in der Ferne. Du hörst ein Auto, das an dem heruntergekommenen Haus vorbeifährt. Die Scheinwerferlichter fallen durch die Vorhänge und ziehen dann weiter.
Zufrieden schleifst du Finch ins Wohnzimmer. Wenn man es überhaupt so nennen kann. Du hast so einen Raum schon Hunderte Male zuvor gesehen: normalerweise nackter Dielenboden, manchmal verdeckt von einem schmuddeligen Teppich, ein Sofa mit Löchern von Zigaretten und Flecken von verschütteten Drinks und Körperflüssigkeiten, ein alter Tisch bedeckt mit gebrauchten Spritzen, überquellenden Aschenbechern, leeren Bierflaschen. In diesem Fall aber kommen überraschenderweise einige Romane hinzu. Das ist mal was Neues. Du kannst dich nicht erinnern, jemals in der Bude eines Dealers Bücher gesehen zu haben. Ein Fernseher, sicher, eine Spielekonsole, definitiv. Etwas, um sich stumpfsinnig abzulenken, während man darauf wartet, dass die Droge kickt und man high wird. Aber Bücher? Nein.
In der Küche stehen ein klappriger Tisch und Stühle. Du ziehst einen davon ins Wohnzimmer, wuchtest Finch darauf und fesselst ihn mit dem mitgebrachten Seil, damit er nicht gleich wieder runterfällt.
Dann wartest du.
Er wacht eine halbe Stunde später auf. Sieht dich auf der Couch sitzen, mit der Waffe auf deinem Schoß. Er öffnet den Mund, will schreien, doch du führst einen Finger vor deine Lippen.
Er ist nicht so dumm, wie er aussieht, und klappt den Mund zu. Er starrt dich mit weit aufgerissenen, ängstlichen Augen an.
Du hast für heute alles geplant. Es ist Freitag, und du weißt, dass Finch an diesem Tag für gewöhnlich von Tully angerufen wird, der Stoff für sich, Wright und Novak bestellt.
»Wenn Tully anruft«, sagst du zu Finch, »sag ihm, dass er nicht herkommen soll. Sag ihm, dass du glaubst, die Cops beobachten dich. Sag ihm, dass du heute Abend um sieben den Stoff zur Holzfabrik bringst, zu dem verlassenen Sägewerk ungefähr zwei Meilen außerhalb der Stadt. Nicke, wenn du mich verstanden hast.«
Finch nickt.
»Wenn du versuchst, sie zu warnen, schieß ich dir ins Auge. Verstanden?«
Finch nickt erneut, verzweifelter diesmal.
Du sitzt für den größten Teil des Tages dort, bis Tully endlich auf Finchs Smartphone anruft.
Du hältst den Lauf der Waffe vor Finchs Auge und das Handy an sein Ohr. Er sagt Tully alles genau so, wie du es von ihm verlangt hast.
Tully ist nicht glücklich darüber. Er ist es gewohnt, seinen Stoff sofort zu bekommen, wenn er anruft. Dann nimmt er ihn mit zu Novak, wo sie sich das Zeug reinziehen, bevor sie zu einer Spelunke am Rand von Overtown fahren, der Double Down Tavern. Du bist ihnen schon einige Male dorthin gefolgt, als du dir deinen Plan zurechtgelegt hast. Der Laden hat verdunkelte Scheiben und Plastikstühle vor der Tür, wenn es drinnen zu voll ist. Eine Neonreklame hängt über dem Eingang – ein lila Billardqueue, der eigentlich vor- und zurückfahren soll; aber die Reklame ist kaputt, sie blinkt nur noch und summt laut vor sich hin.
Finch sagt ihnen, dass sie keine Wahl haben. Entweder sie treffen sich am Sägewerk, oder es gibt keinen Stoff. Tully willigt murrend ein.
Du beendest das Gespräch. Dann setzt du dich hin und starrst Finch an, überlegst dir, was du mit ihm machen sollst. Du könntest ihn einfach umbringen, du würdest jedem anständigen Menschen damit einen Gefallen tun. Du willst es. Du willst alles bis auf den Grund niederbrennen. Alles und jeden vernichten, der etwas mit den Männern zu tun hat, die deine Familie ausgelöscht haben.
Du starrst ihn an. Er sagt nichts. Er weiß, was du denkst, ist sich bewusst, dass die kleinste Regung von ihm dich reizen könnte, auf die eine oder andere Art.
Es ist drei Uhr nachmittags. Vier Stunden bis zum Treffen. Du willst nicht riskieren, ihn so hierzulassen. Er könnte sich befreien. Könnte Tully und die anderen warnen.
Du überprüfst sein Schlafzimmer und findest starke Schlaftabletten. Eine würde einen gesunden Erwachsenen umhauen, du zerteilst sieben und löst sie in Wasser auf. Du tust es vor Finchs Augen, lässt ihn sehen, was du gerade machst.
»Du wirst das trinken«, sagst du. Er schüttelt den Kopf. »Du trinkst das, oder ich töte dich. So oder so, ich will dich außer Gefecht haben. Deine Entscheidung.«
Er zögert, dann nickt er.
Du hältst ihm das Glas an die Lippen, und er trinkt hastig. Du wartest ungefähr vierzig Minuten, bis die Wirkung einsetzt. Du dachtest, die Tabletten würden schneller wirken, aber der Kerl ist harten Stoff gewöhnt. Du hoffst nur, dass du ihm genug verabreicht hast.
Er schließt die Augen, und der Kopf kippt nach vorn. Du knallst ihm eine, aber er rührt sich nicht.
Vier Uhr. Drei Stunden übrig.
Zeit, den Hinterhalt zu legen.
Und hier bin ich, oben auf dem Hügel, und beobachte das Sägewerk durch das Zielfernrohr meines Maschinengewehrs.
Wartend.
Meine Uhr trage ich so, dass ich das Ziffernblatt auf der Unterseite meines Handgelenks sehe. Alte Gewohnheit aus dem Krieg – du willst nicht, dass irgendein Lichtreflex dem Feind deine Position verrät. Außerdem lässt sich so leichter die Uhrzeit prüfen, wenn du auf dem Boden liegst und wartest.
Es ist sieben Uhr. Sie sollten jede Minute hier sein.
Eigentlich …
Ich kann sehen, wie sich Lichter nähern, ein geisterhafter Schein, der so wirkt, als würde er durch die Bäume fließen. Dann höre ich den Motor eines Pick-ups, der dringend mal gewartet werden müsste.
Ich strecke den Nacken, lockere die Muskulatur und schaue wieder durchs Zielfernrohr. Atme ein – eins, zwei, drei, vier –, dann aus – eins, zwei, drei. Ein, dann aus. Ich verlangsame die Atmung.
Der Pick-up kommt schließlich hüpfend und ruckelnd in Sicht. Mit seiner veralteten Federung ist er kaum in der Lage, auf der Schlaglochpiste die Spur zu halten.
Für einen Moment denke ich, dass sie mir die Arbeit abnehmen. Mein eigenes Auto hab ich quer auf der Straße abgestellt, die direkt vor dem Sägewerk vorbeiführt, exakt an der Stelle, wo sie anhalten sollen. Aber sie gehen nicht mal vom Gas, als sie näher kommen.
Ich verfolge den Pick-up durch das Fernrohr und fokussiere den Fahrer. Es ist Tully. Er hat den Kopf zur Seite geneigt, als würde er mit jemandem sprechen, aber dann schaut er wieder nach vorn und bremst gerade noch rechtzeitig.
Die Reifen blockieren, und der Wagen schlittert über den schmutzigen Asphalt, bevor er sich seitlich dreht.
Ich nutze die Gelegenheit, verlagere mein Gewehr, langsam, sodass der Lauf dem Pick-up folgt.
Krawumm!
Eine Kugel schlägt im Vorderreifen ein. Ich verlagere erneut mein Gewehr …
Krawumm!
Eine weitere Kugel macht den anderen Vorderreifen unbrauchbar. Der Wagen schlittert immer noch, dreht sich weiter. Sie müssen die Schüsse gehört haben, gespürt, wie die Luft aus den Reifen gewichen ist.
Ich bewege mein Zielfernrohr nicht, um ihre Gesichter zu sehen, sondern warte, bis der Wagen sich vollständig gedreht hat, sodass er mit dem Heck zu mir steht.
Krawumm!
Krawumm!
Zwei weitere Schüsse, zwei weitere Reifen. Ich hätte es nicht besser planen können.
Der Wagen kommt in einer Staubwolke ungefähr eineinhalb Meter neben meinem zum Stehen. Ich schaue weiter durchs Fernrohr, warte.
Die Tür auf der Beifahrerseite wird geöffnet. Jemand steigt aus, es ist Wright. Er will davonlaufen. Ich betätige den Abzug, höre das scharfe Krachen des Gewehrs. Den Bruchteil einer Sekunde später explodiert eine kleine Wolke dunklen Sprühnebels rund um sein Knie, und er stürzt zu Boden.
Jetzt werden sie in Panik geraten. Ich frage mich, was sie tun werden. Ich wette mit mir selbst, dass sie versuchen zu flüchten, auch wenn sie nicht wissen, wo der Schütze sitzt.
Ich liege richtig. Tully hastet aus dem Pick-up und sucht sein Heil mit einem Sprint in Richtung der Bäume. Ich lasse ihn Hoffnung schöpfen – dann schieße ich ihm von hinten die Kniescheibe weg, und auch er geht zu Boden.
Novak startet den Wagen. Er will mit vier platten Reifen türmen.
Ich ziele auf die Baracke, schieße auf die Propangasflaschen. Dann blicke ich über das Zielfernrohr und sehe, wie sich Feuerbälle in den Himmel erheben, gefolgt von einer gewaltigen Explosion, die den Boden erbeben lässt.
Die Erschütterungen hören nicht auf, denn nun rollen und poltern die zahlreichen Holzstämme den Hügel hinunter auf die Straße, sodass sie Novaks Fluchtweg versperren.
Er fährt weiter. Glaubt er, dass er über die Baumstämme fahren kann? Idiot. Das kann er nicht, aber ich visiere die Motorhaube des Wagens an, feuere Salven in den Kühler sowie den Motorblock.
Der Pick-up rutscht und schlittert, dreht sich wild um die eigene Achse. Ich feuere weiter. Einen Moment später hustet der Motor noch mal und stirbt schließlich, während Rauch aufsteigt.
Ich warte. Ein Teil von mir will das Feuer eröffnen, das ganze Gelände mit Kugeln eindecken, die Kerle in Fetzen ballern. Aber ein anderer Teil von mir, jener Teil, der in dem Wohnzimmer damals gestorben ist, gewinnt. Sie müssen leiden für das, was sie getan haben. Kein schneller Tod.
Novak bewegt sich schließlich. Die Tür schwingt auf, und er gleitet nach draußen. Er ist auf der anderen Seite des Pick-ups, sodass ich keinen sauberen Schuss anbringen kann.
Ich werfe einen Blick auf den Munitionsgürtel. Es sind noch fünfzig Schuss übrig. Ich warte, aber Novak bleibt, wo er ist. Er ist panisch, hat keine Ahnung, wohin er soll, hat keine Ahnung, wo ich bin.
Okay. Dann will ich es ihm zeigen.
Ich stehe mit meinem Gewehr auf, der Munitionsgürtel schlägt gegen meine Knie, und ich beginne meinen Abstieg den Hang hinunter. Ich hab das Gewehr erhoben, immer schussbereit. Ich weiß, dass keine Hindernisse auf dem Pfad warten, ich hab es selbst überprüft, indem ich mehrere Male hoch- und runtergegangen bin, um ein Gefühl für den Weg zu bekommen. Ich muss nicht einmal hinschauen, wohin ich trete.
Ich erreiche den Talgrund, und Novak hat sich nicht einmal bewegt. Ich bleib stehen, lege mich in den Dreck, das Gewehr seitlich von mir, spicke unter dem Pick-up hindurch. Novak ist immer noch da.
Ich lass das Para liegen und nehme die Glock (nicht die Waffe, mit der ich sie erledigen werde, eine andere). Wright stöhnt vor Schmerzen und windet sich an der Stelle, an der er zu Boden gegangen ist. Ich registriere genau den Moment, an dem er meiner gewahr wird. Sein Stöhnen hört auf.
Ich ziehe den Schlitten der Waffe durch. Das Geräusch könnte genauso gut ein Schuss sein, denn es zieht alle Aufmerksamkeit auf mich. Ich warte, bis Tully über seine Schulter blickt. Ich kann auch Novak sehen, der am Pick-up vorbei herüberschielt.
Ich halte weiter auf Wright zu, der sich umdreht und auf seinen Bauch plumpst wie ein gestrandeter Fisch. Doch es gelingt ihm irgendwie hochzukommen, und er zieht ein Bein hinter sich her, als er versucht davonzuhumpeln. Ich bleibe stehen und warte, bis er sich erneut umdreht – und schieße ihm in die andere Kniescheibe.
Er fällt und brüllt wie am Spieß. Ich gehe zu ihm, packe ihn am Shirt und drehe ihn um, sodass er auf dem Rücken liegt.
»Was willst du?«, schreit er.
Meine Stimme ist tonlos. So tot, wie ich mich innen drin fühle. »Vor fünf Wochen seid ihr in mein Haus eingebrochen. Ihr habt meine Frau getötet. Sie war schwanger. Was verflucht noch mal denkst du, was ich will?«
Wrights Augen öffnen sich. »Das … das war ein Versehen. Ich schwör’s. Wir wollten nur etwas Bargeld … Deine Frau, sie ist quasi in uns reingelaufen. Wir haben’s mit der Panik zu tun bekommen …«
Er hört auf zu reden.
Da ist ein Geräusch. Wir hören es beide.
Es ist ein Auto.
Nein, Autos. Schnell näher kommend.
Ich drehe mich zur Straße und sehe rote und blaue Lichter in der Ferne zucken, die die Dunkelheit zwischen den Bäumen erhellen.
Cops?
Was zum Teufel haben Cops hier zu suchen?
Wie …?
Wright versucht wegzukrabbeln. Ich trete auf sein Bein und versuche verzweifelt, einen klaren Gedanken zu fassen. Wright schreit, während zwei Autos aus dem Wald hervorschießen und auf der anderen Seite der herabgestürzten Stämme zum Stillstand kommen.
Die Türen fliegen auf. Ich ziehe die andere Glock aus dem Hosenbund meiner Jeans, diejenige mit den Spezialkugeln, und ziele auf Wright, bereit, ihm in den Kopf zu schießen.
»Constantine!«
Ich erstarre und schaue zurück. Mason, meine Dienstpartnerin, umrundet die Enden der Stämme.
»Constantine, wag es nicht!«, schreit sie.
»Das sind die Arschlöcher, die Amy getötet haben!«
»Interessiert mich ’n Scheiß!«
Weitere Polizisten sind aus ihren Wagen gestiegen. Sie stehen hinter den Türen, die Waffen auf mich gerichtet. Mason schaut zurück und hebt beide Hände. »Wartet! Lasst mich mit ihm reden.«
»Da gibt’s nichts zu reden!«, rufe ich.
»Constantine, bitte, du kannst immer noch aufhören.«
Ich blicke auf Wright hinunter. Hinüber zu Tully. Ich lache laut auf und kann mich kaum beruhigen, während ich die Hysterie in meiner Stimme höre.
»Jack. Bitte …«
Ich sehe Mason an. Ihr Gesicht zeigt einen unendlich traurigen Ausdruck. Wir kennen uns seit zehn Jahren, ich bin der Pate ihres Kindes.
»Nicht …«, beginnt sie.
Novak nutzt die Gelegenheit und läuft los, weg vom Pick-up und hin zu den Polizeiwagen. Ich handle instinktiv, drehe mich um und schieße.
Die Kugel erwischt ihn im Nacken. Mason schreit auf, als Novak zusammenbricht.
Ich habe kaum Zeit, es zu registrieren, weil ich einen heftigen Schmerz in meinem Arm spüre. Ich taumle zurück, die Waffe fällt mir aus der Hand.
Mason steht da, die Waffe auf mich gerichtet, die Augen vor Schreck weit aufgerissen, als könne sie nicht glauben, was sie getan hat.
Die Cops schreien wild durcheinander, doch ich kann durch das Rauschen in meinen Ohren kaum etwas verstehen.
Ich drehe mich um. Sehe, wie Tully wegkrabbelt. Wright auch. Er ist bereits sechs, sieben Meter von mir entfernt. Ich bücke mich, um die Glock aufzuheben.
Da trifft mich etwas an der Seite, und ich werde zu Boden geworfen.
»Sei verdammt noch mal nicht so dumm, Jack«, sagt Mason direkt an meinem Ohr.
Ich versuche, sie wegzuschieben, doch sie packt meinen verwundeten Arm und zwingt ihn mir auf den Rücken. Ich schreie auf vor Schmerz.
Dann spüre ich mehr Gewicht auf mir. Spüre Hände auf meinem Kopf, die mein Gesicht in den Staub drücken.
Das Letzte, was ich sehe, sind die Polizisten, die auf Wright und Tully zugehen.
WARNLAGEBERICHT
Amtliche Mitteilung Nr. 5 des NWS National Hurricane Center Miami FL
Betreff: Hurrikan Josephine
Freitag, 27. August 2021, 17:00 Uhr
ENTWICKLUNG DER WETTER- UND WARNLAGE
Während der vergangenen Stunden hat Josephine ständig an Stärke zugenommen. Josephines Route wird den Sturm diesen Nachmittag über die Turks- und Caicos-Inseln führen, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Meilen pro Stunde (193 Stundenkilometer). Das Zentrum des Hurrikans wird Miami in 12 Stunden erreichen. Der Zyklon wird laut Prognosen am Samstag, den 28. August, von Kategorie 4 auf Kategorie 5 hochgestuft.
WARNUNG
Evakuierung ist zwingend erforderlich. Wiederhole: Evakuierung zwingend erforderlich.
Eins
Freitag, 27. August
06:00 Uhr
Im Gefängnis dreht sich alles darum, dein Strafmaß in Zeiteinheiten zu unterteilen. Das ist der einzige Weg zu überleben. Ein Jahr, das ist zu viel. Ein halbes Jahr ist deprimierend. Verdammt, selbst ein Monat fühlt sich an wie eine Ewigkeit.
Eine Woche hingegen – eine Woche ist gerade so zu managen, zumindest dann, wenn du etwas hast, womit du die Zeit füllen kannst. Ein Besuch der Familie zum Beispiel, dann hast du einen Countdown. Einen Grund, um weiterzumachen.
Ich habe nichts dergleichen. Meine Eltern sind beide tot. Keine Kinder, keine Brüder oder Schwestern. Eine ermordete Ehefrau. Also nicht viel, worauf ich mich hier freuen könnte.
Aber du treibst dich weiter an, du pusht dich, bis du nicht mehr kannst. Denn so ist das Leben, wie mein Alter immer zu sagen pflegte. Du lebst, du stirbst. Alles dazwischen ist lediglich ein dampfender Haufen Scheiße, aber du versuchst, das Möglichste draus zu machen.
Sein Möglichstes bestand in Drogen und Nutten, und es endete damit, als er sich um drei Uhr nachts von einer dreißig Meter hohen Brücke in einen reißenden Fluss stürzte, mit Koks voll bis oben hin und mit nichts weiter bekleidet als seinen Superman-Boxershorts. Die Hure, die aus dem Auto sprang, kurz bevor es von der Brücke fuhr, sagte später, er hätte sich über Lydia – meine Mutter – ausgeheult. Sie würde ihn in einen Käfig sperren, ihn davon abhalten, frei zu sein, doch er würde ihr beweisen, dass ihr das nicht gelänge.
Spoileralarm: Er schaffte den Gegenbeweis nicht.
Aber mit einer Sache hatte er recht. Du machst weiter, oder du steigst aus. Ich komme weder an Koks noch an Nutten ran und ich kann mich auch nicht in einen reißenden Fluss stürzen, also besteht die einzige Alternative darin, sich mit einer von den Gangs anzulegen, sodass sie mich unter der Dusche abstechen (hoffentlich mit was Nichtorganischem, wenn du verstehst, was ich meine), oder die Wächter anzugreifen und ihnen derart übel mitzuspielen, dass sie tödliche Gewalt anwenden müssen.
Vielen Dank auch, da mach ich lieber weiter!
Felix sagt, es wird einfacher, je länger man drinnen ist, aber ich glaub nicht viel von dem, was Felix so von sich gibt. Er ist ein notorischer Lügner. Oder, wie er es gern nennt, ein Geschichtenerzähler. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier drin, wie viel länger wird’s noch dauern?
Ich runzle die Stirn, als ich durch das kleine, zerkratzte Fenster gucke, das in die Zellentür eingelassen ist. Warum zum Teufel denke ich daran, wie die Zeit vergeht? Das ist ein ganz schlechter Weg, in den Tag zu starten. Führt nur zu Depressionen.
Oh yeah, Felix.
»Ich meine, der Bengel hat schon wieder geweint«, sagt Felix von seiner Pritsche. »Er ist hier wie lange? Seit drei Wochen nun? Ich hab’s ihm gesagt. Ich hab ihm gesagt, der einzige Weg, im Gefängnis zu überleben, ist, nicht dagegen anzukämpfen.«
»Ist das so?«, frage ich abwesend.
Unsere Zelle liegt auf der oberen Ebene von Block B. Alles, was ich durchs Fenster sehen kann, ist das Geländer auf dem Gang und die Zellen auf der gegenüberliegenden Seite unseres Traktes. Sieht aus, als hätte Stevens mal wieder seinen Kopf gegen das Glas gehämmert. Sein Fenster ist blutrot verschmiert.
»’türlich ist das so. Akzeptier, dass du hier drin bist, Mann. In der Zukunft existiert für uns kein Haus mit drei Schlafzimmern. Kein kleiner Umweg an einem Freitagnachmittag nach der Arbeit, um der Geliebten ’nen Besuch abzustatten – du weißt schon, die, die die Dinge macht, die deine Frau ekelhaft findet. All das ist vorbei, denk nicht mal daran. Das ist jetzt dein Leben. Umarme es. Gesteh dir die Scheiße ein.«
»Ich dachte, das hätte ich.«
Hatte ich das tatsächlich? Ich war da nicht so sicher. Es ist ziemlich schwer, seinen eigenen Geisteszustand im Gefängnis zu beurteilen. Zu viele Gedanken schießen dir durch den Kopf, die Dinge erscheinen einem verwirrend, konfus.
»Was zum Teufel, Mann?«, blafft Felix. »Du glaubst nicht ein Wort von dem, was ich sage?«
Jessas. Fräulein Temperamentvoll da drüben. Bei Felix muss man vorsichtig sein. Normalerweise ist er ziemlich gechillt, aber die abwegigste Sache kann ihn rasend machen. Ich war bisher noch nie derjenige, der das dann ausbaden musste, aber andere Häftlinge hatten weniger Glück und verbrachten dann die nächsten Tage auf der Krankenstation.
»Ich glaub dir«, sage ich. Mache eine Pause. »Frischst du meine Erinnerung noch mal auf?«
»Ich sage, wir müssen akzeptieren, dass wir hier drin festsitzen. Sieh mal … du hast Leo gesehen, richtig? Der alte Kerl. Sitzt immer ganz hinten in der Kantine. Hält immer Messer und Gabel so, als würde er sie sich gleich in den Schädel rammen.«
»Yeah.«
»Weißt du, warum er so ist?«
»Lass mich mal eine verwegene Vermutung anstellen … weil er nicht akzeptiert hat, hier zu sein?«
»Bingo! Er denkt immer über einen Weg nach, der nach draußen führt. Immerzu Ausschau halten, planen. Der Typ sieht aus wie ’n Achtzigjähriger. War sein ganzes Leben hier drin, und er denkt immer noch, dass er irgendwann wieder das Draußen sehen wird. Immerzu redet er darüber, Tunnel zu graben oder sich durch die Kanalisation rauszuschleichen. Was hat’s ihm gebracht? Magengeschwüre und Wahnvorstellungen. Das hab ich dem neuen Bengel gesagt. Pauly.«
»Was hat er gemacht?«
»Wieder angefangen zu heulen.«
Ich werfe einen Blick über die Schulter rüber zu Felix. Er ist ein großer Kerl, eins neunzig, ziemlich muskulös. Schwarze Haut und intensiv blickende Augen. Mag kitschige Romane aus der Gefängnisbibliothek. Gerade liegt er auf seiner Pritsche und hält ein rosa-oranges Buch in der Hand, ich kann aber nur die nackte Brust eines Typen, der einem Piraten ähnelt, auf dem Cover erkennen.
»Nur damit ich’s richtig verstehe: Du glaubst, dass sich Leo mit seiner fehlenden Akzeptanz Magengeschwüre und Wahnvorstellungen eingehandelt hat?«
»Sicher. Du musst im Strom mitschwimmen, Mann. Das Leben leben wie ein Zenmönch, die Wichser machen sich keinen Stress über nix. So bricht dich der Knast. Du behältst die Hoffnung, das killt dich am Ende. Du musst kapieren, dass das von nun an dein Leben ist. Du musst den Scheiß in deiner Seele akzeptieren. Dann ist alles in Butter.«
»Niemand sagt mehr alles in Butter, Felix«, murmele ich und drehe mich wieder zur Zellentür.
»Ich schon.«
Fakt ist, ich gebe ihm tatsächlich recht. Auch wenn ich von Zeit zu Zeit strauchle, hauptsächlich wegen der Langeweile von all dem Ganzen, hab ich mich doch vor Langem damit abgefunden, dass es das ist. Dass mein Leben vorbei ist.
Nicht dass es mir was ausmacht. Mein Leben war vorbei, bevor ich geschnappt wurde.
Aber was Felix über die Hoffnung sagt, ist wahr. Selbst diejenigen, die einen Grund zum Leben mitbringen, verlieren am Ende. Vielleicht pinnen sie ein Foto von ihrer Freundin an die Wand oder Zeichnungen von den Kindern. Geburtstagskarten, solche Sachen, alles erst mal Zeichen der Hoffnung. Hoffnung, dass sie immer noch ein Leben da draußen haben, dass sie eines Tages rauskommen. Aber wenn die Monate voranschreiten, gewinnt die Verzweiflung die Oberhand. Du kannst die Hoffnung nicht am Leben erhalten, ohne etwas dafür zurückzuzahlen. Du kannst deinem Verstand nur eine Weile lang etwas vorgaukeln, dann wendet er sich gegen dich.
Am besten ist einem alles einerlei. Oder irgendwer. Hat man nichts zu verlieren.
»Durchzählen!«
Ich lehne mich zurück, als ein heftiges Kurbelgeräusch durch den Trakt hallt, gefolgt von dem metallischen Knallen, als sich zweiundvierzig Türen öffnen.
Ich trete aus der Zelle und schaue dabei nach rechts und links. Ein Reflex. Es ist die perfekte Gelegenheit für einen Angriff, weil niemand es erwartet.
Alles safe, nur gähnende Häftlinge, die sich am Sack kratzen, als sie auf den metallenen Gitterrost treten, während Teil eins des täglichen Ablaufs beginnt. Das erste Zeitsegment in der niemals endenden Spirale, die in den Wahnsinn führt oder zum Tod – was immer auch zuerst kommt.
»Du hast die letzte Nacht geschnarcht«, sagt Felix, als er mir auf den Gang folgt.
»Ich schnarche nicht.«
»Verflucht, und ob du schnarchst! Wie ein Güterzug. Ernsthaft. Du musst zu ’nem Arzt oder irgendwas, denn sonst werd ich dich höchstwahrscheinlich irgendwann erwürgen, wenn du so weitermachst.«
»Was auch immer.« Ich unterdrücke ein Gähnen. Ich bin erschöpft, das ist jeder. Der Sturm, der seit zwei Tagen auf Florida einprügelt, hört sich an, als würde er stärker werden. Der tosende Wind sorgt für ein konstantes Heulen und Kreischen, das man selbst durch die dicken Gefängnismauern hört. Es treibt alle in den Wahnsinn, hält jeden nachts wach.
Heute habe ich deshalb verschlafen, normalerweise bin ich vor fünf auf den Beinen. Das ist die ruhigste Zeit im Knast. Selbst die Verrückten, die die ganze Zeit wach bleiben und rumschreien und weinen, dämmern in der Regel nach vier weg. Dann genieße ich die wenigen Momente der Entspannung, bevor mich die Gefängnisroutine dazu zwingt, den Tag in immer kleinere Zeitbröckchen einzuteilen.
Das erste Bröckchen startet mit dem Appell um Viertel nach sechs. Jeder Häftling muss sich aus seiner Zelle bequemen und davor warten, während die Vollzugsbeamten – die Correction Officers oder kurz COs – die vollständige Anwesenheit überprüfen. Wenn jemand verschläft oder zu spät zum Appell erscheint, beginnt der ganze Prozess von vorn, schön bei Nummer eins. Und du willst wirklich nicht der Typ sein, der den Zählappell verzögert. Denn das bedeutet ein verspätetes und hektisches Frühstück, und einige Häftlinge schätzen diese Art von Veränderung in ihrem Tagesablauf überhaupt nicht.
Nicht dass das Frühstück etwas wäre, worauf man sich freuen könnte. Für gewöhnlich gibt’s Haferflocken, manchmal mit Erdnussbutter oder vielleicht auch mal Honig, dann fühle ich mich schon wie im Paradies. Aber das war’s. Von den Eiern werde ich krank, und alles andere schmeckt wie Pappe.
Arbeit beginnt um acht, aber nicht jeder hat ’nen Job. Du musst beweisen, dass du’s wert bist, musst ein Vorzeigegefangener sein, etwas, was ich die meiste Zeit bin, indem ich mich einzig um meinen Kram kümmere. Und glaub mir, das ist nicht leicht, wenn du ’n Ex-Bulle bist. Jeder Mitknacki will ein Stück von dir. Jeder CO will dir das Leben zur Hölle machen.
Ich arbeite mit Henry in der Wartungshalle. Er ist einer der älteren Typen, die noch alles reparieren können, und es ist seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Gerätschaften und Maschinen im Gefängnis laufen. Ein Fulltime-Job in einem Drecksloch wie diesem hier.
Ich verdiene siebzig Dollar im Monat, fast das Doppelte des durchschnittlichen Einkommens der anderen Häftlinge. So kann ich mich meinen Lastern hingeben, Schokolade und Kaffee, was ich beides im Gefängnisladen kaufen kann. Der Kaffee ist allerdings scheiße, Instantmist, nicht mal Granulat, sondern nur ein fein gemahlenes Pulver. Ich glaub, da ist nicht mal Koffein drin. Man könnte das Zeug mit heißem Wasser verrühren und sich direkt in die Augäpfel injizieren, selbst dann täte sich nichts.
Nach dem Mittagessen hänge ich im Gefängnishof ab, nur um die Sonne auf dem Gesicht zu spüren. Früher habe ich es geliebt, an den Strand zu gehen, bin dort jedes Wochenende mit Amy hin. Wir wohnten nicht weit entfernt und konnten sogar das Salz in der Luft schmecken, wenn der Wind aus der richtigen Richtung wehte.
Hier jedoch nicht. Wenn ich auf dem Hof bin, ist das Einzige, was ich riechen kann, der üble Chemiegestank aus der Wäscherei. Der Dampf aus den Lüftungsschächten heizt die Feuchtigkeit noch weiter auf, die auf der Haut klebt wie ’ne Ölschicht.
Danach geht’s bis fünf Uhr zurück zur Arbeit, Abendessen in der Messe, dann Freizeit, recreation time, in der wir Pool spielen, fernsehen, quatschen, Karten spielen oder im Gemeinschaftsareal unter dem Zellenbereich telefonieren dürfen.
Um acht Uhr steht der letzte Zählappell an, dann Bettruhe.
Ich lehne mich übers Geländer und entdecke zwei Wärter, die Wischmopps und Eimer an einige Typen aus den tiefer gelegenen Zellen ausgeben.
»Die Krankenstation ist überflutet«, erzählt Nick, der Typ aus der Zelle gegenüber. »Steht alles dreißig Zentimeter unter Wasser.«
»Und sie versuchen es mit ’n paar Wischmopps?«, frage ich. »Wird ziemlich viel bringen.«
Nick zuckt mit den Schultern. »Hab gehört, der Sturm wird richtig übel.«
»Ja?«
»Hab gestern Nachrichten geguckt.«
»Und was sagten sie?«
»Dass der Sturm richtig übel wird«, antwortet Nick.
Ich warte, aber er scheint nicht vorzuhaben, dem noch was hinzuzufügen. »Und?«
»Und nichts. Ein CO hat den Fernseher ausgestellt, bevor der Bericht zu Ende war.«
»War Freizeit zu Ende?«, fragt Felix.
»Nope.« Nick tippt sich an die Nase. »Kontrollier den Informationsfluss. Verstehst du, was ich sage?«
Ich versuche nicht mal, ein Seufzen zu unterdrücken. Nick ist davon überzeugt, dass jeder Angehörige der staatlichen Autoritäten in eine Art Verschwörung involviert ist, die sich insbesondere direkt gegen ihn richtet.
»Da brauch ich nicht die Nachrichten für, um zu sagen, dass der Sturm übel wird«, sagt Felix. »Hast du’s letzte Nacht gehört? Diesen Wind? Jesus, ich dachte, das ganze Gebäude stürzt über unseren Köpfen zusammen.«
Ein lauter Knall hallt durch den Flügel. Ich sehe nach rechts, wo Evans oben an den Metallstufen steht, den Schlagstock erhoben, um damit ein zweites Mal auf das Geländer einzudreschen.
Typisch, war klar, dass er Schicht haben musste, genau dann, wenn ich müde bin und nicht in der Stimmung für seinen Scheiß. Ich hasse Evans, ernsthaft, und damit meine ich nicht, dass er mich reizt oder ärgert. Es geht tiefer. Ich verachte alles an ihm. Sein Gesicht, wie er atmet, das kleine Zucken in seinem Augenlid, wenn er versucht, Gefangene einzuschüchtern. Er ist ein tyrannischer Rüpel, so einfach ist das. Ein Rüpel, der es in eine Position geschafft hat, die ihm Macht verleiht.
Wäre ich ihm jemals draußen begegnet, hätte ich’s zu meiner Mission gemacht, ihn ins Gefängnis zu stecken. Vielleicht hätte ich ihn rausgewunken und etwas Kokain in seinem Auto »gefunden«, so viel, dass man ihn für Drogenhandel eingebuchtet hätte, nicht nur für Drogenbesitz.
Die meisten anderen Wärter sind okay. Sie kommen zur Arbeit, machen ihren Job, fahren nach Hause. Aber Evans … schon vom ersten Augenblick an wusste ich, dass er auf der anderen Seite der Gitterstäbe sitzen sollte. Ich habe Mörder gesehen. Ich habe Vergewaltiger gesehen. Da ist immer etwas in ihrem Blick. Evans hat diesen Blick.
Und er mag mich nicht, weil … Nun, ich bin mir nicht sicher. Ich vermute, weil ich nicht klein beigebe und seine Spielchen nicht mitspiele. Wieso sollte ich? Ich bin kein Krimineller mit typischer Karriere, sehe mich nicht als Mörder. Okay, ich hab jemanden getötet, aber jemanden zu töten, der deine Frau getötet hat, das ist kein Mord, sondern Vergeltung. Gerechtigkeit. Abgesehen davon bin ich ein ganz normaler Typ, der zwei Jahre verheiratet war, eine Familie gründen wollte. Meine Frau war Krankenschwester, ich war ein Cop, der zur Armee ging und dann wieder als Cop gearbeitet hat, als die Militärzeit um war. Das war’s. Nichts Interessantes, nichts Spektakuläres.
Bis zu jener Nacht.
Evans kann mich nicht einschätzen, und das nervt ihn. Er setzt mich unter Druck und versucht, eine Reaktion zu provozieren. Ich glaube, das lässt ihn morgens aufstehen, der Wunsch, mich zu brechen.
Ich beobachte ihn, wie er den Gang entlanggeht. Er bewegt sich langsam, mit schaukelndem Schritt, der von einer alten Beinverletzung herrühren könnte. Er passt den Appell gern einem gewissen Rhythmus an. Linkes Bein nach vorn, klick, rechtes Bein, klick. Er hasst es, wenn irgendwer diesen Rhythmus unterbricht.
Niemand spricht, als er durchzählt. Auf dem Gang gegenüber tut Martinez es ihm gleich. Sie ist stets vor Evans fertig, der jeden Häftling anstarrt, bis der wegguckt. Manchmal geht das schnell, manchmal auch nicht.
Ich schaue stur geradeaus. Evans Gesicht kommt in mein Blickfeld, seine glasigen Augen starren direkt in meine. Ein Schweißfilm bedeckt sein Gesicht. Klar, hier ist es so feucht wie in Satans Arschritze, aber Evans schwitzt unabhängig vom Wetter. Er wirkt immer speckig, so wie altes Speiseöl.
Er wartet darauf, dass ich wegschaue. Oder besser noch nach unten, als Zeichen der totalen Unterwerfung. Träum weiter, Fickfresse! Ich schau weiter exakt geradeaus, ich zwinkere nicht ein einziges Mal.
Wir stehen so für einen sehr langen Moment, keiner von uns dazu bereit nachzugeben. Nick erkennt, wohin das führen wird, und versucht es abzuwenden.
»Hey, Evans«, fragt er, »hat irgendwer draußen ein Wort über den Sturm verloren?«
Evans nutzt die Gelegenheit zum ehrenvollen Rückzug und widmet seine Aufmerksamkeit Nick. »Das Wort lautet: Kümmer dich um deinen Kram!«
Er geht weiter, klickend.
»Das ist kein Wort«, erwidert Nick. »Das sind sechs … nein, warte, fünf Wörter! Das sind fünf Wörter, Evans! Fünf!«
Nach dem Appell dürfen wir in den Aufenthaltsraum, ein extravaganter – und völlig unpassender – Begriff für das ungleichmäßig geformte Eckchen an freier Fläche außerhalb der Zellen. Das wäre in etwa so, ein schäbiges Motel in irgendeinem Kaff Alabamas als Fünf-Sterne-Luxusresort zu bezeichnen.
Wie immer hetzt alles wie verrückt zu den Telefonen. Sie sind jedermanns Lebensader, die Verbindung zu der Welt da draußen. Ich weiß nicht, warum sie sich die Mühe machen – sieben von zehn Telefonaten enden damit, dass der Häftling den Hörer völlig frustriert auf die Gabel knallt.
Tja, so sieht die Sache aus. Im Knast zu sein sorgt dafür, dass sich jeder wieder mental auf das Niveau eines Teenagers zurückentwickelt. Nichts steht mehr im Verhältnis. Deine ganze Welt – dein ganzes Universum – verkleinert sich auf die Größe einer Highschool, nur mit Mördern und Gangs statt Cliquen von Cheerleadern und Sportskanonen. Eine empfundene Kränkung wird zu einer tödlichen Beleidigung. Einmal schief gucken ist Grund genug, dass jemand dich angreift. So verändert sich deine Sichtweise, wenn du drinnen bist.
Aber diese Veränderung wirkt sich auch auf deine Verbindungen zu der Welt da draußen aus. Du wirst paranoid, und die kleinste Pause am anderen Ende der Leitung, das leichteste Zögern macht dich wütend. Denn jeder einzelne Häftling, der immer noch in einer Beziehung ist, hat nur zwei Sachen im Kopf: Wann wird sie mich verlassen? Und: Mit wem betrügt sie mich? Es kann die stärkste, liebevollste Beziehung da draußen gewesen sein, Verliebte seit Kindheitstagen, die erste, mit der du Sex hattest, was auch immer. Das alles zerbröselt zu Angst und Unsicherheit, und zwar in dem Moment, in dem sich die Gefängnistore hinter dir schließen.
Es gibt sechs am Boden verschraubte, sechseckige Tische, die bereits besetzt sind. Kartenspiele werden gezückt, Lebensmittel aus dem Gefängnisladen wechseln den Besitzer, um Schulden zu begleichen. Wie bei allem im Knast gibt es eine Hackordnung. Niemand wagt es, sich irgendwo hinzufläzen, bis Leon, der Traktboss, sich entschieden hat, wo er Platz zu nehmen wünscht. Dann pflanzen sich seine Leutnants und Leibwächter um ihn, und erst danach werden die restlichen Tische belegt. Diejenigen, die gegenwärtig in Leons Gunst stehen, nehmen die ihm nächstgelegenen und überlassen die unpopulären Tische nahe der Tür den übrigen Insassen.
Mich kümmert dieser Scheiß nicht. Ich schreite den Block ab, Runde für Runde. Das hat zwei Vorteile. Es hält mich fit und gesund, und die anderen bleiben mir gegenüber misstrauisch. Alles, was vom Gewöhnlichen abweicht, sticht hervor, was man entweder zu seinem Vorteil nutzen kann oder vermieden werden muss. Runde um Runde zu marschieren, manchmal sogar zu joggen, je nachdem, wie viel nervöse Energie sich angestaut hat, dabei mit niemandem reden – aus irgendeinem Grund stempelt mich das als jemand ab, der nicht zu lesen ist. Unvorhersagbar.
Einige Häftlinge haben versucht, irgendeinen Scheiß mit mir anzufangen. Als ich neu hier war und sie spitzgekriegt haben, dass ich Cop war. Ich musste sie auf die Krankenstation schicken, einer von ihnen wäre fast an einer inneren Blutung krepiert. Einem anderen hab ich den Kiefer gebrochen, das Handgelenk und drei Rippen. Ich hatte allerdings keine Wahl, ich musste an ihnen ein Exempel statuieren. Wenn du das nicht machst, wenn du dich einfach nur rumschubsen lässt, läufst du hier mit einer großen Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und die Zielscheibe auf dem Rücken eines Cops wiederum ist verdammt groß, das kann ich dir sagen.
Ich hab noch nicht mal eine Runde im Trakt beendet, als mein Name über den Lautsprecher ausgerufen wird.
»Constantine, Manuel, Perez, Stevens, Deacon, Murphy, MacLeod, Felix und Nunes: aufstellen!«
Das erregt jedermanns Aufmerksamkeit. Jede Abweichung von der Routine ist interessant.
Wir stellen uns vor der Tür auf, die aus dem Block führt. Ein lautes Summen ertönt, und Evans tritt ein, stellt sich auf die Seite und hält die Tür halb offen. Ich frage nicht mal, was los ist, er würde sowieso nicht antworten.
Deacon ist derjenige, der das Wort ergreift. »Hey, Evans, was is los? Wir hatten noch nicht mal Frühstück.«
Evans starrt nur auf sein Clipboard.
»Komm schon, Mann«, sagt Deacon. »Ich hab niedrigen Blutzucker. Ich brauch was zu essen.«
Evans wirft ihm schließlich einen gelangweilten Blick zu. »Du wirst später gefüttert. Du hast Arbeit vor dir.«
»Was für Arbeit?«, fragt Nunes.
»Das alte Gefängnis saubermachen.«
»Das Glashaus? Zum Teufel, wozu?«
Das ist eine sehr gute Frage. Das Glashaus wurde vor dreißig Jahren eingemottet, ist total veraltet, ungefähr siebzig Jahre alt, schätze ich. Keine elektrischen Schließvorrichtungen, alle Zellen müssen mit Schlüssel geöffnet werden. Kaum Licht. Eng. Klaustrophobisch. Mehr Irrenhaus als Gefängnis.
»Warum werden wir bestraft?«, fragt Manuel.
»Du weißt schon, wo du bist?«, fragt Evans zurück. »Du stellst keine Fragen. Du tust, was dir verdammt noch mal gesagt wird.« Er zögert. »Aber ich erzähl dir, warum, aber nur, weil ich es dir erzählen will, verstehst du?« Er wartet, bis Manuel zum Zeichen des Einverständnisses nickt. »Einige der anderen Gefängnisse werden evakuiert wegen dem Hurrikan. Wir werden das Glashaus zur vorübergehenden Verbringung nutzen.«
Er dreht sich um und wendet sich den übrigen Häftlingen zu, die uns von ihren Stühlen aus beobachten. »Macht es euch nicht zu bequem. Ich werd die meisten von euch nach und nach rüberbringen. Arbeitsreicher Tag heute.«
Er wedelt mit dem Clipboard, und wir marschieren langsam aus dem Trakt.
WARNLAGEBERICHT
Amtliche Mitteilung Nr. 6 des NWS National Hurricane Center Miami FL
Betreff: Hurrikan Hannah
Samstag, 28. August 2021, 02:00 Uhr
ENTWICKLUNG DER WETTER- UND WARNLAGE
Tropensturm Hannah schwankt seit einigen Tagen zwischen der Kategorie 2 und 3, da sich die Eyewall am Auge ständig neu formiert. Der Hurrikan ist durch den Golf von Mexiko gezogen und in Johnson Bayou, Louisiana, auf Land getroffen. Sein Weg führt ihn weiter durch Alabama, mit Windgeschwindigkeiten von 190 Meilen pro Stunde (305 Stundenkilometer) beim Übertritt nach Georgia. Laut Prognose wird Hannah im Verlauf des 28. August von Kategorie 3 auf Kategorie 4 hochgestuft. Hannah wird zu Behinderungen bei den anlässlich Hurrikan Josephine eingeleiteten Evakuierungsmaßnahmen in den östlichen und südlichen Bundesstaaten führen, darunter auch Florida. Es wird empfohlen abzuwarten, bis Hannah auf den Atlantik trifft, bevor neuerlich der Versuch einer Evakuierung unternommen wird.
WARNUNG
Falls Evakuierung noch nicht abgeschlossen, bitte umgehend Schutz suchen.
Zwei
Freitag, 27. August
07:00 Uhr
Keira Sawyer sitzt auf einem harten Plastikstuhl und knetet nervös die Hände im Schoß, während sie dem Wüten des Sturms vor dem Bürofenster lauscht. Die Jalousien sind heruntergelassen. Sie weiß nicht, ob derjenige, wem auch immer das Büro gehört, lieber nichts vom Wetter draußen sehen möchte, oder ob er einfach noch nicht startklar für den Tag ist.
Es war ein Fehler herzukommen, das weiß sie nun. Teufel, sie wusste es bereits an diesem Morgen, als sie durch überflutete Straßen gefahren ist, vorbei an Verkehrslawinen, die alle in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren. Dumm. Gefährlich. Verrückt.
Aber was sonst hätte sie tun sollen?
Die Tür wird abrupt geöffnet, und eine kleine Frau in Wärteruniform tritt ein. Sie hält ein Clipboard in der Hand und wirkt sowohl gestresst als auch genervt. Ein Eindruck, der sich noch verstärkt, als sie Sawyer im Büro sitzen sieht.
»Ich hab gedacht, er veräppelt mich.«
Sawyer zögert. »Wer?«
»Wilson. Er hat gemeint, die Neue wäre da. Ich hab gesagt, sein Sie doch nicht irre, niemand ist dumm genug, an seinem ersten Tag während eines Hurrikans zu kommen. Und dennoch bist du hier.«
Sawyer lässt die Beleidigung an sich abprallen, die Frau hat ja auch nicht ganz unrecht. »Ich … dachte nicht, dass ich die Wahl hätte. Ich meine, es hat mir niemand gesagt, dass ich nicht erscheinen soll.«
»Du musst den Job wirklich brauchen.«
Sawyer nickt. »Das tue ich.«
Die Vollzugsbeamtin seufzt. »Schön, ich bin Martinez. Sieht so aus, als wäre ich heute deine Fremdenführerin. Los geht’s.«
Als Sawyer aufsteht, wird sie von Martinez von oben bis unten gemustert. Etwas, das sie an »der Neuen« sieht, macht Martinez scheinbar noch unglücklicher. »Was wiegst du, fünfundfünfzig Kilo?«
»Knapp achtundfünfzig. Warum?«
»Größe?«
»Eins siebzig.«
»Jesus, die werden dich bei lebendigem Leib fressen.«
Sawyer reckt sich, und es wirkt ein klein wenig, als wollte sie sich verteidigen. »Ich bin taffer, als ich aussehe.« Sofort bereut sie, dass sie das gesagt hat. Selbst in ihren eigenen Ohren klingt es kindisch.
»Um deinetwegen, Honey, wünsche ich’s mir, ehrlich. Los, gehen wir.«
Sie folgt Martinez aus dem Büro in den dahinterliegenden Korridor. Er ist leer, erhellt von grellen Leuchtern, die in die Decke eingelassen sind.





























