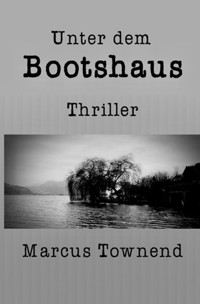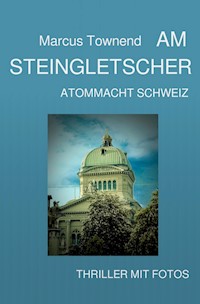
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Am 2. November 1992 flogen über 800 Tonnen Munition und Sprengstoff in die Luft. Die Detonation zerstörte die Kaverne, den Eingangsbereich sowie den Munitionssprengplatz und hinterliess ein riesiges Trümmerfeld. Sechs Menschen fanden dabei den Tod. Was war die Ursache? Inspiriert von zwei tatsächlichen Ereignissen – die Verhaftung eines ranghohen Schweizer Militärs im August 1976 (Teil I) und die Explosion am Steingletscher (Teil II) – entwickelt der Autor, zusammen mit seinen beiden Helden, einem Schweizer Nachrichtenoffizier und seinem Niederländischen Freund, eine atemberaubende Geschichte, bei der alles frei erfunden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AM STEINGLETSCHER
ATOMMACHT SCHWEIZ
Thriller mit Fotos
MARCUS TOWNEND
Zweite, überarbeitete Auflage, mit Fotos
Impressum
Alle Rechte vorbehalten
Erstdruck 2019
Zweite Auflage 2021
Texte und Fotos: Marcus Townend
Sagenriedli 1
CH-6062 Wilen
Lektorat: Cordula Blättler
Korrektorat und Lektorat: Marin Eberli
Titelbild: Marcus Townend
Umschlagsgestaltung: Margrit Naef
Druck und Vertrieb: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Link: www.townend.ch
Teil I handelt im Jahre 1976
Teil II handelt im Jahre 1992
«Wie kann ein gläubiger Mensch den Einsatz von Kernwaffen in Erwägung ziehen?»
Pirmin König, Kollegischüler
«Stellt sich irgend jemand tatsächlich vor, Besitzer von nuklearen Waffen würden in einer Notsituation auf deren Einsatz verzichten?»
Hendrik Dorpeind, Kollegischüler
Grundsatzerklärung des Bundesrats
vom 11. Juli 1958:
«In Übereinstimmung mit unserer jahrhundertealten Tradition der Wehrhaftigkeit ist der Bundesrat deshalb der Ansicht, dass der Armee zur Bewahrung der Unabhängigkeit und zum Schutze unserer Neutralität die wirksamsten Waffen gegeben werden müssen. Dazu gehören Atomwaffen.»
Elf Jahre später unterzeichnet die Schweiz einen internationalen Vertrag, der den Besitz und die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen verbietet.
Kapitel 1
Montag, 16. August
Um ein Uhr früh drangen drei ausländische Militärmaschinen in den schweizerischen Luftraum ein. Es handelte sich um Transportflugzeuge des Typs Antonow Antäus An-22 Antei, Codename der Nato «Cock», den grössten Flugzeugen, die es auf der ganzen Welt gab. Auf Höhe des Bodensees wurden sie von einem Zweierverband des Überwachungsgeschwaders der Schweizer Luftwaffe empfangen.
Sonntag, 15. August, 09.30 Uhr
Sechzehn Stunden zuvor war der Politiker als erster im Gebäude der Talstation eingetroffen. Der Angestellte am Fahrkartenschalter nahm ihn sofort wahr, da jener von kleiner Statur war und seine Sonnenbrille aufhatte, obwohl es hier drinnen dunkler war wie draussen. Um die 30 Jahre alt, schätzte der Mann am Schalter seinen Kunden, etwa einen Meter und 60 Zentimeter gross, schlank, glattrasiert, blond, Föhnfrisur mit Seitenscheitel, hellbraune Hose mit Bügelfalte, ein kurzärmeliges weisses Polohemd, in seiner linken Hand eine beige Schiebermütze, Fassputzer genannt, dazu teure braune Halbschuhe. Was will denn der dort oben auf dem Berg mit diesen Schuhen, schüttelte der Angestellte innerlich den Kopf. Der Fahrgast trat zu ihm an den Schalter und legte seine Mütze auf die Theke. Dem Schalterbeamten fiel ein Ring aus Weissgold mit einem grossen Achat-Siegelstein auf. Um was für ein Siegel es sich handelte, konnte er nicht erkennen, denn der Edelstein war dunkel. Der Fahrgast bat um eine Fahrkarte und während er seine Sonnenbrille abnahm, um das Kleingeld besser zu bestimmen, sah der Beamte seine Augen: Sie waren dunkel, fast schwarz, wie der Achat in seinem Ring. Er überreichte ihm eine Fahrkarte, Hin und zurück.
Der nächste Fahrgast, der in die schlecht beleuchtete Schalterhalle trat, überragte die Mitglieder einer Wandergruppe, welche sich dem aufgehängten Fahrplan gegenüber widmeten um mindestens einen Kopf. Er trug hellbraune wadenlange Wanderhosen, sogenannte Knickerbockerhosen, rote Wollsocken, schwarz eingefettete genagelte Ordonnanzschuhe, ein rotweiss kariertes Hemd sowie einen Militärrucksack und keine Kopfbedeckung. Kräftiger Körperbau, glattrasiert, dichte, braune Haare kurz und kantig geschnitten sowie ein massives Kinn, beobachtete der Schalterangestellte: eine steife Haltung und ein strenger, abschätzender Blick – ein Militärgrind, schloss er in Gedanken seine Klassifizierung und überreichte seinem Gast eine Fahrkarte, diesmal nur für die einfache Fahrt. Der Mann am Schalter hatte gut kombiniert. Der 36-jährige Fahrgast hatte nach seinem Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH die militärische Laufbahn eingeschlagen, weil er Klarheit, Ordnung und Sicherheit suchte. Dank seiner Auffassungsgabe, die es ihm ermöglichte, mehrschichtige Strategien und komplexe taktische Manöver in kurzer Zeit zu erfassen, und mit seinem präzisen Gedächtnis machte er schnell Karriere. Er bekleidete den Rang eines Obersten.
Es gab keinerlei Anzeichen, dass die beiden Kunden etwas miteinander zu tun hatten. Deshalb runzelte der Schalterbeamte erstaunt seine Stirne, als er sah, wie sich die beiden Herren anschickten, gemeinsam einen Sessellift zu ergattern. Die Wandergruppe hatte sich auf die Zweiersessel verteilt, als der letzte aus der Gruppe den Politiker einlud, mit ihm einen Sessel zu teilen. Dieser stellte seinen Kopf leicht schräg und sagte lächelnd, mit leiser Stimme und in höflichem Ton: «Das ist sehr nett von Ihnen, aber gehen Sie ruhig voraus» und stieg, zusammen mit dem gross gewachsenen Mann auf den nächsten Sitzplatz. Hinter ihnen setzten sich zwei Ausländer auf den folgenden Sessel. Bedruckte T-Shirts, helle Baseballkappen und Jeans. Der jüngere trug Turnschuhe, der ältere schwarze Halbschuhe – amerikanische Touristen, meinte der Fahrkartenverkäufer. Doch diesmal lag er falsch.
Du Schleimer, dachte der grosse Mann, und auf seinem Gaumen realisierte er einen säuerlichen Geschmack. Er mochte sie nicht, diese Politiker, diese Windfahnen, die sich vor keinem Trug, keinem Lug zu scheuen schienen, solange sie nur wiedergewählt würden. Der Sessel setzte sich mit einem Ruck in Bewegung und sie schwebten langsam den Hang hinauf. Diese leise, belehrende Stimme, diese eindringliche Art zu sprechen, diese unterwürfige Kopfhaltung, dachte er weiter mit einem Seitenblick auf den Politiker. Sie hatten sich mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfnicken begrüsst, doch niemandem wäre es in den Sinn gekommen, die beiden ungleichen Männer hätten etwas miteinander zu tun. Es war ein warmer Vormittag und im Verlauf des Tages würde die Temperatur bis auf 30 Grad steigen, sodass ein Ausflug in die Berge kühl und angenehm sein würde. Die Kühe grasten im Schatten. Es roch nach feuchtem Gras, frischen Kräutern und Kuhmist. Sie schwiegen und beobachteten, jeder auf seiner Seite die weidenden Kühe unter ihnen, welche sich von den leise rauschenden Sesseln nicht beeindrucken liessen. Der Politiker stammte aus bescheidenen, bürgerlichen Verhältnissen. Am Gymnasium hatte er versichert, er werde später einmal in die Landesregierung, zum Bundesrat gewählt. Doch dies alleine war es nicht, was ihn immer wieder dazu angetrieben hatte, Höchstleistungen zu erbringen und Leute kennenzulernen, welche ihm einmal in irgendeiner Weise dienlich werden könnten. Nein, er wollte höher hinaus. Er beabsichtigte ein aussergewöhnlicher Volksvertreter zu werden. Jemand der Geschichte schrieb. Und das würde ihm, als Initiator und Leiter der geheimen Wehrgemeinschaft 91 gelingen. Er hatte den abschätzigen Gesichtsausdruck des Militärs neben ihm bemerkt. Du selbstherrlicher Wicht!, aufgewachsen in einer hoch wohlgeborenen Patrizierfamilie, musstest nichts machen für deine Karriere, hattest überall deine Steigbügelhalter, gell ...! Und mit solchen Arschgeigen muss ich mich abgeben, um meine Ziele zu erreichen, überlegte er weiter und vergass dabei, dass er für seine Wähler arbeitete und nicht für sich selbst. Oberst von Boltigen war der Spross einer Familie, die vor rund achthundert Jahren zum Edelherrenstand gehört hatte, die nach einigen Jahrhunderten zum patrizischen Stadtadel herabgestiegen war.
Die Fahrt verlief ruhig, man hörte die Glocken der Kühe unter ihnen und von oben das leise und gleichmässige Reiben der Seilrollen. Der Offizier dachte an seinen Sohn, der in einigen Tagen den Kindergarten besuchen und ihm sicher viel zu erzählen haben würde. Du willst, dass ich das Gespräch beginne und dir die offensichtliche Frage stelle. Spielen wir dieses Machtspielchen, dachte der Politiker und fragte: «Wann kommt die Lieferung?»
Der Offizier wandte sich dem Jüngeren, den er nie mit Namen begrüsste, zu und dachte: Immer diese saublöde Sonnenbrille! Er schaute seinen Nachbarn lange an, wie wenn er nach Worten suchen müsste. Dabei stellte er sich vor, wie er diese Wurst von einem Streber mit einem lauten «Pfui» vom Sessel weg in die Tiefe blasen würde. Dieser hielt seinem Blick stand und wartete geduldig auf den Bericht des Älteren. Auf der Wiese begann eine Kuh eine andere Kuh zu besteigen. Der Berufsoffizier schaute nach unten und beobachtete die Wiederkäuer, wie sie ihre Münder langsam und kreisförmig bewegten und das würzige Gras kauten. Er dachte an den feinen Alpkäse, den er sich auf dem Berg mit einem Glas Weisswein genehmigen würde und seine Laune besserte sich.
«Heute Nacht», kam die knappe Antwort des Offiziers. «Ich werde dabei sein». Sein Nachbar machte keine Anstalten, weiter zu fragen. Er fuhr, ohne emotionale Regung, fort: «Um 01 Uhr in der Früh› – 20 atomare Artilleriegranaten, vier Atombomben für unsere Mirages, zwei Atomminen sowie sechs nuklear bestückte Flugkörper, also bodengestützte Missiles, werden es sein.» Heinrich von Boltigen war ein ernster Mann. Er vermochte es nicht, nachzuvollziehen, dass es Wissenschaftler gab, die den beiden Atombomben, welche über Japan abgeworfen worden waren, Kosenamen wie «Little Boy» oder «Fat Man» gegeben hatten.
Der Politiker wusste, dass der Offizier eben von taktischen Gefechtsfeldwaffen gesprochen hatte. Diese wurden zur Bekämpfung gegnerischer Streitkräfte nahe an den eigenen Positionen eingesetzt. Im Arbeitsausschuss (AA) 1 Nuklearpolitik der Landesregierung war der Einsatz dieser Kriegswerkzeuge lange diskutiert und letztlich verworfen worden. Der Politiker ärgerte sich darüber, dass wiederum er das Gespräch wiederaufnehmen musste: «Und Strategic Nuclear Weapons?»
Deutlicher hatte der Arbeitsausschuss den Eigenbau sowie den Einsatz von strategischen Waffen abgelehnt. Strategische Kernwaffen hatten eine viel höhere Sprengkraft als operativ-taktische. Sie wurden nicht auf dem heimischen Gefechtsfeld eingesetzt, sondern zur Zerstörung von ganzen Städten und Regionen im gegnerischen Hinterland. Der Offizier zögerte lange, denn nun folgte der heikelste Teil ihrer streng geheimen Unterhaltung. Am ersten Juli 1968 hatte die Sowjetunion, zusammen mit den USA, Frankreich und Grossbritannien einen Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Darin wurde vereinbart, keine Atomwaffen zu verbreiten. Die Schweiz unterschrieb wenig später, hatte den Vertrag jedoch noch nicht in Kraft gesetzt. Sie hatten, nach Ansicht des Politikers nicht mehr viel Zeit, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.
«Ja, zwei Cruise-Missiles, zwei Mittelstreckenraketen mit bereits montierten atomaren Sprengköpfen also», antwortete er nachdenklich. Damit konnten Ziele in mehreren hundert Kilometern Entfernung zerstört werden. «Die Sowjets wollen uns nicht mehr geben», fügte er deshalb hinzu. Für ihn war der Besitz von nuklearen Waffen ein wirksames Mittel, andere Staaten von einem Überfall auf die Schweiz abzuhalten. Der beste Schutz überhaupt! Niemand würde einen Angriff wagen, weder mit nuklearen, chemischen, biologischen noch mit konventionellen Waffen, weil sie dann mit einem atomaren Rückschlag rechnen mussten! Dafür würden keine offiziellen Erklärungen, keine öffentlichen Begründungen, keine medialen Beiträge nötig sein. Es würde genügen, vor einem drohenden Ernstfall, wirklichen und potentiellen Feinden gegenüber durchsickern zu lassen, dass sie, die Schweiz im Besitz von nuklearen Waffen waren. Oberst Heinrich von Boltigen blickte zu seinem Nachbarn. Er sah, wie dessen dunkle Augen leuchteten und seine dünnen Lippen ein Lächeln andeuteten.
«Ich gratuliere Ihnen», sagte der Jüngere nach einer Weile, doch der Offizier hatte seinen Kopf angewidert abgewandt. Obwohl er bald zum Oberkommandierenden der Artillerie befördert würde und somit die nuklearen Sprengsätze gegen einen allfälligen Angreifer einsetzen konnte und obwohl er sich in den Ausschüssen stets mit Nachdruck für die atomare Option eingesetzt hatte, missfiel ihm das kaum verborgene Vergnügen dieses Zivilisten. Die Vorstellung, dieser machtgierige Arbeitersohn könnte es einmal so weit bringen, dass er über den Einsatz der eben eingetroffenen Waffen entscheiden durfte, missfiel ihm ausserordentlich. Wahrscheinlich wollte dieser Atomwaffen letztlich nur, um sein miserables Ego zu kompensieren! Nicht zuletzt deshalb würde er sich gegebenenfalls beim Bundesrat dafür einsetzen, dass die Entscheidungsgewalt über den Einsatz von taktischen und strategischen Kernwaffen einzig und alleine bei den nüchtern denkenden und sachlich planenden Militärs lag.
«Was ist mit unserem welschen Brigadier?», nahm der Zivilist die Unterhaltung wieder auf.
«Er wird morgen von der Bildfläche verschwinden.»
«Muss dies sein?», fragte der andere und schaute ihn von unten mit geheuchelter Sorge an.
«Ja, die Amerikaner haben ihn auf ihrem Radar.»
«Wie wird Bern vorgehen?», fragte der Politiker nach einer Weile.
«Der Verteidigungsminister wird die Verhaftung anordnen, der Bundespräsident wird am gleichen Tag vor die Medien treten.»
«Wird er dichthalten?»
«Natürlich», bellte Oberst von Boltigen seinen Nachbarn an, aufgebracht durch diese harmlos scheinenden, hinterlistigen Fragen. «Er ist Offizier!» Nach einer Weile ergänzte er: «Und ein guter Patriot!»
Nun hat der vornehme Offizier doch seine Contenance verloren, schmunzelte der Politiker innerlich, ohne eine Miene zu verziehen. Dann wurde sein Gesichtsausdruck hart: Dass er es war, der den Amerikanern einen Tipp gegeben hatte, verriet er ihm nicht. Nur so würde der Brigadier ihrem Anliegen nicht schaden können. Im Gefängnis würden ihn die Amerikaner nie befragen können. Denn über die Lieferung durfte niemand, vor allem die Amis, je etwas erfahren. Er strich sich mit dem linken Zeigefinger durch die Brauen seines linken Auges und setzte sich seine Schiebermütze auf den Kopf.
Die beiden hatten sich an einer militärischen Veranstaltung kennen gelernt. Heinrich von Boltigen war damals Major der Artillerie, einer Truppengattung der Schweizer Streitkräfte, die Geschütze mit grossen Rohren sowie Raketen einsetzt. Der Berufsoffizier hatte eine kluge Rede gehalten, in welcher er fundierte Kenntnisse über die aktuelle Bedrohungslage in und ausserhalb Europas gezeigt und mit eindrücklichen Argumenten für eine massive Aufrüstung der Schweizer Armee geworben hatte. Beim anschliessenden Aperitif hatte der Politiker ihn um ein vertrauliches Gespräch gebeten. An diesem verdeckten Treffen hatten sie über den Unfall im unterirdischen Versuchsatomkraftwerk Lucens anfangs 1969 gesprochen. Damals war, ihrer Meinung nach, die Gelegenheit verpasst worden, Plutonium zu produzieren. Plutonium war ein wichtiges Spaltmaterial für den Bau von Kernwaffen. Ebenso hatten beide die Unterzeichnung des internationalen Atomwaffensperrvertrags im gleichen Jahr bedauert. Hierauf hatte ihm der Politiker seine Idee, wie ihre Heimat trotzdem in den Besitz von Atomwaffen kommen könnte, eröffnet. Seit diesem Gespräch hatte der Oberst mehrere Kontakte zwischen militärischen Instanzen und dem Politiker geknüpft und an geheimen Treffen der Wehrgemeinschaft 91 teilgenommen. Ebenfalls war er es, der den welschen Brigadier rekrutiert und mit dem sowjetischen Militärattaché bekannt gemacht hatte.
Auf dem verbliebenen Teil ihrer Fahrt überwanden sie einige hundert Meter Höhendifferenz, als die Sesselbahn über eine steile Felswand hinaufkletterte. Auf diesem letzten Teil schwiegen beide. Als sie oben auf über 2’600 Metern angekommen waren, trennten sie sich, ohne sich voneinander zu verabschieden. Der Politiker blieb sitzen und fuhr mit der Sesselbahn wieder nach unten, um sich auf den Weg zu einem weiteren geheimen Treffen zu machen. Der Soldat hängte sich seinen Rucksack um und begab sich auf die kurze Wanderung in Richtung Bergrestaurant. Zwei Reihen hinter dem Politiker setzte sich der jüngere der beiden amerikanischen Touristen wieder auf einen Sessel, um nach unten zu fahren. Der andere folgte dem Oberst.
***
Zu dieser Zeit war die Holzterrasse, welche sich auf der Aussichtsseite des Restaurants befand, leer. Einige Tische waren gedeckt, bereit für rund ein Dutzend Wanderer oder Aussichtstouristen. Der Oberst setzte sich so, dass er einerseits die wunderbare Aussicht auf die Berge und die Alpweiden geniessen und mit einer kurzen Drehung seines Kopfes ein Auge auf die ankommenden Gäste richten konnte. Über seinen amerikanischen Schatten, der eben die Treppe zur Terrasse hochstieg, würde er sich nach dem Essen Gedanken machen. Die Kellnerin war gross, um die fünfzig Jahre alt und sie trug einen blonden Gretchenzopf. Ihr verschmitzter Gesichtsausdruck verriet ein frohes Wesen. Er bestellte einen Wurst-Käsesalat sowie eine Karaffe Weisswein aus dem La Côte. Er freute sich auf den Alpkäse, welcher aus der Milch der eben vom Sessellift aus gesehenen, weidenden Kühen hergestellt sein würde. Dann dachte er über die Lieferung von heute Nacht nach. Beide Männer, der Berufsoffizier wie der Politiker gehörten einer kleinen Gruppe von Patrioten an, die sich über die Umstände und die Folgen eines militärischen Angriffs auf die Schweiz, Gedanken machten. Diese geheime Gruppierung war davon überzeugt, der grösste Teil der Bevölkerung, aber auch viele Politiker und Militärs würden die drohenden Gefahren für die Schweiz nicht richtig einschätzen, ja nicht einmal wahrnehmen. Die Kellnerin stellte ihm ein Glas hin und schenkte ihm aus der Karaffe Wein ein. Er nahm einen Schluck und fragte sich: War es gut, was sie in dieser kleinen Gemeinschaft realisierten? War es richtig, was er tat? Diente er seiner Heimat? Der Offizier war sich der grossen Bedeutung und Verantwortung bewusst, die sie mit diesem Geschäft mit den Sowjets übernommen hatten. Und er stellte sich immer wieder Fragen zu seinem Tun: Durfte er als gläubiger Christ diese grauenhaften, menschen- und menschheitsvernichtenden Waffen erwerben? Was würde sein Vater davon halten, wenn er es wüsste, was würde er seinem Sohn einmal erzählen? Dass er ein Held sei? Oder bloss ein Krimineller? Vor einigen Monaten hatte er eine kleine Kirche besucht.
***
Ihr habt gehört, dass gesagt ist: «Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: …». Heinrich von Boltigen erkannte, dass er hier eine der wichtigsten Aussagen des Evangeliums aufgriff. Was Jesus in seiner Bergpredigt sagte, machte für ihn das Christentum aus. Das wusste er schon, als er sich in jungen Jahren mit dem Gedanken befasst hatte, Priester zu werden. Er sass auf der vordersten Bank und richtete seinen Blick auf die Statue von Jesus, dem Erlöser. Diese stand neben dem Altar und schien ihn anzuschauen. Sie waren allein. Doch der Offizier war nicht hierhergekommen, um in der Heiligen Schrift zu lesen. Er legte die Bibel geöffnet auf den Platz neben ihn. Er wollte beten. Ein Gespräch mit seinem Schöpfer führen. Er brauchte seinen Rat. Ehrfürchtig senkte er sein Haupt und richtete seinen Blick auf seine Hände. Er faltete sie und sprach, nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand ihn hören konnte: «Ich musste jemanden töten», begann er mit leiser Stimme. «Er wollte uns nicht helfen, beabsichtigte uns zu verraten. Unsere Arbeit, unsere Bemühungen für die Sicherheit unseres Volkes …, deines Volkes», fügte er nach einer Pause hinzu. Er schaute zum Altar. «Er war ein Kommunist, ein Ungläubiger! Und solche magst du auch nicht», heischte er um Zustimmung, doch gleichzeitig bemerkte er die Hybris, die Unangemessenheit seiner Bitte um Absolution und er senkte den Blick wieder auf seine Hände. Er kniete auf das Kniebrett und flüsterte: «Ich musste es tun. Für uns. Für die Zukunft meines Sohnes, für unsere Heimat, für dein Volk. Ich musste!» Er hob seinen Kopf, betrachtete lange das Triptychon hinter dem Altar. Dann schaute er zum Bild der heiligen Maria und schliesslich zu Jesus empor. Er fuhr fort, diesmal etwas lauter: «Du weisst, dass ich es mir nicht leichtmache. Ich werde ständig von Zweifeln hin- und hergerissen und von meinem Gewissen geplagt, kann oft nicht einschlafen. Soll ich weitermachen? Gib› mir ein Zeichen!»
Nach einer Weile der Stille seufzte er und setzte sich wieder auf die Bank. Er lobte den Herrn und schloss mit einem Gebet: « … denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!» Dann hob er nochmals den Blick zur Jesusstatue, um sich zu verabschieden. Jesus sah ihn nicht direkt an, sondern schaute an ihm vorbei. Heinrich von Boltigen drehte sich um und erkannte, worauf der Blick Jesu gerichtet schien. Von einer leichten Erregung gepackt erhob er sich und schritt um die Bänke herum, näher zu der Wandmalerei, welche in den Kalkputz einer Wand schräg hinter ihm aufgetragen war. Im Gegensatz zu den bunten Darstellungen des Triptychons hatte der Freskant hier ausschliesslich kalkechte graue, schwarze und weisse Pigmente benutzt. Im Vordergrund, in einer Art tiefen Schlucht, lag ein Berg von grossen und kleinen Totenschädeln und Skelette, wirr auf- und ineinander gestapelt, dazwischen Waffen, Kleidungsstücke und andere Habseligkeiten, die auf ärmere Menschen hinwiesen. Im Hintergrund und oberhalb der Knochen war ein steiler Felsenweg angedeutet, welcher in den Felsen gehauen aus dieser Schlucht zu führen schien. Zahlreiche vornehm gekleidete junge und ältere Frauen und Männer sowie Dutzende von Kindern, welche die Hände der Erwachsenen umschlungen hatten, kletterten nach oben. Die düstere Malerei wurde mit folgendem Satz in grossen Buchstaben betitelt: «Behüte uns oh Herr».
Bevor der Soldat sich von der eindringlichen Szene abwandte, fiel ihm etwas auf und so schritt er näher an das Fresko heran. Nach kurzer intensiver Betrachtung breitete sich auf seinem Gesicht ein Lächeln aus. Er hatte die Antwort. Er wandte sich um, zeichnete mit dem rechten Daumen ein Kreuz auf seine Brust und verabschiedete sich mit einem leichten Nicken von Jesus. Dann verliess er die Kapelle.
***
Die Kellnerin brachte einen mit verschiedenen Salaten und Hartkäse reich garnierten Wurstsalat sowie einen Korb mit einigen Brotscheiben, Maggigewürz, Salz und Pfeffer. Der Oberst lächelte, als er sich an das Fresko an der Kirchenwand erinnerte. Ihm war damals aufgefallen, dass die vielen Frauen und Kinder nur von wenigen Männern beschützt wurden. Er hatte sieben Männer gezählt, die bewaffnet und somit die einzigen waren, welche die anderen schützen konnten. Darauf hatte er folgende Verbindung erstellt: Mit ihm zusammen waren sie zu siebt in ‹seiner› Wehrgemeinschaft 91, welche sich regelmässig und in verschiedener Zusammensetzung beim Schachspiel oder in ihrem Bunker am Ende des Weihers trafen. Also ebenso viele Männer, wie auf dem Bild. Mit den entsprechenden Waffen ausgerüstet, konnten sie die Bevölkerung schützen. Gottes Sohn hatte ihm den Weg, seinen Weg gezeigt. Oberst von Boltigen beendete seinen Imbiss und schaute in die Weite, sah sich alle Berge und jeden Gipfel einzeln an und versuchte, sich an deren Namen zu erinnern. Ein letztes Mal kehrte er zu seinen Zweifeln zurück. Nach kurzer Zeit beendete er sein inneres Ringen. Für eine Kehrtwendung war es jetzt zu spät.
***
Unten angekommen begab sich der Politiker zum Parkplatz neben der Talstation, stieg in seine Limousine und fuhr in einen grossen Wald. Nach einigen Kilometern über einen holprigen Weg, welcher für Waldarbeiter, Förster und Holzfäller gebaut worden war, erreichte er eine Lichtung, die an einen kleinen Weiher grenzte. Auf der anderen Seite sah er ein niedliches Gebäude aus Holz mit einem Giebeldach und einem Kamin. Das Haus stand vor einem grossen Felsstück, das dem Haus Halt zu geben schien. Auf dem Felsen, welcher mindestens zwanzig Meter hoch war, wuchsen einige Nadelbäume. Die künstlichen roten Geranien, die auf den Fenstersimsen standen, spiegelten sich im glatten Wasser. Er parkte neben einer Holzbeige, stieg aus und zog Stiefel und eine Jägerjacke an. Nun sah er aus wie jemand, der wie ein Jäger aussehen wollte. Dann machte er sich auf den Weg und lief über einen Pfad um den Weiher herum. Erschreckt durch die Vibration seiner Tritte sprang ein Grasfrosch ins Wasser und verschwand blitzschnell unter dem hervorstehenden Ufer. Einige Vögel warnten vor seinem Eindringen in diese stille Szenerie. Der Politiker erreichte das Chalet und blieb stehen. Während er sich umschaute, ob er alleine war, putzte er sich die Nase. Es war still, er hörte weder Vogelgezwitscher noch Schritte. Niemand war da, und doch spürte er, wie wenn er beobachtet würde. Er drehte sich langsam um die eigene Achse und las den Spruch, der über den Fenstern in weisser Farbe geschrieben stand:
«Der treue Wächter diesem Haus, sei Gott der Herr allein».
Er verzog seine Mundwinkel zu einem spöttischen Lächeln, spazierte um das Haus herum und klopfte laut an die Tür: drei Mal schnell hintereinander, dann zwei Mal langsam.
***
Der amerikanische Gast sprach keine Fremdsprache, aber er entdeckte das Wort Steak auf der kleinen, laminierten Menükarte. Genauer gesagt, er fand es zwei Mal, einmal mit einem bescheidenen, einmal ohne Preis. Er fragte deshalb, was das zweite Steak, dasjenige ohne Preisangabe denn sei. Die grosse Servierfrau im Dirndl, welches ihr Gast für eine Schweizer Tracht hielt, sagte, dies sei ein Elch-Steak, «ä Schtiik of se Elch». Hierbei streckte sie ihre Brust nach vorne und versuchte, den grossen Kopf eines Elchs mit seinem mächtigen Schaufelgeweih mit den Händen über ihrem Kopf darzustellen. «Oh my god», rief ihr Gast aus und machte dazu ein beeindrucktes Gesicht: «The Steak from a Elk! Now that is really something very special!» Er hatte nicht gewusst, dass es hier Elche gab, dann belehrte er sie, indem er dazu mehrmals nickte: «In the United States we call ‹em moose, you know: moose!»
«Yes, yes», nickte sie: «very schpezial!» Sie wollte anfügen, dass es hier oben nur selten Fleisch vom Elch gebe, weil er sich für gewöhnlich vor den Jägern in den Felsspalten verstecke und vor allem keines in dieser Jahreszeit, da die Hochwildjagd noch nicht eröffnet worden sei und er sich glücklich schätzen könne, dass sie extra für ihn einen Elch finden würde. Stattdessen hob sie ihre Schultern und machte dazu ein verzweifeltes Gesicht und so hatte ihr Gast Mitleid mit ihr und er bestellte den Elch sowie eine dunkelfarbige Limonade. Kaum hatte die Kellnerin die Türe zur Küche von innen geschlossen, winkte sie Toni, ihrem Koch, den sie vergnüglich Knorrli nannte, zu und dann mussten beide lachen. Wieder einmal war es ihr gelungen, einen amerikanischen Wandervogel über den Tisch zu ziehen.
Der Tourist nahm sein Fernglas hervor und beobachtete die steil aufsteigende Felswand, welche auf der anderen Seite der Alp emporragte. Er entdeckte die etwas herunter gekommene Bergstation einer zweiten Seilbahn und erkannte, dass sie nur eine Attrappe war. In Wahrheit befand sich die einzige Kabine für den Transport von Personen und Gütern einige Meter innerhalb des Felsens, der starke Motor dafür ebenso. Niemand, ausser der mächtigste Nachrichtendienst der Welt, sein Geheimdienst, wusste, was sich dort oben versteckte: Eine streng geheime Einrichtung der Schweizer Festungsartillerie. In diesem Berg befanden sich mehrere Räume, in denen verschiedene Kanonen standen. Er wusste, er konnte seinem geheimnisvollen Offizier der Truppengattung Artillerie, welcher zwei Tische vor ihm die Berge zu studieren schien, dorthin nicht folgen, denn die Seilbahn konnte nur von Eingeweihten gesteuert werden. Schon vor dem ersten Weltkrieg hatten militärische Strategen Löcher in die Berge gebohrt, um dort ihre Abwehrgeschütze zu installieren, um mechanisierte Angriffe zu verhindern.
Zuerst war dies am Gotthard geschehen, dem wichtigsten europäischen Alpenübergang. Im Zweiten Weltkrieg, wovor die Schweiz wie im Ersten verschont worden war, wurde die sogenannte Réduit-Strategie festgelegt: Ein Verzögerungskampf im Grenzraum sollte durch eine erste Befestigungslinie im Mittelland und der schwer befestigten Zentralraumstellung ergänzt werden. Dazu wurden, meist durch die Truppen selbst, ab 1940 im ganzen Alpenraum unter hohem Zeitdruck gewaltige Festungswerke erstellt. Seit 1942 bewachte und betrieb eine Berufsformation der Armee, das Festungswachtkorps, die vielen Anlagen.
Während sich der Agent über den Ideenreichtum der Schweizer Gedanken machte, wurde ihm ein Teller mit einem Stück Fleisch und Pommes frites serviert. Für ihn sah dies wie ein dickes Kalbsschnitzel aus, doch er liess sich davon und später, als er die horrende Rechnung dafür bekam, nicht von seiner guten Laune abbringen. Er bewunderte die Schweizer. Da dienten alle diensttauglichen Männer jedes Jahr während drei Wochen dem Staat als Soldaten. Von sechs Uhr früh bis abends spät übten sie, wie sie sich im Ernstfall gegen einen Feind wehren mussten und nach Feierabend verschwanden sie in ihren Löchern. Wie sein Oberst, der bald in seine Höhle oben in der Felswand schweben würde. Er versuchte, mit seinem Fernglas zu erkennen, wie viele Löcher diese Wand verbarg, sicher zwei Dutzend mussten es sein und er stellte sich folgendes Szenario vor:
Drei sowjetische MiG-25-Geschwader waren bei ihrem Angriff auf die kleine Schweiz knapp den ihnen überlegenen Mirages entkommen und hofften, sie müssten nur über diesen Berg fliegen, um die Schweizer Jagdflieger abhängen zu können, und dann, bei diesem Gedanken zündete er sich eine Zigarette an, dann würden sich mindestens 24 Löcher im Berg öffnen und zwei Dutzend Oerlikon 35-mm Zwillingskanonen würden full power mit einer Kadenz von über 500 Schuss pro Minute je Rohr auf die feindlichen Abfangjäger schiessen.
Bei dieser Vorstellung leuchteten die Augen des Agenten. Er zog genüsslich an seinem Glimmstängel und bestellte sich nochmals ein Colagetränk. Nachdem ihm die Kellnerin das Getränk gebracht und sich von ihm wieder abgewandt hatte, nahm er, verstohlen um sich blickend, einen Flachmann aus seiner Jackentasche und mischte seinen Zuckerrohrschnaps unter sein Getränk. Ohne seinen hochprozentigen Rum konnte er dieses schwarze Gesöff nicht leiden. Cuba libre!, lächelte er und wandte sich seinen Erinnerungen zu.
***
Der Ausländer, der hinter dem Politiker fuhr, sah, wie dieser in den Wald bog. Er folgte ihm, bis er eine Gelegenheit fand, seinen Kleinwagen in einem Seitenweg stehen zu lassen. Er stieg aus und folgte dem Motorengeräusch des Volksvertreters zu Fuss. Als er den Weiher erreichte, erblickte er den Politiker am anderen Ende des Gewässers. Sein Vorgesetzter, der dem Schweizer Offizier zur Alpwirtschaft gefolgt war, hatte ihm erklärt, der Schweizer Geheimdienst setze sich aus 26 Zellen zusammen, welche einander nicht kannten und keine Kontakte untereinander pflegten. Diese Einheiten bildeten vereint die sogenannte UNA, die Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr. Im Ernstfall würden sie via Kurzwellenfunk geführt, oder so.
Sein Vorgesetzter hatte ihn darüber aufgeklärt, dass die Schweiz zwar neutral sei, in einem bewaffneten Konflikt jedoch auf ihrer, der amerikanischer Seite stünde. Aber sie hätten vor kurzem einen anonymen Hinweis auf Kontakte zwischen einem hochrangigen Schweizer Soldat und dem sowjetischen Attaché in Bern erhalten. Weshalb der Agent diesem Politiker, der sich eben für die Jagd umgezogen hatte, folgen sollte, war ihm schleierhaft. Trotzdem vertraute er seinem chronischen Misstrauen, denn vielleicht, so frohlockte er, führte ihn der beschattete Schweizer zu einem geheimen Versteck einer dieser Untergruppen des Nachrichtendienstes.
***
Der ältere Agent nahm einen Schluck und erinnerte sich: Vor 15 Jahren hatte sein Auslandsgeheimdienst, die Central Intelligence Agency (CIA), einen militärischen Gewaltstreich gegen die benachbarte Insel Cuba geplant und organisiert, um die Revolutionsregierung unter Fidel Castro zu stürzen. Castro schien Wirtschaftsformen zu bevorzugen, welche nicht mit dem Kapitalismus der USA vereinbar schienen. Eine Landungstruppe, die aus 1500 kubanischen und amerikanischen Söldnern bestand, war dazu auf der Bahia de Cochinos, einer 14 Kilometer langen Bucht an der Südküste Kubas, gelandet und hätte von dort aus die Eroberung einleiten sollen. Die Invasoren wurden innerhalb der ersten 72 Stunden vernichtend geschlagen. Die widerrechtliche Aggression war gescheitert und die Vereinigten Staaten wurden von den United Nations sowie von mehreren lateinamerikanischen Nationen gerügt und sein Geheimdienst zum Sündenbock gemacht. Die Stimmung an seinem Arbeitsort in Langley war getrübt, seine Vorgesetzten erschienen mürrisch zur Arbeit und demotivierten so ihre Mitarbeiter jeden Tag von neuem.
Eines Tages kamen er und einige Kollegen auf der Führungsebene auf eine Idee. Durch einen Exilkubaner hatte er mitbekommen, dass der Diktator eine extra für ihn angefertigte Zigarrenmarke bevorzugte. Für diese Zigarren waren nicht wie üblich zwei Fermentationsstadien nötig, sondern drei, was nicht nur den Teer- und Nikotingehalt verringerte, sondern ihr ein besonderes Aroma verlieh. Dieser spezifische Geschmack konnte variieren und das war entscheidend, damit der Rauchende nicht gleich argwöhnisch würde, wenn seine Lieblingszigarre mal etwas anders roch oder schmeckte.
Der Agent seufzte bei dieser Rückblende. Er überging seine Erinnerungen an den Einbau des Sprengstoffes, die Testexplosionen und den Transport nach Cuba und nahm einen Schluck aus seinem Glas.
Sein Plan hatte nicht funktioniert. Die als Geschenk präparierte Zigarre war vom Sicherheitsdienst des Diktators abgefangen worden, und weil es zudem kein besonders intelligenter Plan war, wurde er von seinem Auftrag abgezogen. Seine Vorgesetzten nahmen ihm sein Team weg, er durfte keinen Kontakt mit seinen kubanischen Kontaktleuten mehr haben und sie entzogen ihm die Erlaubnis, ohne Befehl zu töten. Einige Wochen später wurde er in ein Land versetzt, in welchem es einfach niemanden gab, den er umbringen konnte: hierhin in die friedliche, schöne Schweiz mit all den lieben, arbeitsamen und gastfreundlichen Menschen. Dadurch war ihm die Chance verwehrt worden, seine Vorgesetzten von seiner Idee, eine mit Gift versehene Ratte oder eine mit einem tödlichen Virus infizierten Biene in das Schlafzimmer des Diktators … Er seufzte nochmals, doch dann besserte sich seine Stimmung, als er an das Geschenk dachte, welches ihm am letzten Arbeitstag überreicht worden war: eine Holzkiste mit 24 Flaschen bestem kubanischen Rum, die er als Diplomatengepäck getarnt an seinen neuen Wirkungsort, nach Bern mitnahm. «Ein Trösterchen unseres Máximo Líder» stand auf einem Zettel, den er unter der ersten Flasche dieses köstlichen Schnapses fand. Ob es sich hierbei tatsächlich um das Geschenk eines ironischen aber verzeihenden Überlebenden seines misslungenen Attentats handelte, fand der Agent nie heraus. Er bezahlte. Dann streckte er seine Beine und gähnte.
***
Der junge amerikanische Spion platzierte seinen Kaugummi zwischen Oberlippe und Oberkiefer und beobachtete den Schweizer, wie dieser um das putzige kleine Chalet mit seinen stilvollen Blumen vor den Fenstern herumspazierte. Was er seiner aufgesetzten Sonnenbrille wegen nicht sehen konnte, war der folgende standardisierte Ablauf, welcher dem Politiker gewaltig auf den Keks ging. Die Türe öffnete sich um einen Spalt und er merkte, wie er von oben nach unten gemustert wurde. Er sagte:
«Apfelmus und Älplermagrone».
Darauf öffnete sich die Tür und ein jüngerer Mann mit einem höhnischen Lächeln stellte sich breitbeinig in den Türrahmen. Es handelte sich um den Spross eines reichen Fabrikanten. Sie nannten ihn despektierlich nur den «Sohn». Der Politiker hielt ihn für einen blasierten Nichtsnutz, der auf die Übernahme der Produktionsstätte für Waffen wartete, wofür er bisher nichts geleistet hatte. Ein richtiger Schmarotzer, der unter den ersten Profiteuren sein würde, wenn es dereinst darum ginge, sich mit Waffen gegen einen Feind zur Wehr zu setzen. Eigentlich hatte er dessen Vater rekrutieren wollen, dieser erkrankte jedoch und schickte deshalb seinen Sohn in die Gruppe. Der Politiker grunzte, stiess den jungen Mann grob zur Seite und trat ein.