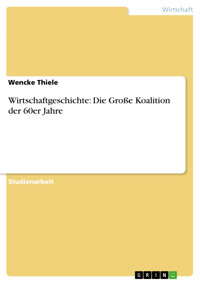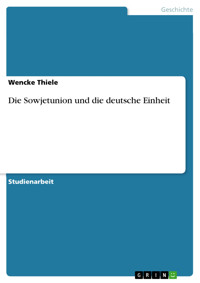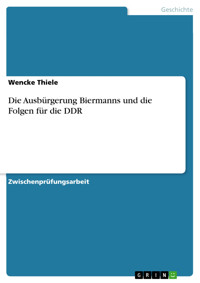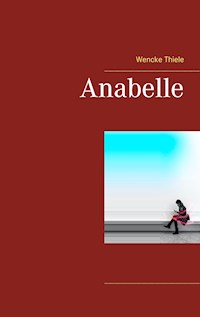
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Anabelle lebt im Luxus - und in der Hölle! Ihre Eltern halten sie wegen eines harmlosen Kusses mit einem Nachbarsjungen für psychisch krank. Hauslehrerinnen, Therapeuten, Isolation und ein Lernpensum, das Anabelle nicht bewältigen kann, sind ihr Leben. Als sie aufgrund der Überforderung ausrastet, droht ihr die EInweisung in die Psychiatrie ... oder in eine Jugeneinrichtung auf dem Land für schwer erziehbare Jugendliche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Regina von Allental stand mit ihrem Mann an einem der bodentiefen Fenster ihres Hauses und sah hinaus. An der Kaffeetafel, die von dem Dienstmädchen wie verabredet auf der Terrasse bereitet worden war, saß die Familie. Es war Reginas 45. Geburtstag. Sie beobachtete ihre Tochter Anabelle, die sich gerade mit der Mutter ihres Mannes unterhielt.
Sie seufzte. Ihr Mann legte ihr beruhigend die Hände auf die Schultern.
Regina sah kurz zu ihm auf. Ihr Mann war eineinhalb Köpfe größer als sie.
„Warum wir?“
Ihr Mann antwortete nicht. Wie oft hatten sie diese Frage schon in den letzten Jahren besprochen. Nie hatten sie eine Antwort darauf gefunden, weder allein, in stundenlangen Gesprächen, noch gemeinsam mit einem Therapeuten, dessen Spezialisierung Anlass zur Hoffnung gegeben hatte. Nichts hatte sich geändert.
„Wir sollten wieder hinunter gehen“, schlug ihr Mann vor. Sie nickte. Sie folgte ihm in das Erdgeschoss. Sie zwang sich zu lächeln. Dann betrat sie die Terrasse. Die Mutter von Richard sah auf.
„Alles in Ordnung, Liebchen?“
Regina nickte.
„Ja, alles in Ordnung, Madeleine, nur ein geschäftliches Telefonat. Entschuldigt die Unterbrechung.“ Sie sah kurz zu ihrer Tochter hinüber. „Über was habt ihr euch denn gerade unterhalten?“
„Ach“, machte Madeleine und lächelte in Anabelles Richtung, „ich habe ihr gesagt, dass ein Hauslehrer nicht das Schlechteste ist. Wie du weißt, haben wir viel Kontakt zu Akademikern, auch Lehrern. Was die so von den öffentlichen Schulen erzählen…“ Sie wandte sich wieder Anabelle zu. „Sei froh, dass du nicht dorthin musst.“
„Es ist langweilig, immer allein zu lernen“, sagte das Mädchen.
„Anabelle, das Thema hatten wir.“ Ihr Vater sah sie eindringlich an.
„Ja, Vater“, antwortete seine Tochter, „ich weiß auch, warum ich Privatunterricht bekomme. Ich sage nur, dass es manchmal langweilig ist.“
Richard von Allental nickte seiner Tochter zu. Madeleine bedachte das Mädchen mit einem mitfühlenden Blick. Seit ihr Sohn ihr anvertraut hatte, dass das Mädchen unter einer scheinbar unheilbaren Krankheit litt, finanzierte sie den Privatlehrer mit. Nicht, dass es ihr Sohn nötig gehabt hätte, aber sie wollte sie daran beteiligen, ihrer Enkelin wenigstens noch dieses zu ermöglichen. Was genau das Mädchen hatte, hatte er nicht gesagt. Nur soviel, dass es vermutlich mit dysfunktionalen Entwicklungen im Bereich der libidinös-affektiven Funktionen zu tun hatte. Was immer das heißen mochte.
„Wie weit seit ihr denn schon?“
Anabelle sah ihre Großmutter väterlicherseits irritiert an.
„Wie weit?“
„Ja, wollte dein Lehrer mit dir nicht dieses Buch lesen?“
„Welches Buch?“
„Aineias“, sagte Regina.
Anabelle seufzte versteckt.
„Wir haben gerade angefangen.“
Latein! Wozu in aller Welt brauchte sie Latein? Sie wollte weder Ärztin noch Anwältin werden. Für ihren Berufswunsch musste sie verständlich reden können, mehr nicht. Oder zumindest die lateinischen Namen der Pflanzen kennen. Naja, vielleicht noch dafür. Aber ein Latinum galt nun mal nicht als Voraussetzung für eine Floristenausbildung oder ähnliches. Ihre Eltern würden soundso nie zulassen, dass sie lediglich eine profane Ausbildung machte. Unter einem Masterstudium ging gar nichts. Und wahrscheinlich nicht mal das. Dazu hätte sie das Haus verlassen müssen!
Sie sah ihrer Familie dabei zu, wie diese sich an der nachmittäglichen Feiertafel über die Entwicklungen des Familienunternehmens und die Umbrüche an den Börsen unterhielt. Sie langweilte sich. Aber nachzufragen, ob sie die Tafel verlassen durfte, brauchte sie nicht. Es würde ihr nicht gestattet werden. Zu groß war die Gefahr, dass sie die Zeit nutzte, in der ihre Eltern durch die Gespräche an die Tafel gebunden waren, um ihrer Krankheit nachzugehen. Nein, das würden sie nicht riskieren. Sie erhob sich dennoch.
„Wohin gehst du?“, kam es sofort von ihrer Mutter.
„Ich möchte ins Badezimmer“, erwiderte Anabelle. Ihre Mutter nickte.
„Komm bitte gleich wieder.“
Anabelle nickte nur. Sie ging ins Haus und betrat das Badezimmer im Erdgeschoss. Vorsorglich schloss sie hinter sich ab. Mehr als einmal war es ihr passiert, dass ihre Mutter nachschauen gekommen war, ob sie auch ja das tat, was sie angegeben hatte. Und pinkeln wollte sie nun wahrlich nicht vor ihrer Mutter. Seufzend ließ sie sich nieder. Die ganze Situation machte ihr das Leben zur Hölle. Diese vermaledeite Diagnose! Alles hatte damit angefangen.
Seitdem stand sie unter ständiger Aufsicht. Nur keine Gelegenheit geben! Selbst ihre Zimmertür hatte sie eines Tages nicht mehr vorgefunden. Es sei zu ihrem Besten, hatte ihre Mutter erklärt, man wolle sie nur schützen.
Schützen? Indem man eine 24-Stunden-Bespitzelung aufrüstete? Hatte sie denn kein Recht auf ein wenig Privatsphäre? Wenigstens am Nachmittag oder sonst wann? Nein, scheinbar nicht. Alles wurde beobachtet. Auf dem Flur vor ihrem Zimmer hing eine Kamera.
Sie wusch sich die Hände und kehrte auf die Terrasse zurück. Ihre Mutter musterte sie forschend. Nein, wohl nicht, dafür war die Zeit zu kurz gewesen. Gut. Anabelle ließ sich wieder neben Madeleine nieder. Auf in die nächste Runde Smalltalk.
„Anabelle, Sie müssen sich besser konzentrieren.“
„Ich kann aber nicht.“ Anabelle schob mit Schwung die Unterlagen beiseite. „Ich sitze hier schon 5 Stunden ohne Pause. Ich komme nie aus diesem verdammten Haus raus ohne irgendwelche Bodyguards weiblicher Art. Wie soll man sich da zwischendurch mal entspannen.
Selbst mein Zimmer wird videoüberwacht.“
Ihre Hauslehrerin lächelte.
„Sie müssen das verstehen“, sagte sie, „Ihre Eltern…“
„Die Leier kenne ich“, unterbrach Anabelle sie, „ist ja schön und gut, dass sie sich Sorgen um mich machen. Aber Totalüberwachung ist absolut übertrieben.“
Frau von Zurbriggen zog die Unterlagen wieder heran.
„Wir machen noch das hier und dann eine Pause.“ Anabelle knurrte nur. Sie konnte nicht mehr. Sie wollte nicht mehr. Am liebsten hätte sie geschrien.
Aber das hätte ihre Eltern nur wieder in dem Glauben bestärkt, die Krankheit habe noch mehr Besitz von ihr ergriffen.
„Können wir nicht jetzt eine Pause machen?“, fragte sie. „Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Sie müssen nachher eh nochmal alles erklären.“
„Nein“, antwortete ihre Hauslehrerin, „das machen wir jetzt noch.“
Anabelle seufzte. Sie wusste, Frau von Zurbriggen würde nicht nachgeben.
Zwei Stunden später durfte sie aufstehen.
„Das geht nicht.“
Sie hörte ihre Eltern im Wohnzimmer. Anabelle blieb auf der Treppe stehen. Sie lauschte.
„Richard, wir können das Mädchen nicht allein hier lassen. Du weißt, was passieren würde. Das wäre ein großer Rückschritt in ihrer Heilung. Und mitnehmen können wir sie auch nicht. Nein, du musst allein zu diesem Kongress. Ich werde mich krankmelden.“
„Du kannst nicht fehlen“, hörte sie ihren Vater, „Regina, das ist dein Spezialgebiet in der Firma.
Sie erwarten, dass du einen Vortrag über das Konzept hältst. Niemand hat in der Firma einen solchen Einblick darüber wie du.“
„Ich kann nicht mit“, wiederholte ihre Mutter, „wir können Anabelle nicht alleine lassen. Und unserem Dienstmädchen Elvira vertraue ich sie mit Sicherheit nicht an.“
„Das sollst du ja auch nicht. Es muss noch eine andere Lösung geben. Vielleicht kann meine Mutter einspringen?“
„Weiß sie, was Anabelle hat?“
Ihr Vater antwortete nicht, aber sie schätzte, dass er den Kopf schüttelte.
„Siehst du“, fuhr ihre Mutter fort, „du müsstest ihr alles sagen. Nein, das können wir nicht.“
Anabelle seufzte lautlos. Sie war nicht krank! Sie war nicht verrückt! Sie kam gut und gerne zweieinhalb Tage allein zurecht!
„Dann werde ich mich krankmelden“, erklärte nun ihr Vater, „du musst dahin, Regina. Meine Anwesenheit ist nicht unbedingt notwendig. Ich werde einen grippalen Infekt vorschieben.
Während ich hier bin, kann ich endlich mal die ganze Post beantworten, die in den letzten Wochen liegen geblieben ist.“
Anabelle entfernte sich leise.
Kopfschüttelnd saß ihr ihre Mutter gegenüber.
„Kind“, sagte sie, „ich verstehe dich nicht. Du hast schon die beste Lehrerin und Einzelunterricht.
Was sollen wir noch machen?“
Anabelle schwieg.
Egal, was sie sagen würde, es würde als Ausflüchte angesehen.
Frau von Allental wandte sich an die Hauslehrerin.
„Sagen Sie mir, wie können wir unsere Tochter noch besser unterstützen?“
Frau von Zurbriggen lächelte.
„Sie muss sich besser konzentrieren“, entgegnete sie, „das ist alles. Sie muss sich mehr auf das Lernen einlassen.“
„Ich tu nichts anderes als Lernen“, vermeldete Anabelle.
„Scheinbar nicht genug“, versetzte ihre Mutter.
„Scheinbar zu viel“, entgegnete ihre Tochter, „ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren. Ich sehe nur noch Bücher, Bücher, Bücher. Schon n Wunder, wenn ich mal in den Garten darf.
Bewegen darf ich mich nur unter Anleitung. Kein Wunder, dass ich keine … dass ich nicht nur lernen will.“
Besser sie vermied derartige Wörter.
„Wie sehen Sie das?“
Ihre Mutter sah die Lehrerin an.
„Wir bleiben bei unserem Pensum.“
Anabelle verdrehte die Augen.
„Soll ich nicht noch Griechisch, Hebräisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch und weiß ich nicht was lernen?! Atomphysik wäre auch noch 'ne Möglichkeit. Oder warum mache ich nicht gleich ein BWL-Studium?“
„Sei nicht so sarkastisch, Anabelle.“
„Ich kann nicht mehr!!!“
„Schrei hier nicht so rum. Es ist zu deinem Besten.“
Nun schrie Anabelle wirklich. Zu ihrem Besten!
Von wegen!
Einen Erfolg hatte sie damit. Ihre Mutter brach den Unterricht für heute ab. Was folgen würde, wusste Anabelle. Saft trinken, von dem sie genau wusste, dass ein starkes Beruhigungsmittel darunter gemischt worden war, und schlafen bis zum nächsten Morgen. Von ihr aus! Hatte sie wenigstens Ruhe. Ändern würde sich eh nichts.
Regina von Allental saß aufgelöst im Wohnzimmer. Ihr Mann sah neben ihr und hatte ihr den Arm um die Schultern gelegt. Er versuchte sie zu beruhigen.
„Es war schon alles so gut“, schniefte Regina, „so lange hatte sie keinen Anfall mehr. Und heute… aus heiterem Himmel…“ Sie seufzte laut.
„Was war denn los?“, fragte ihr Mann zum dritten Mal. Er hatte noch keine Antwort auf seine Frage bekommen. Regina berichtete vom Nachmittag.
„Sie lernt wirklich viel“, bemerkte ihr Mann anschließend. Regina hob den Kopf.
„Du gibst ihr Recht?“, fragte sie entgeistert.
„Ich finde nur, dass sie in letzter fast nur noch Unterricht hat. Frau von Zurbriggen ist von morgens um halb neun bis abends um fünf hier.
Und bis auf das Mittagessen gibt es so gut wie keine Pause.“
Regina von Allental sah ihren Mann an.
„Willst du mir damit sagen, dass ich unsere Tochter nicht richtig fördere, oder wie?“
„Nein“, sagte er beruhigend, „aber ich finde, wir könnten ihr ein bisschen mehr Freizeit lassen.“
„Freizeit!“, sie schnaufte ironisch. „Du weißt schon, wofür sie die nutzen wird.“
„Sie ist nicht unbeobachtet“, warf ihr Mann ein.
„Wenn etwas in die Richtung geschieht, können wir eingreifen. Oder gib ihr ein eigenes Projekt, an dem sie arbeiten kann. Die Homepage für die Kindergala zum Beispiel. Da ist sie beschäftigt, tut etwas Sinnvolles und wir haben sie im Blick.“
Seine Frau musterte ihn.
„Ich weiß nicht“, sagte sie, „vielleicht sollten wir das mit Professor Neureich besprechen.“
Anabelle wusste, was sie erwartete, als sie den Therapeuten im Wohnzimmer ihrer Eltern sitzen sah. Seit Jahren begleitete er die Familie. Sie begrüßte ihn.
„Anabelle, es freut mich, Sie zu sehen.“
Anabelle bemerkte, dass Professor Neureich der einzige Mann war, der das Haus betreten durfte, außer ihrem Vater natürlich.
„Guten Tag, Professor.“
Ihre Eltern beobachteten das Geschehen.
„Nun“, begann der Professor, „Ihre Eltern haben mich gerufen. Gab es denn etwas Neues?“
„Nein.“
„Nein?“ Der Therapeut war überrascht. Er sah zu den von Allentals hinüber.
„Anabelle hatte wieder einen ihrer Anfälle“, erklärte ihre Mutter.
„Hatte ich nicht.“
Regina von Allental seufzte und sah ihr Tochter mitleidend an.
„Wissen Sie, Professor, wir machen uns Sorgen um Anabelle. Sie wird im Privatunterricht immer schlechter. Sie ist ungehalten. Sie schreit.“
„Ich habe einmal etwas lauter gesprochen.“
„Also war doch was?“, erkundigte sich der Professor.
„Ja.“
„Nein.“
„Ja, was denn nun?“
Der Therapeut schien verwirrt. Er sah zu Herrn von Allental hinüber.
„Ich war nicht dabei“, Anabelles Vater hob die Hände, „das müssen Sie mit meiner Frau besprechen.“
„Professor“, wandte sich ihre Mutter nun wieder an ihn, „bitte reden Sie noch einmal mit unserer Tochter. So kann es nicht weitergehen.“ Sie erhoben sich. Leise schlossen sich die Flügeltüren von außen. Anabelle schnaufte laut.
„Ich bin ein wenig verwirrt“, sagte Professor Neureich, „was ist denn nun genau passiert?“
Anabelle berichtete von dem Gespräch, von ihrer Kritik und der Auseinandersetzung.
„Das heißt, Sie sehen es nicht als Anfall?“
„Nein“, sagte Anabelle beherrscht, „es war keiner, ich war einfach nur überfordert. Ich muss von morgens bis abends lernen und habe keine Zeit für Rekreation.“
„Die wie aussehen soll?“
Anabelle wusste, was er wissen wollte.
„Ich möchte mein Beet im Garten wieder bepflanzen, ich möchte mal wieder auf dem Klavier üben, für mich, nicht als Unterricht, ein wenig lesen.“
„Lesen, was denn?“
Sie zuckte mit den Schultern.
„Jedenfalls nichts, was ich erst übersetzen muss oder wovon man anschließend eine astreine Interpretation von mir haben will.“
Sie überlegte. Was war unverfänglich?
„Es gibt ein Buch von einer englischen Autorin.
Sie schreibt über Kinder, über ihre Schulzeit, verschiedene Geschichten, wie sie ihren Schultag meistern.“
Harry Potter, aber das würde sie ihm nicht sagen.
„Nun, das wäre in der Tat eine gute Lektüre.“
Anabelle verkniff sich ein Grinsen.
„Aber ich habe keine Zeit dafür.“
„Warum nicht?“
„Meine Eltern, vor allem meine Mutter bestehen darauf, dass ich von 8.30 bis 17.00 Uhr lerne. Mit einer Stunde Pause für das Mittagessen.“
„Durchweg?“
Sie nickte.
„Das ist in der Tat zu viel.“
„Meine Mutter denkt das nicht.“
Professor Neureich sah sie an.
„Ich werde mit ihr reden“, sagte er. „Was halten Sie für angemessen, Anabelle?“
„Von 8.30 bis 12“, sagte sie, „dann Mittagessen und dann noch mal bis halb drei. Danach kann ich mich nie konzentrieren.“
Er nickte langsam.
„Frau von Allental“, rief er dann in Richtung Tür.
Augenblick öffnete sie sich.
„Ja, Professor.“
„Setzen Sie sich. Ich habe einen Vorschlag. Mir scheint die junge Dame ein wenig überreizt. Ich halte es für gut, wenn sie sich ein wenig ausruhen kann. Wäre es möglich, die tägliche Lernzeit auf 14 Uhr zu beschränken.“
„Und danach?“
Ihre Mutter sah ihn an.
„Geben Sie ihr ein wenig Freiraum. Hat sie nicht ein Beet? Lassen Sie sie es bepflanzen. Oder lassen Sie sie lesen. Nichts für die Schule. Einfach so.
Oder…
Musik wäre auch gut.“
„Anabelle bekommt Klavierunterricht.“
„Schon wieder Unterricht“, sagte der Professor, „nein, das ist keine Entspannung für das Mädchen. Klassische Musik hören oder auch nur so auf dem Klavier spielen.“
Man sah Frau von Allental ihr Missbehagen an.
Anabelle schwieg. Der Professor sprach ganz in ihrem Sinne.
„Ich weiß nicht. Und was ist mit den schlechten Noten?“
„Das gibt sich auch“, erklärte Professor Neureich.
„Trauen Sie Ihrer Tochter mehr Eigenständigkeit im Lernen zu. Machen Sie ihr gemeinsam mit der Hauslehrerin einen Themenplan. Lassen Sie sie lernen, wann sie möchte. Sie bestimmt den Zeitpunkt. Sie und Frau von Zurbriggen die Themen und das Prüfungsdatum.“
„Ich muss erst mit ihr reden.“
War das nicht klar!
Der Professor erhob sich.
„Ich denke, so sollten wir es versuchen“, sagte er, „wenn irgendetwas sein sollte, rufen Sie mich an.
Meine Nummer haben Sie ja.“ Er verabschiedete sich. Anabelle sah ihre Mutter an.
Sie musterte ihre Tochter.
„Geh ins Studio. Frau von Zurbriggen wartet.“
Es hatte sich nichts geändert. Die Studienzeiten blieben die gleichen, zusätzlich hatte sie sich um die Homepage für eine Spendengala zu kümmern, der Garten sollte in Ordnung gebracht werden und statt dreimal hatte sie nun fünfmal Klavierunterricht. Anabelle streikte. Sie benahm sich extra unmöglich. Sie lernte nicht mehr. Die Homepage hatte sie nicht angefangen, beim Klavierunterricht weigerte sie sich zu spielen.
Immer wieder geriet sie in Streit mit ihren Eltern.
Es kümmerte sie nicht.
Sie wusste, dass sie über kurz oder lang mit Konsequenzen rechnen musste. Die Gespräche ihrer Eltern wurden zunehmend intensiver.
Auch heute hatte sie Frau von Zurbriggen wieder zur Weißglut getrieben. Nicht eine Deklination hatte sie gekonnt. Es war zum Streit gekommen.
Ihre Mutter hatte sie in den Saal bestellt, unter ihre Aufsicht, und hatte ihren Mann angewiesen alles Notwenige in die Wege zu leiten. Was das heißen sollte, wusste Anabelle nicht.
Drei Tage später, Anabelle hatte sich gewundert, dass der Privatunterricht ausgefallen war, klingelte es an der Tür. Anabelle war am Morgen angewiesen worden, ihre gute Kombination anzuziehen. Es ging nach draußen? Welch Wunder!
Eine Frau und ein Mann mittleren Alters traten ein. Anabelle betrachtete sie. Sie sahen verbissen aus, dachte sie. Jemand anderem hätten ihre Eltern auch nie zugestimmt.
Die beiden Besucher unterhielten sich mit ihren Eltern. Anabelle saß dabei und seufzte innerlich.
Warum musste sie hier sein?
Nach einer Stunde erhoben sie sich.
„Kommen Sie.“
Das waren die ersten Worte, die man an sie richtete.
„Wohin?“, fragte Anabelle.
„Hinaus.“
Welch sinnreiche Antwort. Anabelle folgte ihnen.
Vor dem Haus stand ein Auto. Anabelle sah die beiden an.
„Wohin fahren wir?“
Der Mann hatte die Tür geöffnet.
„Steigen Sie bitte ein.“
„Wohin fahren wir?“, fragte sie noch einmal. Sie machte keinen Schritt vorwärts. Eine Hand legte sich auf ihre Schulter.
„Geh mit.“ sagte ihre Mutter. „Mach bitte keine Schwierigkeiten.“
„Ich möchte nur wissen, wohin wir fahren.“
erwiderte Anabelle ruhig. Das war ihr gutes Recht, oder nicht?
„Steigen Sie bitte ein, Fräulein von Allental.“ Der Ton ihrer Begleiterin war streng.
„Sagen Sie mir, wohin wir fahren, und ich sitze sofort im Auto.“
„Nach Jobheim.“
Nie gehört.
Sie setzte sich. Ihre Mutter atmete hörbar auf. Ihr Vater drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Anabelle wunderte sich. Sie sah durch das Rückfenster, wie eine Tasche verladen wurde. Der Mann setzte sich an das Steuer, seine Begleitung neben sie. Als sie abfuhren, winkten ihre Eltern. Irgendwas passierte hier gerade Seltsames.
Was es war, wusste Anabelle schnell. Jobheim war kein gewöhnlicher Ort, es war eine psychiatrische Klinik. Mehrere Tage wurde sie ruhig gestellt.
Aber Anabelle beruhigte sich nicht. Sie verlangte mit ihren Eltern zu sprechen. Sie verlangte ein Gespräch mit der Leitung. Sie… Jedes Mal wurde sie mit Medikamenten zum Schweigen gebracht.
Sie verlor das Gefühl für die Zeit. Mehr als eine Woche hatte sie keinen Tag und keine Nacht mehr unterschieden. Sie war von den anderen isoliert.
Scheinbar hielt man sie für einen schweren Fall.
Anabelle war wütend. Wenn sich nur einer, einer oder eine Einzige mal die Zeit nehmen würde, ihr vorurteilsfrei zuzuhören! In Nullkommanix wäre die ganze Angelegenheit geklärt. Aber ihre Meinung war nicht gefragt. Eltern hatten Recht, vor allem wenn sie Geld und Einfluss hatten.
Nach einiger Zeit wurde sie nach oben in den Eingangsbereich gebracht. Anabelle war verwundert. Sie folgte der Schwester auf den Parkplatz. Dort wartete ein Geländewagen.
Erstaunt betrachtete Anabelle die Frau, die am Wagen lehnte.
„Anabelle von Allental“, sagte die Schwester.
Die Frau nickte ihr zu.
„Guten Tag“, sagte sie, „dann steigen Sie mal ein.“
Anabelle setzte sich. Was sie erwartete, wusste sie nicht. Besser als hier würde es überall sein. Und Tötungsstationen gab es ja wohl nur für Tiere im Süden.
Sie fuhren vom Gelände. Die Frau warf einen Blick in den Rückspiegel. Sie grinste.
„Sie sehen aus, als wüssten Sie überhaupt nicht, was los ist.“ sagte sie.
Anabelle nickte.
„Weiß ich auch nicht.“
Sie hielt an einer roten Ampel und wandte sich um.
„Gar nicht?“
„Nein.“
Für einen Moment verharrte der Blick auf ihr.
Dann wandte sie sich wieder nach vorn. Sie fuhren einige Straßen. Dann hielt sie. Sie schaltete den Motor aus.
„OK, dann lassen Sie mich Sie mal auf den neuesten Stand bringen“, sagte sie. „Mein Name ist Dr. Christine Kober. Ich arbeite in einem Jugendprojekt, das sich mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Wir sind eine etwas andere Einrichtung. Wir arbeiten nicht mit Medikamenten, sondern mit Arbeit. Unsere Einrichtung liegt auf dem Land. Weit weg von Gewalt, Drogen und allem anderen. Die Klinik hat mich gebeten, Sie aufzunehmen, weil sie mit Ihnen nicht mehr klargekommen sind.“
„Sie haben mich mit Medikamenten vollgepumpt“, sagte Anabelle nur.
Dr. Kober nickte.
„Eine sehr geläufige Maßnahme dort, aber für Ihren Fall nicht die richtige.“
„Ich bin kein Fall.“
Dr. Kober lächelte.
„So meinte ich es auch nicht. Medikamente helfen bei physischen Krankheiten, auch bei manchen psychischen. Aber eben nicht immer. Wir fahren erst mal weiter, okay? Ist es Ihnen recht, wenn wir uns duzen? Das tun wir alle dort.“
Anabelle nickte.
„Also, ich bin Christine.“
„Anabelle“, sagte sie, „oder Ann oder so.“
„Oder so“, grinste Christine, „dann fahren wir mal weiter, oder so.“
Anabelle schmunzelte. Die benahm sich normaler als viele in ihrer Familie.
Nach einer längeren Autofahrt bog Christine schließlich in einen kleineren Sandweg ein, der