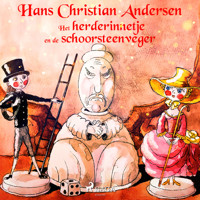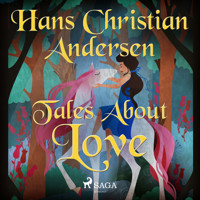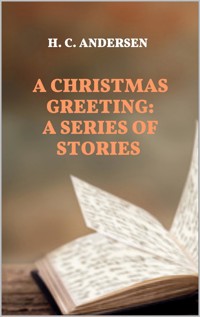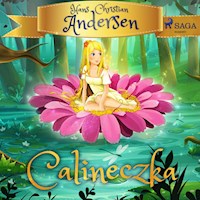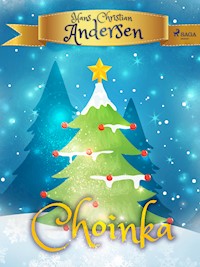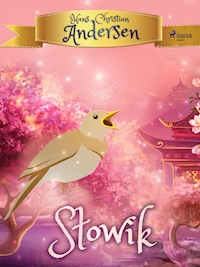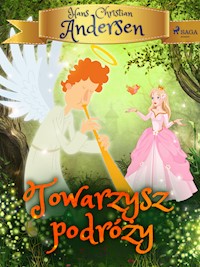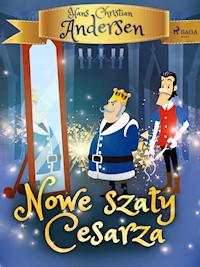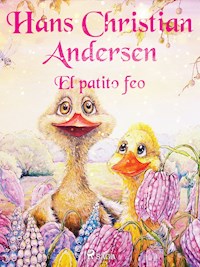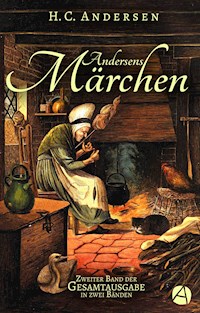
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Märchen von H. C. Andersen zeichnen sich durch eine ganz eigene Atmosphäre aus. Seine durch und durch originellen Geschichten vermeiden den moralischen Zeigefinger und die Klischees, mit denen Märchen oft in Verbindung gebracht werden. Stattdessen haben die Schönheit, Tragik und Seltsamkeit seiner Kunstmärchen seit jeher die Fantasie von jungen und alten Lesern in ihren Bann gezogen. Andersen betrachtete das Leben als etwas Geheimnisvolles, das jedoch von der Vorsehung gelenkt wird, als einen Ort, an dem Magie unter jedem gefallenen Blatt zu finden ist und an dem sich die Regeln der Moral in den Geschehnissen der Natur widerspiegeln. Wie kaum einem Zweiten gelang es dem dänischen Dichter, diesen wundervollen Blick auf die Welt in seinen Geschichten lebendig werden zu lassen. Dieser zweite Band von insgesamt zwei Bänden versammelt 45 der sämtlichen Märchen von Hans Christian Andersen und entspricht dem ursprünglichen Ergänzungsband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
H. C. ANDERSEN
ANDERSENS MÄRCHEN
ZWEITER BAND DER
GESAMTAUSGABE
IN ZWEI BÄNDEN
Ergänzungsband zur einzigen vollständigen vomVerfasser besorgten Ausgabe
Übersetzt von Guido Höller
ANDERSENS MÄRCHEN wurden unter dem Titel “Sämmtliche Märchen” zuerst veröffentlicht im Jahr 1862. Der vorliegende Ergänzungsband wurde zurerst veröffentlicht im Jahre 1905.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2021
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-420-2
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
*
* *
ROMANE von JANE AUSTEN
bei apebook
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
bei apebook
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Andersens Märchen. Zweiter Band
Impressum
Vorbemerkung
Der Stein des Weisen
Des Hagestolzen Nachtmütze
Das Abcbuch
A. Amme
B. Bauer
C. Columbus
D. Dänemark
E. Elefant
F. Ferkel
G. Grab
H. Hurra!
I. Idee
K. Kuh, Kalb
L. Löwe, Liebe
M. Morgensonne
N. Neger
O. Olive, Ölblatt
P. Pulver
Q. Quecke
R. Runder Turm
S. Schwein
T. Teekessel, Teemaschine
U. Uhr
V. Vieh
W. Waschbär
X.
Y. Yggdrasil
Z. Zopf
Der Wind erzählt von Waldemar Doe und seinen Töchtern
Turmwächter Ole
Der erste Besuch
Der zweite Besuch
Anne Lisbeth
Ein Stück Perlenschnur
I.
II.
»Schön«
Eine Geschichte aus den Dünen
Die Muse des neuen Jahrhunderts
»Die Irrwische sind in der Stadt,« sagt die Moorfrau.
Der Bischof auf Börglum und seine Sippe
In der Kinderstube
Der Teetopf
Die kleinen Grünen
Der Kobold und die Frau
Peiter, Peter, Peer
Der Sohn des Pförtners
Ziehtag
Tante
Des Paten Bilderbuch
Lumpen
Wanö und Glanö
Wer war die Glücklichste?
Die Dryade
Hühnergretes Familie
Was die Distel erlebte
Was man erfinden kann
Das Glück kann in einem Zweige liegen
Der Komet
Die Tage der Woche
Sonnenscheingeschichten
Urgroßvater
Die Lichte
Das Unglaublichste
Was die ganze Familie sagte
»Tanze, tanze, Puppe mein!«
»Frag' die Amagerfrau«
Die große Seeschlange
Der Gärtner und die Herrschaft
Der Floh und der Professor
Was die alte Johanne erzählte
Der Hausschlüssel
Der Krüppel
Tante Zahnweh
Tante Zahnweh
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
VORBEMERKUNG
Am 2. April 1905 sind hundert Jahre verflossen, daß Hans Christian Andersen zu Odense auf Fühnen geboren wurde. Er nahm, gleich dem »Sohn des Pförtners« (Bd. II, 137) aus den niedrigen und ärmlichen Verhältnissen der väterlichen Schuhmacherwerkstätte seinen Aufstieg in die höchsten Kreise und durfte auf der Höhe seines Ruhmes Fürsten zu seinen Freunden zählen. Diese Wandlung kam ihm selbst so wunderbar vor, daß er am Schlusse seiner Tage beglückt ausrief: »Ja, das Leben ist das schönste Märchen« (Bd. II, 255). Doch wurde ihm der Aufstieg nicht leicht gemacht; Neid, Unverstand und Lieblosigkeit seiner Landsleute und ihrer literarischen Beiräte verbitterten ihm manche Stunde, erpreßten ihm manche Träne. »Das häßliche junge Entlein« (Bd. I, 141), »Ein Blatt vom Himmel« (Bd. I, 394), »Was man erfinden kann« (Bd. II, 228) und »Der Gärtner und die Herrschaft« (Bd. II, 266) lassen diese Stimmung deutlich genug erkennen. Die schwerste Wunde aber schlug ihm die Liebe und an ihr ist seine Seele langsam verblutet; denn die er sich als junger Student erkor, liebte und heiratete einen anderen. Darum blieb er auch unvermählt und knüpfte auch nur freundschaftliche Beziehungen zu den Frauen an. Wo immer er die Liebe schildert, nimmt sie einen unglücklichen Ausgang, wie in dem standhaften Zinnsoldaten (Bd. I, 45), »Unter dem Weidenbaum« (Bd. I, 150) und »Was die alte Johanne erzählte« (Bd. II, 277). Aber trotz alles Leides und Ungemachs setzte Andersen sich durch, da er eine starke Dichterpersönlichkeit war und er fest an seinen Dichterberuf glaubte. Er wurde der bekannteste dänische Dichter aus dem Anfang und der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das wurde er vor allem durch seine Märchen und Geschichten. Ausgehend von den dänischen Volksmärchen und Volkssagen, von denen er ungefähr ein Dutzend nacherzählt hat, hat er mehr und mehr seine reiche Lebenserfahrung und Menschenkenntnis in ihnen niedergelegt. Der Mensch mit seinen Freuden und Leiden, seinem Sehnen und Hoffen, seinen Fehlern und Gebrechen ist der eigentliche Gegenstand seiner Märchen und Geschichten, selbst dort wo sie an das Volksmärchen erinnern oder von ihm beeinflußt sind. So hat Andersen dichterisches Neuland gewonnen, urbar gemacht und reich angebaut, um es späteren Dichtern als Erbe zu überlassen. Gehört er auch nicht zu den großen literarischen Eroberern, so doch zu denen, die stille Triften aufgefunden haben. Denn alle späteren Märchenerzähler stehen auf seinen Schultern, wie ihm die ersten Anregungen von den deutschen Romantikern, namentlich von Th. A. Hoffmann gegeben worden sind. Und auch der neueste Trieb am Märchenbaume, die naturgeschichtlichen Märchen eines Laßwitz und Ewald liegen als Knospe schon in den »Störchen« (Bd. I, 22) und »Den kleinen Grünen« (Bd. II, 126).
Aber nicht nur literarhistorisch verdienen seine Märchen und Geschichten einen hervorragenden Platz, sondern auch um ihres dichterischen Wertes willen. Sie sind heute noch so anziehend wie am ersten Tag, und dies ganz allein durch eigene Schönheiten. Haben sie auch noch keine lange Vergangenheit, so ist nach ihnen doch schon manches Märchen in den Staub der Vergessenheit gesunken. Die reiche Phantasie des Dichters ist in ihnen zu schönen, üppigen, aber auch grotesken Blumen erblüht, und der Humor des Dichters lacht bald übermütig, bald spottlustig, bald lächelt er unter Tränen. Andersen gehört zu den echten Humoristen, von denen Rosegger sagt: daß sie die Kluft zwischen Kasperl und Bußprediger zu überbrücken vermögen.
In seinem künstlerischen Schaffen nehmen wir kaum eine Entwicklung wahr. Nachdem Andersen sich von Musäus lossagte, in dessen Manier er sein erstes Märchen »Der Tote,« das er später noch einmal erzählt und als »Reisekamerad« (Bd. I, 662) in seine gesammelten Märchen und Geschichten aufgenommen hat, ist er in seinen ersten Schöpfungen ebenso vollendet wie in seinen mittleren und letzten. Wenn auch die Fähigkeit, die Idee klarer zu gestalten, mit den Jahren noch wächst und neue Probleme hinzutreten, so ist er im Gebrauch seiner künstlerischen Mittel von Anfang an erstaunlich sicher, was jeder an der Hand der chronologischen Übersicht der Märchen und Geschichten, die an das Ende des Bandes gestellt worden ist, herausfühlen kann.
Um das Jahr 1860 herum veranstaltete Andersen eine deutsche Ausgabe seiner Märchen und Geschichten, die 112 derselben umfaßte, die viele Jahre in Deutschland als Gesamtausgabe galt. Aber erst im Jahre 1872 schrieb er sein letztes Märchen, so daß ihr die Märchen der letzten zwölf Jahre fehlen, sowie einige Märchen, die nicht mit aufgenommen waren. Zu der sogenannten Gesamtausgabe ist daher dieser Ergänzungsband, der die fehlenden 44 Märchen und Geschichten enthält, hinzugetreten. Dies ist also die einzige deutsche Gesamtausgabe, wenn man von seinen gesammelten Werken absieht, so daß allen Freunden Andersens endlich Gelegenheit gegeben ist, seine Hauptschöpfung im ganzen Umfange kennen zu lernen. An Kinder allein ist dabei nicht gedacht. Es gehört zu den Grundirrtümern über Andersen, daß man glaubt, er habe seine Märchen nur für Kinder geschrieben. Nur bis zum Jahre 1845 trugen seine kleinen Märchenhefte im Titel den Zusatz: »Für Kinder erzählt,« von der Zeit an nannte er die Erzählungen kurzweg: Märchen und Geschichten. Andersen selbst spricht sich über diesen Punkt aus: »Die Kinder interessieren sich mehr für das, was ich Staffage nennen will, die Erwachsenen mehr für die zugrunde liegenden Ideen.«
DER STEIN DES WEISEN
Du kennst doch die Geschichte von Holger Danske? Wir wollen sie dir auch nicht erzählen, sondern nur fragen, ob du dich erinnerst, daß »Holger Danske das große Indien östlich an der Welt Ende gewann, bis an den Baum, welcher der Baum der Sonne genannt wird,« wie Christian Pedersen sagt. Kennst du Christian Pedersen? Es macht nichts, wenn du ihn nicht kennst. Holger Danske verlieh dem Priester Jon Macht und Würde über Indien. Kennst du den Priester Jon? Nein? Es ist auch einerlei, ob du ihn kennst; denn er kommt in dieser Geschichte nicht vor. Du sollst hier von dem Baum der Sonne »in Indien östlich an der Welt Ende« hören, wie die Leute es damals verstanden, die noch keine Geographie gelernt hatten, wie wir heutzutage. Aber das ist auch einerlei.
Der Baum der Sonne war ein prächtiger Baum, wie wir noch keinen gesehen haben und auch du keinen zu sehen bekommen wirst. Die Krone erstreckte sich mehrere Meilen im Umkreis; sie war eigentlich ein ganzer Wald. Jeder ihrer kleinsten Zweige war wieder ein Baum. Es waren Palmen, Buchen, Pinien, Platanen; ja alle Baumarten, die man rings in der Welt finden konnte, schossen hier, wie kleine Zweige, aus den großen Zweigen hervor, und diese glichen mit ihren Krümmungen und Auswüchsen Tälern und Höhen. Sie waren mit einem samtweichen Grün bekleidet und mit Blüten übersät. Jeder Zweig glich einer blumigen Wiese oder einem lieblichen Garten. Die Sonne strahlte in vollem Glanze herab – es war ja der Baum der Sonne – und die Vögel aus aller Welt Ende versammelten sich hier: aus den fernen Wäldern Amerikas, aus den Rosengärten von Damaskus und aus den Waldwildnissen des inneren Afrika, wo Elefanten und Löwen sich einbilden, allein zu regieren. Die Eisvögel, Störche und Schwalben kamen natürlich auch. Aber die Vögel waren nicht die einzigen lebenden Geschöpfe, die hierher kamen. Hirsche, Eichhörnchen, Antilopen und hunderte anderer Tiere, durch Schnelligkeit und Schönheit ausgezeichnet, waren hier zu Hause. Ein großer duftender Garten war ja die Krone des Baumes, und inmitten, wo die allerstärksten Zweige sich wie grüne Berge erstreckten, lag ein Schloß aus Kristall, mit Aussicht über alle Länder der Welt. Jeder Turm erhob sich wie eine Lilie; man konnte in dem Stengel hinaufsteigen; denn dort war eine Treppe. Nun wirst du verstehen können, daß man auf die Blätter hinaustreten konnte, die Altanen glichen, und ganz oben in der Blüte war ein runder, glänzender Festsaal, der kein anderes Dach als den blauen Himmel mit Sonne und Sternen hatte. Ebenso schön – nur in anderer Weise – war es in den unteren weiten Sälen des Schlosses. Rings an den Wänden spiegelte sich die ganze Welt ab. Man konnte alles sehen, was in ihr geschah, so daß man keine Zeitungen zu lesen brauchte, und die gab es hier auch gar nicht. Alles war in lebenden Bildern zu sehen, hätte man es nur sehen wollen oder sehen mögen. Aber zu viel ist zu viel, selbst für den weisesten Mann, und hier wohnte der weiseste Mann. Sein Name ist so schwer auszusprechen, daß du es nicht kannst, und deshalb brauchst du ihn auch nicht zu kennen. Er wußte alles, was ein Mensch wissen kann und jemals wissen wird. Er kannte jede Erfindung, die gemacht war und gemacht werden sollte, aber auch nicht mehr; denn alles hat seine Grenze. Der weise König Salomo war nur halb so klug und war doch sehr klug. Der weise Mann herrschte über die Naturkräfte, über mächtige Geister; ja der Tod selbst mußte ihm jeden Morgen Nachricht bringen und die Liste derjenigen vorlegen, die an dem Tage sterben sollten. Aber auch der König Salomo mußte sterben, und das war der Gedanke, welcher den Forschergeist, den mächtigen Herrn im Schlosse des Sonnenbaums mit lebhafter Unruhe erfüllte. Auch er sollte einst sterben, wie hoch er auch in der Weisheit über den Menschen stand; das wußte er. Seine Kinder sollten sterben; wie die Blätter des Waldes sollten sie niedersinken und Staub werden. Er sah die Menschengeschlechter wie das Laub der Bäume vergehen und neue an ihre Stelle treten; aber die Blätter, die niederfielen, wuchsen niemals wieder; sie wurden zu Staub, zu anderen Pflanzenteilen. Was geschah mit den Menschen, wenn der Engel des Todes kam? Was war der Tod? Der Körper löste sich auf, und die Seele – ja, was war mit ihr? Wo blieb sie? Wohin ging sie? »Zum ewigen Leben,« sagte tröstend die Religion. Aber wie war der Übergang? Wie lebt man? Wo lebt man? In dem Himmel, sagten die Frommen, »aufwärts gehen wir.« »Aufwärts,« wiederholte der Weise und sah gegen die Sonne und die Sterne. »Aufwärts,« und er sah aus der Kugelgestalt der Erde, daß oben und unten ein und dasselbe ist, je nach dem Ort, den man auf der schwebenden Kugel einnimmt, und stieg er so hoch, wie die höchsten Berge der Erde ihre Gipfel erheben, so wurde die Luft, die wir klar und durchsichtig »den reinen Himmel« nennen, zur kohlenschwarzen Finsternis, gleich einem ausgespannten Tuch, und die Sonne glühte ohne Strahlen und unsere Erde lag in einem orangegelben Nebel eingehüllt. Begrenzt ist das leibliche Auge, begrenzt auch das geistige Auge! Wie gering ist unser Wissen! Selbst der Weiseste weiß nur wenig von dem, was uns das Wichtigste erscheint.
In der Geheimkammer des Schlosses lag der größte irdische Schatz: »Das Buch der Wahrheit.« Er las es Blatt für Blatt. Es ist ein Buch, in welchem jeder Mensch lesen kann, aber nur stückweise. Die Schrift zittert vor manchem Auge, so daß es die Worte nicht zu entziffern vermag; auf einigen Blättern ist die Schrift so blaß und undeutlich, daß man dort nur ein leeres Blatt sieht. Je weiser man ist, desto mehr kann man lesen, und der Weiseste liest das meiste. Er wußte dazu das Licht der Sterne, der Sonne, verborgener Kräfte und der Geister zu sammeln, und bei diesem verstärkten Schein trat auf den Blättern mehr der Schrift hervor. Aber bei dem Abschnitt des Buches mit der Überschrift: »Das Leben nach dem Tode« war nicht einmal ein Tipfelchen zu sehen. Das betrübte ihn! Sollte er hier auf der Erde nicht ein Licht finden können, wodurch ihm sichtbar wurde, was in dem Buche der Wahrheit stand?
Wie der weise König Salomo verstand er die Sprache der Tiere. Er lauschte ihrem Gesange und ihren Gesprächen; aber er erfuhr von ihnen über jene Frage nichts Neues. Er entdeckte die Kräfte der Pflanzen und Metalle, Kräfte, um Krankheiten zu vertreiben, den Tod zu vertreiben, aber nicht, ihn aus der Welt zu schaffen. In allem, was erschaffen war und er erreichen konnte, suchte er das Licht zu finden, das die Gewißheit eines ewigen Lebens zu beleuchten vermöchte; aber er fand es nicht. Das Buch der Wahrheit lag wie mit unbeschriebenen Blättern vor ihm. Das Christentum zeigte ihm in der Bibel die Worte der Vertröstung auf ein ewiges Leben; aber er wollte es in seinem Buche lesen, und dort sah er nichts.
Fünf Kinder hatte er, vier Söhne, so wohlunterrichtet, wie der weiseste Vater seine Kinder unterrichten kann, und eine Tochter, schön, sanft und klug, aber blind. Doch das schien für sie kein Mangel zu sein; Vater und Brüder waren ihre Augen, und ihre Liebe ließ sie den Mangel des Augenlichts nicht fühlen.
Niemals hatten sich die Söhne weiter aus den Sälen des Schlosses entfernt, als sich die Zweige des Baumes erstreckten, die Schwester noch weniger. Sie waren glücklich in dem Heim, in dem Lande ihrer Kindheit, in dem schönen, duftenden Baume der Sonne, Wie alle Kinder hörten sie gern erzählen, und der Vater erzählte ihnen vieles, was andere Kinder nicht verstanden haben würden; aber sie waren ja auch so klug, wie bei uns die alten Menschen. Er erklärte ihnen, was sie in den lebenden Bildern an den Wänden des Schlosses sahen, die Tätigkeit der Menschen und den Gang der Begebenheiten in allen Ländern der Erde, und oft wünschten die Söhne, daß sie mit draußen wären und an allen den Großtaten teilnehmen könnten. Und der Vater sagte ihnen dann, daß es schwer und ungerecht in der Welt zuginge, daß es nicht ganz so wäre, wie sie es aus ihrer schönen Kinderwelt sahen. Er erzählte ihnen von dem Schönen, Wahren und Guten, sagte, daß diese drei Dinge die Welt zusammenhielten und daß unter dem Drucke, den sie erlitten, sie zu einem Edelstein würden, klarer als das Wasser des Diamanten. Sein Glanz hätte Wert vor Gott; er überstrahlte alles und wäre eigentlich das, was man »Den Stein des Weisen« nenne. Er sagte ihnen auch, daß, wie man durch die Schöpfung zur Erkenntnis Gottes käme, so käme man durch die Menschen zur Erkenntnis, daß es einen solchen Edelstein gäbe. Mehr könnte er ihnen nicht sagen; mehr wüßte er nicht. Diese Erzählung wäre nun anderen Kindern zu schwer verständlich gewesen; aber sie verstanden dieselbe, und später verstehen die anderen sie auch.
Sie fragten ihren Vater nach dem Schönen, Wahren und Guten, und er erklärte es ihnen, sagte ihnen gar vieles, sagte auch, daß Gott, als er die Menschen aus Erde schuf, seinem Geschöpf fünf Küsse gegeben hätte: Feuerküsse, Herzensküsse, einige Gottesküsse, und daß sie es sind, was wir die fünf Sinne nennen. Durch sie wird das Schöne, Wahre und Gute gesehen, empfunden und verstanden; durch sie wird es geschätzt, beschirmt und gefördert. Fünf Sinnestätigkeiten sind für innen und außen gegeben, sind Wurzel und Spitze, Körper und Geist.
Darüber dachten die Kinder nun häufig nach; das war in ihren Gedanken Tag und Nacht. Da träumte dem Ältesten ein schöner Traum, und seltsam genug, der zweite Bruder träumte ihn auch, und der dritte träumte ihn und der vierte ebenfalls. Jedem von ihnen träumte dasselbe, träumte, er zöge in die weite Welt hinaus und fände den Stein des Weisen. Wie eine leuchtende Flamme strahlte er auf seiner Stirn, als er im Morgenröte auf seinem pfeilschnellen Pferde über die samtgrüne Wiese des heimatlichen Gartens in das väterliche Schloß zurückritt und der Edelstein würfe ein so himmlisches Licht und einen solchen Glanz über die Blätter des Buches, daß sichtbar würde, was dort über das Leben jenseits des Grabes geschrieben stand. Der Schwester träumte nicht, in die weite Welt hinauszukommen; das kam ihr nicht in den Sinn; ihre Welt war das Haus ihres Vaters.
»Ich reite in die weite Welt hinaus,« sagte der Älteste; »ich muß erproben, wie es dort zugeht und mich unter den Menschen umhertummeln. Nur das Gute und Wahre will ich; mit ihnen will ich das Schöne verteidigen. Vieles soll anders werden, wenn ich dabei bin.« Ja, er dachte kühn und groß, wie wir alle daheim hinter dem Ofen denken, ehe wir in die Welt hinauskommen und Regen und Rauch und Dornengestrüpp kennen lernen.
Die fünf Sinne waren bei ihm, wie bei seinen Brüdern, höchst vortrefflich. Aber ein Sinn übertraf alle übrigen an Stärke und Ausbildung. Bei dem Ältesten war es das Gesicht, das ihm hauptsächlich nützen sollte. Er hätte Augen für alle Zeiten, sagte er, Augen für alle Völker, Augen, die gleich gut in das Erdinnere, wo die verborgenen Schätze liegen, wie in die menschliche Brust sehen könnten, als wäre nur eine Scheibe davor, das heißt, es sah mehr als wir auf der Wange sehen können, die errötet und erbleicht, und in dem Auge, das weint und lacht, Hirsche und Antilopen folgten ihm bis an die westliche Grenze, und dann kamen die wilden Schwäne und flogen gegen Nordwesten. Ihnen folgte er, und so war er draußen in der weiten Welt, fern von dem Lande seines Vaters, das sich erstreckt »östlich an der Welt Ende.«
Na, wie er die Augen aufsperrte! Es gab viel zu sehen, und es ist doch etwas anderes, die Orte und die Dinge selbst zu sehen, als nur die Bilder derselben, wenn sie auch noch so gut sind, und sie waren außerordentlich gut daheim in dem Schlosse seines Vaters. Er war nahe daran, im ersten Augenblick beide Augen zu verlieren vor Erstaunen über all das Gewimmel, all den Fastnachtsschmuck, der sich ihm überall als das Schöne aufdrängte. Aber er verlor sie nicht; er hatte eine andere Bestimmung für sie.
Gründlich und ehrlich wollte er in der Erkenntnis des Schönen, Wahren und Guten zu Werke gehen. Aber wie stand es damit? Er sah, wie oft das Häßliche den Preis erhielt, den das Schöne haben sollte, wie das Gute oft nicht bemerkt und die Mittelmäßigkeit belacht und nicht belächelt wurde. Die Menschen sahen auf den Namen und nicht auf den Wert, sie sahen auf das Kleid und nicht auf die Person, sie sahen auf den Beruf und nicht auf die Berufung. Das konnte nun nicht anders sein.
»Ja, ich muß wohl ordentlich eingreifen,« dachte er, und er griff ein. Aber da er das Wahre suchte, kam der Teufel, welcher der Vater der Lüge, ja die Lüge selbst ist. Gern hätte er dem Seher sofort beide Augen ausgeschlagen; aber das ist zu grob. Der Teufel geht feiner zu Werke. Er ließ ihn das Wahre suchen, ließ ihn das Wahre und das Gute sehen. Aber wenn er es sah, so blies ihm der Teufel einen Splitter in die Augen, in beide Augen, einen Splitter nach dem andern. Das war nicht gut für das Gesicht, selbst nicht für das beste, und der Teufel blies den Splitter auf, daß er zu einem Balken wurde, und dann war es mit dem Sehen vorbei. Der Seher stand da wie ein blinder Mann mitten in der weiten Welt und konnte ihr nicht mehr trauen. Er gab seine guten Gedanken über die Welt und sich selbst auf, und wenn man die Welt und sich selbst aufgibt – ja, dann ist es mit einem vorbei.
»Vorbei,« sangen die wilden Schwäne, die über das Meer gen Osten flogen. Und das waren keine guten Nachrichten für die daheim.
»Dem Seher ist es übel ergangen,« sagte der zweite Bruder, »aber dem Hörer wird es besser ergehen.« Der Gehörsinn war es, den er besonders geschärft hatte. Er konnte das Gras wachsen hören, so weit hatte er es gebracht.
Er nahm herzlichen Abschied und ritt mit guten Fähigkeiten und guten Vorsätzen von dannen. Die Schwalben folgten ihm, und er folgte den Schwänen, und so war er fern von der Heimat, draußen in der weiten Welt
Man kann aber auch zu viel von einem guten Dinge haben; davon sollte er sich bald überzeugen. Sein Gehör war zu fein, er hörte das Gras wachsen. Aber deshalb hörte er auch jedes Menschen Herz in Freude und Schmerz schlagen. Es war ihm, als ob die ganze Welt eine große Uhrmacherwerkstätte wäre, wo alle Uhren tick! tack! gingen und alle Turmuhren bim! bam! schlugen. Nein, es war nicht zu ertragen! Aber er hielt die Ohren steif, so lange er konnte. Doch zuletzt wurde all der Lärm und all das Geschrei für einen Menschen zu gewaltig. Es kamen Straßenjungen von sechzig Jahren – das Alter tut es ja nicht – und schrien; aber dazu hätte man noch lächeln können. Allein nun kamen die Klatschereien, die durch alle Häuser, Gassen und Straßen bis auf die Landstraße hinaus zischelten; Lügen wurden laut und spielten die Herren; die Narrenschellen erklangen und wollten Kirchenglocken sein. Das wurde zu arg für den Hörer, und er steckte die Finger in beide Ohren. – Aber auch jetzt noch hörte er falschen Sang und schlimmen Klang, Geschwätz und Geklätsch, zäh verteidigte Behauptungen, die keinen sauren Hering wert waren, über die Zunge schwirren, so daß es in diesem trefflichen Umgange nur so knickte und knackte. Das war ein Schreien und Lärmen, ein Tosen und Krachen außen und innen! Gott behüte uns! Es war nicht auszuhalten; es war zu laut! Er steckte die Finger tiefer in seine beiden Ohren, immer tiefer, und da sprang das Trommelfell. Nun hörte er nichts mehr, nicht einmal das Schöne, Wahre und Gute, und doch sollte das Gehör die Brücke zu seinen Gedanken sein. Er wurde still und mißtrauisch, glaubte keinem, glaubte zuletzt sich selbst nicht mehr, und das ist schlimm. Er würde den mächtigen Edelstein nicht finden und heimbringen. Und er gab das Suchen auf und sich selbst, und das ist das allerschlimmste. Die Vögel, die gen Osten flogen, verbreiteten die Kunde von seinem Unglück, bis sie das Schloß seines Vaters erreichte. Briefe kamen nicht an; es ging ja auch keine Post dahin.
»Nun will ich es versuchen,« sagte der dritte; »ich habe eine feine Nase,« und das war nicht gerade fein gesagt. Aber er sprach so, und man mußte ihn nehmen, wie er war. Er war die gute Laune selbst und war ein Dichter, ein wirklicher Dichter. Er konnte singen, was er nicht sagen konnte. Vieles fiel ihm weit früher als anderen ein. »Ich rieche Lunte,« sagte er, und es war auch der Geruch, der im höchsten Grade bei ihm entwickelt war und dem er auch ein großes Gebiet im Reiche des Schönen einräumte. »Einer liebt den Apfelduft und ein anderer den Stallduft,« sagte er, »jede Duftregion im Reiche des Schönen hat ihr Publikum.« Einige fühlen sich heimisch in der Kneipenluft bei dem qualmenden Docht des Talglichtes, wo der Schnapsgestank sich mit schlechtem Tabaksrauch vermischt; andere sitzen lieber in dem schwülen Jasminduft und reiben sich mit dem stärksten Nelkenöl ein, das man nur vertragen kann. Andere suchen die gesunde Seeluft, die frische Brise auf oder steigen auf die hohen Berge und sehen auf das geschäftige Tagesleben hinab.« Ja, das sagte er! Es war, als ob er schon früher draußen in der Welt gewesen wäre, mit den Menschen gelebt und sie kennen gelernt hätte. Aber er hatte diese Kenntnis aus sich selbst: es war der Dichter in ihm, das Talent, das Gott ihm als ein Geschenk in die Wiege gelegt hatte.
Nun sagte er dem väterlichen Schloß im Baum der Sonne Lebewohl und schritt durch die Schönheit seiner Heimat. Aber draußen setzte er sich auf einen Strauß, der schneller läuft als ein Pferd. Und als er später die wilden Schwäne sah, schwang er sich auf den Rücken des stärksten. Er liebte die Veränderung, und deshalb flog er hin über das Meer nach fremden Ländern mit großen Wäldern, tiefen Seen, mächtigen Bergen und stolzen Städten. Und wohin er kam, war es als ob ein Sonnenstrahl über die Lande ging. Jede Blüte und jeder Strauch duftete stärker in dem Gefühl, daß ein Freund nahe war, ein Kenner, der sie schützte und verstand. Ja, der verkümmerte Rosenstock erhob seine Zweige, entfaltete seine Blätter und trug die lieblichste Rose. Jeder konnte sie sehen; selbst die schwarze, feuchte Waldschnecke bemerkte ihre Schönheit.
»Ich will der Blume mein Zeichen geben,« sagte die Schnecke. »Nun habe ich sie angespien, anders kann ich es nicht.«
»So geht es gewöhnlich dem Schönen in der Welt,« sagte der Dichter, und er sang ein Lied darüber, sang es auf seine Weise; aber niemand hörte darauf. Deshalb gab er dem Trommelschläger zwei Groschen und eine Pfauenfeder, und dieser setzte das Lied für die Trommel und trommelte es in der Stadt in allen Straßen und Gassen aus. Nun hörten es die Menschen und sagten, daß sie es verständen; es wäre so tief. Und der Dichter durfte nun mehr Lieder singen, und er sang von dem Schönen, dem Wahren und dem Guten, und sie hörten davon in den Kneipen, wo das Talglicht qualmte; sie hörten es auf dem frischen Kleeacker, im Walde und auf dem weiten Meere. Es schien, daß dieser Bruder mehr Glück haben sollte als die beiden andern. Aber das konnte der Teufel nicht dulden und er kam schnell mit fürstlichem und kirchlichem Weihrauch und allem Räucherwerk der Ehre, das sich finden läßt und das der Teufel vortrefflich zu bereiten versteht. Er kam mit dem stärksten Weihrauch, der alle peinigt und selbst einen Engel betäuben kann, wieviel mehr nicht einen armen Dichter. Der Teufel weiß, wie er die Menschen zu nehmen hat. Er nahm den Dichter mit Weihrauch, so daß er rein weg darin war, seine Sendung vergaß, sein Vaterhaus – alles, sich selbst. Er ging auf in Rauch und Beräucherung.
Alle kleinen Vögel trauerten, als sie das hörten, und sangen drei Tage nicht. Die schwarze Waldschnecke wurde noch schwärzer, aber nicht aus Trauer, sondern aus Neid. »Ich bin es, die beräuchert werden müßte,« sagte sie; »denn ich war es, die ihm die Idee zu seinem berühmten Liede gab, das für die Trommel über den Lauf der Welt. Ich war es, die die Rose anspie; ich kann Zeugen dafür herbeischaffen.«
Aber daheim in Indien erscholl darüber keine Botschaft. Alle kleinen Vögel trauerten ja und schwiegen drei Tage, und als die Trauerzeit zu Ende war, ja da war die Trauer so groß gewesen, daß sie vergessen hatten, worüber sie trauerten. Ja, so geht es!
»Nun muß ich in die Welt hinaus,« sagte der vierte, »und wie die andern fortbleiben.« Er hatte gleichfalls eine gute Laune wie der vorige Bruder: aber er war kein Dichter, und gerade deshalb hatte er Grund guter Laune zu sein. Diese beiden hatten Fröhlichkeit ins Schloß gebracht; nun ging die letzte Lust dahin. Gesicht und Gehör sind jederzeit von den Menschen als die bedeutendsten Sinne angesehen worden, die man sich besonders stark und scharf wünscht. Die andern drei Sinne werden als minder wesentlich angesehen. Aber das war durchaus nicht die Meinung dieses Sohnes; er hatte besonders den Geschmack in allen Bedeutungen entwickelt, die es gibt, und dieser hat eine große Macht, ein mächtiges Regiment. Er regiert über das, was durch den Mund geht und auch über das, was durch den Geist geht. Deshalb schmeckte er alles, was in der Pfanne und im Topfe, in der Flasche und im Fasse war. Das wäre das Grobe in seinem Geschäft, meinte er. Jeder Mensch war ihm eine Pfanne, in der es kochte, jedes Land eine ungeheure Küche, geistig genommen. Das war das Feine, und nun wollte er hinaus, um das Feine zu erproben.
»Vielleicht ist das Glück mir günstiger als meinen Brüdern,« sagte er. »Ich reise fort; aber welches Beförderungsmittel soll ich nehmen? Sind die Luftballons schon erfunden?« fragte er seinen Vater, der ja von allen Erfindungen wußte, die gemacht waren oder gemacht werden sollten. Aber die Luftballons waren noch nicht erfunden, nicht einmal die Dampfschiffe und die Eisenbahnen. »Ja, deshalb nehme ich gerade einen Luftballon,« sagte er, »mein Vater weiß ja, wie sie gemacht und gesteuert werden; ich lerne es. Niemand kennt die Erfindung und deshalb glauben sie, daß es eine Lufterscheinung sei. Wenn ich den Ballon gebraucht habe, verbrenne ich ihn. Deshalb mußt du mir einige Stücke der zukünftigen Erfindung mitgeben, die man ›chemische Streichhölzer‹ nennt.«
Alles das erhielt er, und dann flog er fort. Die Vögel folgten ihm länger als sie den andern Brüdern gefolgt waren. Sie wollten gern sehen, wie es mit dem Fluge ging, und immer mehr kamen hinzu; denn sie waren neugierig und meinten, es wäre ein neuer Vogel, der flöge. Ja, er bekam Begleitung! Die Luft wurde schwarz von Vögeln, sie kamen wie eine große Wolke, wie ein Heuschreckenschwarm über das Land Ägypten gezogen, und so war er draußen in der weiten Welt.
»Ich habe einen guten Freund und Hilfsmann im Ostwind gehabt,« sagte er. »Ostwind und Westwind, meinst du,« sagten die Winde. »Wir zwei haben miteinander abgewechselt, sonst wärest du nicht nordwestlich gekommen.«
Aber er hörte nicht, was die Winde sagten, und das kann auch einerlei sein. Die Vögel folgten ihm nun auch nicht länger. Als sie zahlreich beisammen waren, wurden einige von ihnen der Fahrt überdrüssig. »Das hieße zu viel aus einer Sache machen,« sagten sie. »Er wird noch eingebildet; es ist nicht des Nachfliegens wert; es ist nichts, es ist abgeschmackt,« und deshalb blieben sie zurück; sie blieben alle zusammen zurück; das Ganze war ja nichts.
Und der Ballon senkte sich über einer der größten Städte, und der Luftschiffer setzte sich auf den höchsten Ort, auf die Turmspitze. Der Ballon ging wieder in die Höhe; das sollte er nicht. Wo er abblieb, läßt sich nicht gut sagen; aber das ist auch gleichgültig, denn er war ja damals noch nicht erfunden.
Dort saß er nun hoch oben auf der Turmspitze; die Vögel flogen nicht zu ihm; sie waren seiner müde und er war ihrer müde. Alle Schornsteine der Stadt rauchten und rochen.
»Das sind Altäre, die für dich errichtet sind,« sagte der Wind; er wollte ihm gern etwas Angenehmes sagen. Keck genug saß er da und sah auf die Leute in der Straße. Da ging einer, der stolz auf seinen Geldsack war; ein anderer war stolz auf seinen Schlüssel, den er hinten trug, obgleich er nichts zu verschließen hatte; noch ein anderer war stolz auf sein Kleid, in das die Motten kamen, und ein vierter war stolz auf seine Gestalt, in die die Würmer kamen.
»Eitelkeit! – Ja, ich muß wohl bald hinunter, und den Topf umrühren und schmecken,« sagte er, »aber ich will hier noch ein bißchen sitzen; der Wind kitzelt mich so schön auf den Rücken, das ist eine große Annehmlichkeit. Ich bleibe hier sitzen, solange der Wind weht. Ich will meine Ruhe haben. Es ist gut des Morgens lange zu liegen, wenn man viel zu beschicken hat, sagt der Faule. Aber Faulheit ist die Wurzel alles Schlechten, und Schlechtes gibt es nicht in unserer Familie; das sage ich, und das wird jeder Sohn auf der Straße sagen. Ich bleibe sitzen, solange der Wind weht; er schmeckt mir.«
Und er blieb sitzen. Aber er saß auf dem Wetterhahn des Turmes, und der drehte und drehte sich mit ihm, so daß er glaubte, es wäre stets derselbe Wind. Er blieb sitzen, und er durfte lange dort sitzen und schmecken.
Aber in Indien, in dem Schlosse auf dem Baume der Sonne war es leer und still geworden, da die Brüder einer nach dem andern fortgezogen waren.
»Es geht ihnen nicht gut,« sagte der Vater, »niemals bringen sie mir den leuchtenden Edelstein; sie finden ihn nicht; sie sind fort; sie sind tot« – und er beugte sich über das Buch der Wahrheit und starrte auf die Seite, wo er über das Leben nach dem Tode lesen wollte; aber es gab für ihn nichts zu sehen und zu erfahren.
Die blinde Tochter war sein Trost und seine Freude; innig und zärtlich schloß sie sich ihm an. Um seiner Freude, seines Glückes willen wünschte sie, daß der köstliche Edelstein gefunden und heimgebracht würde. In Trauer und Sehnsucht dachte sie an ihre Brüder. Wo waren sie? Wo lebten sie? Gar innig wünschte sie von ihnen träumen zu können; aber seltsam genug, selbst im Traum konnte sie sich nicht mit ihnen vereinigen. Endlich eines Nachts träumte ihr, daß ihre Stimmen zu ihr drangen, sie nannten, sie riefen fernher aus der weiten Welt. Und sie mußte hinaus, weit, weit fort, und doch schien es ihr, als wäre sie immer noch in ihres Vaters Hause. Die Brüder traf sie nicht; aber in ihrer Hand fühlte sie, brannte es wie Feuer; doch es schmerzte nicht. Sie hielt den leuchtenden Edelstein und brachte ihn ihrem Vater. Als sie erwachte, glaubte sie einen Augenblick, daß sie ihn noch hielte; aber es war nur der Spinnrocken, über welchen sie ihre Hand geballt hatte. In den langen Nächten hatte sie unaufhörlich gesponnen, und auf der Spindel war ein Faden feiner als Spinngewebe; Menschenaugen konnten den einzelnen Faden nicht gewahren. Sie hatte ihn mit ihren Tränen genetzt, und er ward stark wie ein Ankertau. Sie erhob sich, ihr Entschluß war gefaßt; der Traum sollte verwirklicht werden. Es war Nacht; ihr Vater schlief. Sie küßte ihm die Hand, nahm ihre Spindel und band das eine Ende des Fadens an das Haus ihres Vaters fest; sonst würde sie, die Blinde, ja niemals wieder heim finden. An dem Faden hielt sie sich, auf ihn verließ sie sich und nicht auf sich und andere. Sie pflückte vier Blätter von dem Baum der Sonne; die wollte sie Wind und Wetter übergeben, die sie den Brüdern als Brief und Gruß bringen sollten, wenn sie dieselben draußen in der weiten Welt nicht treffen würde. Wie würde es ihr dort wohl gehen, dem armen blinden Kinde. Doch sie brauchte sich nur an den unsichtbaren Faden zu halten. Vor allem andern besaß sie eine Eigenschaft, das tiefe Gefühl, und es war ihr als hätte sie Augen in den Fingerspitzen und Ohren in dem Herzen.
Und so ging es hinaus in die bewegte, lärmende, wunderliche Welt, und wohin sie kam, wurde der Himmel sonnenklar; sie konnte die warmen Strahlen fühlen. Der Regenbogen spannte sich aus der schwarzen Wolke hin durch die blaue Luft. Sie hörte den Gesang der Vögel; sie empfand den Duft der Orangen- und Apfelgärten so stark, daß sie glaubte, sie könnte ihn schmecken. Sanfte Töne und schöne Gesänge drangen zu ihr, aber auch Geheul und Geschrei und miteinander widerstreitende Gedanken und Urteile. Aber in dem tiefsten Winkel ihres Herzens ertönten die Herzensklänge und Gedankenklänge der Menschheit. Es erbrauste im Chor:
Das Erdenleben ist nur Rauch,Eine finstre Nacht voll Leiden.
Allein es ertönte auch das Lied:
Und oft ist's auch ein RosenstrauchVoll Sonnenschein und Freuden.
Und bitter erklang es:
An sich allein denkt jeder nur,Die Wahrheit laß dir geben.
Dann ertönte die Gegenstrophe:
Es geht der Liebe ElfenspurHin durch das Erdenleben.
Sie hörte auch diese Worte:
Ein wenig klein ist unsere Welt,Voll Fehler, unvollkommen.
Und sie vernahm auch:
Und mancher gab schon Gut und Geld,Was nicht die Welt vernommen.
Und es sang rings im brausenden Chor:
Gießt über alles nur Hohn und Spott,Und bellt mit den Hunden zusammen.
Dann ertönte es im Herzen des blinden Mädchens:
Vertrau' auf dich, halt' fest an Gott,Geschehe dann sein Wille. Amen.
Und wo sie im Kreise der Männer und Frauen, bei alt und jung erschien, da leuchtete in die Seelen die Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen; wohin sie kam, in die Werkstätte des Künstlers, in den festlichen Saal des Reichen, in die Fabrik zwischen surrenden Rädern, war es als ob Sonnenstrahlen kämen, Saiten erklängen, Blumen dufteten und der erfrischende Tautropfen auf das durstende Blatt fiele. Aber der Teufel konnte sich nicht darein finden; er hat mehr Verstand als zehntausend Männer, und darum erfand er ein Mittel, um sich zu helfen. Er ging zum Sumpf, nahm Blasen des faulenden Wassers, ließ das siebenfache Echo von Worten der Lüge über sie erdröhnen, um sie stark zu machen. Er stieß bezahlte Ehrenverse und lügenhafte Leichenpredigten zu Pulver, so viel zu finden waren, kochte sie in Tränen, welche der Neid geweint hatte, streute Schminke darauf, welche von der gelblichen Wange eines alten Fräuleins abgeschabt war, und schuf daraus ein Mädchen, welches in Gestalt und Bewegung dem blinden, segensreichen Mädchen, dem milden Engel des Gefühls, wie die Menschen es nannten, gleich war. Und so hatte der Teufel das Spiel gewonnen. Die Welt wußte nicht, welche von den beiden die rechte war, und wie sollte es die Welt auch wissen:
»Vertrau' auf dich, halt' fest an Gott,
Geschehe dann sein Wille. Amen,«
sang das blinde Mädchen voll Vertrauen. Die vier grünen Blätter vom Baume der Sonne übergab sie Wind und Wetter, um sie ihren Brüdern als Brief und Gruß zu bringen. Und sie war überzeugt, daß es erfüllt würde, ja, es würde auch erfüllt werden, daß der Edelstein sich fände, der alle irdische Herrlichkeit überstrahlte. Von der Stirn der Menschheit würde er bis zum Hause ihres Vaters strahlen.
»Bis zum Hause meines Vaters,« wiederholte sie. »Ja, auf der Erde ist die Stätte des Edelsteins, und mehr als diese Gewißheit bringe ich heim. Seine Glut empfinde ich, sie wird größer und größer in meiner geschlossenen Hand. Jedes Wahrheitskörnchen, fein genug, daß der scharfe Wind es trägt und fortführt, fing ich auf und verwahrte ich. Ich ließ es mit dem Duft alles Schönen durchdringen, woran die Welt so reich ist, selbst für den Blinden. Ich nahm den Klang vom Herzschlag des Menschen im Guten und legte ihn hinein. Ein Stäubchen ist das Ganze nur, was ich bringe, aber doch der Staub des gesuchten Edelsteins in reicher Fülle: meine ganze Hand ist voll davon.« Und sie streckte sie aus gegen ihren Vater. Sie war in der Heimat. Mit Gedankenschnelle war sie dorthin gekommen, da sie den unsichtbaren Faden zum Hause ihres Vaters nicht losgelassen hatte.
Die bösen Mächte fuhren mit dem Getöse des Sturmes hin über den Baum der Sonne und drängten sich mit einem Windstoß durch die geöffnete Tür in die Geheimkammer.
»Dort weht es hin,« rief der Vater, und griff nach der Hand, welche geöffnet war.
»Nein,« antwortete sie mit ruhiger Bestimmtheit, »es kann nicht fortwehen: ich fühle die Strahlen meine Seele erwärmen.«
Der Vater sah eine leuchtende Flamme; wie funkelnder Staub fuhr es aus ihrer Hand hin über das weiße Blatt des Buches, das die Gewißheit eines ewigen Lebens verkünden sollte. Im blendenden Glanze stand dort eine Schrift, ein einziges sichtbares Wort, nur das eine Wort:
»Glaube.«
Und bei ihnen waren wieder die vier Brüder. Das Heimweh hatte sie ergriffen und geführt, als die grünen Blätter auf ihre Brust niederfielen. Sie waren gekommen; die Zugvögel folgten, und Hirsch und Antilopen und alle Tiere des Waldes. Sie wollten auch an der Freude teilnehmen. Und weshalb sollten es die Tiere nicht, wenn sie es können.
Und wie oft haben wir es gesehen, wenn die Sonne durch ein Loch in der Tür in die stauberfüllte Stube scheint, daß eine schimmernde Staubsäule sich dreht. So, – aber nicht so plump und armselig wie sie, selbst der Regenbogen ist schwerfällig und in den Farben nicht kräftig genug gegen den Anblick, der sich hier zeigte – so erhob sich von dem Blatte des Buches, von dem leuchtenden Wort: »Glaube,« jedes Stäubchen der Wahrheit mit dem Glanze des Schönen, dem Klange des Guten, strahlte stärker als die Feuersäule in der Nacht, als Moses mit Israel nach Kanaan zog. Aus dem Worte: »Glaube« führt die Brücke der Hoffnung zur ewigen Liebe in die Unendlichkeit.
DES HAGESTOLZEN NACHTMÜTZE
Es gibt in Kopenhagen eine Straße, die den wunderlichen Namen »Hüskenstraße« führt. Weshalb heißt sie so und was soll es bedeuten? Es soll deutsch sein; aber man tut damit der deutschen Sprache unrecht. »Häuschen« sollte man sagen, denn das bedeutet kleine Häuser. Sie waren damals – und das war vor vielen Jahren – nicht viel mehr als hölzerne Buden, wie sie jetzt noch auf Jahrmärkten aufgeschlagen werden. Etwas größer waren sie wohl und hatten auch Fenster; aber die Scheiben waren aus Horn oder einer Tierblase; denn in jener Zeit waren gläserne Scheiben noch sehr teuer. Allein sie liegt auch so weit zurück, daß Großvaters Großvater, als er davon erzählte, auch schon »in alten Tagen« sagte. Mehrere hundert Jahre sind seitdem verflossen.
Die reichen Kaufherren aus Bremen und Lübeck trieben Handel in Kopenhagen. Selbst kamen sie nicht hinauf; aber sie schickten treue Diener, und diese wohnten in den hölzernen Buden der »Kleinhäusergasse« und verkauften Bier und Gewürze. Das deutsche Bier war vortrefflich, und es gab viele Sorten, wie Bremer-, Prysinger-, Emserbier und Braunschweiger Mumme. Dazu die vielen Gewürze, wie Safran, Anis, Ingwer und Pfeffer; ja dieser war der Hauptartikel, und deshalb führten die deutschen Handlungsdiener den Namen »Pfefferhöker.« Sie hatten in der Heimat die Verpflichtung eingehen müssen, sich dort oben nicht zu verheiraten, und manche derselben wurden darüber alt. Sie mußten alles selbst besorgen, ihre Betten machen und Feuer anlegen. Es gab gar einsame alte Junggesellen unter ihnen mit eigenartiger Denkart und eigenartigen Gewohnheiten. Nach ihnen nannte man jede ledige Mannsperson, die in ein gewisses gesetztes Alter gekommen war, einen Pfefferhöker. Das alles muß man wissen, um die folgende Geschichte zu verstehen.
Man macht sich lustig über den »Pfefferhöker,« sagt, er solle die Nachtmütze aufsetzen, sie über die Augen ziehen und zu Bett gehen:
»Schneide, schneide einen Span,Du armer Hagestolz,Geh mit der Nachtmütze zu BettUnd zünd' dir selbst den Kienspan an.«
Ja, so singt man von ihnen: so verspottet man den Pfefferhöker und seine Nachtmütze – gerade weil man sie so wenig kennt. Ach! die Nachtmütze soll sich niemand wünschen. Und weshalb nicht? Hört!
In alten Zeiten war die Kleinhäusergasse nicht gepflastert; Loch war neben Loch, wie in einem ausgefahrenen Hohlwege. Und eng war sie: die Häuser erhoben sich nebeneinander und so nahe gegenüber, daß im Sommer oft ein Seil quer über die Straße von einer Wohnung zur andern gezogen wurde, und es zwischen ihnen immer recht stark nach Pfeffer, Anis und Ingwer duftete. Hinter dem Ladentische standen nicht viele junge Burschen, im Gegenteil es waren meist recht alte Gesellen, und sie gingen durchaus nicht, wie wir es uns denken mögen, in Perücke und Nachtmütze, in Kniehosen und bis an den Hals geschlossenen Westen und Röcken. Nein, so war des Großvaters Großvater gekleidet und so ist er auch gemalt worden. Aber der Pfefferhöker hatte nicht die Mittel, sich malen zu lassen, und doch hätte es Wert für uns, von einem derselben ein Bild zu besitzen, wie sie hinter dem Tische standen, oder an Feiertagen in die Kirche gingen. Sie trugen einen breitkrempigen hohen Hut, und oft steckte einer der jüngsten Pfefferhöker eine Feder an denselben. Ein leinener Klappkragen verdeckte das wollene Hemd; das enganschließende Wams war bis oben zugeknöpft; der Mantel hing lose darüber und die Hosen reichten bis zu den breiten Schuhen; denn Strümpfe trugen sie nicht. In dem Gürtel steckte ihr Eßgeschirr, Messer und Löffel, und auch noch ein langes Messer zur Verteidigung, und das mußten sie damals häufig gebrauchen. Genau so ging der alte Anton, einer der ältesten Pfefferhöker der Kleinhäusergasse, an Feiertagen. Nur trug er nicht den hohen Hut, sondern eine Kapuze und darunter eine gestrickte Mütze, eine richtige Nachtmütze, an die er sich so gewöhnt hatte, daß er sie immer aufbehielt, und er besaß zwei davon. Sein Bild war leicht zu malen; denn er war dürr wie ein Stecken, hatte Falten um Mund und Augen, lange, knochige Finger und graubuschige Augenbrauen. Über dem linken Auge hing ein ganzer Büschel Haare herab; schön war es gerade nicht; aber es machte ihn leicht kenntlich. Man wußte von ihm, daß er aus Bremen war; aber es war nicht seine wirkliche Heimat; dort wohnte nur sein Herr. Er selber stammte aus Thüringen, aus der Stadt Eisenach unterhalb der Wartburg. Davon erzählte der alte Anton nicht oft; aber er dachte desto mehr daran.
Die alten Burschen der Straße kamen nur selten zusammen; gewöhnlich blieb jeder in seinem Häuschen, das er zeitig am Abend schloß. Und dann war es dort dunkel, und nur ein matter Lichtschein fiel durch die kleine Hornscheibe unterhalb des Daches, wo gewöhnlich der alte Diener mit einem deutschen Gesangbuche auf dem Bette saß und ein Abendlied sang, oder er ging bis spät in die Nacht hin und her und tat dies und das. Lustig war es sicher nicht. Als Fremder in einem fremden Lande leben, ist ein bitter Ding; denn niemand beachtet ihn, außer wenn er im Wege steht.
Oft, wenn es draußen stockfinster war und der Regen herabströmte, konnte es in dieser Gasse recht unfreundlich und öde sein. Laternen sah man nicht, außer einer recht kleinen. Sie hing von dem einen Ende der Straße herab vor dem Bilde der Jungfrau Maria, das auf die Mauer gemalt war. Man hörte den Regen ordentlich auf das Gebälk der nahen Schloßinsel, wohin das andere Ende der Straße führte, rinnen und klatschen. Solche Abende waren lang und einsam, wenn man nicht etwas vornahm. Aus- und Einpacken, Tüten kleben oder die Wagschale putzen ist nicht jeden Tag nötig; aber dann nimmt man eben etwas anderes vor, und das tat der alte Anton auch. Er besserte selbst sein Zeug aus und flickte seine Schuhe. Ging er dann endlich zu Bett, dann behielt er seiner Gewohnheit gemäß die Nachtmütze auf und zog sie nur tiefer herab. Aber bald darauf zog er sie wieder hoch, um nachzusehen, ob das Licht auch gut ausgelöscht wäre. Er fühlte es an, preßte den Docht zusammen, legte sich dann auf die Seite und zog die Nachtmütze wieder herab. Aber plötzlich kam ihm der Gedanke, ob wohl in dem kleinen Kohlenbecken jede Kohle ausgebrannt oder ausgelöscht wäre. Ein kleiner Funke könnte doch noch vorhanden sein, zünden und viel Verdruß bereiten. Und er stand wieder aus seinem Bette auf, stieg die Leiter hinab, – denn eine Treppe konnte man es nicht nennen – und wenn er zu dem Kohlenbecken kam, war kein Funke zu sehen, und er konnte wieder gehen. Aber er hatte kaum den halben Weg gemacht, als er unsicher war, ob auch die eisernen Stangen an die Tür gelegt und die Fensterläden durch Krampen wohl befestigt wären. Ja, da mußte er wieder auf seinen dünnen Beinen niedersteigen. Ihn fror und die Zähne klapperten ihm, als er endlich ins Bett kroch; denn die Kälte macht sich am fühlbarsten, wenn sie weiß, daß sie fort soll. Er zog die Decke höher hinauf, die Nachtmütze tiefer über seine Augen und wandte seine Gedanken von dem Handel und den Beschwerden des Tages ab. Aber die Behaglichkeit kam doch nicht: denn alte Erinnerungen kamen und hingen ihre Gardinen auf, und sie haben zuweilen Nadeln, an denen man sich sticht. »Au,« sagt man, und stechen sie in das blutige Fleisch und bereiten brennenden Schmerz, so steigen uns die Tränen in die Augen. Dem alten Anton erging es oft so; heiße Tränen, die klarsten Perlen, kamen. Sie fielen auf die Bettdecke und die Diele, und es klang so herzbrechend, als ob eine Schmerzenssaite spränge. Sie verdunsteten, brannten in lodernder Flamme und beleuchteten ein Lebensbild, das niemals aus seinem Herzen verschwand. Trocknete er seine Augen mit der Nachtmütze, dann wurden die Tränen und die Bilder fortgewischt; aber ihre Quelle blieb, sie lag in seinem Herzen. Die Bilder kamen nicht, wie sie in der Wirklichkeit einander folgten, oft kamen die schmerzlichsten; aber auch die froh-wehmütigen leuchteten vor ihm auf. Und gerade diese warfen die stärksten Schatten.
Schön sind die Buchenwälder in Dänemark, sagt man; aber schöner erhoben sie sich für Anton in der Gegend der Wartburg; mächtiger und ehrwürdiger erschienen ihm die alten Eichen um die stolze Ritterburg, wo Schlingpflanzen von den Steinblöcken herabhingen; süßer dufteten dort die Blüten des Apfelbaums als im dänischen Land. Lebendig fühlte und vernahm er es noch jetzt; eine Träne rollte, klang und brannte. Er sah in ihrem Lichte deutlich zwei kleine Kinder, einen Knaben und ein Mädchen, miteinander spielen. Der Knabe harte rote Backen, gelbes, krauses Haar und ehrliche, blaue Augen; es war der Sohn des reichen Kaufmanns, der kleine Anton, er selbst. Das kleine Mädchen hatte braune Augen und schwarzes Haar; keck und klug sah sie drein; es war Molly, die Tochter des Bürgermeisters. Die beiden spielten mit einem Apfel; sie schüttelten ihn und hörten wie die Kerne im Innern rasselten; sie schnitten ihn durch und jeder erhielt ein Stück; sie teilten die Kerne unter sich und aßen sie bis auf einen. Den müßten sie in die Erde legen, meinte das kleine Mädchen.
»Und du sollst sehen, was aus ihm hervorkommen wird; es kommt etwas, was du dir gar nicht denken kannst; es kommt ein ganzer Apfelbaum, aber nicht gleich.«
Und der Kern wurde in einen Blumentopf eingepflanzt; alle beide waren eifrig dabei. Der Knabe grub mit seinen Fingern das Loch in die Erde, das kleine Mädchen legte den Kern hinein, und beide deckten ihn mit Erde zu.
»Du darfst ihn aber morgen nicht wieder herausnehmen, um zu sehen, ob er Wurzeln geschlagen hat,« sagte sie, »das darf man nicht. Ich tat es bei meinen Blumen zweimal; ich wollte sehen, ob sie wüchsen. Ich wußte es nicht besser, und die Blumen starben.«
Der Blumentopf blieb bei Anton, und während des ganzen Winters sah er jeden Morgen nach; allein es war nur die schwarze Erde zu sehen. Aber nun kam der Frühling; die Sonne schien so warm, und da brachen in dem Blumentopf zwei schmale, grüne Blätter hervor.
»Das bin ich und Molly,« sagte Anton, »das ist schön, das ist reizend.«
Bald kam ein drittes Blatt. Wen sollte es vorstellen? Und nun kam eins um das andere. Jeden Tag und jede Woche wurde der Keim größer und größer, die Pflanze wurde ein ganzer Baum. – Und das alles spiegelte sich in einer Träne wieder, die zerdrückt wurde und verschwand; allein sie konnte aus derselben Quelle, aus dem Herzen des alten Anton, wieder heraufsteigen.
In der Nähe von Eisenach erstreckt sich eine Reihe steiniger Berge, aus welcher sich ein runder Gipfel heraushebt, der weder Bäume, noch Sträucher, noch Gras trägt. Es ist der Venusberg; dort wohnt Frau Venus, eine Göttin aus heidnischer Zeit. Frau Holle hieß sie damals; das wußte und weiß noch jetzt jedes Kind in Eisenach. Sie hatte den edlen Ritter Tannhäuser, den Minnesänger aus dem Sängerkreis der Wartburg, zu sich hineingelockt.
Die kleine Molly und Anton standen oft vor dem Berge, und einmal sagte sie: »Wagst du anzuklopfen und ›Frau Holle! Frau Holle! schließ auf! Tannhäuser ist hier‹« zu rufen?« Aber das wagte Anton nicht. Molly tat es; doch nur die Worte: Frau Holle! Frau Holle! sagte sie laut und deutlich; die übrigen sprach sie so undeutlich in den Wind hinein, daß Anton sicher war, sie hätte eigentlich nichts gesagt. Sie sah so keck aus, so keck wie manchmal im Garten, wenn sie und andere kleine Mädchen ihn trafen und ihn küssen wollten, gerade deshalb, weil er sich nicht küssen lassen wollte, und um sich schlug. Sie allein wagte es.
»Ich darf ihn küssen,« sagte sie stolz und umschlang seinen Hals. Das war ihre Eitelkeit, und Anton fand sich hinein und dachte darüber nicht nach. Wie reizend sie war, wie keck! Frau Holle in dem Berge sollte auch schön sein. Aber ihre Schönheit, sagte man, verführe zum Bösen; die höchste Schönheit aber wäre die, die Elisabeth geschmückt hatte, die Schutzheilige des Landes, die fromme thüringische Fürstin, deren gute Taten hier manchen Ort durch Sage und Legende verherrlichen. In der Kapelle hing ihr Bild, von silbernen Leuchtern umgeben, – doch Molly glich ihr durchaus nicht.
Der Apfelbaum, den die Kinder gepflanzt hatten, wuchs Jahr für Jahr; er wurde so groß, daß er in den Garten in die frische Luft verpflanzt werden mußte, wo der Tau fiel, die Sonne warm schien und er die Kräfte erhielt, den Winter zu überstehen. Aber aus Freude, daß des Winters Härte vorüber war, setzte er im Frühling Blüten an, im Herbst brachte er zwei Apfel, einen für Molly und einen für Anton; weniger hätten es nicht gut sein können.
Der Baum war schnell groß geworden. Molly wuchs wie er; sie war frisch wie eine Apfelblüte; aber lange sollte er diese Blüte nicht mehr sehen. Alles ändert sich, alles wechselt! Mollys Vater verließ die alte Heimat, und Molly zog mit, weit fort. Ja, in jetziger Zeit ist es bei der Geschwindigkeit des Dampfes nur eine kurze Reise; aber damals brauchte man mehr als einen Tag und eine Nacht, um so weit östlich von Eisenach, nach der äußern Grenze von Thüringen, nach der Stadt Weimar zu gelangen.
Und Molly weinte und Anton weinte, – alle die Tränen rannen nun zu einer einzigen zusammen, und sie hatte der Freude rotes, schönes Licht. Molly hatte ihm gesagt, daß sie ihn lieber hatte als die ganze Pracht Weimars.
Ein Jahr verging; es vergingen zwei, drei Jahre, und in dieser Zeit kamen zwei Briefe an. Den einen überbrachte ein Frachtfuhrmann; den andern hatte man einem Reisenden mitgegeben; denn der Weg war weit und beschwerlich und führte in vielen Windungen an Dörfern und Städten vorbei.
Wie oft hatten Anton und Molly nicht die Geschichte von Tristan und Isolde gehört, und ebenso oft hatte er dabei an sich und Molly gedacht, obgleich Tristan bedeuten sollte, daß er in Trübsal geboren wäre. Das paßte nicht auf Anton, und er würde auch niemals den Gedanken gefaßt haben »sie hat mich vergessen;« aber Isolde vergaß ja auch den Freund ihres Herzens nicht, und als beide gestorben und an den beiden Seiten der Kirche begraben waren, wuchsen zwei Lindenbäume aus den Gräbern hervor und ihre blühenden Zweige vereinigten sich über dem Kirchendach. Das schien Anton so schön und doch so traurig. Aber traurig konnte es für ihn und Molly niemals werden, und deshalb summte er eine Weise des Minnesängers Walther von der Vogelweide:
»Unter der Linden auf der Heide.«
Und besonders schön klangen die Zeilen:
»Und aus dem Walde im stillen TalTandaradei!Sang so süß die Nachtigall«
Das Lied kam ihm immer auf die Zunge; er sang und pfiff es in der mondhellen Nacht, als er zu Pferde durch den tiefen Hohlweg ritt, um Weimar zu erreichen und Molly zu besuchen. Unerwartet wollte er kommen, und er kam unerwartet.
Man hieß ihn willkommen und reichte ihm einen vollen Becher Wein. Er fand eine lebhafte Gesellschaft, eine vornehme Gesellschaft, ein behagliches Zimmer und ein gutes Bett, und doch fand er es gar nicht so, wie er es gehofft und geträumt hatte. Er verstand sich nicht! er verstand auch die andern nicht; aber wir verstehen es! Man kann in einem Hause, in einer Familie leben und dort doch nicht festwurzeln,; man unterhält sich, wie man sich in einem Postwagen unterhält: man kennt sich, wie man sich in einem Postwagen kennt, geniert einander, und wünscht, daß man selbst oder der gute Nachbar über alle Berge wäre. Ähnliches empfand Anton.
»Ich bin ein ehrliches Mädchen,« sagte Molly zu ihm, »ich will es dir selbst sagen. Viel hat sich seit der Zeit verändert, da wir noch als Kinder zusammen spielten. Ich bin äußerlich und innerlich eine andere geworden. Gewohnheit und Wille haben keine Macht über unser Herz, Anton! Ich möchte nicht, daß du mir zürnst, nun ich bald weit fort gehe. Glaube mir, ich habe gern an dich gedacht; aber geliebt, wie ich nun weiß, daß man einen Menschen lieben kann, habe ich dich niemals, – Du mußt dich darein finden, Anton. Lebewohl!«
Und Anton sagte auch Lebewohl! Aber keine Träne kam ihm in die Augen, als er vernahm, daß er nicht mehr Mollys Freund war. Die glühende Eisenstange und die eisige Eisenstange reißen mit der gleichen Empfindung uns die Haut von den Lippen, wenn wir sie küssen, und er küßte gleich stark in der Liebe wie im Haß.
Keinen Tag gebrauchte Anton, um nach Eisenach zurückzukommen; aber das Pferd, das er geritten hatte, brach tot zusammen.
»Was will das sagen,« sagte er, »Ich bin vernichtet und ich will alles vernichten, was mich an dich erinnert, Frau Holle, Venus, heidnisches Weib! Den Apfelbaum will ich brechen, will ihn mit der Wurzel ausreißen; niemals soll er wieder blühen und Früchte reifen!«
Aber der Baum wurde nicht weggeworfen: er selbst wurde umgeworfen, und in heftigem Fieber lag er in seinem Bette, Was konnte ihm wieder aufhelfen? Da kam eine Medizin, die es konnte. Es war die bitterste, die sich finden ließ, und sie rüttelte den kranken Körper und die sich krümmende Seele wieder auf: Antons Vater war nicht mehr der reiche Kaufmann. Schwere Tage, Tage der Prüfung standen vor der Tür. Das Unglück brach herein; wie ein wogendes Meer stürzte es plötzlich in ein reiches Haus. Der Vater wurde ein armer Mann; Unglück und Sorge lähmte ihn. Da hatte Anton an anderes zu denken als an Liebesleid und an seinen Zorn gegen Molly. Er mußte nun Vater und Mutter im Hause ersetzen, mußte ordnen, helfen, Hand anlegen, selbst hinaus in die weite Welt und sein Brot verdienen.
Er kam nach Bremen und lernte Not und schwere Tage kennen, und sie machen das Herz hart oder weich, oft nur allzu weich. Wie ganz anders waren doch Welt und Menschen, als er es sich in seiner Kindheit gedacht hatte. Was waren ihm nun die Lieder der Minnesänger. Nichts als leerer Klang und hohler Sang. Ja, das meinte er zuweilen; aber zu andern Zeiten ertönten sie durch seine Seele, und er wurde ein frommes Gemüt.
»Gottes Wille ist der beste,« sagte er jetzt. »Gut war es, daß Gott mir Mollys Herz nicht erhielt; wozu würde es geführt haben, da das Glück sich so ganz von mir wandte, Sie verließ mich, ehe sie den bevorstehenden Wechsel der Dinge wußte oder ahnte. Ja, der Herr war mir gnädig. Alles geschieht zu unserm Besten! Alles geschieht weislich! Sie hat keine Schuld daran, und doch bin ich ihr so bitterbös gewesen.«