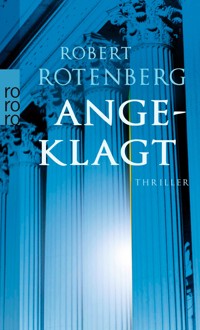
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
«Ich habe sie getötet.» Das ist das Letzte, was Kevin Brace sagt, als man ihn blutverschmiert neben der Leiche seiner Freundin findet. Ganz Toronto hält den Atem an, als der bekannte Radiomoderator des Mordes angeklagt wird. Warum schweigt er, statt sich zu verteidigen? Während Staatsanwalt Fernandez alles daransetzt, seinen ersten großen Fall zu gewinnen, und Staranwältin Nancy Perish an ihrer Verteidigung bastelt, interessiert Detective Greene nur eines: die Wahrheit. «Dies ist eines der besten Bücher, die ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe.» (Douglas Preston)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Robert Rotenberg
Angeklagt
Thriller
Deutsch von Edith Beleites
Für Vaune
And she shows you where to look
Among the garbage and the flowers
There are heroes in the seaweed
There are children in the morning
They are leaning out for love
And they will lean that way forever
Leonard Cohen, «Suzanne»
TEIL 1
DEZEMBER
1
Zum Entsetzen seiner Familie trug Gurdial Singh gern Zeitungen aus. Wer hätte auch gedacht, dass ein ehemaliger Lokführer der Indischen Eisenbahn – immerhin das größte Transportunternehmen der Welt – eines Tages Zeitungen auf Fußmatten legen würde, und zwar jeden Morgen ab 5:05Uhr. Dabei hatte Singh es gar nicht nötig zu arbeiten. Doch als er vor drei Jahren nach Toronto ausgewandert war, hatte er darauf bestanden. Und das, obwohl er am kommenden Donnerstag vierundsiebzig wurde. Sicher, es war ein alberner Job. Singh gab es freimütig zu, wenn er mit seiner Frau Bimal und seinen drei Töchtern darüber sprach. Aber er gefiel ihm nun mal.
Gut gelaunt summte er ein altes indisches Lied vor sich hin, als er an diesem Montag, dem 17.Dezember, bei Dunkelheit und klirrender Kälte die marmorne Lobby eines luxuriösen Apartmenthauses an der Front Street betrat, den sogenannten Market Place Tower. Freundlich winkte er Rasheed, dem Nachtportier, zu. Ein Stapel Globe and Mail lag gleich hinter der Tür neben einem Plastikweihnachtsbaum bereit. Verrückt, dachte Singh, als er seine graue Flanellhose an den Knien lüpfte und sich bückte, um mit seinem Taschenmesser die Kordel durchzuschneiden, mit der die Zeitungen zusammengebunden waren. Ein Land mit riesigen Wäldern – aber Weihnachtsbäume aus Plastik! Er teilte den Stapel in zwölf abgezählte Packen, einen für jede Etage. Es hatte nicht lange gedauert, bis er auswendig wusste, welche Bewohner des Market Place Tower die Globe and Mail abonniert hatten. Auch der Rest war einfach. Er brauchte nur die menschenleeren Flure entlangzugehen und eine Zeitung vor die Wohnungstüren der Abonnenten zu legen.
Singh genoss die Stille und das Alleinsein. Kein Vergleich zum lärmenden Chaos von Delhi! Als er das oberste Stockwerk erreichte, wusste er, dass er gleich den Mann sehen würde, der um diese Zeit immer schon wach war. Mr.Kevin Soundso. Singh konnte sich den Nachnamen nicht merken, obwohl es sich um einen der berühmtesten Männer Kanadas handelte. Gleich würde er in seinem altmodischen Morgenmantel auf den Flur treten, eine Zigarette und Orangenspalten in der rechten Hand, einen Becher Tee in der linken. Er würde sich den grauen Bart an der Schulter reiben und es kaum abwarten können, einen Blick in die Zeitung zu werfen.
Dieser Mr.Kevin, wie Singh ihn für sich nannte, moderierte eine Radiosendung, die vormittags im ganzen Land ausgestrahlt wurde. Singh hatte sie sich ein paarmal angehört, aber für seinen Geschmack war es belangloses Geplauder über so uninteressante Themen wie Fischfang in Neufundland, traditionelle Volksmusik in den Tälern von Ottawa oder landwirtschaftliche Probleme in der Prärie. Die Kanadier waren ein komisches Volk, denn obwohl die meisten von ihnen in Großstädten wohnten, schienen sie sich vor allem für das Landleben zu interessieren.
So früh am Morgen wirkte Mr.Kevin zwar noch ein wenig ungepflegt, aber er war zweifellos ein Gentleman. Vielleicht etwas zu schüchtern. Trotzdem freute Singh sich auf den immer gleichen Wortwechsel.
«Guten Morgen, Mr.Singh», pflegte Mr.Kevin zu sagen.
Darauf sagte Singh immer: «Guten Morgen, Mr.Kevin. Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Frau geht es gut.»
Darauf Mr.Kevin scherzhaft: «Aber ja, Mr.Singh. Sie wird immer schöner.» Dann steckte er sich die Zigarette in den Mund und reichte Singh eine Orangenspalte. «Frisch geschält.»
«Oh, vielen Dank», pflegte Singh dann zu sagen und gab Mr.Kevin im Gegenzug die Zeitung.
Darauf folgte Morgen für Morgen ein wenig Smalltalk über Gartenarbeit, Kochen oder Tee. Obwohl er ein vielbeschäftigter Mann und in Gedanken bestimmt schon bei der Arbeit war, schien Mr.Kevin nie in Eile zu sein. Immer nahm er sich Zeit für ein kurzes Gespräch, selbst zu dieser unwirtlichen Stunde. Ein höflicher und kultivierter Mann.
Singh brauchte fünfundzwanzig Minuten bis zum zwölften Stock. Dort oben gab es nur zwei Wohnungen. Mr.Kevins Wohnung, die 12A, lag links vom Fahrstuhl, am Ende eines langen Ganges. Rechts wohnte eine ältere Dame, die ebenfalls die Globe and Mail bekam. Sie war immer die Letzte, die Singh in diesem Haus belieferte.
Als er an diesem Morgen auf Mr.Kevins Wohnung zuging, stand die Tür, wie üblich, einen Spaltbreit offen. Nur von Mr.Kevin war nichts zu sehen, das war ungewöhnlich. Ich könnte die Zeitung einfach auf die Fußmatte legen, dachte Singh. Aber vielleicht warte ich einfach. Nur ungern wollte er auf die morgendliche Plauderei verzichten.
Unschlüssig blieb Singh stehen. Natürlich hätte er anklopfen können, aber er wollte nicht aufdringlich sein. Er summte vor sich hin, und um sich bemerkbar zu machen, summte er nun etwas lauter und scharrte ein wenig mit den Füßen. Trotzdem kam Mr.Kevin nicht an die Tür.
Singh wurde unruhig. Es war sicher der Lokführer in ihm, der nach Routine verlangte. Routine und Ordnung. Er wusste noch genau, wie sein Mathelehrer in der elften Klasse gesagt hatte, es gäbe keine Geraden. Selbst Parallelen müssten wegen der Erdkrümmung irgendwo in der Unendlichkeit aufeinandertreffen. Danach hatte Singh eine Woche lang nicht schlafen können.
Plötzlich hörte er in der Wohnung ein Geräusch. Ein merkwürdiger, hohler Ton. Was war das? Dann wurde eine Tür geschlossen. Jetzt kommt er wohl gleich, dachte Singh und wartete. Aber alles blieb still. Vielleicht, dachte er, sollte ich doch einfach gehen. Doch dann unternahm er einen letzten Versuch, indem er die Zeitung auf den Parkettboden der Wohnung warf. Mit genug Schwung, sodass es ordentlich klatschte. So etwas hatte er noch nie getan. Jetzt musste Mr.Kevin doch merken, dass er da war!
Wieder war in der Wohnung etwas zu hören, dieses Mal von weiter weg. Waren das Schritte? Was sollte er bloß tun? Er konnte doch nicht einfach hineingehen!
Singh wartete weiter. Dabei fiel sein Blick auf die Titelseite der aktuellen Globe and Mail. Ein großformatiges Foto von einem Hockeyspieler, der triumphierend die Arme hochgerissen hatte. Der Schlagzeile entnahm Singh, dass es um die Lokalmatadoren ging, die Toronto Maple Leafs. Auch wieder so eine kanadische Verrücktheit! Der Plural von «leaf» war «leaves». Warum schrieb man den Namen des eigenen Teams falsch? Außerdem war das Mannschaftssymbol auf den Spielertrikots, ein Ahornblatt, blau. Im Herbst hatte Singh schon rote und gelbe Ahornblätter gesehen, aber blau waren sie zu keiner Jahreszeit!
Da endlich näherten sich Schritte. Mr.Kevin erschien wie immer in seinem abgetragenen Morgenmantel und öffnete die Tür ganz. Singh hörte, wie sie an den Türstopper stieß.
Doch wo war Mr.Kevins Zigarette? Wo der Tee und die Orange? Mr.Kevin schaute auf seine leeren Hände. Singh sah, dass seine Fingerspitzen ganz rot waren. Blutorangen, dachte er. Die hatte er in seiner alten Heimat immer besonders gern gegessen. Erst kürzlich war ihm aufgefallen, dass sie um diese Jahreszeit in den kanadischen Läden auftauchten. Mr.Kevin musste wohl gerade eine geschält haben. Ganz genau konnte Singh die rote Flüssigkeit sehen, als Mr.Kevin die Hände ins Licht hielt. Aber sie war viel dicker als Orangensaft.
Singhs Herz begann zu rasen.
Es war Blut.
Singh wollte gerade etwas sagen, als Mr.Kevin ihm zuvorkam. Er beugte sich vor und flüsterte: «Ich habe sie getötet, Mr.Singh. Ich habe sie getötet.»
2
Officer Daniel Kennicott betrat den Market Place Tower im Laufschritt. «Wo soll ich hin?», rief er über die Schulter. Seine Kollegin Nora Bering war nur einen halben Schritt hinter ihm.
«Ich überwache die Lobby», sagte sie. «Du gehst in die Wohnung.»
Ein uniformierter Portier stand an einem imposanten Empfangstresen aus poliertem Holz und schaute von seiner Zeitung auf, als die Polizisten an ihm vorbeirannten. Reliefs veredelten die Marmorwände, und außer dem obligaten Weihnachtsbaum schmückten frische Blumen die Halle. Aus einer Lautsprecheranlage drang leise klassische Musik.
Als Dienstältere oblag Bering die Einsatzleitung. Als der Notruf bei ihr eingegangen war, hatte sie sich per Handy bei der Zentrale über Einzelheiten informiert, denn sie wollte verhindern, dass Dritte, die den Polizeifunk abhörten, von dem Geschehen genauso schnell erfuhren wie die Polizei selbst. Demnach hatte Kevin Brace, der berühmte Radiomoderator, um 5:31Uhr, also vor zwölf Minuten, seinem Zeitungsboten, einem Mr.Singh, an der Tür seiner Penthousewohnung Nr.12A anvertraut, dass er soeben seine Frau getötet habe. Darauf hatte er Singh die Tote gezeigt, die in einer Badewanne lag. Singh hatte sie berührt und festgestellt, dass sie kalt war. Brace sei ruhig und unbewaffnet.
Dass ein Tatverdächtiger ruhig war oder sogar einen lethargischen Eindruck machte, war bei Fällen von häuslicher Gewalt nicht ungewöhnlich. Kennicott wusste das. Der Affekt, die kurzzeitige Erregung, hatte sich gelegt, und langsam setzte der Schock ein.
Bering zeigte auf die Treppe neben dem Fahrstuhl und sagte: «Zwei Möglichkeiten.»
Kennicott nickte und atmete tief durch.
«Falls du den Fahrstuhl nimmst, denk dran, dass du laut Vorschrift zwei Stockwerke tiefer aussteigen musst.»
Wieder nickte Kennicott. Das hatte er schon in der Grundausbildung gelernt. Einige Jahre zuvor waren zwei Kollegen zu einem Fall von häuslicher Gewalt in ein Hochhaus gerufen worden. Alles hatte ganz normal gewirkt. Aber als die Kollegen im vierundzwanzigsten Stock aus dem Fahrstuhl stiegen, wurden sie auf der Stelle von dem Familienvater erschossen, der gerade seine Frau und sein Kind getötet hatte.
«Ich nehme die Treppe», entschied Kennicott.
«Denk dran, dass alles, was der Tatverdächtige sagt, wichtig sein kann», sagte Bering, während Kennicott tief durchatmete. «Achte darauf, dass du dir alles wörtlich notierst!»
«Klar.»
«Betritt die Wohnung mit vorgehaltener Waffe», riet Bering. «Und sei vorsichtig.»
Kennicott nickte. «Okay.»
«Melde dich bei mir, kurz bevor du den zwölften Stock erreichst.»
«Mache ich.» Kennicott rannte auf die Treppe zu. Die Aufgabe desjenigen Polizisten, der als Erster am Tatort eintraf, bestand vor allem darin, den Ist-Zustand zu bewahren. Das klang einfach, aber es war, als wollte man eine Sandburg vor Sturmböen schützen, denn jede Sekunde konnte wertvolles Beweismaterial vernichtet werden. Am liebsten hätte Kennicott immer drei Stufen auf einmal genommen, aber seine kugelsichere Weste, seine Waffe und das Funkgerät wogen zusammen gut acht Pfund. Langsam, sagte er sich. Es hatte keinen Sinn, wenn er zu schnell außer Atem geriet.
Zwischen dem zweiten und dritten Stock fand er den richtigen Rhythmus und kam gut voran, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Zusammen mit Bering hatte er vier Tage hintereinander Nachtschicht geschoben. Eine Stunde vor Beginn einer viertägigen Freischicht war der Notruf eingegangen, als sie sich gerade auf der anderen Straßenseite in den Hallen des St.-Lawrence-Markts befanden, dem größten Markt für frische Lebensmittel in Toronto, und die Marktleute hatten gerade angefangen, ihre Stände für den Tagesbetrieb herzurichten.
Im sechsten Stock merkte Kennicott, wie ihm der Schweiß, der sich in seinem Nacken bildete, langsam den Rücken runterzulaufen begann. Bis zu diesem Notruf war es eine ruhige Nacht gewesen. Ein Tamile in Regent Park hatte seiner Frau ein Stück Ohr abgebissen, aber als sie dort ankamen, sagte die Frau, sie sei auf eine Glasscherbe gefallen. Jemand war ins Haus eines schwulen Pärchens eingebrochen und hatte als Visitenkarte einen stinkenden Haufen auf dem Perserteppich hinterlassen. In der Jarvis Street hatte eine minderjährige Prostituierte behauptet, der Säufer, der ihr eine Bleibe angeboten hatte, wenn sie ihm dafür jeden Tag einen blies, hätte sie geschlagen. Aber als sie Kennicott sah, hatte sie sofort begonnen, ihn anzubaggern. Eine ganz normale Nachtschicht also.
Im zehnten Stock begann Kennicott zu keuchen. Erst vor dreieinhalb Jahren war er in den Polizeidienst eingetreten und hatte dafür eine vielversprechende Karriere als Anwalt in einer der angesehensten Kanzleien der Stadt aufgegeben. Der Grund war sein Bruder Michael, der zwölf Monate zuvor ermordet worden war. Als sich abzeichnete, dass die polizeilichen Ermittlungen im Sande verliefen, hatte Kennicott die Anwaltsrobe gegen eine Dienstmarke eingetauscht.
Das hier war genau das, worauf er seitdem gewartet hatte: in einem Mord zu ermitteln. Er nahm jetzt drei Stufen auf einmal und schaltete sein Funkgerät an. «Kennicott hier», sagte er zu Bering. «Bin gleich im elften Stock.»
«Roger. Die Spurensicherung, jemand von der Mordkommission und jede Menge Wagen sind unterwegs. Ich habe die Fahrstühle blockiert. Niemand ist runtergekommen. Schalte das Gerät jetzt aus, damit du keinen Krach machst, wenn du die Wohnung betrittst.»
«Roger. Over und out.»
Im zwölften Stock blieb Kennicott stehen und orientierte sich kurz. Vor ihm lag ein langer Gang, der nach einigen Metern abbog, vermutlich zum Fahrstuhl und der anderen Gebäudeseite. Gedimmte Wandleuchten warfen ein milchiges Licht auf die blassgelben Wände. Diese Seite des Hausflurs führte zu einer einzigen Wohnung: 12A.
Vorsichtig bewegte er sich auf die Tür zu. Sie stand halb offen. Er atmete tief durch, zog seine Waffe und stieß die Tür mit dem Fuß ganz auf. Dann trat er in eine große Diele mit Parkettboden. Alles war ruhig. Es war ein merkwürdiges Gefühl, so ohne weiteres in diese friedliche, gepflegte Wohnung einzudringen. Und dann die Waffe! Kennicott kam sich vor wie ein kleiner Junge, der mit den anderen Jungs Räuber und Gendarm spielte.
«Polizei», rief er laut.
«Wir sitzen in der Küche, am Ende der Diele», rief jemand mit indischem Akzent. «Die verstorbene Dame befindet sich in dem Badezimmer, das von der Diele abgeht.»
Kennicott schaute hinter die Wohnungstür, dann ging er langsam durch die Diele. Es kam ihm so vor, als machten seine Stiefel einen ungeheuren Lärm auf dem Holzfußboden. Eine Tür in der Mitte der Diele stand einen Spaltbreit offen. In dem Zimmer dahinter brannte Licht, und eine Reihe weißer Fliesen war zu erkennen. Kennicott trug keine Handschuhe, deswegen stieß er die Tür mit dem Ellbogen auf.
Es war ein kleines Badezimmer. Zwei Schritte – und Kennicott stand vor der Badewanne, in der eine schwarzhaarige Frau lag. Ihr Gesicht war fast so weiß wie die Wanne. Sie rührte sich nicht.
Kennicott kehrte in die Diele zurück, ohne etwas zu berühren. Er schwitzte jetzt am ganzen Körper, und alles fühlte sich klebrig an.
«Wir sind hier hinten», rief der Mann mit dem indischen Akzent.
Kennicott ging weiter die Diele entlang, bis eine Küche mit großem Esstisch vor ihm lag. Dort saß Kevin Brace, der berühmte Radiomoderator, ganz still auf einem schmiedeeisernen Stuhl. In der Hand hielt er einen Keramikbecher. Er trug Hausschuhe und einen alten Morgenmantel, dessen Kragen er hochgeschlagen hatte. Eine traurige Figur, aber eindeutig zu identifizieren an seinem zottigen Bart und seiner großen, altmodischen Nickelbrille. Ein Gesicht, das man kannte, da er seine Radiosendung schon seit Jahren moderierte und sein Foto häufig in Zeitungen oder im Fernsehen gezeigt wurde. Brace schaute nicht einmal auf.
Ihm gegenüber saß ein älterer braunhäutiger Mann. Er trug Anzug und Krawatte und beugte sich vor, um Brace Tee nachzuschenken. Zwischen den Männern hing eine bunte Tiffanylampe über dem Tisch. Wie eine große Sprechblase in einer Comiczeichnung, in der nur noch der Text fehlt, dachte Kennicott. Unter der Lampe stand ein Teller mit Orangenspalten. Dabei musste es sich um einen Rest handeln. Die meisten waren offenbar schon aufgegessen worden. Sie waren ungewöhnlich rot. Blutorangen, dachte er.
Auf der anderen Seite der Küche war ein großes Fenster, das nach Süden rausging und einen atemberaubenden Blick über den Ontariosee bot, der jetzt wie ein schwarzes Brett dalag. Ganz schwach zeichnete sich in der ersten Morgendämmerung die schmale Inselkette ab, die der Stadt halbmondförmig vorgelagert war.
Kennicott kam sich wie im falschen Film vor. Der phantastische Ausblick, die friedliche Tischszene… Die Waffe noch im Anschlag, betrat er den glatten Kachelboden der Küche. Plötzlich rutschte er mit dem rechten Fuß aus. Sofort ließ er die Arme sinken, um den Sturz abzufedern, ließ dabei jedoch die Waffe fallen, die über den Fußboden schlitterte, bis sie mitten in der Küche liegenblieb.
Idiot, dachte Kennicott, als er wieder aufstand. Der Inspector, der gleich den Fall übernimmt, wird begeistert sein!
Am Tisch träufelte Brace Honig in seinen Becher und rührte den Tee um, als sei nichts geschehen.
Vorsichtig ging Kennicott auf seine Waffe zu, um nicht wieder auszurutschen. «Kevin Brace?», fragte er.
Brace mied jeglichen Blickkontakt. Zudem waren seine Brillengläser ziemlich verschmiert. Er sagte kein Wort, sondern rührte einfach nur weiter seinen Tee um.
Kennicott bückte sich nach seiner Waffe. Als er sich wieder aufrichtete, sagte er: «Mr.Brace, ich bin Officer Daniel Kennicott. Die Frau in der Badewanne… Ist es Ihre Frau?»
«Natürlich», mischte der Inder sich ein. «Sie ist tot. Ich habe viele Tote gesehen, als ich noch Lokführer bei der Indischen Eisenbahn war. Es ist übrigens das größte Transportunternehmen der Welt.»
Kennicott sah zu dem Mann hinüber. «Verstehe, Mr.…»
Der Mann sprang so schnell vom Stuhl auf, dass Kennicott unwillkürlich einen Schritt zurückwich. «Gurdial Singh. Ich bin der Zeitungsbote. Ich habe die Polizei verständigt.»
Die Polizei verständigt… Was für eine gezierte Ausdrucksweise! Kennicott musste sich beherrschen, um nicht zu grinsen. Er griff nach seinem Funkgerät.
«Heute war ich schon eine Minute eher hier als sonst, um fünf Uhr neunundzwanzig, und um fünf Uhr einunddreißig habe ich angerufen, gleich nachdem ich die Tote gesehen hatte», erklärte Singh. «Seitdem trinken Mr.Kevin und ich Tee und warten auf Sie. Es ist schon unsere zweite Kanne. Ein besonderer Darjeeling, den ich am Monatsersten immer mitbringe. Er hilft gegen Verstopfung.»
Kennicott schaute zu Brace hinüber, der seinen Teelöffel betrachtete, als handle es sich um eine kostbare Antiquität. Er steckte die Waffe ins Halfter, trat näher an den Tisch und berührte Brace an der Schulter.
«Mr.Brace, ich verhafte Sie wegen Mordverdacht», sagte er und klärte Brace über seine Rechte auf.
Brace zeigte keinerlei Regung, streckte aber die Hand aus und reichte Kennicott etwas mit blutigen Fingern. Es war eine Visitenkarte: Nancy Parish, Strafverteidigerin und Prozessanwältin.
Kennicott schaltete sein Funkgerät an. «Hier Kennicott.»
«Deine genaue Position?», fragte Bering.
«In der Wohnung.» Kennicott sprach leise. «Der Tatverdächtige ist hier, zusammen mit dem Zeugen, Mr.Gurdial Singh, dem Zeitungsboten. Alles ruhig. Das Opfer befindet sich in einem Badezimmer, das von der Diele abgeht. Konnte nur noch den Tod feststellen. Habe den Tatverdächtigen verhaftet.»
«Was tut er jetzt?»
Kennicott schaute zu Brace hinüber. Der ergraute Moderator goss Milch in seinen Tee. «Trinkt Tee.»
«Gut. Behalte ihn im Auge. Verstärkung ist unterwegs.»
«Roger.»
«Und, Kennicott, schreib Wort für Wort auf, was er sagt!»
«Alles klar. Over und out.»
Kennicott steckte sich das Funkgerät an den Gürtel. Er hatte alles getan, was der erste Polizist am Tatort zu tun hatte. Langsam normalisierte sich sein Adrenalinspiegel wieder.
Wie würde es weitergehen? Nachdenklich blickte er auf Brace. Er hatte den Löffel auf den Tisch gelegt, nippte an seinem Tee und schaute aus dem Fenster. Kennicott wusste, dass ein Fall wie dieser die unerwartetsten Wendungen nehmen und die bizarrsten Familiengeschichten zutage bringen konnte, aber als er sich die kleine Teerunde so ansah, war er sich ziemlich sicher, dass Kevin Brace kein Wort über die Lippen bringen würde.
3
«Hör endlich auf zu gähnen», murmelte Inspector Ari Greene zu sich selbst, als er sein 88er Oldsmobile in die enge Einfahrt vor dem Haus seines Vaters lenkte. Er griff nach der Papiertüte auf dem Beifahrersitz. Gut, dachte er, die Bagels von Gryfe’s sind noch warm. Aus einer zweiten Gryfe’s-Tüte holte er einen Milchkarton und fischte unter dem Fahrersitz aus einem Knäuel von Einkaufstüten eine der Supermarktkette Sobey’s heraus. Die ist gut, dachte Greene und steckte die Milch hinein. Wenn sein Vater merkte, dass die Milch aus der Bagelbäckerei stammte, würde er ihm die Hölle heiß machen. «Was? Du kaufst Milch bei Gryfe’s? Was hast du dafür bezahlt? 2,99? Bei Sobey’s kostet sie diese Woche 2,49 und bei Loblaws 2,51.Außerdem habe ich noch einen Coupon für zehn Cent Rabatt.» Alles in einem unnachahmlichen Mix aus Englisch und Jiddisch, der besonders komisch war, wenn sein Vater sich aufregte.
Greene hatte die zehnte Nachtschicht in Folge hinter sich und war zu müde, um wegen der Milch noch extra zum Supermarkt zu fahren. Aber sein Vater hatte im Leben genug gelitten. Da brauchte er nicht noch zu erleben, dass sein einziger überlebender Sohn das Geld aus dem Fenster warf.
In der Nacht war ein wenig Schnee gefallen, der nun wie ein dünnes Laken alles überdeckte. Greene griff nach der Schaufel, die am Treppengeländer lehnte, und schippte den Schnee von den Stufen. Er hob den Toronto Star auf, der auf der Fußmatte lag, und schloss die Tür auf.
Im Haus hörte er den Fernseher laufen. Greene seufzte. Seit dem Tod seiner Mutter mied sein Vater das eheliche Schlafzimmer. Lieber sah er im Wohnzimmer fern, bis er auf dem Plastiksofa einschlief.
Greene zog sich die Schuhe aus. In der Küche legte er die Bagels auf die Arbeitsplatte und stellte die Milch in den Kühlschrank, wobei er die Sobey’s-Tüte gut sichtbar liegen ließ. Dann ging er leise ins Wohnzimmer. Sein Vater lag zusammengerollt unter einer braun-weißen Wolldecke, die Greenes Mutter ihm zum siebzigsten Geburtstag gestrickt hatte. Sein Kopf war vom Kissen gerutscht und lag auf dem harten Plastik.
Greene schob den Couchtisch zur Seite und kniete sich vor seinen schlafenden Vater. Als Inspector der Mordkommission hatte er fünf Jahre und als einfacher Polizist zwanzig Jahre viele harte Burschen gesehen. Aber keiner von ihnen konnte diesem kleinen polnischen Juden das Wasser reichen, den die Nazis einfach nicht totgekriegt hatten, obwohl sie sich die größte Mühe gegeben hatten.
«Ich bin’s, Dad, Ari.»
Greene berührte seinen Vater vorsichtig an der Schulter, zog sich schnell wieder zurück und machte sich auf das gefasst, was nun folgen würde. Er wartete, aber nichts geschah. Ohne ihm zu nahe zu kommen, streckte er die Hände aus und drückte die Schultern seines Vaters etwas fester. «Dad, ich habe frische Bagels und Milch mitgebracht.»
Sein Vater riss die Augen auf. Es war der Moment, den Greene seit frühester Kindheit fürchtete. Was für ein grauenhafter Albtraum war es wohl, aus dem sein Vater jeden Morgen aufs Neue erwachte? Seine graugrünen Augen hatten einen irren Blick, und er schien nicht zu wissen, wo er war.
«Die Bagels sind noch warm, Dad. Und die Milch ist…»
Sein Vater starrte auf seine Hände. Greene rückte etwas näher und legte seinem Vater das Kissen unter den Kopf. Mit einer Hand streichelte er seinen Arm.
Sein Vater murmelte auf Jiddisch: «Meine Tochter.» Dann nannte er sie beim Namen: «Hannah!» Sie war in Treblinka ermordet worden.
Greene half ihm, sich aufzusetzen. Langsam kam sein Vater zu sich. «Wo hast du die Milch gekauft?», wollte er wissen.
«Bei Sobey’s.»
«Gab’s Coupons?»
«Nein, alle schon weg. Du weißt doch, wie das in der Weihnachtszeit immer ist.»
Sein Vater rieb sich das Gesicht. «Ja, ich weiß, wie das in der Weihnachtszeit ist. Da fährst du eine Schicht nach der anderen, um die Kollegen zu entlasten, die Familie haben. Du siehst müde aus. Hattest du schon wieder Nachtschicht?»
«Nur ein paar Stunden», log Greene, war sich aber ziemlich sicher, dass sein Vater die Wahrheit kannte.
«Dann hast du heute frei?»
Greene zeigte auf den Pager an seinem Gürtel. «Ich stehe ganz oben auf der Bereitschaftsliste. Aber vielleicht habe ich ja Glück, und es wird ein ruhiger Tag.»
Sein Vater klopfte ihm auf die Schulter und testete nebenbei den Kragen seines Anzugs. «Dieser neumodische Schneider, zu dem du immer gehst, scheint langsam nähen zu lernen.»
Im Grunde seines Herzens war Greenes Vater immer noch Schneider. Das war sein Beruf in seinem polnischen Heimatdorf gewesen, als die Nazis es eines Morgens im September 1942 einkesselten. Bei der Ankunft in Treblinka erzählte ein Freund von ihm einem ukrainischen Wachmann, er sei Schuster, denn Schuster wurden im Lager gerade gebraucht. So wurde Greenes Vater Schuster. Als er nach Kanada kam, eröffnete er eine kleine Schusterwerkstatt in der Innenstadt von Toronto, wo es vor europäischen Einwanderern nur so wimmelte. Das KZ war seine Lehrstelle gewesen. Nachdem er dort zwei Jahre lang die Schuhe von Juden aus ganz Europa repariert hatte, kannte er praktisch alle Marken und wusste, was man am besten mit ihnen anstellte.
«Na, das hoffe ich doch», sagte Greene, als er sich das Jackett auszog und seinem Vater das Futter zeigte. «Ich musste zwei Monate auf diesen Anzug warten.»
«Zwei Monate!» Sein Vater schnaubte verächtlich. «Setz dich. Ich mache mir einen Kaffee. Du möchtest bestimmt lieber Tee?»
Greene lächelte gerührt. «Nein danke, Dad.»
Das Plastiksofa war die einzige Sitzgelegenheit. Greene hasste das Ding, seit er als Kind das erste Mal Freunde mit nach Hause gebracht hatte. Sie stammten aus gutem Hause, ihre Eltern sprachen akzentfrei Englisch, fuhren Ski, spielten Tennis und hatten keine Nummern auf den Armen eintätowiert.
Nach all den Jahren hätte Greene aus diesem scheußlichen Sofa am liebsten immer noch Kleinholz gemacht. Aber es hatte keinen Sinn, mit seinem Vater darüber zu streiten. Weder über das Sofa noch über sonst etwas. Heute schon gar nicht. Greene war hundemüde. Er lehnte sich zurück, schob den Couchtisch an seinen Platz und legte die Füße darauf.
«Haben die Leafs schon wieder verloren?», rief sein Vater aus der Küche. «Ich bin gegen Ende des zweiten Drittels eingeschlafen, als es zwei zu null für Detroit stand.»
«Dann hast du was verpasst», rief Greene. «Innerhalb der letzten zehn Minuten haben sie drei Tore gemacht und die Wings drei zu zwei geschlagen.»
«Ach, wirklich?», rief sein Vater. «Na, wennschon. Das nächste Spiel verlieren sie bestimmt wieder. Die Jungs sind einfach nicht in Form.»
Greene rutschte auf dem Sofa herum, um eine einigermaßen bequeme Sitzposition zu finden. Das Plastik knackte und quietschte unter seinem Gewicht – auch das hasste er an dem Möbelstück. Aber das Schlimmste war, dass es so unbequem war. Sein ganzer Körper schrie nach Ruhe und Entspannung. Trotzdem übernahm er in der Weihnachtszeit gern Zusatz- und Bereitschaftsschichten. Abgesehen davon, dass es Pluspunkte in seiner Personalakte brachte, war er der einzige Jude in der Mordkommission, sodass es ihm nichts ausmachte, in dieser Zeit viel zu arbeiten.
Für einen ehrgeizigen Polizisten, dessen Karrierechancen mit nur einem ungelösten Fall ziemlich gut standen, war diese Jahreszeit ein wahrer Segen. In den letzten drei Jahren hatte er im Dezember jeweils einen Mordfall bearbeitet, aber dieses Jahr war es bislang ruhig.
Der Geruch von Instantkaffee breitete sich im Wohnzimmer aus. Seit seiner Kindheit hasste Greene diesen Geruch. Er verlagerte das Gewicht, und sein Pager verkantete sich im Sofa.
«Probier doch mal den Frischkäse, den ich dir am Freitag mitgebracht habe, Dad!»
«Hab ich schon. Ich suche ihn gerade. Vielleicht habe ich ihn nicht richtig verpackt. Nach drei Tagen hat er bestimmt sein Aroma verloren», rief Greenes Vater aus der Küche. «Möchtest du Himbeermarmelade?»
«Ja, bitte», rief Greene zurück. Er hatte das Gefühl, dass ihm gleich die Augen zufallen würden. Das Sofa war scheußlich und furchtbar unbequem, aber im Moment kam es ihm trotzdem wie der ideale Schlafplatz vor.
Er griff nach dem Pager und löste ihn von seinem Gürtel. Ah! Das war gleich viel bequemer. Gott, war er müde! Langsam fielen ihm die Augen zu.
Im nächsten Moment fuhr er auf, dass das Plastik unter ihm nur so krachte. Der Pager piepte auf höchster Alarmstufe.
4
A-l-i-m-e-n-t-e
A-l-l-d-a-s-G-e-l-d
A-l-l-e-s-v-o-n-A-w-o-t-w-e
A-l-l-m-e-i-n-G-e-l-d
Ja, das trifft’s, dachte der Reporter Awotwe Amankwah, als er Buchstaben auf die Rückseite eines Notizzettels kritzelte: All mein Geld! Danke, Euer Ehren, vielen herzlichen Dank! Hasserfüllt dachte er an die Worte zurück, die Richterin Romina Hillgate am Ende eines langen und schmutzigen Scheidungsprozesses gelassen ausgesprochen hatte. Danach durfte er Fatima und Abdul mittwochs von halb sechs bis neun sehen, samstags von zwei bis fünf, und abends durfte er sie zwischen halb acht und acht kurz anrufen. Sehr großzügig! Und alles für schlappe achthundert Dollar im Monat!
«Wenn Sie Ihre Kinder über Nacht bei sich haben wollen, besorgen Sie sich gefälligst eine Wohnung!», hatte Romina-die-Domina, wie Amankwah sie für sich nannte, am vorläufig letzten Verhandlungstag verfügt. Claire war natürlich anwesend. Konservativ und respektabel gekleidet wie eine Supermutti aus den Sechzigern. Ihre Anwälte hatten ihn häufiger mit Eingaben, Forderungen und einstweiligen Verfügungen überzogen, als seine Ex die Liebhaber wechselte. Amankwah konnte sich schon bald keinen Anwalt mehr leisten, also vertrat er sich bei der Verhandlung selbst.
Für das Recht, die Kinder bei sich übernachten zu lassen, würde er ein neues Verfahren anstrengen müssen. Es würde Monate dauern, bis ein Termin anberaumt werden konnte, und das Geld dafür hatte er auch nicht.
Um seinen Unterhaltsverpflichtungen nachzukommen, schob er seit Wochen die Idiotenschicht beim Toronto Star, der größten Tageszeitung des Landes, bei der er seit fast zehn Jahren arbeitete, und schlug sich die Nächte im sogenannten Funkraum um die Ohren.
Der Funkraum – hausintern auch Gummizelle oder Panikraum genannt – lag an der Nordseite des Großraumbüros. Eigentlich war es kein Raum, sondern ein gläsernes Kabuff, vollgestopft mit technischen Geräten aller Art. Von den fünf Abhöranlagen funktionierten zwei, die für den Polizeifunk und die Notrufzentrale. Sie liefen rund um die Uhr, genau wie ein Fernsehkanal, der damit warb, dass er vierundzwanzig Stunden am Tag Nachrichten sendete, nachts jedoch todlangweilige Dauerwerbung für Fitness- oder Küchengeräte ausstrahlte. Ein Radiosender, der tatsächlich den ganzen Tag Nachrichten brachte, lief ebenfalls und trug seinen Teil zu einer konfusen Geräuschkulisse bei.
Amankwah musste all diese Geräte überwachen, dazu noch die Meldungen von zwei Nachrichtenagenturen, die pausenlos über zwei große altmodische Monitore in einer Ecke des Raums liefen. Zusätzlich musste er stündlich eine Telefonliste abarbeiten, auf der sich die Nummern von Polizeirevieren in und außerhalb Torontos befanden, inklusive der entfernteren Vororte und benachbarten Städte wie Durham, Peel, Halton, Milton, York, Oakville, Aurora und Burlington – kurz: die Gegend, die als Goldenes Hufeisen bezeichnet wurde und das fünftgrößte Ballungsgebiet Nordamerikas darstellte. Auch Feuerwehren, die Verkehrsbetriebe und Krankenhäuser galt es abzuchecken sowie die Polizeiämter von ganz Ontario. Eine Nachtschicht im Funkraum war also kein Zuckerschlecken. Wenn sich trotzdem nirgendwo etwas Berichtenswertes tat, musste man die Todesanzeigen durchgehen, in der Hoffnung, dass wenigstens dort eine Story lauerte.
Auf den ersten Blick mochte der Job im Funkraum kompliziert wirken, und arbeitsreich war er allemal, aber Amankwah fand, dass jeder Anfänger, Praktikant und Journalismusstudent damit fertigwerden konnte. Jedenfalls fühlte er sich dabei maßlos unterfordert.
Sein Blackberry ließ er die ganze Zeit an, falls E-Mails von Außenreportern eingingen oder etwas mit den Kindern war. Wenn er durch die Glasscheibe in das Großraumbüro schaute, das um diese Zeit fast leer war, konnte er hinten an der Wand eine Reihe von Uhren sehen, von denen man die aktuelle Zeit der wichtigsten Metropolen ablesen konnte – London, Paris, Moskau, Hongkong, Tokio, Melbourne und Los Angeles. Immer wieder wanderte sein Blick sehnsüchtig dorthin. Er hatte immer Auslandskorrespondent werden wollen, der erste schwarze Reporter, den der Toronto Star nach Übersee schickte. Doch der Traum war nun ausgeträumt. Die Uhr über dem Schild ORTSZEIT zeigte 5:28 an. Noch eine halbe Stunde bis Feierabend. Dann hatte er vier Stunden, um in die Wohnung seiner Schwester nach Thorncliffe zu fahren, wo er Asyl auf der Wohnzimmercouch gefunden hatte, zu duschen und sich auf den Rückweg zu machen, um pünktlich zur nächsten Schicht um zehn wieder an seinem Schreibtisch zu sitzen.
Gelangweilt schaute er aus dem Fenster, was kaum möglich war, da es über und über mit Memos, Witzen und bunten Notizzetteln beklebt war. Um sich die Zeit zu vertreiben, schrieben alle die Skurrilitäten auf, die man während der Schicht im Funkraum so aufschnappte, und klebten die Zettel ans Fenster. Amankwah schaute, ob etwas Witziges dabei war.
15.Dezember, 2:12
Einsatzzentrale: «Der Täter hat eine Warze und Rollschlitze?»
Polizist vom 21.Revier: «Nein, er trägt eine schwarze Wollmütze.»
Polizist vom 43.Revier: «Ich will ja nicht behaupten, dass ich alle Straßengangs in Scarborough kenne, aber eine, die sich Nippel nennt, wäre mir neu.»
Einsatzzentrale: «Egal. Fotografier sie trotzdem!»
Das enge Kabuff war völlig überhitzt. Amankwah hatte sich schon vor Stunden das Jackett ausgezogen und die Krawatte gelockert. Alle fünfzehn Minuten notierte er die Vorkommnisse mit seiner akkuraten Handschrift in ein Notizbuch. Es mochte ein lausiger Job sein, aber er war ein guter und gewissenhafter Journalist. Was er machte, machte er richtig.
Die Nacht war ruhig gewesen. Das war oft so in der Vorweihnachtszeit: keine Story weit und breit. Dabei hatte die Lokalredaktion ihn gebeten, ausgerechnet in dieser Nacht etwas mit Lokalkolorit aufzustöbern, das sich für die Titelseite eignete.
So etwas hatte diese Nacht jedoch nicht hergegeben. In einem Vorort war ein iranischer Taxifahrer, der in seiner Heimat Geschichtsprofessor gewesen war, von ein paar jugendlichen Ostasiaten mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt worden. Allerdings waren die Kids ziemlich dämlich. In den Vororten hatte es nämlich geschneit, und die Polizei brauchte bloß den Fußspuren zu folgen, um die Jugendlichen dann in ihren Wohnhäusern zu verhaften. In der Innenstadt waren pakistanische Collegestudenten mit Cricketschlägern in einen Donutladen eingedrungen und hatten einen ehemaligen Kumpel zusammengeschlagen. Im Vergnügungsviertel war ein betrunkener Autofahrer einem Polizisten über den Fuß gefahren. Nichts Besonderes also. Jedenfalls nichts für die Titelseite.
Kurz nach eins hatte es einmal so ausgesehen, als braute sich doch noch etwas zusammen. Ein wohlhabender Arzt in Forest Hill hatte seine Frau mit dem besten Freund seines minderjährigen Sohns im Bett überrascht und den Teenager mit einem Küchenmesser bearbeitet. Zuerst hieß es, er habe dem jugendlichen Liebhaber den Penis abgeschnitten. Amankwah hatte sofort in der Redaktion angerufen, und alle waren schwer begeistert. Vor allem hoffte man, dass es sich bei dem Arzt um einen Chirurgen handelte. Aber eine Stunde später wusste man, dass er Dermatologe war und ein Buttermesser benutzt hatte. Der Teenager hatte lediglich einen Kratzer an der Hand.
Eine Attacke mit einem Buttermesser, dachte Amankwah enttäuscht. Was für ein Weichei!
Die Uhr mit der Ortszeit zeigte nun 5:30 an. Amankwah checkte die Agenturmeldungen. Nichts. Auch die halbstündigen Nachrichten des Radiosenders gaben nichts her. Und zwar gar nichts. Amankwah drehte den Taxifunk lauter und hörte eine ganze Minute lang zu. Nichts. Dann konzentrierte er sich auf den Polizeifunk.
Das übliche Hin- und Hergerede. Doch dann hörte er plötzlich «Code rot». Die Polizei änderte die Codes jede Woche, aber es gehörte nicht viel Phantasie dazu, um zu begreifen, dass «Code rot» ein größeres Kaliber bedeutete. Vielleicht sogar Mord. Amankwah drehte die Lautstärke auf.
Eine Adresse wurde durchgegeben: Market Place Tower, Front Street 85A, Wohnung 12A.Plötzlich war Amankwah hellwach. Verdammter Mist! Er kannte die Wohnung, er war selbst schon dort gewesen. Sie gehörte Kevin Brace, dem berühmten Radiomoderator. Vor ein paar Jahren waren Amankwah und Claire Gäste in seiner Sendung gewesen, und anschließend hatte Brace sie zu der Party eingeladen, die er und seine junge zweite Frau jedes Jahr Anfang Dezember gaben. Damals galten Claire und er als das Glamourpärchen der Stadt – gebildet, schwarz und verdammt gutaussehend. Amankwah strahlte von allen Werbeplakaten, mit denen der Star damals für sich warb. Er galt als der heißeste junge Lokalreporter der Stadt.
Er biss sich auf die Lippen. Der Market Place Tower lag nur ein paar Straßenecken weiter. Amankwah drosselte die Lautstärke und hielt das Ohr an den Lautsprecher. Jetzt hörte man die Streifenpolizisten, an die der Notruf gegangen war. Sie waren clever genug, um Brace’ Namen nicht zu erwähnen.
Nicht zu fassen! Kevin Brace! Kanadas Vorzeige-Talker und Gutmensch, «die Stimme Kanadas». Die Praktikanten in den Funkräumen der anderen drei großen Zeitungen hatten bestimmt nicht kapiert, um wen es ging. Wenn das keine Story war – höchste Alarmstufe wegen etwas, das in Brace’ Wohnung passiert war, vielleicht sogar ein Mord. Und außer ihm wusste niemand etwas davon!
Amankwah schaute in das fast leere Großraumbüro. Ein Redakteur arbeitete an der Onlineausgabe der Zeitung, ein anderer bearbeitete einen Artikel, den ein junger Kollege eingereicht hatte. Eigentlich musste er ihnen Bescheid sagen.
Aber er wusste ganz genau, was dann passieren würde. Man würde einen Kollegen vom Bereitschaftsdienst auf die Story ansetzen. Amankwah würde man allenfalls anerkennend auf die Schulter klopfen, aber das wär’s dann auch schon gewesen.
Unruhig erhob er sich und ging in dem winzigen Kabuff auf und ab. Gleich würde Großalarm gegeben werden, und dann würde sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreiten. Ganz ruhig bleiben! Amankwah nahm seine Brieftasche aus dem Jackett und steckte sie sich in die Hosentasche. Dann holte er seine Digitalkamera aus dem Jackett und umschloss sie mit einer Hand. Bis jetzt hatte er damit hauptsächlich Fotos von seinen Kindern gemacht. Er versuchte, sich seine Erregung nicht anmerken zu lassen, verließ den Funkraum und gähnte übertrieben.
«Ich hol mir mal eben einen Kaffee», sagte er, als er an einem der Redakteure vorbeischlenderte, und ließ mit der freien Hand ein paar Münzen in seiner Hosentasche klimpern.
Nur eine portugiesische Putzfrau stand vor den Fahrstühlen neben dem Großraumbüro. Der Rufknopf nach oben leuchtete. Die Cafeteria lag einen Stock tiefer. Amankwah drückte auf den Abwärtsknopf, lehnte sich an die Wand und gähnte wieder.
Der Fahrstuhl nach oben kam zuerst, und die Putzfrau stieg ein. Amankwah sah ihr betont gelangweilt hinterher. Aber in dem Moment, als sich die Fahrstuhltür schloss, rannte er los. Die Treppe an der Westseite des Gebäudes lag direkt hinter der gläsernen Fassade. Amankwah schaute auf die dunkle Straße, als er hinunterrannte, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Seine Schritte hallten durch das ganze Treppenhaus. Fünf Stockwerke weiter unten drosselte er das Tempo, winkte dem Mann vom Sicherheitsdienst freundlich zu und verließ das Gebäude, das direkt am Ufer des Ontariosees lag, durch den Eingang zur Yonge Street. Dann rannte er wieder los, in nördlicher Richtung. Ein eiskalter Wind blies ihm entgegen.
Er nahm die Unterführung unter dem hässlichen Gardiner Expressway, mit dem die Innenstadt in den fünfziger Jahren vom Seeufer abgeschnitten worden war. Damals hatte man gebaut, als würde kein Mensch je zu Fuß gehen. Nur ein schmaler Fußgängerweg, mit einer Betonmauer von der Fahrbahn getrennt, führte unter der monströsen Stadtautobahn hindurch. Jeden Morgen zwängten sich Massen von Menschen auf dem Weg zur Arbeit durch dieses Nadelöhr. Viele von ihnen wohnten auf den Inseln, die der Stadt südlich vorgelagert waren, und kamen von den Fähren, die regelmäßig zwischen der Innenstadt und den Inseln verkehrten. Gut, dass es noch so früh war! Ein paar Stunden später wäre hier kein Durchkommen mehr gewesen.
Amankwah rannte, so schnell er konnte, die Hand fest um die Kamera geschlossen. Am nördlichen Ende der Unterführung erreichte er die Front Street und drehte keuchend nach Osten ab. Der Wind war bitterkalt.
Nur noch ein Häuserblock! Ein Straßenschild wies bereits auf den Market Place Tower hin.
Ich brauche diese Story, dachte Amankwah immer wieder. Ich brauche diese Story!
5
So früh am Morgen herrschte noch nicht viel Verkehr, und Inspector Greene kam gut voran. Er staunte immer wieder, wie zügig man durch die Stadt kam, wenn die Straßen ausnahmsweise mal frei waren. Außerdem hatte er das Signallicht aufs Autodach gestellt, sodass er nicht mal bei Rot anhalten musste. Ein, zwei Stunden später hätte ihm das aber nicht mehr viel genützt.
An der Front Street bog er nach Osten ab und fuhr an einigen der ältesten Backsteinhäuser der Stadt vorbei, vier oder fünf Stockwerke hoch und liebevoll restauriert. In den Erdgeschossen befanden sich Läden mit großen, geschmackvoll dekorierten Schaufenstern. Die Fußgängerwege auf beiden Straßenseiten waren ungewöhnlich breit und verliehen der Front Street ein gediegenes, fast europäisches Flair. Der Market Place Tower stand auf einem Eckgrundstück am Ende eines vornehmen Straßenabschnitts.
An der Kreuzung bog Greene in südlicher Richtung in eine Seitenstraße und fand einen freien Parkplatz hinter einem alten Kleintransporter, auf dem noch Schnee lag. Wahrscheinlich gehörte er einem Lieferanten, der frische Ware zum St.-Lawrence-Markt auf der anderen Straßenseite brachte, dachte Greene. Wenn der Schnee in der Stadt längst geschmolzen oder vom Räumdienst beseitigt worden war, lag auf den Wagen, die aus den kälteren Vororten und den umliegenden Städten kamen, oft noch Schnee.
Greene stieg aus und beeilte sich, an den Tatort zu gelangen. Er kam an der Einfahrt einer Tiefgarage vorbei, vor der ein Schild stand: Zufahrt nur für Bewohner des Market Place Tower. Besucher melden sich bitte beim Portier.
Greene ging, so schnell er konnte, ohne zu rennen. Für das Auftreten eines Inspectors der Mordkommission gab es ungeschriebene Gesetze. Unter anderem besagten sie, dass man sich gepflegt kleidete, keine Waffe trug und – außer im größten Notfall – nicht rannte.
Die große Doppeltür am Haupteingang des Market Place Tower glitt zur Seite. Hinter einem langen Rosenholztresen saß ein uniformierter Portier, der, seinem Aussehen nach zu urteilen, aus Vorderasien stammte und die Toronto Sun las.
«Inspector Greene von der Mordkommission», sagte Greene.
«Guten Morgen, Inspector.»
Rasheed war auf die Portiersjacke gestickt. Der Mann sprach mit deutlichem Akzent. Wahrscheinlich ist er Doktor der Naturwissenschaften und gilt in seiner Heimat als bedeutender Gelehrter, dachte Greene.
Weiter hinten in der Lobby, zwischen den Fahrstühlen und einer Tür, die wohl zum Treppenhaus führte, stand eine strategisch perfekt positionierte Polizistin. Als sie merkte, dass jemand das Haus betrat, drehte sie sich zu Greene um.
Greene erkannte sie und lächelte erfreut.
Officer Nora Bering nickte ihm zu, warf einen prüfenden Blick auf die Fahrstuhltüren und ging Greene dann entgegen.
«Hallo, Inspector», sagte sie und gab ihm die Hand. «Ich habe die Fahrstühle blockiert. Polizisten können sie aber selbstverständlich benutzen. Mein Kollege ist allerdings in den zwölften Stock gelaufen. Er hat sich schon aus der Wohnung gemeldet und sagt, dass da oben alles unter Kontrolle ist. Der Notarztwagen war schon da. Das Opfer war aber bereits tot, als mein Kollege am Tatort eintraf. Die Kollegen von unserem Revier haben den Tatverdächtigen und den Zeugen bereits ins Polizeipräsidium gebracht. Inspector Ho von der Spurensicherung ist gerade auf dem Weg nach oben. Mein Kollege ist auch noch in der Wohnung und hat dafür gesorgt, dass dort nichts verändert wird.»
Greene nickte. Bering galt zu Recht als eine der besten Streifenpolizistinnen der Stadt. «Welcher Kollege ist denn da oben?», fragte er. Wer mit Bering zusammenarbeitete, hatte bestimmt viel von ihr gelernt und war selbst ein brauchbarer Polizist.
Bering zögerte einen Moment, ehe sie sagte: «Officer Daniel Kennicott.»
Unwillkürlich wandte Greene den Blick von ihr ab, merkte aber trotzdem, dass sie ihn aufmerksam musterte. Kennicotts Bruder war vor viereinhalb Jahren ermordet worden, und Greene hatte die Ermittlungen geleitet – sein bislang einziger ungelöster Fall.
Ein Jahr nach dem Mord, als Kennicott seine Anwaltskarriere beendet hatte, um Polizist zu werden, hatte sich die Presse auf ihn gestürzt und wochenlang über den vielversprechenden jungen Anwalt berichtet, dessen Gerechtigkeitsgefühl so verletzt war, dass er auf eine lukrative Karriere und gesellschaftliches Ansehen verzichtete. Dass Kennicott ein gutaussehender, sprachgewandter Single mit guten Manieren war, machte ihn für die Medien noch interessanter. Zusätzliche Sympathiepunkte sammelte er dadurch, dass ihm der Rummel um seine Person sichtlich unangenehm war.
Greene hatte ihn stets wie jeden anderen behandelt, der den gewaltsamen Tod eines nahen Verwandten zu beklagen hatte. Nach ihren ersten Begegnungen – direkt nach dem Mord – hatten sie sich zunächst alle zwei Monate getroffen, dann immer seltener. Seit Kennicott Polizist war, fanden diese Treffen immer statt, wenn er nicht im Dienst war und keine Uniform trug.
Greene rechnete ihm hoch an, dass er keine Sonderbehandlung verlangte. Aber im Laufe der Jahre, als die Treffen immer kürzer wurden und es kaum noch Neues zu berichten gab, wurde Kennicotts Enttäuschung zusehends spürbarer. Zwischen dem leitenden Ermittler und den Angehörigen eines Mordopfers herrschten immer Spannungen. Die Erwartungen der Hinterbliebenen – dass der Täter schnell gefasst, zügig der Prozess eingeleitet und eine klare Verurteilung mit einem angemessen hohen Strafmaß erfolgen würde – kollidierten oft mit den bürokratischen Rahmenbedingungen der Polizeiarbeit und der Rechtsprechung. Die Staatsanwaltschaft bewegte sich ohnehin in unzugänglichen Sphären, sodass den Hinterbliebenen gar nichts anderes übrigblieb, als sich an die ermittelnden Polizisten zu halten – auf der Suche nach Trost und auch, um ihren wachsenden Frust loszuwerden.
Beruflich waren sich Greene und Kennicott immer aus dem Weg gegangen. Ohne je darüber gesprochen zu haben, wussten beide, dass es so besser war. Vielleicht war es nun an der Zeit, zur Normalität überzugehen, dachte Greene. Insgeheim hatte er Kennicotts Karriere genau verfolgt, wie ein großer Bruder, der sich nicht einmischt, aber trotzdem jederzeit Bescheid weiß. Und der junge Mann hatte ihn durchaus beeindruckt. Ein geflügeltes Wort unter Polizisten besagte: Um in die Mordkommission aufzusteigen, braucht man einen Rabbi. Jemanden, der einen beobachtete und förderte.
«Wie gesagt, Kennicott hat alles unter Kontrolle», sagte Bering.
«Das überrascht mich nicht», erwiderte Greene. Dann ging er zu Rasheed zurück und fragte: «Wie viele Fahrstühle gehen in den zwölften Stock?»
«Die beiden dahinten und einer für Lieferungen und den Hausservice im hinteren Teil des Gebäudes.»
Greene beugte sich über den Empfangstresen, um auf die Monitore zu schauen, die Livebilder aus verschiedenen Gebäudeteilen übertrugen.
«Können Sie von hier aus alle Ausgänge sehen?»
«Ja. Alle Hauptausgänge.»
Was sollte das heißen? «Gibt es denn noch andere?»
Rasheed fühlte sich sichtlich unwohl. «Nur in der Tiefgarage. Aber der wird fast nie benutzt. Man kann ihn nur von innen öffnen.»
Greene warf Bering einen fragenden Blick zu.
«Ich habe alle drei Fahrstühle blockiert, auch den für den Hausservice», sagte sie. «Die Treppe habe ich bewacht, bis Verstärkung eintraf. Die Tiefgarage konnte ich nicht auch noch sichern.»
«Gut gemacht», sagte Greene. Bering war ganz allein in der Lobby gewesen und hatte aufgepasst, dass niemand herunterkam oder die Lobby verließ. Greene war sich ganz sicher, dass sie auch Rasheed keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte.
«Woran merken Sie, ob die Tür zur Tiefgarage geschlossen ist?», fragte er den Portier.
«Ich sehe nach, wenn ich meine Kontrollgänge mache.»
«Haben Sie das heute Morgen schon getan?»
«Nein. Aber die Tür wird wirklich kaum benutzt. Dies ist ein ruhiges Haus.»
Mit der Ruhe dürfte es bald vorbei sein, dachte Greene. Sobald bekannt würde, dass die Frau von Kevin Brace tot in der Badewanne gefunden worden war, würde hier die Hölle los sein. «Und wenn jemand die Tür offen hält, zum Beispiel mit einem Stein oder einem anderen Gegenstand?»
Rasheed wurde rot. «Na ja… das kommt schon mal vor.»
Alles klar, dachte Greene. Es war bereits das zweite Mal, dass er Rasheed eine Aussage entlockt hatte, die der ursprünglich hatte zurückhalten wollen.
Auf dem Weg zu den Fahrstühlen vergegenwärtigte er sich die momentane Lage: Bering hatte die Lobby überwacht. Tatverdächtiger und Zeuge waren schon fortgebracht worden. Die Spurensicherung war bei der Arbeit. Er wollte gerade die Tür zum Treppenhaus öffnen, als sie von innen aufgestoßen wurde.
Eine kleine alte Frau mit streng aus der Stirn frisiertem grauem Haar ging zügig an ihm vorbei. Sie trug einen langen schwarzen Mantel und einen leuchtend blauen Schal, den sie fest um den Hals gebunden hatte. Für ihr Alter hielt sie sich bewundernswert gerade. Schnell ging sie auf die Haustür zu und grüßte den Portier im Vorbeigehen mit Namen.
Greene musste sich beeilen, um sie noch an der Tür abzufangen. Eine zusammengerollte Matte hing an ihrer Schulter, zwei weiße Handtücher hatte sie sich unter die Arme geklemmt, und in der Hand hielt sie eine große Wasserflasche.
«Entschuldigen Sie, Ma’am», sagte Greene und zückte seinen Dienstausweis. «Inspector Ari Greene von der Polizei. Im Moment darf niemand das Gebäude verlassen.» Dass er von der Mordkommission war, wollte er nicht unbedingt gleich verraten.
«Niemand darf das Gebäude verlassen? Was soll das heißen?» Die Frau sprach mit leichtem britischem Akzent. Trotzdem konnte man hören, dass sie schon länger in Kanada lebte. Von nahem sah Greene, dass ihre hohen Wangenknochen ihr Gesicht jünger wirken ließen. Sie trug kein Make-up, und ihre Haut war erstaunlich glatt. Sie hatte etwas Würdevolles an sich, das Greene anrührte.
«Es hat einen Vorfall in dem Gebäude gegeben», erklärte er.
«Und was hat das mit mir zu tun?», fragte die Frau. «Ich muss in elf Minuten beim Training sein.»
Greene ging um sie herum und verstellte ihr den Weg zur Tür. «Ich fürchte, es handelt sich um eine ernste Angelegenheit», sagte er.
Die Frau zeigte auf Rasheed. «Der Portier kann Ihnen sicher alle Auskünfte geben, die Sie brauchen.»
Greene zückte ein ledergebundenes Notizbuch und einen Kugelschreiber mit eingravierten Initialen. Der Polizeichef, Hap Charlton, hatte ihm den Stift geschenkt, als er in die Mordkommission berufen wurde. Er trat einen Schritt näher an die Frau heran und konnte plötzlich eine Spur von Parfum riechen. Er wusste selbst nicht, warum, aber irgendwie rührte ihn das noch mehr.
«Würden Sie mir bitte sagen, wie Sie heißen?», fragte er.
«Edna Wingate. Dauert das hier lange? Ich möchte nicht zu spät kommen. Mein Yogalehrer mag es gar nicht, wenn man zu spät kommt.»
«Sie wohnen in diesem Haus, Ms.Wingate?»
«12B.Ich mache Bikram Yoga, Inspector, in einem überhitzten Trainingsraum. Manche bezeichnen es auch als heißes Yoga.» Wingate lächelte Greene kokett an. «Dabei kann man Muskeln und Sehnen weiter dehnen als sonst. Deswegen habe ich zwei Handtücher dabei.»
«Und seit wann wohnen Sie hier?»
«Seit zwanzig Jahren. Sie sollten auch Bikram Yoga machen. Männer ziehen es normalem Yoga oft vor.»
«Wir haben die Fahrstühle blockiert», sagte Greene. «Es tut mir leid, dass Sie dadurch Unannehmlichkeiten hatten und die Treppe benutzen mussten.»
Wingate lachte. Ein helles, gewinnendes Lachen. «Ich benutze den Fahrstuhl sowieso nie. Zwölf Stockwerke hoch und runter sind ein gutes Training. Mein Yogalehrer sagt, dass ich die stärksten Beine habe, die er je an einer Dreiundachtzigjährigen gesehen hat.»
Auf der Fahrt hierher hatte Greene mit der Einsatzleitung telefoniert und erfahren, dass es im zwölften Stock nur zwei Wohnungen gab. «Haben Sie heute Nacht oder am frühen Morgen etwas Ungewöhnliches auf Ihrer Etage bemerkt?», fragte er.
«Das kann man wohl sagen.»
«Ach! Und was war das?»
«Ich habe keine Zeitung bekommen und mache mir Sorgen über den Zeitungsboten, Mr.Singh. Sonst ist er die Zuverlässigkeit in Person.»
«Sonst noch was?»
«Nein. Nun muss ich aber wirklich los!»
«Nur wenn Sie mir versprechen, dass Sie mir morgen früh für weitere Fragen zur Verfügung stehen», sagte Greene.
Wingate schaute auf ihre Armbanduhr, eine modische Swatch. «Dann können Sie gleich meine Weihnachtskekse probieren», sagte sie und zwinkerte Greene zu.
«Soll ich vor sechs da sein?»
«Nein. Kommen Sie um acht. Nur montags habe ich so früh Training. Bis dann.» Sie legte Greene eine Hand auf die Schulter und lief geschmeidig um ihn herum.
Greene schaute ihr nach, wie sie auf die Straße trat und schnellen Schrittes in der Dunkelheit verschwand. Immer noch hatte er ihr Parfum in der Nase, und er hing dieser ungewöhnlichen Begegnung einen Moment nach, ehe er sich auf den Weg nach oben machte, um sich die Tote in der Badewanne anzusehen.
6
Sechs Uhr. Perfekt! Albert Fernandez trocknete sich das Gesicht und kämmte sein schwarzes Haar zurück. Zehn Minuten brauchte er noch zum Nägelschneiden und Zähneputzen, weitere fünfzehn zum Anziehen. Zehn, wenn er sich beeilte. Um 6:30 würde die Kaffeemaschine anspringen, und um 6:50 würde er die Wohnung verlassen. Die Fahrt in die Innenstadt dauerte eine halbe Stunde. Blieben sogar noch zehn Minuten Luft für den Frühparkerrabatt, der bis 7:30 gewährt wurde.
Er wickelte sich ein dickes, weiches Handtuch um die Hüften und ging ins Schlafzimmer. Marissa schlief noch. Er blieb stehen, um sie zu betrachten. Ihr schwarzes Haar lag locker auf dem weißen Laken, und er konnte die sanften Rundungen ihrer Halsbeuge und ihrer Schultern sehen.
Nun waren sie schon zwei Jahre verheiratet, aber immer noch konnte Fernandez nicht fassen, dass er Nacht für Nacht mit dieser wunderschönen Frau ins Bett gehen konnte. Obwohl seine Eltern dagegen gewesen waren, hatte er eine Chilenin zur Frau genommen. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte er eine Kanadierin aus sozialistischer oder wenigstens sozialdemokratischer Familie geheiratet. Dabei dachten sie an Leute wie die, von denen sie in den siebziger Jahren als politische Flüchtlinge aufgenommen worden waren. Stattdessen war er in die alte Heimat geflogen und hatte um die Hand einer der reichsten Erbinnen des Landes angehalten. Seither hatten seine Eltern kein Wort mehr mit ihm gesprochen.
Fernandez warf das feuchte Handtuch auf einen Stuhl und betrat seinen Lieblingsort – den begehbaren Kleiderschrank. Er liebte den Anblick seiner Maßanzüge. Meine Eintrittskarte zum Erfolg, dachte er, als er mit einer Hand über den Ärmel eines dunkelblauen Gabardinejacketts fuhr und weiter über eine lange Reihe von Hemden, bis er sich für ein cremefarbenes aus ägyptischer Baumwolle entschied. Es hatte französische Manschetten, die nicht geknöpft, sondern mit Manschettenknöpfen zusammengehalten wurden.
Er nahm das Hemd vom Kleiderbügel und hielt es ans Licht. «Ts, ts!» Er schüttelte den Kopf. Marissa war ihr Leben lang von Dienstboten umgeben gewesen. Erst seit sie mit ihm zusammen war, lernte sie, was Hausarbeit war, und richtig bügeln konnte sie immer noch nicht. Er musste ihr noch einmal klarmachen, wie ein Hemdkragen auszusehen hatte. Dann wählte er von der überquellenden Krawattenstange ein dunkelrotes Exemplar von Armani.
Fernandez’ Art, sich zu kleiden, war wichtiger Bestandteil seiner Karriereplanung, wichtig genug, um sich an allen anderen Ecken und Enden finanziell einzuschränken. Die meisten Kollegen von der Staatsanwaltschaft kleideten sich wie Lehrer oder Vertreter, trugen Schuhe mit Kreppsohlen, braune Anzüge und Krawatten in gedeckten Farben. So setzte er sich schon rein äußerlich von ihnen ab. Sein Erscheinungsbild war tadellos, wie es sich seiner Meinung nach für einen Vertreter der Krone gehörte.
Er nahm ein Paar dunkelbraune Loafers aus dem Schuhregal und warf einen prüfenden Blick darauf. Sie mussten unbedingt nachpoliert werden. Das würde ihn zusätzliche zwei, drei Minuten kosten.
Er zog das Hemd an, band die Krawatte, zog die Anzughose an und griff nach einem seiner Lieblingsgürtel. Glattes braunes Leder mit einer schlichten mattierten Metallschnalle.
Als er seine Gerichtszulassung bekommen hatte, hatte er sich ein Nachschlagewerk über Herrenmode gekauft, und dort hieß es, ein Gürtel müsse im dritten Loch geschlossen werden. Daran hatte er sich stets gehalten. Doch als er den Gürtel jetzt wie gewohnt schließen wollte, musste er feststellen, dass er viel zu eng war. Erst als er den Bauch einzog, bekam er die Schnalle zu.
Erschrocken zog er sein Hemd hoch und betrachtete sich im Spiegel. Keine Frage: Seine Taille war nicht mehr so schlank wie sonst. Das durfte doch wohl nicht wahr sein! Er hatte nichts als Verachtung für die Kollegen übrig, denen der Bauch über die Gürtel aus Kunstleder quoll. Ich muss damit aufhören, dachte er. Schluss mit den billigen Sandwiches in der Mittagspause, Schluss mit den Donuts, die nachmittags im Büro herumgereicht wurden! Für den Moment blieb ihm jedoch nichts anderes übrig, als den Gürtel zu lockern.
Als er sich fertig angekleidet hatte, ging er ins dämmrige Schlafzimmer zurück. Laut Display des Radioweckers war es 6:18.Zwei Minuten vor der Zeit. Marissa bewegte sich im Schlaf und drehte sich auf die andere Seite. Dabei verrutschte die Bettdecke und gab den Blick auf ihren Brustansatz frei.
Auf Zehenspitzen trat Fernandez ans Bett, beugte sich über seine Frau und küsste ihr Haar. Dann betrachtete er ihre Rundungen unter der Decke. Obwohl er Marissa jeden Tag nackt sah, freute er sich immer noch diebisch über jeden unverhofften Blick, den er erhaschen konnte.
Plötzlich spürte er eine warme Hand am Schenkel. «Ich habe nicht gut bügeln?», sagte Marissa im Halbschlaf.
Sie musste sein «Ts, ts» gehört haben. «Gebügelt», korrigierte Fernandez. «Ja, daran musst du noch arbeiten.»
Marissa nahm ihre Hand von seinem Schenkel.
Verdammt, dachte er. Immer wieder machte er den gleichen Fehler. Versteckt hinter seinen Pullovern lag ein Buch in seinem Kleiderschrank, in dem er dienstagabends las, wenn Marissa zum Englischunterricht ging – ein Eheratgeber mit dem Titel Wie man die ersten Jahre übersteht. Immer wieder wurde darin betont, dass man seinen Partner unterstützen sollte, statt ihn zu kritisieren.
«Aber du lernst es bestimmt noch», sagte er und streichelte Marissas Arm.
«Das Bügeleisen muss mehr heiß sein, richtig?», fragte sie. Sie strich mit der Hand über sein Hosenbein.
«Ja, es muss heißer sein. Es kommt auf die richtige Temperatur an.»
Auf Marissas Lippen zeichnete sich ein winziges Lächeln ab. «Und ich muss mehr fest drücken.»
«Genau. Du musst fester drücken. Da siehst du mal, wie gut du schon Bescheid weißt!»
«Heißer und fester», wiederholte Marissa, der diese sprachlichen Korrekturen nicht entgangen waren. Dann zog sie die andere Hand unter der Decke hervor und streichelte Fernandez’ Schenkel.
Fernandez schaute auf den Radiowecker. 6:26.Eine Minute über die Zeit. Der Frühparkerrabatt betrug immerhin vier Dollar.
Marissa fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, rückte näher und griff nach Fernandez’ Gürtelschnalle.
Fernandez fragte sich, ob sie jetzt, da sie seinen Gürtel öffnete, wohl merkte, dass er ihn am zweiten Loch geschlossen hatte. Er wandte den Blick vom Wecker ab. Gönn es dir, Albert, sagte er sich. Immer war er morgens der Erste im Büro. Was machte es schon, wenn er ausnahmsweise mal als Zweiter oder Dritter kam?
Marissa zog seine Hose herunter.
Wenn er aufs Mittagessen verzichtete, bekäme er die vier Dollar wieder rein. Gleichzeitig würde er damit etwas für seine Figur tun.
Marissa griff nach seiner Hand, lehnte sich zurück und führte seine Hand an ihre Brust.
Fernandez spürte ihre steifen Brustwarzen, aber Marissa schob seine Hand weiter nach unten und hob ihm die Hüften entgegen.
Während der letzten Monate hatte sie sich öfter bei ihm beschwert. «Albert, du gehst morgens zu früh los und kommst abends zu spät heim», fand sie.
«Das muss sein, wenn ich bei der Krone vorankommen will», erklärte er ihr stets. «Das schaffe ich nur, wenn ich mehr und länger arbeite als die anderen.»
«Aber deine Frau braucht dich auch», sagte sie.
Sie braucht mich tatsächlich, dachte Fernandez, als sie seinen Penis in den Mund nahm. Beide begannen sich rhythmisch zu bewegen, und Marissas Haar wogte über das weiße Laken. Fernandez sog ihren süßlichen Duft ein. Schließ die Augen und genieße den Moment, sagte er sich.
Um 6:39 zog er sich die Hose wieder an. Adios, Frühparkerrabatt! Der Kaffee war auch schon seit fast zehn Minuten fertig und wurde langsam schal. Am liebsten hätte Fernandez sich frischen aufgebrüht, aber dafür war es jetzt zu spät. Stattdessen goss er den Kaffee in seine alte Thermoskanne, um ihn mitzunehmen. Auch wenn er nicht mehr ganz frisch war, schmeckte er zehnmal besser als das grauenvolle Zeug im Büro.
An der Wohnungstür hob er den Toronto Star auf und überflog ihn auf der Suche nach dem Einzigen, was ihn interessierte: War letzte Nacht ein Mord geschehen? Auf der Titelseite reckten siegreiche Hockeyspieler ihre Schläger in die Luft. Auch beim Durchblättern stellte er fest: kein Mord. Seit Wochen ging das so. Irgendwann musste diese Durststrecke doch vorbei sein! Frustriert ließ Fernandez die Zeitung fallen.
Seit fünf Jahren arbeitete er sich die Karriereleiter bei der Kronanwaltschaft strategisch hinauf: als Erster kommen, als Letzter gehen, stets gut vorbereitet sein, souverän und makellos auftreten. Und er arbeitete daran, die Richter besser kennenzulernen. Entsprechende Unterlagen befanden sich gut versteckt in seiner untersten Schreibtischschublade – eine Schachtel mit Karteikarten, auf denen er die Eigenheiten, Vorlieben und Abneigungen jedes einzelnen Richters in seiner fein geschwungenen Handschrift sorgfältig notierte. Aber das Wichtigste war natürlich, Fälle zu gewinnen.
Langsam begann sich sein Arbeitseifer auszuzahlen. Vor einem Monat hatte ihn die leitende Staatsanwältin, Jennifer Raglan, in ihr Eckbüro gerufen.
«Albert», hatte sie gesagt und einen Stapel Prozessakten auf ihrem stets überladenen Schreibtisch verrückt, «ich weiß, wie sehr es Sie drängt, die Krone endlich einmal in einem Mordprozess zu vertreten.»
«Nein, nein», hatte Fernandez bescheiden abgewehrt. «Ich nehme, was kommt. Für mich sind alle Fälle gleich wichtig.»
Raglan grinste. «Sie haben sich eine Chance verdient, Albert. Dafür, dass Sie erst seit fünf Jahren hier sind, haben Sie bereits viel geleistet. Der nächste Mord ist Ihrer.»
In der Tiefgarage lief der alte Toyota langsam warm, und Fernandez holte seine schwarzen Lederhandschuhe aus dem Handschuhfach.
Als er vom Bett aufgestanden war, hatte Marissa gesagt: «Das war nur ein Vorgeschmack. Heute Abend machen wir richtig.»
«Machen wir es richtig», hatte er korrigiert.
Marissa hatte geseufzt. «Englisch ist so schwer!»
Das ist doch mal eine Perspektive, dachte Fernandez, streifte sich die Handschuhe über und haute unsanft den Gang rein. Nun fehlt mir nur noch ein Mord, der nach Redaktionsschluss begangen wurde. Dann könnte es – abgesehen von dem schalen Kaffee – ein perfekter Tag werden.
7
Verdammt! Warum bereiten sie einen darauf eigentlich nicht im Jurastudium vor?, fragte sich Nancy Parish genervt, als sie eine neue Strumpfhose aus dem Kleiderschrank holte. Die erste war gerade beim Anziehen zerrissen. Unwillkürlich fiel ihr Blick auf den Ganzkörperspiegel der offenen Schranktür. Es war der einzige, für den sie in ihrer winzigen Doppelhaushälfte Platz hatte. Wie sollte man so früh am Morgen mit diesem Anblick fertigwerden? Eine alleinstehende Frau, die auf die vierzig zuging und nur mit einer Strumpfhose bekleidet war? Einer zerrissenen noch dazu!





























