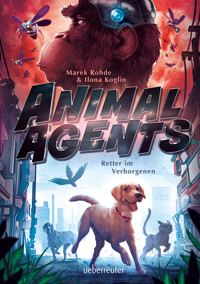
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Animal Agents
- Sprache: Deutsch
Hier kommen die Animal Agents: Eine geheime Gesellschaft der Tiere mit dem Auftrag, die Fehler der Menschen wiedergutzumachen Mit ihren Trillionen Mitgliedern sind die Agenten der Geheimen Gesellschaft der Tiere in unermüdlicher Mission unterwegs, um die Welt vor den Fehlern der Menschen zu bewahren. Und nun will die fiese Firma Black X sogar alle fleißigen Bienen durch mörderische Roboterbienen ersetzen! Das können die junge Labradorhündin Berry, die Khao-Manee-Katze Yoko, der Straßenhund Doozer und der Papagei Quiri nicht zulassen! Doch es gibt auch Tiere, die der Gesellschaft nicht angehören und nur einen Ausweg sehen: Sie wollen gleich die ganze Menschheit vom Thron stürzen ... Atemberaubende und spannende Tierfantasy à la »Woodwalkers« und »Animox«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Mit ihren Trillionen Mitgliedern sind die Agenten der Geheimen Gesellschaft der Tiere in unermüdlicher Mission unterwegs, um die Welt vor den Fehlern der Menschen zu bewahren. Und nun will die fiese Firma Black X sogar alle fleißigen Honigbienen durch mörderische Roboterbienen ersetzen! Das können die junge Labradorhündin Berry, die Khao-Manee-Katze Yoko, der Straßenhund Doozer und der Papagei Quiri nicht zulassen!
Doch es gibt auch Tiere, die der Gesellschaft nicht angehören und nur einen Ausweg sehen: Sie wollen gleich die ganze Menschheit vom Thron stürzen …
Atemberaubend spannende Tierfantasy!
Inhalt
Prolog: Eine Biene in Gefahr
1. Alles kann wichtig sein
2. Der Plan der Fellwechsler
3. Zum Glorreichen Ufer
4. Die Mauern von Haunting Heart
5. Das dunkle Zeichen
6. Das gute Tier
7. Der Hohe Rat
8. Viel Kleines ergibt was Großes
9. Der schleichende Tod
10. Man weiß nie, wer hinter einem steht
11. So sind die Regeln
12. Die Welt wird, wie man sie sieht
Epilog: Es gibt ein Zurück
Dank
Prolog: Eine Biene in Gefahr
Die Straßen von Brooklyn waren so ruhig und friedlich, als wären sie eben erst mit einem großen, unsichtbaren Pinsel voller bunter Sonnenstrahlen in die Landschaft gemalt worden. Bell genoss es, in den frühen Morgenstunden durch die Häuserschluchten zu fliegen. Zu tanzen, zu wirbeln und sich in der Luft zu überschlagen. Hinauf in den rosa-blauen Himmel zu sausen und von weit oben, nach einem kühnen Moment der Schwerelosigkeit, herabzuschießen. Hoch und runter, auf und ab. Bis ihr schwindlig wurde. Und dabei den wohlig warmen Windhauch zu spüren, der ihren alten Bienenkörper umschmeichelte, sich unter den Flügeln aufblähte und ganz sanft gegen sie drückte. Bell liebte Tage wie diese.
Sie wusste zwar, dass es ihre Aufgabe war, die Gegend auszukundschaften. Dass sie unterwegs war, um neue ergiebige Futterquellen zu finden. Dass Fliegen kein Zeitvertreib war! Doch trotz aller guten Vorsätze ließ sie sich immer wieder hinreißen. Manchmal beobachtete sie einfach nur, was um sie herum vor sich ging. Untersuchte eine Blume am Wegesrand. Oder verfolgte einen der vielen Fellwechsler, wenn er da unten aus seiner Behausung trat und sich an sein Tagewerk machte. Ja, manchmal zog sie sogar neugierig über seinem Kopf Kreise oder reiste ein Stück des Weges unbemerkt auf seiner Schulter mit.
Für Bell gab es in dieser Welt immer etwas Neues zu entdecken. Und wenn sie genug hatte, dann flog sie wieder zurück. Zurück auf die Dachterrasse zu ihrem Bienenstock, um aufgeregt tänzelnd von ihren Erlebnissen zu berichten. Manche Bienen missbilligten ihr nutzloses Treiben. Doch sie war sich sicher: Es konnte nichts Schöneres geben.
Auch heute nahm sie ihren Lieblingsweg, der in ihrem Bienenstock in der Clinton Avenue begann, und überflog die begrünten Dachterrassen mit all ihren Pflanzen und Blüten in unzähligen Töpfen und Kisten. Aufgeregt steuerte sie die Hausfassade entlang, vorbei an Balkons mit üppigen Blumenkästen und satten Baumkronen. Und wie jeden Tag brauste sie an der Mary of Nazareth Kirche mit ihren Büschen vorüber und besuchte das kleine Schwimmbad im Commodore-Barry-Park mit den Wildrosenblüten und dem Klee.
Bell hatte eben ihre Lieblingstränke erreicht und wollte umkehren, als sie schräg hinter sich etwas bemerkte. Mit ihren großen Facettenaugen konnte sie für gewöhnlich fast alles sehen, was hinter ihrem Rücken geschah. Dieses Mal nicht. Da war irgendetwas. Ganz sicher. Nur flog es außerhalb ihres Sichtbereichs. Deutlich konnte sie die Schallwellen spüren. Sie schauderte. Sie zögerte. Dann schwebte sie für einen Augenblick leicht wippend auf der Stelle, um die Gegend nach gefährlichen Anzeichen abzusuchen … Nichts.
Sie flog weiter. Doch nach einem kurzen Moment war es wieder da. Und kam näher. Bedrohlich nah. Sie erhöhte ihre Geschwindigkeit und schlug ein paar Haken. Aber das, was sie verfolgte, ließ sich nicht so leicht abschütteln. Bell war zu weit von dem Dachgarten entfernt, auf dem ihr Stock stand. Dorthin konnte sie also nicht fliehen. Deshalb tat sie das Einzige, was ihr übrig blieb: Sie sauste, so schnell sie konnte davon. Und dennoch spürte sie das unsichtbare Etwas immer dichter an sich herankommen. Sie wusste nicht, was es war oder woher es kam. Doch eines war ihr klar: Es war anders als alles, was sie kannte – und es hatte es auf sie abgesehen.
Und so hielt sie sich dicht an den Hausfassaden und suchte fieberhaft nach einem Versteck. Irgendeinen Spalt, eine Ritze oder einen anderen Ort, an dem sie sich verkriechen und abwarten konnte, bis das Ding weitergezogen war. Ohne Erfolg. Ihre Kräfte schwanden. Wenn sie ihm nicht bald entkam, würde es sie einholen.
Kaum hatte Bell das gedacht, bemerkte sie, dass sich dieses bedrohliche Etwas direkt hinter ihr befand. Todesangst fuhr ihr durch alle Glieder und sie schickte ihre letzten Kraftreserven in ihre Flügelstöße. Viel brachte es nicht. Da kam ihr eine Idee. Augenblicklich ließ sie ihren kleinen, runden Körper zu Boden fallen. Trudelte herab. Bewegte sich nicht mehr. Stellte sich tot. Die Sache war riskant. Lebensgefährlich. Das wusste sie. Denn unter ihr zog sich eine dicht befahrene Straße entlang. Und die großen, rasend schnellen Rollkästen, die die Fellwechsler nutzten, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, waren nun mal so ziemlich das Gefährlichste hier draußen, wie andere Bienen sie eindringlich gewarnt hatten. Diese gepanzerten, gewaltigen Monster, deren Augen in der Nacht blendeten, waren schnell und unheilvoll – auf jede denkbare Weise. Eine Biene musste sich hüten, auch nur in ihre Nähe zu geraten. Normalerweise. Bell hatte viele schreckliche Geschichten gehört, von mutigen und starken Bienen, die nach einer Begegnung mit ihnen nicht zurückgekehrt waren. Alles das wusste sie, als sie sich zu Boden fallen ließ. Aber was blieb ihr übrig?
Während Bell also fiel und dabei um ihre eigene Achse wirbelte, versuchte sie zu erkennen, ob ihr dieses Etwas noch folgte. Und tatsächlich konnte sie einen kurzen Blick darauf werfen. ›Eine andere Biene?‹, wunderte sie sich. Da rauschte auch schon ein Rollkasten riesengroß und bedrohlich über sie hinweg und riss sie mit seinem Fahrtwind etliche Meter weit mit sich. Wie durch ein Wunder blieb sie unversehrt, überschlug sich jedoch mehrfach, bevor sie die Kontrolle zurückerlangte. Eilig stieg sie auf. Gerade noch rechtzeitig. Nur einen Augenblick später und das nächste Gefährt hätte sie erfasst.
Bell war schlecht, alles tat ihr weh, sie hatte vollkommen die Orientierung verloren – und zu allem Übel, jagte dieses Etwas noch immer hinter ihr her. Mit überbieniger Geschwindigkeit kam es von der Seite auf sie zu. Anscheinend wollte es sie rammen. Und endlich konnte sie ihren Verfolger genauer ins Visier nehmen. Dieses Ding flog und es sah aus – wie eine Biene. Doch produzierte es diese merkwürdig starken Schallwellen. Es hatte nichts Lebendiges an sich. Es war größer als sie. Und es glitzerte wie nichts, was sie kannte. Wie auf Tautropfen reflektierten sich die hellen Strahlen der Morgensonne auf dem glatten, unbehaarten Körper. Seine hellblauen Augen leuchteten unheimlich zu ihr herüber. Doch was Bell am meisten entsetzte, war der lange, goldene Stachel an seinem Unterleib.
Und da geschah es. Es rammte sie. Traf sie zwar nicht mit voller Wucht, doch immerhin stark genug, um sie ein gutes Stück zur Seite zu schleudern. Es fühlte sich an wie eine Explosion aus Angst und Schmerz. Könnten Bienen schreien, hätten sich alle Fellwechsler gewiss nach ihr umgedreht. Und es waren mittlerweile einige unterwegs. Aber das können Bienen nun mal nicht, also war sie ganz auf sich allein gestellt. Zum Glück war sie eine erfahrene Fliegerin. Und so schaffte sie es, doch noch einmal einen kleinen Abstand zwischen sich und ihren Verfolger zu bringen.
Die alte Biene stabilisierte ihren Flug mit einem geschickten, kleinen Flügelmanöver und erblickte endlich eine rettende Zuflucht. Direkt vor ihr lag ein sandiges, rundes Areal, mit etwas Gras und einigen großen Bäumen darauf. Dazwischen ein paar wild wuchernde Büsche. ›Das perfekte Versteck!‹, dachte sie, flog aber nicht direkt darauf zu. Stattdessen warf sie sich mit einer allerletzten, verzweifelten Kraftanstrengung noch mal in die Höhe und machte instinktiv das wohl einzig Richtige: Sie flog auf die Sonne zu, sodass ihr unerbittlicher Verfolger im blendenden Gegenlicht nicht ausmachen konnte, wo sie war. Der Trick gelang. Der Schall hinter ihr wurde schwächer. Bell flog noch einige gewagte Kurven, um dann in einem rasanten Sturzflug in einem der Büsche zu verschwinden. Schnell suchte sie zwischen den Blättern Schutz und wartete ab.
Schon kurz darauf schwebte das Ding ganz dicht an ihr vorüber. Vorsichtig lugte sie am Rand eines großen Blattes vorbei, um herauszufinden, was dieses leblose Etwas denn nun war. Eine Biene auf keinen Fall. Vorsichtig, um sich nicht durch unnötiges Blätterrascheln zu verraten, spähte sie hervor. Was sie sah, ließ sie bis ins Innerste erzittern: Auf der glänzend glatten Brust des Angreifers prangte ein schwarzes »X«. ›Das Dunkle Zeichen!‹, dachte Bell entsetzt und überlegte fieberhaft, was sie tun könnte. Sie musste ihr Volk warnen. Alle Tiere. Womöglich sogar den Hohen Rat! Doch vorerst saß sie in der Falle.
Der nächste Hieb kam vollkommen unvorbereitet. Und er traf Bell mit aller Wucht genau am Kopf. Sie wurde vom Ast geschleudert. Im Fallen rauschten etliche Blätter an ihr vorbei. Irgendwie musste dieses Etwas sie entdeckt und sich angeschlichen haben. Wie hatte es das nur geschafft? Aber das spielte keine Rolle. Jetzt ging es nur noch ums nackte Überleben. Wie schwer hatte es sie erwischt? Sie sah, wie zwei blau leuchtende Augen durch das Blätterwerk auf sie zukamen. Der nächste Schlag könnte der Letzte sein.
Bell hatte ihrem Angreifer nichts entgegenzusetzen. Und dabei hatte er noch nicht mal seinen Stachel gebraucht. Halb bewusstlos und starr vor Angst ließ sie sich weiter fallen. Und auf einmal wurde ihr bewusst, dass sie sich direkt über einem Spalt befand, der sie womöglich retten würde. Eine Öffnung im Sand, gerade so breit, dass eine kleine Biene hindurchpasste. Der tief in die Unterwelt hineinführte. Weit nach unten, an einen Ort, von dem sie nur wenig wusste. Sie trudelte mehr, als dass sie darauf zuflog. Gleich. Gleich hatte sie ihn erreicht. Ohne noch einmal zurückzuschauen, stürzte sie sich hinein. Sie wusste, sie war in Sicherheit. Es war einer der vielen geheimen Eingänge zu genau jenem unterirdischen Höhlensystem, in dem irgendwo der oberste Rat der Tierwelt seine Treffen abhielt. Und so ließ sie sich in die Dunkelheit hinabfallen, voller Vertrauen und mit der Gewissheit, dass sie eben dem sicheren Tode entronnen war.
Es dauerte eine Weile, bis sie endlich Boden unter sich spürte. ›Geschafft‹, dachte sie und in diesem Augenblick verlor sie das Bewusstsein.
Das Labyrinth der tausend Gänge
Bell konnte nicht sagen, wie lange sie ohnmächtig gewesen war, und es dauerte einen Moment, bis sie realisierte, wo sie war. Doch dann saß der Schreck wieder in all ihren Gliedern. Panisch blickte sie sich um. Aber von dem funkelnden Etwas war weit und breit nichts zu sehen oder zu spüren. Gut. Bell rappelte sich langsam auf. Eines ihrer Beine machte ihr zu schaffen und noch immer hatte sie Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Doch jetzt war nicht die Zeit, wehleidig zu sein. Das Dunkle Zeichen! Sie musste den Rat warnen. Dringend. Doch wie sollte sie zu ihm finden? Sie wusste, dass sie sich in einem weitverzweigten Tunnelsystem befand. Von Fellwechslern angelegt und zahllosen Tieren in mühevoller Arbeit um Tausende von Gängen erweitert. Durch viele der Tunnel schlängelten sich Wesen, die noch viel größer und gefährlicher als die Rollkästen waren. Sie wurden von den Tieren ›Lichtschlangen‹ genannt. Sie jagten durch die Höhlengänge und machten in kleinen Einbuchtungen halt, in denen Fellwechsler ihre leuchtenden Bäuche betraten und andere sie verließen. Und wehe man geriet als Biene in eine hinein! Dann musste man aufpassen, nicht von einem Fellwechsler gejagt zu werden oder qualvoll zu verhungern, weil man nicht mehr herausfand. Zumindest hatte man ihr dies wieder und wieder eingeschärft.
Aber es half nichts. Irgendwo hier, so sagte man, am Ende eines verlassenen Schachtes, den die Fellwechsler schon vor Langem aufgegeben hatten, gelangte man über eine gut bewachte Mulde in einen großen Hohlraum. Hier traf sich der Hohe Rat der Geheimen Gesellschaft der Tiere. Und genau dort musste sie hin. Musste ihn unbedingt finden. Koste es, was es wolle. Sogar ihr Leben. Also flog Bell tapfer los. In die Dunkelheit hinein, immer dicht an den feuchten Wänden der Gänge entlang. Sie kannte den Weg nicht. Doch wen hätte sie fragen sollen? Hier gab es nur sie und die Finsternis.
Bell erreichte eine Abzweigung. Der Tunnel teilte sich auf in zwei neue Gänge. Sie nahm den rechten. Dann kam sie an noch einen Ausläufer und noch einen. Sie war kurz davor zu verzweifeln. Da begann auf einmal auch noch der ganze Schacht um sie herum zu vibrieren, immer stärker. Sie ahnte schon, was jetzt kam. In einiger Entfernung sah sie die gleißend hellen Augen der Lichtschlange auf sich zurasen. So schnell sie konnte, drängte sie sich in eine der kleinen Spalten, von denen es in dem grob behauenen Gestein viele gab. Sie drückte sich hinein und klammerte sich fest, so gut sie konnte. Dann war es so weit. Bauch für Bauch zog die Schlange an ihr vorüber. Bell wagte nicht hinzusehen.
Ein unglaublich starker Wind zerrte unerbittlich an ihr. Und als sie schon fast glaubte, vor Erschöpfung nachgeben zu müssen – war die Schlange fort. Ein letzter, kalter Windstoß wirbelte herum. Dann war alles so ruhig wie zuvor. Und Bell machte sich weiter auf den Weg. Ein Tunnel und noch ein Tunnel und wieder einer. Gab es denn gar kein Ende? Sie überlegte bereits, ob sie nicht doch zurückkehren sollte, als sie den Schall vieler Lebewesen wahrnahm. Sie flog durch den Schacht. So schnell, dass sie das »Halt! Wer da?« der zwei verdutzten Katzen am Eingang kaum bemerkte.
Bell gelangte in einen großen Hohlraum, der von irgendwo her Tageslicht einließ und voll war mit Tieren aller Arten. Und obwohl man kaum einen Laut von ihnen hörte, mochten es Hunderte sein. Sie hatte es geschafft! Mit neuer Kraft flog sie über die Köpfe der Tiere hinweg, die alle in einer langen Reihe vor einer Öffnung geduldig warteten. Schwirrte hindurch, in eine kleine Nebenhöhle hinein, in der ein Uhu majestätisch in der Mitte eines Steinkreises mit fünf weiteren Tieren saß. Eine Schildkröte, ein Frosch, eine Taube, ein Weißkopfseeadler und ein Fuchs.
Der Hohe Rat tagt
»Einspruch! Ich erhebe entschieden Einspruch! Ich bin nicht einverstanden mit der Lösung. Und ich bin mir sicher, dass der gesamte Waldkreis das auch so sieht«, knurrte gerade der etwas untersetzte Fuchs, dessen Fell ganz struppig war. Er war der offizielle Sprecher des Waldkreises, also aller Tiere, die in den Wäldern wohnten. Ungeduldig zeigte er seine scharfen Zähne.
Der Hohe Rat beriet, wie die Tierheit mit den neuerlichen Jagdausflügen der Fellwechsler umgehen sollte.
»Wir wissen sehr wohl, dass der Waldkreis in besonderer Weise betroffen ist und in dieser Angelegenheit berechtigte Interessen hegt, Waldo«, entgegnete der schwarz-braun gefleckte Virginia-Uhu namens Seneca. Er schwenkte bedächtig seinen majestätischen Kopf mit den puscheligen Ohren, mit denen er auch noch das leiseste Gemurmel in der großen Nachbarhöhle wahrnahm. Die Biene an der Felswand hatte er längst entdeckt und beobachtete jede ihrer Bewegungen.
»Doch müssen wir nun zu einer Entscheidung kommen. Wir müssen die Interessen der gesamten Tierheit berücksichtigen und zu einem gemeinsamen Standpunkt gelangen.« Seine Stimme war von der langen Diskussion schon heiser. Außerdem war er nicht mehr der Jüngste.
»Vorfälle?«, ereiferte sich Waldo nur noch heftiger und sprang auf einen Stein. Sein Fell sträubte sich. »Habe ich mich unklar ausgedrückt? Die Fellwechsler rücken uns Waldtieren auf den Pelz. Jagen und töten uns. Das sind keine Vorfälle. Das ist kalter, brutaler Mord«, aufgebracht blitzten seine Augen zum Vorsitzenden Seneca hinüber, der nun abwägend vor- und zurückwippte.
»Vielleicht … sollten wir … noch etwas … abwarten?«, schlug die steinalte Landschildkröte Magula vor, die als Sprecherin des Landkreises alle Tiere oberhalb oder unterhalb der ebenen Erde im Rat vertrat, und zog sicherheitshalber ihren Kopf ein kleines Stückchen in ihren Panzer zurück.
»Oder wir versuchen irgendwie, auf irgendeine Weise sozusagen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Vielleicht haben sie ja Verständnis?«, setzte der Frosch Rana vom Wasserkreis quakend an und hüpfte von einem Stein zum anderen.
»Ach ja? Kontakt? Und wie darf ich mir das vorstellen? Ich gehe einfach zu ihnen und sage: ›Das mit der Jagd finden wir gar nicht gut. Könntet ihr das bitte unterlassen?‹ Und die sagen dann: ›Aber ja, natürlich, sofort. Das alles war ja nur ein Missverständnis‹«, höhnte Waldo lauthals. »Ich denke, auf so eine Idee kann auch nur ein ahnungsloser Frosch kommen.«
Doch Seneca wies ihn gleich zurecht: »Bitte mäßige dich, Waldo, es ist nicht Ranas Schuld. Vielleicht sollten wir wirklich …«, wollte der alte Uhu nun einen Kompromiss vorschlagen.
In diesem Augenblick flog Bell beherzt direkt vor seinen Schnabel und vollführte dort einen geradezu ekstatischen Tanz in der Luft auf.
»Was will diese Biene hier? Warum wartet sie nicht, wie die anderen?«
Als Bell merkte, dass die Mitglieder des Rates sie nicht gleich wegschickten, ließ sie sich auf einen großen, flachen Stein in der Mitte nieder. Putzte sich ganz kurz und begann dann in einer Art Schwänzeltanz und mit flatternden Flügeln zu erzählen. So wie es Bienen nun mal tun. Wunderschön. Doch wer kein Bienisch kann, versteht kein Wort. Und da Seneca die Sprache der Bienen nie erlernt hatte, schaute er Bells aufgeregtem Gesumme und Gebrumme, Gedrehe und Gewusel nur verdutzt und ratlos zu.
»Kann mir bitte jemand erklären, was das alles zu bedeuten hat?«, wandte er sich Hilfe suchend an Quiri. Der leuchtend grüne Amazonenpapagei mit dem roten Fleck über dem gelben Schnabel hatte etwas abseits gesessen, sein Gefieder gepflegt und wie unbeteiligt dem Schlagabtausch zugehört. Nun segelte er in einem eleganten Bogen zu Seneca herüber und ließ sich neben ihm auf einem Bein, seinem einzigen, nieder. Er schaute Bell aufmerksam zu. Es war wohl schon ein Weilchen her, seit er sich das letzte Mal mit einer Biene unterhalten hatte. Und obwohl er der beste Sprachwandler der gesamten Tierheit war (zumindest behauptete er das gern), musste er sich wieder neu in das Bienische einfinden. Bell zog immer wieder ihre Kreise und Pirouetten, bis Quiri diese endlich entziffert hatte.
»Nun, ja, also …«, meinte der Papagei und klapperte mit dem Schnabel. »Hm, die Biene … also die Biene erzählt etwas von einer Biene. Nein! Keine Biene. Etwas, das nur so aussieht wie eine Biene, aber keiner unserer Welten angehört. Nicht zur Unterwelt und auch nicht zur Oberwelt. Und keinem Kreis. Nicht dem Wasser-, nicht dem Land-, dem Berg-, Wald-, Luft- oder Stadtkreis oder sonst wohin.«
Ungeduldig hüpfte er noch ein bisschen näher, als könne er dadurch Bells Tanz besser deuten. Dann krächzte er mit sich überschlagender Stimme: »Es hat sie verfolgt, gejagt und angegriffen. Sie kam gerade noch mit dem Leben davon. Ein Tier. Aber nicht lebendig. Und auf der Brust trug es … das Dunkle Zeichen!« Er malte mit seinem Schnabel ein »X« in den sandigen Boden und sprang dann einen Schritt zurück, damit es alle sehen konnten. Es wäre nicht nötig gewesen.
Für einen Augenblick herrschte Totenstille in der Runde. Selbst Waldo, der sonst nichts unkommentiert ließ, hatte es die Sprache verschlagen.
Seneca war der Erste, der sich fing: »Wenn diese Biene recht hat und das alles nicht nur die Einbildung eines verwirrten Verstandes mit ausschweifender Fantasie ist, dann haben wir es mit einem vollkommen neuen Wesen des Dunklen Zeichens zu tun. Einem Tier ohne Seele, aber voller böser Absichten. Und wir alle wissen, was das zu bedeuten hat. Wir dürfen keine Zeit verlieren!«
Er wandte seinen großen Kopf von einer Seite zur anderen. Ein Raunen ging durch den Rat. Fragen wie »Nicht lebendig und doch ein Tier?« und »Was hat das zu bedeuten?« klangen heraus. Ein Schauder der Angst nahm alle in Besitz.
Nur Waldo ergriff die Gelegenheit, um die entsetzliche Entdeckung sogleich für seine Sache zu nutzen. »Ich sehe das richtig? Wieder eine dieser finsteren Ideen der Fellwechsler, um noch mehr Unheil anzurichten? Wir müssen endlich etwas unternehmen.«
Doch Seneca unterbrach ihn entschieden: »Nein! Hier liegst du falsch. Nicht alle Fellwechsler sind so«, herrschte er ihn ungewohnt heftig an. Und etwas ruhiger an die anderen Tiere gewandt sagte er: »Ich schlage vor, wir schicken umgehend eine Anfrage über die großen Wasser. Dorthin, wo die Fellwechsler vom Dunklen Zeichen zuletzt ihr Unwesen trieben. Zum Kalten Ufer. Wir haben dort eine pflichttreue Agentin im Einsatz, die sich bestens für diesen Bienenfall eignet. Quiri, schicke die schnellsten Boten! Und führt mir die Biene zu ihrem Stock zurück. Sie ist vollkommen erschöpft.« Der Papagei nickte und flog davon.
Dann wandte Seneca sich an Waldo: »Wir bitten dich, dieses eine Mal mit unserer Stimme zu sprechen. Die Sache ist zu ernst, um sie für lange Rederunden zu missbrauchen.« Und nach einer kleinen Pause, in der sie still und nahezu reglos den Schock verdauten, fragte er: »Will dagegen irgendjemand einen Einspruch erheben?« Aber es kam keiner.
Selbst Waldo zischelte nur etwas wie: »Das kann lange dauern …« Er sagte es so leise, dass noch nicht einmal Seneca es hörte.
Nur die Schildkröte Magula, die Lippen lesen konnte, meinte geduldig: »Manchmal … muss man … eben warten können, … um was zu bewegen.«
1. Alles kann wichtig sein
»Gib Pfötchen! Komm Berry! Mach schon!« Ein Mann, dunkelbraune Lockenmähne, dicke Brille, beugte sich in einem Wohnzimmer in Hamburg über eine junge, zierliche Labrador-Retriever-Hündin mit weichem, fuchsroten Fell. Sie liebte ihr Herrchen Mark. Doch das bedeutete ja noch lange nicht, dass sie alles mitmachen musste, oder? Vor allem, weil sie aus den Augenwinkeln ihre Freundin Yoko beobachtete, die hinter der Glastür zum Hinterhofgarten saß. Die elegante, alte, weiße Khao-Manee-Katzendame sah ihr mit ihrem einen blauen und einem bernsteingelben Auge spöttisch zu, als wäre diese ganze Hund-Fellwechsler-Sache weit unter ihrer Würde.
»Du weißt genau, wie das geht. Wir haben das doch so lange geübt. Berry, schau mal: Herrchen hat auch eine Leckerei für dich.« Sie verstand nicht alles. Aber genau, was er wollte. Mark ließ nicht locker und versuchte, sie mit einem Hundekeks zu überzeugen, den er über ihre Schnauze hielt. Doch sie saß nur da und schnupperte. Legte den Kopf auf die Seite und wurde immer ungeduldiger. Hinter dem Glas fing Yoko an, sich gemächlich die Pfoten zu schlecken, ließ sie aber keine Sekunde aus den Augen.
»Wenn sie nicht will, lass sie doch«, schaltete sich eine Frau mit braunem Pferdeschwanz ein. Ina war soeben aus der Küche gekommen, stellte sich neben ihn und legte ihm einen Arm um die Hüfte. Ein kurzer Blickwechsel zwischen ihr und Berry genügte, damit die Hündin wusste, dass sie sie verstand. Ina lächelte.
Doch Mark wollte nicht aufgeben. »Pfötchen!«, sagte er und wedelte mit dem Hundekeks etwas dichter vor ihrer Nase herum. »Gestern konnte sie es noch.« In seiner Stimme schwang Enttäuschung mit. Aber Berry hatte nun mal anderes im Sinn. Sie wartete, dass Herrchen die angebotene flache Hand wieder zu Boden senkte. Draußen schüttelte sich Yoko. Drinnen seufzte Mark.
»Na gut. Dann eben nächstes Mal. Ich weiß, du kannst das.« Er gab ihr den Keks, den Berry mit einem einzigen Happs zufrieden verschlang.
»Schau mal, das ist doch Yoko von nebenan. Sicher will sie Berry zum Spielen abholen.« Ina zeigte zur Glastür. Etwas Mildes, Warmes lag in ihrer Stimme.
»Wer?«, fragte Mark und sah sich irritiert um.
»Na, die alte weiße Katze mit den unterschiedlichen Augen. Du weißt doch.« Und mit diesen Worten ging sie zur Tür und öffnete sie einen Spalt, damit Berry nach draußen konnte.
»Ach deshalb. Ist es nicht schon zu spät?«, fragte Mark.
»Es ist noch nicht mal dunkel. Gönne ihr doch die Freude«, entschied Ina und Mark willigte grummelnd ein.
Fellwechsler sind gefährlich
Als Berry sich durch den Türspalt drängte und in den Hinterhof stürmte, saß Yoko bereits ein paar Schritte entfernt auf einer halbhohen Ziegelmauer, die von wilden roten Rosen gesäumt wurde.
»Hey Yoko! Da bin ich. Machen wir Übungen? Bitte, bitte! Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf«, rief sie und sprang in die Luft. Yoko schaute sie mit ihrem strahlend blauen Auge an, das andere, das gelbe, hatte sie zugekniffen. Und das verhieß nichts Gutes.
»Du hast es schon wieder getan.« Ihr blauer Blick konnte sich unangenehm tief in einen hineinbohren.
»Nö. Was denn?«, fragte Berry ganz harmlos und kratzte sich mit der Pfote ausgiebig hinter dem Ohr.
»Du weißt genau, was ich meine. Diese Fellwechseleien. Kleine Kunststückchen. Gehorchen und gefallen und so was.« Yokos Stimme war hart und streng. Sie mochte es gar nicht, wenn Berry es ihren Fellwechslern recht machen wollte.
»Und wenn? Was ist denn schon dabei? Meine Fellwechsler sind nett zu mir. Herrchen ist richtig lustig. Und Frauchen …«, wollte sie sich verteidigen.
»Nett? Lustig? Darum geht es nicht. Es geht um deine Würde! Deine Unabhängigkeit. Du lässt sie zu nah an dich heran. Unterwirfst dich ihnen.« Yoko starrte Berrys Halsband an, dessen schwarzer Anhänger ein Auge zeigte.
»Aber du hast doch auch ein Frauchen«, erwiderte Berry.
»Wenn ich dieses alberne Wort schon höre … Frauchen«, äffte Yoko sie nach. »Nein, habe ich nicht. Ich bin eine freie Katze. Bekomme mein Futter und hole mir Nähe und Behaglichkeit ab, wann ich es will. Es sind und bleiben nun mal Fellwechsler. Begrenzte, unberechenbare Wesen, von denen immer Gefahr ausgeht. Immer!«
»Ich mag Gefahr«, gab Berry aufgeregt hechelnd zurück.
Yoko sprang von der Mauer herunter, reckte und streckte sich genüsslich, öffnete das gelbe Auge und baute sich dann vor ihr auf. Sie war ein gutes Stück kleiner als sie, konnte aber sehr Respekt einflößend sein.
»Vergessen wir das. Machen wir mit deiner Ausbildung weiter. Die ALLES-KANN-WICHTIG-SEIN-Übung«, entschied sie.
»Oh ja!«, rief Berry.
»Also, wie du bereits weißt, geht es hierbei um Konzentration und Wahrnehmung. Du musst auf alles achten«, erklärte Yoko und durchschritt mit erhobenem Kopf den verwilderten Garten. Genau darauf bedacht, jede noch so flache Pfütze zu umgehen. Yoko verabscheute nasse oder gar dreckige Pfoten wie nur sonst was.
»Achtung, Yoko, Wurm in Not!« Berry lief zu einer Pfütze und schob einen kleinen Regenwurm, der sich hilflos durch das Wasser wand, mit der Schnauze auf einen sicheren Erdhaufen.
»Hör auf zu trödeln und komm«, rief Yoko ungeduldig herüber.
Aber Berry sah fasziniert zu, wie er damit begann sich einzugraben. »Yoko, stell dir mal vor, du bist der Wurm. Dann ist das das Einzige, was zählt.«
»Das stimmt natürlich. Irgendwie. Aber komm jetzt!«, befahl Yoko und sie gingen vorbei an der mächtigen Eiche in der Mitte des Hofes, einer alten, verrosteten Hollywood-Schaukel und einigen Blumenbeeten, in denen mehr hohes Gras als Blumen wuchsen. Als sie an der gegenüberliegenden Mauer des Gartens ankamen, blieb Yoko stehen und wandte sich ihr zu: »Also, Berry, Konzentration! Pass auf! Was hörst du? Was siehst und riechst du gerade?«
Berry verharrte augenblicklich, stellte ihre Schlappohren auf und schnupperte. »Ich höre und rieche – die weite Welt da draußen.« Dann verstummte sie und atmete sehnsüchtig tief durch.
»Was habe ich dir gesagt? Bleib bei der Sache. Die weite Welt wirst du noch früh genug sehen. Erst musst du lernen, genauer wahrzunehmen. Und dich nicht nur auf das zu konzentrieren, was dich im Augenblick interessiert. Höre, sehe, fühle, rieche und spüre alles um dich herum. Denn alles …«
»… kann wichtig sein. Ich weiß«, ergänzte sie den Satz und gähnte demonstrativ.
»Ja genau. Vom leisesten Geräusch in der Ferne bis zum kleinsten Duft in deiner Nähe.«
»So wie der Wurm eben?«
»Vergiss mal den Wurm. Also?« Berry strengte sich an. »Also, ich höre … ein paar Fliegen.«
»Gut, was noch?«, forderte Yoko.
Sie schaute sich um und horchte angestrengt. »Noch mehr Fliegen. Und Möwen, da oben im Himmel. Eine Taube, die gurrt. Drüben im Baum. Den Wind, der durch die Blätter fegt. Meinen Atem. Deinen Atem. Und meinen Magen. Der knurrt ganz heftig.«
Yoko überging ihre Anspielung. »Du musst das Hören üben, immer wieder. Nimm alles genau wahr und husche nicht nur einfach hindurch.«
»Sag mal, Yoko?«, hob Berry nach einer kurzen Weile an.
»Ja?« Yokos Stimme klang fast mild.
»Warum gehen wir beide eigentlich nie da raus? Richtig raus, meine ich. Ohne Leine. Sind Fellwechsler denn wirklich so schlimm, wie du sagst? Wenn ich nicht bald mehr von der weiten Welt sehe, dann platze ich.«
Yoko überlegte, sah sie an und schüttelte sich gründlich. »Vielleicht sind nicht alle schlimm. Aber du weißt nie, woran du bei ihnen bist. In einem Moment noch ist alles Ordnung. Du wirst geliebt, umsorgt, gefüttert und beschützt. Und plötzlich ist es vorbei.« Die alte Katze schluckte. Sie bekam diesen besonderen Blick, den Berry schon kannte. Dann war es, als schaute sie in die Unendlichkeit hinein.
»Das kann ich nicht glauben. Nicht Herrchen und Frauchen. Die werden sich immer …«
»Um dich kümmern?« Yoko klang etwas mitleidig. »Du hast Glück, dass man dich damals hier im Hof gefunden hat. Aber was, wenn du alt und hinfällig wirst? Werden sie dann immer noch zu dir halten? Oder bist du ihnen nur im Weg?«
Berry wusste keine Antwort. Wie auch?
»Bringst du mir deswegen so viel bei? Damit ich später auf mich aufpassen kann?«, fragte sie vorsichtig. »Alle anderen sind doch auch da draußen. So schlimm kann die weite Welt nicht sein.«
»Tiere ohne Eltern und ohne Gefährten müssen besonders auf sich aufpassen. So sind nun mal die Regeln«, entgegnete Yoko. Dann schwieg sie und starrte gedankenverloren zur Baumkrone der Eiche hinauf, auf der eben eine zweite Taube gelandet war und sich gurrend zur ersten gesellte.
»Dämliche Regeln«, sagte Berry und dachte nach. Stille spannte sich zwischen ihnen auf. Ihr Leben lang hatte sie sich gefragt, woher sie kam. Hatte niemand sie haben wollen? Gehörte sie nirgends richtig dazu? Hatte sie keine Familie gehabt? Keine Eltern? Sosehr sie es auch probierte, sie konnte sich an nichts erinnern. Keine Gerüche. Keine Erlebnisse. Nichts. Und Yoko hatte nicht mehr angedeutet, als einen Unfall mit einem Rollkasten. Seitdem war sie jeder Frage nach ihren Eltern ausgewichen.
Ein geheimnisvoller Auftrag
Doch wie alle jungen Hunde war Berry voller Tatendrang und konnte nun mal nicht lange ruhig bleiben. »Was ist? Wollen wir weiterspielen?«, bellte sie und sprang aufgeregt vor Yoko hin und her.
»Das ist kein Spiel! Das ist ernstes Training«, zischte Yoko, ohne den Blick von den Tauben abzuwenden.
»Und wofür trainieren wir?«, wollte Berry wissen. Es kam keine Antwort und so machte sie einfach weiter: »Na gut, jetzt rieche ich … Also, ich rieche die Fellwechslerjungen, die vorhin hier gespielt haben. Ich rieche Frauchen und Herrchen. Einen Knochen, den ich irgendwo beim Baum vergraben habe. Eine halbvolle alte Fischbüchse in den Mülltonnen. Einen Hauch saure Milch riech ich auch.«
Sie hob ihre zuckende Nase weiter in den Wind, um sich besser auf die Gerüche um sie herum konzentrieren zu können. »Ich rieche das Abendessen von den Fellwechslern im ersten Stock. Lecker! Und … ich rieche einen Hund, der ganz grässlich nach Hafen stinkt«, zählte sie auf und schaute stolz zu Yoko hinüber.
Plötzlich war die Katze wieder voll da. »Einen Hund? Wo?«, rief sie laut, machte einen Buckel und plusterte ihren Schwanz so dick wie möglich auf.
»Hallo, ihr Hübschen«, sagte eine tiefe Stimme und jemand trat aus dem Schatten der Hauswand hervor. Es war ein halbhoher, schrecklich ungepflegter Drahthaar mit strähnigen, grau-braunen Zotteln und buschigen wuchernden Augenbrauen, hinter denen seine Augen fast komplett verschwanden.
Yoko gab ein furchterregendes Fauchen von sich.
»Ich bin Doozer. Vielleicht kennt ihr mich?«, stellte er sich vor und schmatzte.
Yoko sprang mit einem Satz schützend vor Berry und herrschte ihn an: »Was willst du, Gossenhund? Hast du dich im Hinterhof vertan?« Sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie zu allem entschlossen war, um sie zu verteidigen.
»Nun mal langsam. Ich bin hier schon ganz richtig. Du bist Yoko, oder?«
»Was geht dich das an?«, zischte sie und zeigte wie beiläufig ihre Krallen.
»Und wer ist die da?«, fragte er, anstatt ihr zu antworten, und warf Berry einen abschätzigen Blick zu.
»Niemand, der dich etwas angeht.« Yokos Rückenhaare stellten sich noch ein bisschen mehr auf.
»Ich frag ja nur …« Doozer nahm auf seinem massigen Hintern Platz, um sich ausgiebig am Kinn zu kratzen. »Es geht um eilige Angelegenheiten der Gesellschaft.«
Seine Stimme klang mit einem Mal sehr wichtig, fand Berry – und das machte sie neugierig: Was für eine Gesellschaft?
Doch bevor sie nachhaken konnte, fuhr Doozer fort: »Die Gesellschaft schickt mich. Damit wir gemeinsam in einer äußerst bedeutsamen Angelegenheit ermitteln. Und zwar schnell. Denn vielleicht geht es sogar um Leben und Tod. Verstehst du?« Er gähnte und schüttelte sich ausgiebig.
»Gesellschaft?«, flüsterte Berry Yoko zu. »Was meint er damit? Was ermitteln?«, wollte sie wissen.
»Unwichtig«, herrschte Yoko sie an und ihr war sofort klar, dass sie ihr irgendetwas Spannendes verheimlichen wollte.
Derweil plapperte Doozer munter weiter: »Bist du etwa DIE Yoko? Die damals bei der Flut …«
»Halt endlich deine vorlaute Schnauze, Hund. Nicht jetzt. Und nicht hier«, schnitt Yoko ihm messerscharf das Wort ab und kniff wieder mal das gelbe Auge zu. So energisch hatte Berry sie noch nie gehört.
Auch Doozer schien die Reaktion der Katze ziemlich überzogen zu finden. Jedenfalls zeigte er seine Lefzen und hob die Augenbrauen. »Was soll das denn jetzt? Ich hab den undankbaren Auftrag, dich abzuholen – könnte mir auch was Schöneres vorstellen –, aber mir wurde nun mal gesagt: ›Hol die alte Katze, die ist Expertin im Auskundschaften geheimer Orte. Und gehe mit ihr zum Wasser, um …‹«
»Sei jetzt still. Ich komme ja schon. Den Rest kannst du mir unterwegs erzählen«, rief Yoko. Dann drehte sie sich zu Berry um, die voller Neugier in Richtung Doozer schnupperte. Sie öffnete das gelbe Auge wieder und befahl nur: »Geh nach Hause. Unsere Lektion ist beendet. Wir sehen uns morgen.«
»Was? Wieso gerade jetzt, wo es endlich mal spannend wird?«, sträubte sich Berry.
Doozer schnüffelte noch ein oder zwei Mal zurück, legte den Kopf schief und brummte dann: »Sag mal. War das eben etwa die junge Pinker–«
Doch Yoko, die gerade an ihm vorbei zum Hoftor wollte, teilte mit ihrer Tatze einen Hieb in seine Richtung aus und kreischte fast: »Los jetzt! Auf der Stelle!«
Unwillig trottete Doozer hinter ihr her in Richtung Ausfahrt und Berry hörte noch etwas wie: »Unglaublich. Warst du etwa die ganze Zeit hier? Mit der? Seit damals? Ich fass es nicht. Musst du mir unbedingt erzählen.«
Als Antwort bekam Doozer nur ein bitteres Knurren von Yoko zurück.
Doch Berry hatte nun mal ihren eigenen Kopf. Und das war auch genau der Grund, warum sie an diesem Abend eben nicht brav nach Hause ging, wie Yoko es verfügt hatte. Gerade Yoko, die immer so korrekt tat, aber wohl einige Geheimnisse vor ihr hatte. Und wenn es stimmte, was dieser Hund da erzählte, betrafen manche davon sie: Berry.
Wie der dagestanden und so wichtiggetan hatte. Dabei konnte jeder sehen, dass er nur ein gewöhnlicher Straßenhund war. Grässlich ungepflegt. Ein Rüpel durch und durch, der nach alten Fischen stank. Und genau der durfte einfach so mit Yoko umspringen und mit ihr fortgehen? In einer geheimnisvollen Angelegenheit?
Berry war neugierig. Schrecklich neugierig. Und sie fragte sich, was es mit all den Andeutungen auf sich hatte. Doozer hatte etwas von einer Gesellschaft erzählt. Und davon, dass Yoko bei ihr war, seit damals … Was hatte das zu bedeuten? Wieso war Yoko eine Expertin und für was überhaupt? Was sollte das heißen: »Auskundschaften geheimer Orte?« Waren die beiden etwa in diesem Moment auf dem Weg zu so einem Ort? Ohne sie?
Obwohl es Zeit für ihr Abendessen war und Mark und Ina bald nach ihr suchen würden, entschloss sich Berry, ihnen zu folgen, und lief zum halb geöffneten Hoftor. Draußen angekommen, sah sie gerade noch, wie die beiden um eine Ecke bogen. Sie schienen in ein hitziges Gespräch vertieft. Berry schlich hinterher.
Es war viel los auf der Straße. Sie war gezwungen, mehreren Fellwechslern auszuweichen und sich einige Male zu verstecken. Sie wusste, dass sie hier draußen aufpassen musste. Sonst ging sie für gewöhnlich mit Ina oder Mark, die sie durch jede Gefahr lotsten. Doch jetzt war sie auf sich allein gestellt. Sie musste aufmerksam sein. Auf alles achten. So wie es ihr Yoko eingeschärft hatte.
Es wurde dunkler. Heftiger Regen setzte ein und machte die Verfolgung immer schwieriger. Doozer und Yoko überquerten einige Straßen und bogen um etliche Ecken. So langsam wusste Berry nicht mehr, wo genau sie eigentlich waren. Aber sie blieb ihnen auf den Fersen. Durch den Regen konnte sie ihre Fährte nicht mehr so gut riechen. Das heißt: Yoko konnte sie gar nicht riechen. Aber dieser Doozer stank sogar gegen den Wind an.
»Diese grässliche, aufgeblasene Zeckenschleuder entkommt mir nicht«, murmelte sie vor sich hin und ihr Herz hüpfte vor Aufregung. Es ging über dicht befahrene, laute Straßen, vorbei an etlichen Behausungen. Die bunten Lichter in den Häusern erhellten die Szenerie und spiegelten sich in den Pfützen. Nach und nach wurde es stiller. Die Gegend verlassener.
Jetzt sah Berry die beiden in einiger Entfernung an einem Zaun stehen, der das Gelände zum Ufer absperrte. Während sie immer noch miteinander redeten, liefen sie ein Stück an ihm entlang und verschwanden dann durch einen Riss in der Umzäunung. Sie schienen die Gegend zu kennen. Berry war zu weit weg, um etwas verstehen zu können. Sobald die beiden sich weit genug entfernt hatten, lief sie schnell zu der Stelle am Zaun hinüber und schlüpfte selbst hindurch.
Yoko und Doozer gingen weiter in Richtung Ufer und auf eine große Fellwechslerbehausung zu, die dicht am Wasser stand, und versteckten sich. Was war da los? Berry schlich sich auf den Boden geduckt etwas näher heran. Zum Glück lagen um das Bauwerk herum einige Gegenstände, hinter denen sie Schutz fand. Hinter einem alten Rohr, einem verrosteten Rollkasten und zuletzt einem Stapel Holzplatten.
Der Regen wurde heftiger. Berry war nass bis auf die Knochen. Sie machte die MAN-WEISS-NIE-WER-HINTER-EINEM-STEHT-Übung und achtete darauf, dass sie keinen Rückenwind hatte, der sie verraten konnte. Als sie nah genug war, konnte sie erkennen, warum die beiden nicht weitergingen. Vor dem Gebäude waren etliche Fellwechsler versammelt. Sie alle hatten auffällige schwarze Panzer um ihre Oberkörper. Eben rollten mehrere riesige Rollkästen heran. Die Fellwechsler liefen durcheinander. Einer öffnete das große Tor.
Zwei Fellwechsler stiegen aus und verschwanden im Gebäude. Licht ging an. Dann kehrten sie zurück. Einer der beiden rief etwas und alle rannten hinein. Der Platz war leer. Das war der Augenblick, auf den Yoko und Doozer wohl gewartet hatten. Sie eilten zum Eingang und waren auch schon verschwunden. Berry überlegte, ob sie lieber in ihrem Versteck warten sollte, bis sie wieder auftauchten. Doch ihre Neugier siegte. Wenn sie erfahren wollte, worum es hier ging, dann musste sie da rein! Also lief sie los.
Ein dunkles Zeichen
Als sie das Gebäude betrat, gelangte Berry in einen langen Gang. Von Yoko und Doozer war nichts zu sehen. Sie schnüffelte und horchte. Aus einiger Entfernung kam ein Poltern, dann das ungeduldige Rufen von Fellwechslern. Sie schlich weiter und erreichte einen schlecht beleuchteten Flur. Von ihm führte eine Treppe hinunter in einen noch dunkleren Gang. Das war eigentlich gut, denn hier konnte man sie nicht so schnell entdecken. Doch was kam danach? Sie lauschte angestrengt und hörte seltsame Laute. Es klang nicht nach Fellwechslern. Eher wie ein Stöhnen und Wimmern. Äußerst unheimlich. Berry zögerte. Doch dann war alles still. Sie schnüffelte. Es roch nach Tier. Doozers Geruch konnte sie nicht ausmachen. Wo waren sie nur hin? Was, wenn Yoko und der Straßenhund schon wieder weg waren, die Fellwechsler das Tor zuschlossen und sie hier ganz allein festsaß?
Da! Wieder ein Geräusch. Dieses Mal waren es ganz sicher die Stimmen von Fellwechslern und sie kamen aus dem Gang hinter ihr. Ihr blieb keine Wahl. Sie musste sich die nächste Treppe hinab in die Dunkelheit retten. Leise tastete sie sich vor. Plötzlich polterte es. Sie erstarrte. Stille. Blut schoss ihr in den Kopf. Der Augenblick kam ihr unendlich lang und zugleich wahnsinnig kurz vor. Noch eine Stimme. Ein schwaches Licht tauchte am Ende des Ganges auf. Schritte. Noch mehr Schritte und ein komisches Dröhnen.
Berry hielt den Atem an, schlich sich aber weiter. Nach ein paar Metern machte der Gang einen Knick und als sie vorsichtig um die Ecke sah, konnte sie erkennen, woher das Licht kam: Eine Tür, halb offen, ließ es hinein.
Sie ging auf leisen Pfoten darauf zu und spähte durch den Türspalt. Vor sich sah sie eine riesige, hell ausgeleuchtete Halle. An ihrem Ende befand sich eine Rampe, an der sich Fellwechsler an einigen glänzenden Kisten zu schaffen machten. Eine hagere Gestalt mit Glatze und hellem Bart stand unter ihnen. Sie fuchtelte mit den Armen und schrie die anderen mit hoher Stimme an. Die hoben hastig eine Kiste nach der anderen auf das Band und beförderten sie nach oben. Die Rampe ächzte.
Jetzt sah Berry, dass die ganze Halle voller Kisten war, die in langen Reihen bereitstanden. Und jede von ihnen war mit einem großen, schwarzen Symbol markiert. Zwei gekreuzten Balken in X-Form.
Berry betrat die Halle. Weitere Fellwechslerstimmen hinter sich. Noch waren sie im Gang, aber ihre Stiefel knallten immer lauter auf dem Betonboden. Gleich würden sie kommen und sie entdecken. Berry nahm all ihren Mumm zusammen und schlich weiter hinein, um sich zwischen den Kisten zu verstecken. In diesem Augenblick kam auch schon die Gruppe durch genau die Tür, durch die sie eben hereingekommen war. Mit angehaltenem Atem saß sie hinter einer Kiste und beobachtete, wie sie schnellen Schrittes auf die Rampe zugingen.
Berry wollte sich davonstehlen und zurück in den Gang, aus dem sie gekommen war. Doch da trat noch ein Fellwechsler ein – und schloss die Tür hinter sich. Sie zuckte zusammen, als sie mit einem laut schnappenden Geräusch zufiel. Die würde sie alleine nie aufkriegen! Instinktiv bewegte sie sich rückwärts, weg von den Fellwechslern. Und in ihrem Schreck achtete sie nicht so genau darauf, wohin sie trat. Und schon war sie gegen eine der Kisten gestoßen.
Der Deckel rutschte zur Seite und wäre fast scheppernd zu Boden gefallen, hätte Berry ihn nicht blitzschnell mit der Schnauze aufgefangen. Neugierig schaute sie in die Kiste hinein. Und was sie da sah, konnte sie nicht einordnen – so seltsam war es. In dem halb gefüllten Behälter lagen, dicht an dicht in durchsichtigen Schächtelchen, kleine Bienen. Zumindest sahen sie so aus. Aber nur auf den ersten Blick. Denn wer so gut riechen kann wie ein Hund, merkt sofort, dass das keine echten Bienen sind. Nichts, was lebt und seine eigene, besondere Ausdünstung hat. Das hier stank anders! Ein Geruch, den Berry kannte. So roch es, wenn Herrchen an seinem Rollkasten bastelte. Es waren Bienen aus einem blanken, hellen Material. Wie der Hundenapf bei ihr zu Hause. Und keine bewegte auch nur einen Fühler.
Verwirrt ließ sie vom Inhalt der Kiste ab und schob den Deckel behutsam an seinen Platz zurück. Da bemerkte sie mit Schrecken, dass einige der Fellwechsler in ihre Richtung kamen. Sie wollten die nächsten Kisten holen. Nervös schaute sie sich um. Wie kam sie hier unbemerkt wieder raus? Die Fellwechsler gingen direkt auf sie zu. Da entdeckte sie an der anderen Seite der Halle eine weitere Tür, vor der eben noch Kisten gestapelt waren. Mit klopfendem Herzen nahm sie Maß. Das war zu schaffen: Sie musste sie nur schneller erreichen als die Fellwechsler. Berry atmete tief durch und sprintete los.
Zunächst lief sie bis zu der Kiste, die der Tür am nächsten war. Nur noch ein beherzter Satz und sie hätte es geschafft. Berry sah sich ein letztes Mal um, dann sprang sie. Doch noch bevor ihre Vorderpfoten den Boden berührten, gab es in ihrem Nacken lautes Geschrei.
Sie preschte, so schnell sie konnte, durch die Tür. Wohin nun? Sie kannte den Weg nach draußen ja nicht. Hinter sich hörte sie einen Fellwechsler rennen. Raste einen Gang entlang, der viel zu hell erleuchtet war. Ihr Herz jagte. Hier war sie zu gut zu sehen. Außerdem war der Boden furchtbar glatt und sie schlitterte mehr, als dass sie rannte. Da tauchte vor ihr eine Treppe nach oben auf. War das dieselbe Treppe, die sie vorhin nach unten gegangen war? Ohne lang zu überlegen, stürmte sie hoch. Hinter sich hallende Schritte. Hastig spähte sie nach links und rechts. Weit und breit keine Dunkelheit, um sich darin zu verstecken. Wo sollte sie lang? Sie schaute und horchte sich um, schnüffelte, aber nichts verriet ihr den richtigen Weg. Hier gab es jede Menge verwirrende Gerüche. Ohne zu wissen, was sich daraus ergeben würde, bog sie links ab. Der Fellwechsler kam brüllend hinter ihr her.
Berry schlitterte davon. Sie erreichte noch eine Treppe und auch die hetzte sie entschlossen nach oben. Wieder stand sie in einem blendend hellen Flur. Aber diesmal erkannte sie ihn am Geruch. Es war genau der Gang, durch den sie vorhin hereingekommen war. Sie konnte das Wasser draußen riechen … da prallte sie mit voller Wucht gegen etwas.
Der unheimlichste Ort der Welt
Es rumpelte, ein Knäuel entstand. Berry bellte erschrocken und löste sich schnell wieder aus dem Gewühl. Jetzt sah sie, mit wem sie zusammengestoßen war: Yoko und Doozer.
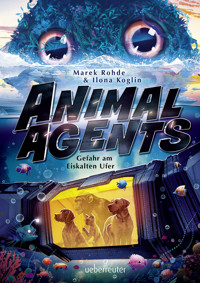















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












